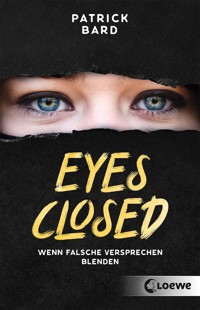
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Blendende Lügen Mit sechzehn Jahren lernt Maëlle im Internet Mokhtar kennen. Mokhtar und seine Versprechen des IS. Kurze Zeit später reist sie mit gefälschten Papieren nach Syrien, um ihn zu heiraten. Als sie die Schrecken des Kriegs jedoch hautnah erlebt, gelingt ihr die Flucht. Jetzt ist Maëlle zurück in Frankreich, aber eine Frage bleibt: Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Ein eindrücklicher Roman über Extremismus, Radikalisierung von Jugendlichen und die Rolle der Sozialen Medien In Eyes Closed beschreibt Patrick Bard einnehmend, wie ein junges Mädchen in die Fänge des radikalen Islamismus gerät, warum sie als Islambraut sich dem Dschihad anschließt und welche Rolle Social Media dabei spielt. Zudem zeigt er die Konsequenzen nach Maëlles Rückkehr auf. Ein hochaktueller Roman, der zum Nachdenken anregt und sich perfekt als Schullektüre eignet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Maëlle – Vorort von Le …
Aïcha – Als Céline Le …
Redouane – Hättet ihr mich …
Amina – Ich komme nicht …
Céline – Meine Mutter hat …
Hugo – Als ich sie …
Frédéric Da Silva – Manche Schüler vergisst …
Jeanne – Ich mach mir …
Souad – Was für eine …
Jeanne – Ehrlich gesagt wussten …
Céline – Manchmal hört man …
Aïcha – Der Apfelkuchen war …
Ayat – Ende Februar 2015
Warum ich Maëlles Geschichte erzählen wollte
Danksagung
Was die Massen sich weigern anzuerkennen, ist die Zufälligkeit, die eine Komponente alles Wirklichen bildet. Ideologien kommen dieser Weigerung entgegen, sofern sie alle Tatsachen in Beispiele vorweggenommener Gesetze verwandeln und alle Koinzidenz eliminieren durch die Annahme einer alle Einzelheiten umfassenden Allmächtigkeit. Diese Attitude der Flucht aus der Wirklichkeit in die Einbildung, von dem Ereignis in den notwendigen Ablauf des Geschehens, ist die Voraussetzung für alle Massenpropaganda.
Hannah Arendt,
MAËLLE
Vorort von Le Mans, September 2014
Manchmal frage ich mich, ob ich tot bin.
Aber nein, ich bin am Leben und das Baby, das sich in meinem Bauch bewegt, erinnert mich daran. Ich bin am Leben und Redouane ist tot. Durch das Fenster sehe ich den Garten unseres Einfamilienhauses mit den Geranien, dem gemähten Rasen und den verwelkten Rosenbüschen. Unser Haus sieht genauso aus wie die Häuser der Nachbarn rechts und links von uns. Würden auf den Eingangstüren keine Nummern stehen, könnte man sie nicht voneinander unterscheiden.
Ich betrachte dieses unwirkliche Zimmer und die hellen Stellen an den Wänden, wo einmal Beyoncé-Poster hingen. Eine Jugendliche, in der ich mich nicht wiedererkenne, hat sie abgerissen.
Ich möchte rausgehen. Aber das darf ich nicht. Noch nicht. Außer um mich bei den Behörden zu melden. Morgens, mittags und abends.
Ich gehe dreimal am Tag die Straße entlang, vorbei an dem Geschäft für Gartengeräte, an der Turnhalle, dem Baumarkt, der Bäckerei und dem Café. Schließlich komme ich bei der Gendarmerie an, wo ich das Meldeformular unterschreibe, um meine Anwesenheit zu bestätigen – morgens, mittags und abends, abends und morgens und mittags.
Danach gehe ich denselben Weg zurück nach Hause.
Dass ich manipuliert wurde, ist für mich am schwersten zu akzeptieren. Ich würde so gerne auf Facebook gehen, um mit meinen Schwestern zu reden und mich mit ihnen auszutauschen. Wir haben das ständig getan, sie waren wirklich für mich da. Aber Mama hat meinen Internetzugang gesperrt und mein Handy hab ich nicht mehr. Das wurde beschlagnahmt. Ich hab mich noch nie so einsam gefühlt. Sie versteht nicht, dass Maëlle nie wieder zurückkommen wird, dass ich Ayat bleiben werde, und das für immer. Sie versteht nicht, dass ich nach allem, was passiert ist, noch ein Kopftuch trage – es ist nicht mal ein Hidschab! – und immer noch kein Schweinefleisch mehr esse. Neulich hat sie mich dabei ertappt, wie ich auf dem Teppich gekniet und gebetet habe. Sie hat angefangen zu schreien, ich hätte mich ihnen wieder angeschlossen. Sie hat die Leute vom Deradikalisierungs-Programm angerufen, doch selbst die konnten sie nicht beruhigen. Schließlich hat Mama auf Papas Rat hin die Tür meines Zimmers ausgehängt, um mich Tag und Nacht bewachen zu können. Aber sie muss ja auch irgendwann mal schlafen.
Zum Glück ist gegen vier Uhr morgens, wenn ich für Fadschr, das Morgengebet, aufstehe, niemand wach, um mich auszuspionieren. Das ist gut so. Was denken die eigentlich? Ich bin mir vollkommen bewusst, was mit mir passiert ist.
Warum können sie mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich fühle mich wie eine Gefangene.
Wenn sie mich wieder in ihre Arme treiben wollten, könnten sie es nicht besser machen.
Nicht einmal einen Vorhang darf ich haben. Sie wollen nicht wahrhaben, dass die Religion mir hilft. Dass ich sie brauche, um zurechtzukommen, dass das Gebet das Einzige ist, das mir noch Halt gibt. Mama glaubt nicht an Gott, sie kann das nicht verstehen. Ich verzeihe ihr, weil ich weiß, wie sehr sie mich lieb hat. So kurz vor der Geburt meines Babys wird mir langsam bewusst, wie stark diese Liebe ist. Mama hat sehr viel Liebe gebraucht, um mich aus der Türkei zu holen. Und auch noch nach unserer Rückkehr. Nie werde ich den Blick vergessen, mit dem sie mich angesehen hat, als mich die Polizei am Flughafen in Paris verhaftet hat.
Manchmal fühle ich mich völlig verloren. Wenn ich könnte, würde ich sogar zurückkehren. Dort würde man mich besser verstehen, habe ich das Gefühl. Ich glaube eigentlich immer noch, dass sie recht haben und man mich hier anlügt. Wenn sie Redouane nicht umgebracht hätten, wäre ich vielleicht zu ihnen zurückgekehrt. Mit ihm. Oder auch nicht. Wer weiß.
Sein Tod hat eine große Leere in mir hinterlassen, eine Leere, die das Baby nicht füllen kann. Ich spreche oft mit Redouane, auch wenn ich weiß, dass er tot ist. Ich hoffe, er ist im Paradies. Ich kann nicht glauben, dass er in der Hölle ist. Redouane war kein Verräter. Und schon gar kein Ungläubiger. Er war nur ein sanftmütiger Mensch. Genau deshalb haben sie ihn umgebracht. Zum Glück kann ich auch mit dem kleinen Mädchen in meinem Bauch sprechen. Bis zu ihrer Geburt sind es nur noch vier Monate. Der Gedanke daran macht mir ein bisschen Angst. Wenn der Herbst vorbei ist, wird sie schon da sein. Dann habe ich schon meinen siebzehnten Geburtstag gefeiert. »Gefeiert«, wenn man das so sagen kann.
Ich bin Witwe, zweifache Witwe, und ich bin gerade mal sechzehn Jahre alt. Mein erster Mann wurde von einer Rakete zerfetzt, noch bevor ich ihn überhaupt kennenlernen konnte. Den zweiten haben sie umgebracht, als wir gemeinsam aus Syrien geflüchtet sind.
In dieser Nacht machten wir kein Auge zu. Wir gingen unseren Plan immer wieder und wieder durch – bis wir Kopfschmerzen davon bekamen. Schließlich standen wir gegen sechs Uhr morgens so leise wie möglich auf. Die Brüder schliefen im Zimmer nebenan. Wir durften sie auf keinen Fall wecken. Redouane legte seine Kalaschnikow auf das Bett. Er hat sie absichtlich zurückgelassen. Wir bereiteten unsere Flucht schon seit zwei Wochen vor und verließen Raqqa zu Fuß, um nicht aufzufallen. Ich trug einen Niqab und er einen Kamis, die Uniform des IS. Das sah so gut aus mit seinem schönen langen Bart. Bei der Straßensperre an der Stadtgrenze ließen uns die Brüder passieren. Sie kannten uns schon.
Redouane hatte einen alten syrischen Händler aufgetrieben, der mit seinem Lieferwagen voller Waren jeden Samstag in die Türkei fuhr. Er bezahlte ihn und der Mann ließ uns hinten einsteigen. Von Raqqa bis zur Grenze sind es acht Stunden Fahrt. Jedes Mal, wenn wir anhielten, schaute ich nervös durch ein kleines Loch in der Plane. Ich bekam kaum Luft vor Angst. Die Wachen hatten den Alten hinter seinem Steuer wohl schon so oft kontrolliert, dass irgendwann ihre Wachsamkeit nachließ. Mittlerweile achteten sie überhaupt nicht mehr auf ihn. Ohne ihn auch nur eines Blickes zu würdigen, unterhielten sie sich weiter und gaben ihm lediglich mit einer lässigen Handbewegung zu verstehen: »Los, fahr schon!«
Redouane und ich hielten uns an den Händen, den Kopf gesenkt, um die Angst in den Augen des anderen nicht zu sehen. Uns war klar, dass man uns als Verräter betrachten würde. Darauf waren wir nicht stolz.
Schließlich bog der Alte von der Hauptstraße auf einen kleinen ruhigen Weg ab. In der Nähe war ein Wald. Er bremste kaum und schrie nur: »Jetzt, los, beeilt euch, schnell, schnell! Bleibt auf keinen Fall stehen, sonst sehen euch die Brüder und fangen euch wieder ein.« Dreihundert Meter weiter war der Wald und der Weg zur Grenze. Wir sind direkt aus dem fahrenden Lieferwagen gesprungen und losgestürmt. Fast augenblicklich hörte ich die Schreie. Ich habe nicht alles verstanden, weil mein Arabisch nicht besonders gut ist und sie noch weit weg waren, als sie anfingen zu schießen. Aber das typische Taktaktak der AK-47-Gewehre erkannte ich sofort wieder. Wir hatten den Wald schon fast erreicht, als Redouane aufschrie. Als ich mich umdrehte, lag er auf dem Bauch. Mit einer Hand hielt er sich die Seite und hob den Kopf. Er war ganz blass. Hundertfünfzig Meter hinter uns kamen auch schon die Brüder angerannt.
Ich machte kehrt. Ich wollte Redouane aufhelfen, ihn bis zum Wald stützen.
»Nein! Dafür ist keine Zeit! Renn! Verschwinde von hier! Ich flehe dich an!«, schrie Redouane.
Es ging nicht, ich stand wie angewurzelt da.
»Rette dich! Tu’s für das Baby! Bitte, schnell!«
Ich konnte ihn nicht zurücklassen, es ging einfach nicht. Ich wusste erst nicht, was ich tun sollte, und stand einfach nur da wie ein dummes Schaf. Aber als er unser Kind erwähnte, wachte ich auf. Ich wusste, was sie mit Deserteuren anstellten. Sie enthaupteten sie. Ich wusste auch, dass immer mehr Leute flohen und erst kürzlich sogar eine Einheit eigens für Leute wie uns ins Leben gerufen worden war.
An das, was danach passiert ist, erinnere ich mich nur noch verschwommen. Es ist, als hätte jemand anderes die Entscheidungen getroffen. Ich drehte mich um und stürzte ohne zu überlegen davon. Ich sah nichts mehr, weil mir die Tränen übers Gesicht liefen und mir die Sicht nahmen. Ich rang unter meinem Niqab nach Luft. Er blieb an den Ästen hängen. Ich weiß nicht mal, wie ich es geschafft habe, ihn auszuziehen, ohne stehen zu bleiben oder mich mit den Füßen darin zu verheddern. Ich rollte ihn zu einer Kugel zusammen und klemmte ihn mir unter den Arm. Ich wusste, dass ich ihn später brauchen würde. Sie fingen wieder an zu schießen. Ich war schon immer eine sehr gute Sprinterin gewesen und beim Handball erst recht. Mit drei großen Schritten erreichte ich den Wald. Meine Beine bewegten sich wie die Kolben eines Motors. Ich konnte nicht aufhören zu rennen. Da erinnerte ich mich an die Bio-Stunde, in der wir die Funktion von Adrenalin im menschlichen Körper behandelt hatten, und verstand, dass meine Angst mir half. Ich hörte, wie hinter mir Äste knackten. Ich wusste, dass die Brüder von ihren Waffen und ihren Patronengurten behindert wurden und ich schneller war als sie. Sie schossen weiter blindlings und gaben nach einer Weile die Verfolgung auf. Ich hörte sie noch untereinander reden. Und dann war es still. Sie hatten wahrscheinlich kehrtgemacht, um Redouane zu holen. Ich hoffte, dass er bereits tot war. Ich wollte gar nicht daran denken, was sie mit ihm anstellen würden.
Als ich die Grenze überquerte, wurde es noch einmal brenzlig. Es wimmelte nur so von Wachleuten. Ich brauchte über vier Stunden und fast wäre wieder auf mich geschossen worden, weil türkische Soldaten mich bemerkt hatten. Aber ich habe es trotzdem über die Grenze und schließlich zu Fuß bis nach Urfa geschafft. Ich hatte meinen zerrissenen und schmutzigen Niqab wieder übergezogen.
Die Brüder setzten ein Kopfgeld auf Deserteure aus. Sogar in der Türkei konnten sie mich ausfindig machen. Ich durfte keine Zeit verlieren. Mit dem Handy, das wir hatten mitnehmen können, rief ich Mama an. Ich wusste, dass sie nicht weit von hier auf uns wartete. Als ich ihre Stimme hörte, brach ich in Tränen aus. Ich dachte an Redouanes Familie in Chartres. Sie würden am Boden zerstört sein.
Erst als die Raketen der Koalition schließlich unser Haus trafen, entschlossen wir uns endgültig wegzugehen. Für das Baby. Dabei hatte alles so gut angefangen. Man hatte uns herzlich aufgenommen. Es war definitiv nicht so, dass wir inmitten von Ruinen, abgeschlagenen Köpfen und Gekreuzigten dahinvegetierten. Zumindest nicht am Anfang. Es herrschte nicht überall Krieg, ganz im Gegenteil. Die Menschen waren froh, endlich Ruhe vor Assads Soldaten und den Bombenangriffen aus der Luft zu haben. Wir führten ein normales Leben und blieben unter uns Franzosen. Wir waren viele und in unserer Gemeinschaft gab es sogar eine Zeitschrift auf Französisch. Redouane nahm mich mit zum Markt und wir kauften ein. Wir schauten Filme. Wir wollten den Shâm besuchen, das Reich Gottes auf Erden, und den Boden betreten, wo alles seinen Anfang genommen hat. Und so haben wir ein Auto gemietet und sind den Euphrat entlanggefahren. Es war wirklich wunderschön, es war heiß und die Sonne schien. Wir kamen uns vor wie im Urlaub. Ich sah zu, wie Redouane mit ein paar Kindern Fußball spielte. In seinem Kampfanzug und mit dem schwarzen Stirnband um den Kopf sah er einfach unglaublich gut aus.
Wir haben auch den Irak besucht. Und eine Menge Selfies gemacht. Die hätte ich gerne noch, aber die Polizei hat mein Handy beschlagnahmt. Ich habe kein einziges Foto mehr von ihm.
Was uns aber richtig enttäuscht hat, war, dass vor Ort der religiöse Aspekt keine große Rolle mehr spielte. Vor allem mich, die noch nie in einer Moschee gewesen war und auch noch nie den Koran gelesen oder Ramadan gefeiert hatte. Redouane war wenigstens muslimisch erzogen worden …
Als wir aus dem »Urlaub« zurückkamen, war Raqqa zum Angriffsziel der Kuffar, der Ungläubigen, geworden. Unsere religiöse Ausbildung stand für die Brüder nicht mehr an erster Stelle. Wir hatten das Gefühl, uns selbst überlassen zu sein. Ständig mussten wir umziehen. Anfangs war das Haus, in dem wir lebten, gar nicht so schlecht. Doch dann mussten wir es räumen, weil ein bekannter Imam mehr Platz für seine vielen Frauen brauchte. Daraufhin landeten wir in einer ekelhaft versifften Unterkunft, in der wir mit Leuten aus der Bretagne, aus Grenoble und auch aus Vororten von Brüssel zusammengepfercht waren. Dort gab es keine Türen, kein Wasser und nur fünf Stunden Strom am Tag. Wir mussten Kanister hoch in die Etagen schleppen.
Ich hatte geglaubt, sie würden für alle Kosten aufkommen, aber von wegen. Redouane besaß null militärische Erfahrung. Sie hatten ihm nur eine Uniform gegeben. Die Waffe musste er aus eigener Tasche bezahlen, tausenddreihundert Euro, und die Munition genauso. Zum Glück hatte er vor seiner Abreise einen Kredit bei einer Bank aufgenommen.
»Beim Leben meiner Mutter«, sagte er lachend, »so schnell sehen die ihre Kohle nicht wieder!«
Wer an die Front geht und sich der Katiba, der Kampfeinheit, anschließt, bekommt die Munition umsonst, aber alle anderen müssen dafür bezahlen, und zwar einen Euro pro Kugel. Das Geld wurde schnell zum Problem. Dabei hatten sie Redouane im Internet versprochen: »Komm zu uns, mach dir keine Sorgen, wir kümmern uns um alles«, doch sie kümmerten sich um gar nichts und wir mussten sehen, wie wir allein klarkamen. Wir waren schon bald völlig pleite und kapierten sehr schnell, dass wir ihnen ziemlich egal und nicht viel mehr als Kriegsbeute für sie waren. Unser Wert bestand darin, dass wir Ausländer, Leute aus dem Westen waren, nicht, dass wir Krieger waren. Redouane war sowieso froh, nicht in den Kampf zu ziehen. Da ich schwanger war, wollte er mich nicht allein lassen und lieber an meiner Seite bleiben. »Rund um die Uhr«, sagte er.
Redouane war nicht wie die anderen. Er war ein sanftmütiger Mensch. Viele der Männer, die nicht kämpften, kümmerten sich um alltägliche Dinge wie die Wartung der Geländefahrzeuge. Dafür erhielt Redouane einen bescheidenen Lohn. Die Frauen mussten in der Wäscherei arbeiten. Dorthin hatten sie mich gesteckt, zusammen mit Amina. Meiner Schwester. Mit ihr bin ich bis Gaziantep gereist, als ich von zu Hause weg bin. Sie kam auch aus einem Vorort von Le Mans. Wir hatten so viel Spaß zusammen!
In Raqqa las ich den Koran, versuchte so viel wie möglich zu lernen und betete viel. Ich versuchte, meine Zweifel zu unterdrücken. Obwohl sich unsere Situation immer weiter verschlechterte, fand ich ständig neue Entschuldigungen für die Brüder und Schwestern. Redouane meinte schließlich, dass es im Shâm eigentlich genauso lief wie überall sonst auch. Über Beziehungen. »Wenn du berühmt bist, kriegst du alles, was du willst. Ansonsten musst du dich damit zufriedengeben, was man dir gibt.« Das ging ihm voll gegen den Strich. Aber ich war anderer Meinung und wir fingen an, uns zu streiten. Ich warf ihm vor, kein guter Muslim zu sein und die ganze Sache nicht ernst zu nehmen.
Er alberte wirklich gerne herum. Doch in dem Moment fand ich ihn gar nicht mehr witzig. Ich hielt ihm vor, dass er nicht genug betete und sich Filme anschaute, die er sich nicht anschauen sollte. Manchmal hörte er sogar Musik. Das war nicht richtig.
Als die Kuffar begannen, uns zu bombardieren, wurden die Brüder immer misstrauischer. Überall sahen sie Verräter. Und dann fingen die öffentlichen Hinrichtungen an. Überall waren abgeschlagene Köpfe zu sehen. Nie werde ich das Gesicht des Jungen vergessen, den sie umgebracht haben, weil er während des Ramadan beim Eisessen erwischt worden war. Er war gerade mal vierzehn! Da kamen mir erste Zweifel. Mit der Scharia habe ich kein Problem – Dieben die Hände abhacken und so –, aber er war doch noch ein Kind. Am schlimmsten war es, als sie den gefangenen jordanischen Piloten bei lebendigem Leib in seinem Käfig verbrannt haben. Sie filmten alles und danach lief das Video ununterbrochen im Internet. Redouane sagte mir, er hätte im Koran gelesen, dass Feuer eine Strafe sei, die allein Allah, gepriesen sei Sein Name, verhängen könne. »Für wen halten die sich eigentlich, dass sie sich mit Gott gleichsetzen?«, fragte er mich. Ich erwiderte, er müsse sich irren. Die Brüder und erst recht die Imame würden doch Allah nicht lästern. An diesem Tag haben wir uns so gestritten wie danach nie wieder. Ich beschimpfte ihn als gottlos und als Abtrünnigen! Ehrlich gesagt stand ich sogar kurz davor, ihn zu denunzieren. Ich erkannte den Mann nicht wieder, der mir den Shâm so angepriesen hatte. Wenn ich nicht sein Kind erwartet hätte, hätte ich vielleicht tatsächlich die Geheimpolizei informiert. Ich glaube, das war der Grund. Ich wollte, dass wir unser Kind zu Liebe, Respekt und Ehrfurcht dem Allerhöchsten gegenüber erziehen. Ich wollte, dass Redouane sich änderte. Doch danach sah es überhaupt nicht aus, ganz im Gegenteil. Er tat alles, um auf sich aufmerksam zu machen! Wie mit der Uniform, dem Kamis. Anfangs war er noch sehr stolz, sie zu tragen. Aber später hatte er es schnell satt, vor allem, weil er nie die Gelegenheit bekommen hatte, seine Kalaschnikow zu benutzen, außer um damit zu posieren, wenn wir Fotos von uns beiden machten. Es dauerte dann nicht lange, bis er mit seinen angesagten französischen Klamotten angab, die er die ganze Zeit aufbewahrt hatte: Sneakers, Mütze, Fußballtrikot von Olympique Marseille und Jogginghose. Ich versuchte, ihn wieder davon abzubringen, aber ohne Erfolg. Ihm fehlte seine Familie. Er rief sie oft an.
Anfangs schaffte er es noch, sich über Western Union hier und da hundert Euro schicken zu lassen, und jedes Mal, wenn er in der Türkei war, holte er sich das Geld ab. Er rief seine Mutter sogar auf der Straße an, um Hallo zu sagen. Er konnte es nicht lassen, ihr etwas vorzumachen. Er trug voll dick auf, nach dem Motto: »Alles läuft gut, hier ist es super, glaubt nicht, was die Medien euch erzählen«, und redete dabei immer superlaut. Die Brüder machten sich wegen seines Outfits offen über ihn lustig und auch darüber, dass er kein Kämpfer war. Sie beschimpften ihn als Angeber und als Vorstadtclown. Ich bat ihn, vorsichtiger und respektvoller zu sein und sich etwas zurückzuhalten. Doch er hörte nicht auf mich. Das hätte er besser mal getan. Denn sie nahmen ihn schließlich fest. Sie tauchten in der Kfz-Werkstatt auf, wo er gerade bei den Geländewagen das Öl wechselte, und schleppten ihn zum Verhör mit. Als er abends nicht nach Hause kam, ahnte ich schon etwas. Dank Amina erfuhr ich, was los war. Ihr Mann ist in der Geheimpolizei und sie wusste über alles bestens Bescheid. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht, aber damals wohnte sie in einem schönen Haus, in einer Luxusvilla. Sie hielten Redouane zwei Wochen lang fest. Ich dachte nicht mehr an die Brüder, ich dachte nur noch an ihn. Tag und Nacht betete ich für seine Freilassung. Mir wurde bewusst, wie sehr ich ihn vermisste. Als er zurückkam, war er ganz abgemagert und sah gar nicht gut aus. Als er sich am Abend auszog, sah ich, dass er nur so mit blauen Flecken übersät war, und er gestand mir, dass sie ihn geschlagen hatten. Letztendlich ließen sie ihn gehen, weil sie nichts Konkretes gegen ihn in der Hand hatten. Ich glaube ja, dass ich das Amina zu verdanken habe, die ihren Mann überzeugt hat, für Redouanes Freilassung zu sorgen. Sonst hätten sie ihn umgebracht, wie alle anderen.
Danach haben sie seinen Sold halbiert und er durfte nicht mehr in die Werkstatt zurück. Er musste den ganzen Tag in der prallen Sonne vor einem Baustofflager Wache stehen. Wir hatten nicht mehr viel Geld zum Leben. Nachts war es schrecklich kalt. Wir schliefen alle auf dem Boden. Und da schlugen die Raketen ein und explodierten nur fünf Meter von uns entfernt. Ich weiß immer noch nicht, wie wir das überlebt haben. Alle anderen hat es erwischt. Wir waren die einzigen Überlebenden. Als wir aufstanden, waren wir von oben bis unten mit Staub bedeckt und ich hatte wegen der Detonation ein Dröhnen in den Ohren und hörte nichts mehr. Durch eine eingestürzte Mauer fiel Tageslicht herein. Ich spürte, wie sich ein Asthmaanfall ankündigte. Ich rang nach Atem und geriet in Panik. In den Trümmern konnte ich mein Asthmaspray nicht mehr finden und dachte, ich müsste sterben und mein Baby auch. Da sah ich plötzlich das Spray auf dem Boden, gleich neben einer zerbrochenen Vase. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie es dort gelandet war. Sobald ich wieder normal atmen konnte, tasteten Redouane und ich uns gegenseitig ab, um uns zu vergewissern, dass es uns gut ging und wir nicht verletzt waren. Und dann sahen wir die anderen, die alle reglos und mit geschlossenen Augen auf dem Boden lagen, weiß wie Statuen, halb mit Schutt bedeckt. Tot. Redouane sah mich mit irrem Blick und weit aufgerissenen Augen an. Aus einem Ohr kam ihm ein wenig Blut, das ihm die kreidebleiche Wange hinunterlief. Im Nachhinein hat er mir gestanden, dass ihm in dem Moment eine Sache klar geworden war: Er wollte nicht mehr als Märtyrer sterben. Er wollte die Geburt seines Kindes miterleben, es aufwachsen sehen.
Doch ich wusste nicht mehr, was ich denken sollte. Ich hatte das Gefühl, den Verstand zu verlieren.
Bis zu diesem Morgen wäre ich superstolz auf ihn gewesen, wenn es ihm gelungen wäre, sich als Freiwilliger zu melden, um als Schahid den Märtyrertod zu sterben. Aber in dem Moment war ich einfach nur erleichtert, dass er am Leben war!
Der Allmächtige hatte uns verschont, Hamdulillah, Allah sei Dank! Er hatte nicht gewollt, dass wir alle drei im Bombenhagel starben. Das musste einen Grund haben. Und zum ersten Mal, seit ich Frankreich verlassen hatte, war mir danach, Mama anzurufen.
AÏCHA
Als Céline Le Bihan im letzten Juni zum ersten Mal Kontakt zu mir aufnahm, hatte sie gerade einen Anruf von ihrer Tochter bekommen. Den ersten, seit diese nach Syrien gegangen war.
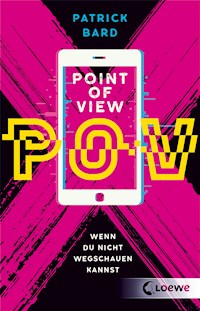
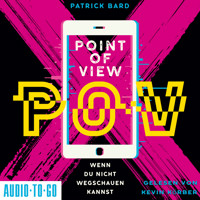














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












