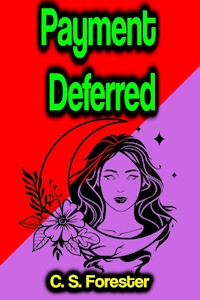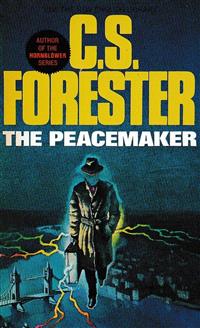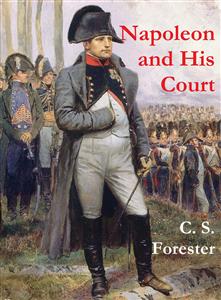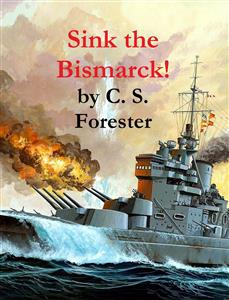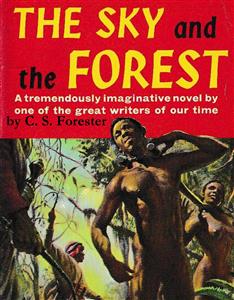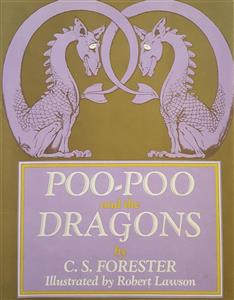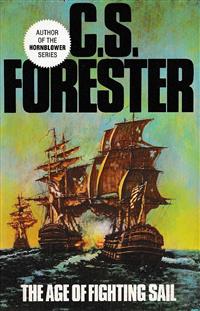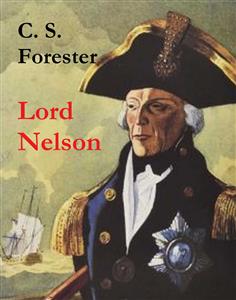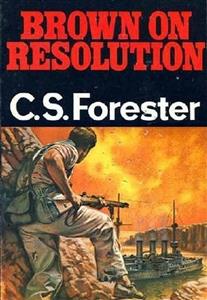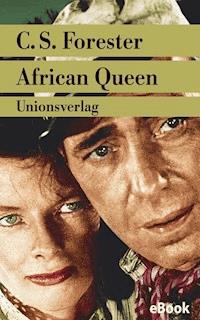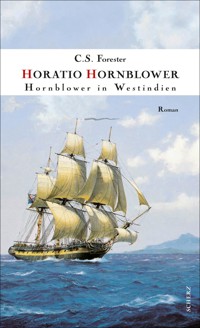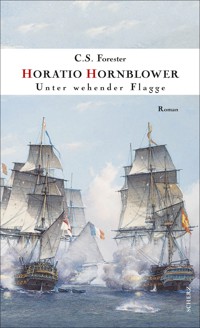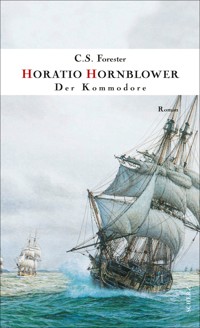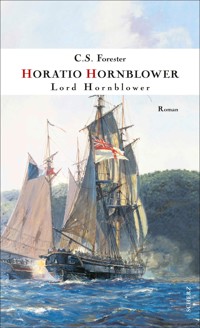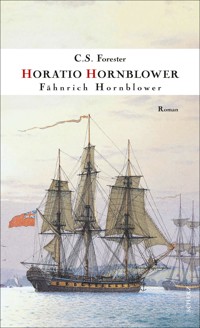
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hornblower
- Sprache: Deutsch
Der Klassiker unter den Seefahrerepen: Horatio Hornblower. Als Horatio Hornblower seinen Dienst in der Marine ihrer Majestät aufnimmt, glaubt kaum jemand, dass er der rauen See und der dort lauernden Gefahren gewachsen ist. Seekrankheit, ein unerbittlicher Kapitän und die Hackordnung an Bord machen das Leben bei der Marine zum Spießrutenlauf. Doch als es zum Gefecht kommt, beweist Hornblower Mut und Tapferkeit und gewinnt den Respekt seiner Kameraden. Die gefährlichste Bewährungsprobe aber steht ihm noch bevor: Ihm wird das Kommando einer gekaperten französischen Brigg übertragen. Als der Rumpf leckschlägt und die Besatzung meutert, muss Hornblower beweisen, aus welchem Holz er geschnitzt ist … Der erste Band der berühmten Romanserie um Horatio Hornblower ist ein großes Seeabenteuer, ein Meilenstein der maritimen Literatur und ein Lesevergnügen, das bereits Generationen von Lesern begeistert hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Cecil Scott Forester
Fähnrich Hornblower
Horatio Hornblower Band 1
Über dieses Buch
Keiner an Bord des englischen Linienschiffs ›Justinian‹ würde dem jungen Fähnrich Horatio Hornblower eine steile Karriere in der Marine ihrer Majestät voraussagen. Schon der erste Seegang zieht ihn in arge Mitleidenschaft. Aber bald gewinnt er mit schneller Auffassungsgabe und Wagemut die Achtung der Mannschaft. Und so wird ihm eine gefährliche Aufgabe übertragen: Mit nur vier Mann muss er eine gekaperte französische Brigg zur englischen Küste bringen. Der Aufstand der französischen Besatzung und ein Leck im Schiffsrumpf lassen diese Fahrt zu einem Wettlauf mit dem Tod werden. Nur mit allerletzter Kraft kann Hornblower seine Mission beenden und wird zum Leutnant befördert.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Cecil Scott Forester wurde 1899 in Kairo als Sohn eines ägyptischen Regierungsbeamten geboren. Schon bald schickte ihn der Vater ins weit entfernte England, wo er neben dem Medizinstudium zunehmend Gedichte verfasste, bis er der Medizin schließlich den Rücken wandte, um sich ausschließlich der Literatur zu widmen. Mit dem Zyklus seiner Seeabenteuerromane um Horatio Hornblower schuf Forester ein unvergängliches Epos, das ihm Weltruhm einbrachte und ihn bis heute zu einem der großen Erzähler des 20. Jahrhunderts macht. Während des Zweiten Weltkrieges ging Forester nach Hollywood, wo er 1966 starb.
Die Gesamtserie um Horatio Hornblower:1 ›Fähnrich Hornblower‹2 ›Leutnant Hornblower‹3 ›Hornblower auf der Hotspur‹4 ›Kommandant Hornblower‹5 ›Der Kapitän‹6 ›An Spaniens Küsten‹7 ›Unter wehender Flagge‹8 ›Der Kommodore‹9 ›Lord Hornblower‹10 ›Hornblower in Westindien‹11 ›Zapfenstreich‹
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Coverabbildung: Derek G. M. Gardner
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel ›Mr. Midshipman Hornblower‹ im Verlag Michael Joseph Ltd., London
›Mr. Midshipman Hornblower‹ © 1977 by Dorothy Forester
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© Wolfgang Krüger Verlag GmbH, Hamburg 1967
Alle deutschsprachigen Rechte:
S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Veröffentlicht als E-Book 2012.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402688-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1 DAS DUELL
2 DIE REISLADUNG
3 FREIWILLIGE SÜHNE
4 IN DER GIRONDE
5 IM KREUZMARS
6 AUF FRANKREICHS BODEN
7 DIE SPANISCHEN GALEEREN
8 OFFIZIERSEXAMEN
9 DIE ARCHE NOAH
10 HORNBLOWERS GEFANGENNAHME
Karten
ERKLÄRUNG SEEMÄNNISCHER AUSDRÜCKE
VORBEMERKUNG
RANGFOLGE ZUR ZEIT HORNBLOWERS
DIENSTSTELLUNGEN
1DAS DUELL
Der Januarsturm fegte von Westen her durch den englischen Kanal, er orgelte in der Takelage und jagte immer wieder schwarze Regenböen vor sich her. Dann prasselten die schweren Tropfen jedesmal laut auf das Ölzeug der Offiziere und Mannschaften nieder, die der unerbittliche Dienst an Deck festhielt. So hart und so lange hatte der Sturm bereits getobt, daß sogar das mächtige Linienschiff, das in den geschützten Gewässern des Spithead vor Anker lag, etwas von seiner Gewalt verspürte. Es gierte unruhig hin und her, stampfte sogar ein wenig in der kurzen, steilen See und ruckte zuweilen mit einem unerwarteten Stoß in seine brechend steifen Ankertrossen. Jetzt näherte sich von Land her ein fremdes Boot, zwei wetterfeste Frauensgestalten trieben es mit ihren Riemen kräftig voran, obwohl es in dem kabbligen Seegang wild auf- und niedertanzte und manchmal sogar die Nase so weit wegsteckte, daß die Gischt von vorn bis achtern flog. Die beiden Ruderinnen verstanden sich offenbar ausgezeichnet auf ihr Geschäft. Mit raschen Blicken über die Schulter hielten sie ihr Fahrzeug nicht nur auf Kurs, sondern drehten es überdies jedesmal mit dem Bug geschickt gegenan, wenn eine besonders üble See herangerollt kam, damit es nicht in Gefahr geriet zu kentern. Allmählich kam das Boot der Justinian immer näher und hielt schon auf deren Steuerbordgroßrüsten zu, als es vom Fähnrich der Wache angerufen wurde.
»Aye, aye!« gab das Frauenzimmer am Schlagriemen mit gewaltiger Lungenkraft zur Antwort. Nach einer seltsamen, uralten Überlieferung in der Marine bedeutete das, daß sich in dem Boot ein Offizier befand. – War damit etwa gar jenes zusammengekauerte Etwas im Heck des Bootes gemeint, das sich ausnahm wie ein Häufchen Elend unter einer Persenning?
Mehr konnte Mr. Masters, der Wachhabende Offizier, einstweilen nicht erkennen. Er barg sich in Lee des Kreuzmastes so gut es ging vor dem Regen, das Boot aber ging auf die Anweisung des Fähnrichs der Wache an den Großrüsten längsseit und kam ihm deshalb aus Sicht. Jetzt geschah eine ganze Weile nichts. Wahrscheinlich fiel es dem Offizier im Boot ein wenig schwer, an der Bordwand hochzuklettern. Endlich erschien das Boot wieder in Masters’ Gesichtsfeld, die Frauen hatten wieder abgelegt und setzten nun ein winziges Luggersegel, unter dem das Boot in fliegender Fahrt in Richtung Portsmouth davonjagte und dabei wie ein Rennpferd über die auflaufenden Seen sprang. Als sich das Fahrzeug schon ein ganzes Stück entfernt hatte, bemerkte Mr. Masters, daß jemand das Achterdeck betrat und auf ihn zukam. Es war der Neuankömmling in Begleitung des Fähnrichs der Wache. Dieser verwies ihn an Masters und zog sich zurück.
Mr. Masters diente schon viele Jahre in der Marine. Er hatte das Glück gehabt, das Leutnantspatent zu erhalten. Inzwischen waren seine Haare weiß geworden, und er wußte längst, daß er es nie bis zum Kapitän bringen würde. Er hatte sich dadurch aber nicht erbittern lassen. Seine stille Freude fand er darin, das Wesen seiner Kameraden zu ergründen. Er sah dem Nähertretenden erwartungsvoll entgegen. Dieser war offenbar noch sehr jung, wahrscheinlich kaum erst dem Knabenalter entwachsen, auffallend hager und etwas über mittelgroß. Nur die Füße waren anscheinend dem Wachstum vorausgeeilt, was dadurch besonders ins Auge fiel, daß seine allzudünnen Beine in großmächtigen Halbstiefeln staken. Der junge Mann bewegte sich so linkisch und ungeschickt, daß man unwillkürlich auf seine Ellbogen und Hände achtete. Er trug eine schlechtsitzende Uniform, die vom Spritzwasser ganz durchnäßt war, aus dem hohen Kragen ragte ein dünner Hals, und darüber blickte einem ein bleiches Gesicht entgegen, das nur aus Haut und Knochen zu bestehen schien. So ein Blaßgesicht war an Bord eines Kriegsschiffes ein seltener Anblick, weil hier Sonne und Wind die Haut der ganzen Besatzung in kürzester Zeit mahagonibraun gerbten. Aber war das denn gewöhnliche Blässe? Nein, die hohlen Wangen zeigten verräterische grüne Schatten – kein Zweifel, der Junge war auf der Bootsfahrt eben richtig seekrank geworden. In seinem blassen Gesicht brannten ein paar dunkle Augen, sie wirkten durch den Farbkontrast wie schwarze, ausgeschnittene Löcher in einem weißen Bogen Papier. Masters fielen diese Augen auf, weil sie der junge Mensch trotz seiner Seekrankheit unermüdlich umherwandern ließ, um jede Einzelheit einer Umgebung in sich aufzunehmen, die ihm offensichtlich neu war. In diesen forschenden Augen verriet sich eine unbändige Wißbegierde, die sogar stärker war als alle Menschenscheu und als das Elend der Seekrankheit. Nach Mr. Masters etwas gesuchtem Urteil mußte dem jungen Mann Vorsicht oder Voraussicht eigen sein, wie er seine neue Umwelt musterte, als wollte er sich vor Überraschungen bewahren. So mochte Daniel auf die Löwen geblickt haben, als er in deren Grube kam.
Der Blick der dunklen Augen heftete sich an Masters, die schlaksige Gestalt nahm Haltung an und hob mit selbstbewußter Gebärde die Hand zur Krempe des wassertriefenden Hutes. Der Junge öffnete den Mund, um etwas zu sagen, klappte ihn dann aber gleich unverrichteter Dinge wieder zu, da ihn offenbar die Schüchternheit übermannte. Endlich riß er sich nochmals sichtlich zusammen und stieß die vorgeschriebenen Worte hervor, die man ihm für diese Gelegenheit eingetrichtert hatte.
»Melde mich an Bord, Sir.«
»Sie heißen?« fragte Masters nach einer kurzen, erwartungsvollen Pause.
»H – Horatio Hornblower, Sir – Fähnrich«, stammelte der Neue.
»Danke, Mr. Hornblower«, gab Masters ebenso förmlich zur Antwort. »Haben Sie Ihr Garnier gleich mitgebracht?«
Hornblower hatte diesen Ausdruck noch nie gehört, aber er fand gerade noch genug Überlegung, um zu erraten, was damit gemeint war.
»Meine Seekiste, Sir? Jawohl, sie steht mittschiffs an der Fallreepspforte.«
Er brachte diesen Satz nach kurzem Zögern heraus, obgleich ihm wohlbekannt war, wie man sich an Bord auszudrücken hatte, daß er also mittschiffs und durch die Fallreepspforte an Bord gekommen war. Dennoch kostete es ihn Überwindung, diese Worte in den Mund zu nehmen.
»Ich werde die Kiste unter Deck bringen lassen«, sagte Masters. »Auch für Sie selbst wüßte ich im Augenblick keinen besseren Aufenthalt. Der Kommandant ist nämlich an Land, und der Erste Offizier will auf keinen Fall vor acht Glasen gestört sein. Ich rate Ihnen also, Ihre nassen Sachen auszuziehen, solange Sie noch Zeit dazu haben.«
»Ja, Sir«, sagte Hornblower und fühlte schon im selben Augenblick, daß er sich falsch ausgedrückt hatte – ein Blick auf Masters’ Gesicht bestätigte ihm das –, und er verbesserte sich, bevor Masters es tun konnte. (Er konnte es noch kaum glauben, daß man außerhalb der Bühne so sprach.)
»Aye, aye, Sir«, sagte Hornblower und fuhr etwas verspätet mit der Hand an den Hut, weil es ihm nicht rechtzeitig eingefallen war. Masters erwiderte seinen Gruß und wandte sich an einen der Läufer, die kältebebend im unzureichenden Schutz des Schanzkleids hockten.
»Junge! Führ Mr. Hornblower unter Deck in die Fähnrichsmesse.«
»Aye, aye, Sir.«
Hornblower ging mit dem Schiffsjungen nach vorn zum Hauptniedergang. Die Seekrankheit bewirkte ohnehin, daß er unsicher auf den Beinen stand, als aber nun die Justinian während seines kurzen Wegs unter dem Druck besonders harter Böen gar noch zweimal heftig in ihre Ankertroß ruckte, taumelte er jedesmal nach vorn, als ob er über eine Leine an Deck gestolpert wäre. Schließlich glitt der Schiffsjunge wie ein Aal den steilen Niedergang hinunter, während sich Hornblower richtig Zeit nehmen mußte, ehe er ungeschickt und behutsam in die Dämmerung der Unterbatterie und weiter ins Zwielicht des Zwischendecks hinuntertauchte. Der Geruch, der ihm dort in die Nase stieg, war ebenso seltsam und undefinierbar wie die Geräusche, die an seine Ohren drangen. Am Fuß eines jeden Niederganges erwartete ihn der Schiffsjunge mit der Geduld, die er offenbar dem Neuling schuldig zu sein glaubte. Als er den letzten glücklich hinter sich hatte, waren es nur noch wenige Schritte – Hornblower hatte schon ganz die Richtung verloren und wußte nicht, ob sie voraus oder achteraus führten – bis zu einem düsteren Verschlag, dessen Dunkelheit durch ein Talglicht auf einem kupfernen Teller eher betont als gemildert wurde. Dieses Licht stand auf einem Tisch, um den ein halbes Dutzend Männer in Hemdsärmeln saßen.
Der Schiffsjunge verschwand und ließ Hornblower allein zurück. Es verstrichen mehrere Sekunden, ehe der Mann mit dem Backenbart, der am Kopf des Tisches saß, von ihm Notiz nahm.
»Bist du ein ehrliches Gespenst, so sprich«, sagte er endlich. Hornblower fühlte, wie ihn plötzlich ein Anfall von Übelkeit überkam – er litt immer noch unter der Nachwirkung der Bootsfahrt, und darum setzten ihm die Stickluft und der Gestank im Zwischendeck besonders zu. Es fiel ihm also an sich schon schwer zu sprechen; am ärgsten aber war, daß er überhaupt keine Ahnung hatte, wie er sich diesen Leuten gegenüber benehmen sollte.
»Mein Name ist Hornblower«, brachte er schließlich stammelnd hervor.
»Da hast du aber lausiges Pech gehabt«, meinte ein anderer aus der Runde ohne jede Spur von Mitgefühl.
In diesem Augenblick schoß der heulende Sturm, der draußen herrschte, ganz plötzlich um mehrere Striche aus, so daß sich die schwere Justinian ein wenig auf die Seite legte, ehe sie in die neue Richtung schwamm und wieder einmal heftig in die Ankertrossen ruckte. Für Hornblower war das ein Gefühl, als ob sich die Welt aus den Angeln höbe. Alles schien sich um ihn zu drehen, und zugleich spürte er, wie ihm der Schweiß auf die Stirne trat, obwohl er am ganzen Leib vor Kälte zitterte.
»Ich habe den Eindruck«, sagte der Bärtige am Kopf des Tisches, »daß Sie an Bord dieses Schiffes gekommen sind, um sich Ihren seebefahrenen Kameraden aufzudrängen. Wir hätten also wieder einmal so einen begriffsstutzigen, ahnungslosen Zeitgenossen unter uns, der uns das Leben schwer macht, weil wir ihm mühsam beibringen müssen, was er zu tun und zu lassen hat. Schaut euch den Kerl nur einmal an …«, der Sprecher wies mit einer Geste auf Hornblower, und alle Anwesenden sahen sich nach ihm um. »Ja, seht ihn euch an! Mit dem ist der König wieder einmal verdammt schlecht bedient … Wie alt sind Sie eigentlich?«
»Sie–Siebzehn, Sir«, stammelte Hornblower.
»Was, schon siebzehn Jahre?« Der Ton des Sprechers verriet nur zu deutlich, wie er darüber dachte. »Bilden Sie sich nur ja nicht ein, daß da noch ein richtiger Seemann aus Ihnen wird. Dazu hätten Sie mit zwölf anfangen müssen. Können Sie überhaupt ein Fall von einer Schot unterscheiden?«
Jetzt lachte die ganze Gesellschaft, und wenn es auch in Hornblowers Kopf wild durcheinander ging, konnte er doch am Klang des Gelächters erkennen, daß er sich in ihren Augen noch lächerlicher machen würde, mochte er nun mit Ja oder Nein erwidern. Er suchte daher krampfhaft nach einer neutralen Antwort und sagte:
»Es wird das erste sein, was ich in Nories ›Handbuch der Seemannschaft‹ nachschlagen werde.«
In diesem Augenblick holte das Schiff von neuem über, so daß Hornblower nach der Tischkante greifen mußte, um sein Gleichgewicht zu halten.
»Meine Herren«, begann er feierlich, ohne noch recht zu wissen, wie er sich dieser Gesellschaft verständlich machen sollte.
»Ach du großer Gott«, rief da einer aus der Tafelrunde, »der Mensch ist ja seekrank!«
»Seekrank im Spithead!« bemerkte ein anderer. Aus der Art, wie er das sagte, ließ sich unschwer entnehmen, daß er diesen Sachverhalt ebenso erstaunlich wie verächtlich fand. Aber Hornblower war jetzt schon alles gleich, er faßte überhaupt nicht mehr richtig auf, was rings um ihn vorging. An seinem gegenwärtigen Zustand trugen die Aufregungen der letzten Tage mindestens ebensoviel Schuld wie die stürmische Bootsfahrt und die unberechenbaren Bewegungen der Justinian. Aber das spielte hier natürlich keine Rolle, für die anderen war er fortan der Fähnrich, der im Spithead seekrank wurde. Der Fluch der Lächerlichkeit, der ihn damit traf, hatte notwendig zur Folge, daß er sich erst recht von aller Welt verlassen fühlte und doppelt unter Heimweh litt. Der seelische Druck, der sich da auf ihn legte, wollte nicht mehr von ihm weichen, solange der Teil der Kanalflotte, dem es noch nicht gelungen war, die Besatzungen aufzufüllen, in Lee der Isle of Wight vor Anker lag. Fürs erste half ihm der Messesteward in seine Hängematte, und dort erholte er sich innerhalb einer Stunde wenigstens so weit, daß er sich beim Ersten Offizier melden konnte.
Schon nach wenigen Tagen fand er sich überall im Schiff zurecht und verlor auch unter Deck nicht mehr, wie zu Anfang, die Orientierung, sondern wußte stets, wo vorn und achtern war. Auch die Gesichter seiner Kameraden verloren allmählich ihre verschwommene Ähnlichkeit und zeigten ihm jetzt deutlich unterschiedene, individuelle Züge. In mühsamer Übung lernte er mit der Zeit die Stationen kennen, die ihm die Rolle zuwies, wenn Klarschiff angeschlagen wurde, wenn er die Wache hatte, oder wenn die Besatzung zum Segelsetzen oder -bergen an Deck gepfiffen wurde. Bald hatte er sogar schon so viel Verständnis für sein neues Dasein gewonnen, daß er sich darüber Rechenschaft gab, wieviel schlimmer diese erste Zeit womöglich für ihn ausgefallen wäre, wenn ihn das Schicksal gleich zu Anfang an Bord eines Schiffes verschlagen hätte, das nicht vor Anker liegen blieb, sondern sofort in See zu gehen hatte.
Aber das war eben doch nur ein schwacher Trost, er war und blieb ein todunglücklicher, einsamer Junge. Seine Schüchternheit allein hätte es ihm schon schwer genug gemacht, sich an andere anzuschließen; hier auf der Justinian hatte es überdies ein böser Zufall gefügt, daß die übrigen Fähnriche all um ein gut Teil älter waren als er. Es waren ältere Steuerleute aus der Handelsmarine und andere Fähnriche, hoch in den Zwanzigern, denen es infolge fehlender Protektion oder wegen mangelnder Begabung, die nötigen Prüfungen zu bestehen, noch nicht gelungen war, das Leutnantspatent zu erhalten. Sie hatten im ersten Augenblick ihren Schabernack mit ihm getrieben, dann aber ließen sie ihn bald links liegen, und er hatte nichts dagegen einzuwenden. Am liebsten verkroch er sich wie eine Schnecke ins Gehäuse und war vor allem ängstlich darauf bedacht, nicht aufzufallen.
Auf der Justinian herrschte in jenen düsteren Januartagen auch wirklich kein guter Geist. Kapitän Keene – als er an Bord kam, erlebte Hornblower zum erstenmal das pomphafte Zeremoniell, das einem Kommandanten zustand – war ein kranker Mann und litt unter melancholischen Depressionen. Er hatte keinen Ruhm erworben, der es anderen Kommandanten leicht machte, ihre Besatzung mit begeisterten Freiwilligen aufzufüllen, und ihm fehlte es auch an persönlicher Ausstrahlung, um die mürrischen Leute, welche ihm die Preßkommandos täglich heranschleppten, mitzureißen. Seine Offiziere bekamen ihn wenig zu Gesicht und waren alles andere als begeistert, wenn er wirklich einmal in Erscheinung trat. Als Hornblower zu seiner ersten Meldung in die Kajüte gerufen wurde, empfing auch er keinen besonderen Eindruck. Hinter einem mit Papieren bedeckten Tisch saß ein Mann mittleren Alters, dessen gelbe, eingefallene Wangen von jahrelangem Leiden zeugten.
»Mr. Hornblower«, begann er in förmlichem Ton, »ich freue mich, Sie an Bord meines Schiffes begrüßen zu können.«
»Jawohl, Sir«, gab Hornblower zur Antwort – das schien ihm für diese Gelegenheit passender als ›Aye, aye, Sir‹, und eine andere Wahl war nicht zu treffen, da man von einem jungen Fähnrich offenbar bei jedem denkbaren Anlaß eine von diesen beiden Antworten erwartete.
»Sie sind – lassen Sie mich nachsehen – Sie sind also siebzehn Jahre alt, nicht wahr?« Kapitän Keene nahm ein Blatt Papier zur Hand, das offenbar über seine kurze dienstliche Laufbahn Auskunft gab.
»Jawohl, Sir.«
»Vierter Juli 1776«, murmelte Keene lesend vor sich hin. Das war Hornblowers Geburtstag. »Fünf Jahre, bevor ich Kommandant wurde. Als Sie geboren wurden, bin ich schon sechs Jahre als Leutnant gefahren.«
»Jawohl, Sir«, sagte Hornblower – was sollte er sonst sagen.
»Ihr Vater ist Arzt, ja? Sie hätten sich besser einen Lord als Vater ausgesucht, wenn Sie bei uns vorwärtskommen wollen.«
»Jawohl, Sir.«
»Wie steht es mit Ihrer Schulbildung?«
»Ich habe das humanistische Gymnasium besucht.«
»Da können Sie also neben Cicero auch Xenophon übersetzen.«
»Jawohl, Sir. Aber nicht besonders gut, Sir.«
»Es wäre besser, Sie verstünden sich auf Sinus und Cosinus, noch besser, Sie könnten eine Bö früh genug erkennen, um rechtzeitig die Bramsegel zu bergen. Für den Ablativus absolutus haben wir in der Marine wenig Verwendung.«
»Jawohl, Sir«, sagte Hornblower.
Was ein Bramsegel war, hatte er jetzt erst erfahren; aber er hätte erwidern können, daß er es in der Mathematik schon ziemlich weit gebracht hatte. Er unterdrückte das jedoch; sein Instinkt und seine jüngsten Erfahrungen hielten ihn davon zurück, freiwillig unerbetene Mitteilungen zu machen.
»Aber das hat nichts zu sagen. Wenn Sie alle Befehle gewissenhaft befolgen und gründlich lernen, was der Dienst von Ihnen verlangt, dann kann Ihnen hier nichts Schlimmes widerfahren. Ich danke Ihnen.«
»Danke, Sir«, sagte Hornblower und zog sich zurück.
Es schien, als wollte das Schicksal die letzten Worte des Kommandanten sofort und gründlich Lügen strafen. Ausgerechnet von diesem Tage an widerfuhr Hornblower nämlich eine Fülle von Unbill, obwohl er jedem Befehl gehorchte und seine dienstlichen Obliegenheiten immer besser erfüllen lernte. Alle diese Widrigkeiten hingen mit der Rückkehr John Simpsons zusammen, der als Dienstältester sofort den Vorsitz in der Fähnrichsmesse übernahm. Hornblower saß gerade mit seinen Kameraden bei Tisch, als er zur Tür hereinkam, ein kräftiger, gutaussehender Mann, der schon an die dreißig Jahre zählen mochte. Zunächst blieb er stehen und blickte über die Tafelrunde, genau wie Hornblower vor wenigen Tagen dagestanden hatte.
»Hallo!« begrüßte ihn irgendwer – es klang alles andere als herzlich.
»Freund Cleveland«, meinte der ungebetene Gast, »was soll das eigentlich heißen, daß Sie einfach sitzen bleiben? Los, runter von diesem Stuhl, ich führe jetzt wieder den Vorsitz hier am Tisch.«
»Aber …«
»Weg von diesem Platz, sage ich«, schnauzte ihn Simpson an.
Cleveland räumte mit etwas gespieltem Zögern das Feld, Simpson nahm seinen Platz ein und begegnete mit finsterer Miene den neugierigen Blicken, die ihn von allen Seiten trafen.
»Ja, meine teuren Kameraden«, sagte er, »ich bin leibhaftig in den Schoß der Familie zurückgekehrt. Denkt euch, ich bin nicht einmal überrascht, daß niemand davon begeistert ist. Eure Begeisterung wird sich noch mehr verflüchtigen, wenn ich euch erst wieder richtig in Schwung habe. Aber das nur nebenbei.«
»Was ist denn mit Ihrer Beförderung?« wagte jetzt endlich jemand zu fragen.
»Was mit meiner Beförderung ist?« Simpson lehnte sich über den Tisch und trommelte mit den Fingerspitzen auf der Platte; dabei musterte er den neugierigen Frager mit finsteren Blicken. »Dieses eine Mal will ich auf deine Frage antworten, aber dann ist Schluß, und wehe dem, der sich herausnimmt, noch einmal darauf zurückzukommen. Also: eine Kommission von Fetthälsen, die sich Kapitäne schimpfen, hat mir meine Beförderung versalzen. Die Burschen waren der Meinung, mit meinen mathematischen Kenntnissen würde ich nie einen zuverlässigen Nautiker abgeben. Na ja. So wurde denn aus dem diensttuenden Leutnant Simpson wieder der alte Fähnrich Simpson von früher. Den aber sollt ihr jetzt kennenlernen, und dazu gnade Gott euren armen Seelen.«
Die Tage vergingen, aber es hatte nicht den Anschein, als ob der liebe Gott auch nur das geringste Einsehen mit ihnen hätte. Seit Simpson wieder da war, wurde alles bisher Erlebte durch die unaufhörlichen Schikanen in den Schatten gestellt, mit denen er wahllos jeden bedachte. Offenbar war dieser Simpson schon immer ein übler Menschenschinder gewesen, jetzt kam dazu, daß er über seinen Durchfall bei der Offiziersprüfung verbittert und wohl auch heimlich beschämt war. Die Folge war, daß er gegen seine Kameraden schlimmer wütete als je zuvor und vor allem im Ausdenken neuer Quälereien immer erfinderischer wurde. In Mathematik mochte er schwach gewesen sein, aber er verstand sich meisterhaft darauf, anderen Menschen das Leben zur Hölle zu machen. Als Messeältester hatte er an sich schon ziemlich weitreichende Befugnisse gegenüber seinen Kameraden, seine messerscharfe Zunge und sein geradezu krankhafter Hang, anderen üble Streiche zu spielen, hätten ihm auch dann ein Übergewicht gegeben, wenn die Justinian einen wachen und tüchtigen Ersten Offizier an Bord gehabt hätte, der ihn gelegentlich zur Ordnung rief. Leider konnte man von Mr. Clay nichts Derartiges erwarten. Zweimal schon hatten sich Fähnriche gegen Simpsons Willkürherrschaft aufgelehnt, aber Simpson hatte sich den Meuterer dann jedesmal gekauft und ihn mit seinen mächtigen Fäusten bis zur Bewußtlosigkeit zusammengedroschen. Das konnte er, weil er Kräfte besaß, die einem Preisboxer Ehre gemacht hätten. Er selbst trug dabei nie eine Schramme davon, sein armer Widersacher aber war jedesmal mit blauen Augen und geschwollenen Lippen gezeichnet, was ihm womöglich noch Strafentern oder Strafdienst eintrug, wenn er damit dem Ersten Offizier unter die Augen kam und seine Entrüstung weckte. Die Messe kochte vor ohnmächtiger Wut. Selbst die Kriecher und Speichellecker unter den Fähnrichen – denn auch deren gab es einige – haßten den Tyrannen.
Bezeichnenderweise waren es nicht die täglichen Praktiken Simpsons, die seine jüngeren Kameraden am meisten empörten – ob er nun eine Anleihe aus ihrer Seekiste machte, um zu einem reinen Hemd zu kommen, ob er sich jedesmal mit dem besten Stück Fleisch bediente oder ihnen gar die begehrte Schnapsration wegnahm – solche Übergriffe hätten sie noch verstanden, vielleicht hätten sie sich ähnliches herausgenommen, wenn sie die Macht dazu besessen hätten. Aber er ließ sie darüber hinaus eine launische Willkür fühlen, die den klassisch gebildeten Hornblower an die extravaganten Scherze römischer Kaiser erinnerte. So zwang er Cleveland dazu, seinen Backenbart zu rasieren, auf den er so unbändig stolz war, oder er gab dem armen Hether den Auftrag, Mackenzie Tag und Nacht jede halbe Stunde zu wecken, so daß keiner von beiden ein Auge zutun konnte – und es fand sich immer ein Kriecher, der ihm verriet, wenn Hether einmal nicht mitmachte. Natürlich hatte er Hornblowers schwache Seiten ebenso rasch herausgefunden wie die aller anderen Fähnriche. Er wußte vor allem um seine Schüchternheit, darum fand er es im Anfang besonders lustig, ihn vor den versammelten Fähnrichen zum Aufsagen von Grays ›Elegie auf einem Dorfkirchhof‹ zu zwingen. Simpsons Garde von Speichelleckern forderte Hornblower dazu auf, Simpson selbst legte mit einem vielsagenden Blick seine Dolchscheide auf den Tisch, Hornblower sah sich von den Kriechern umringt und wußte genau, daß er beim geringsten Verzug über den Tisch gezogen wurde und Hiebe mit dieser Dolchscheide bekam. Das war schon schmerzhaft genug, wenn sie ihn mit der flachen Seite traf, und vollends unerträglich, wenn die Schläge gar mit der Kante geführt wurden. Aber alle Schmerzen wogen nichts gegen das Gefühl der Demütigung, das ihn bei dieser Prozedur überkam. Und doch sollte es noch viel schlimmer kommen. Simpson hatte sich für Hornblower eine Quälerei ausgedacht, die er Inquisition nannte. Dabei wurde das Opfer einer langsamen und methodischen Befragung unterworfen, die sich besonders eingehend mit seinem Zuhause und seiner Kindheit befaßte. Jede Frage mußte genau beantwortet werden, da sonst gleich wieder die Dolchscheide in Aktion trat. Hornblower mochte sich drehen und wenden, wie er wollte, er mußte Rede und Antwort stehen. Unwillkürlich entschlüpfte ihm dabei unter dem Druck des bohrenden Verhörs zuweilen irgendein harmloses Eingeständnis, das der versammelten Corona schallendes Gelächter entlockte. In der ganzen einsamen Kinderzeit, die hinter ihm lag, gab es bei Gott nichts, dessen er sich zu schämen brauchte, aber Knaben sind nun einmal seltsame Geschöpfe, besonders wenn sie schon von Natur verschlossen sind wie der junge Hornblower.
Solche jungen Menschen schämen sich oft irgendeiner Kleinigkeit, die einen anderen überhaupt nicht berühren könnte. Hornblower fühlte sich jedesmal ganz krank und schwach, wenn das qualvolle Examen überstanden war. Ein leichter veranlagter Mensch als er hätte sich vielleicht mit einem Witzwort aus der Affäre gezogen und damit womöglich die Lacher auf seiner Seite gehabt, aber Hornblower war mit seinen siebzehn Jahren viel zu schwerblütig, um den Spaßmacher zu spielen. Er mußte alle Qualen voll auskosten und erlebte ein Elend, so trostlos, wie es nur ein Junge seines Alters empfinden kann.
Vor den anderen unterdrückte er tapfer die aufsteigenden Tränen, dafür weinte er sich des Nachts in seiner Hängematte oft genug in den Schlaf, wenn ihn das bittere Knabenweh seiner siebzehn Jahre übermannte. Oft sehnte er sich danach, zu sterben. Dann spielte er wohl auch mit dem Gedanken an Desertion, aber nur, um alsbald zu erkennen, daß er sich durch einen solchen Schritt in eine schlimmere Lage brächte, als wenn er freiwillig aus dem Leben schied. Ein Drittes gab es nicht, so blieb ihm also nur die Wahl, endgültig Schluß zu machen, wenn er dem Elend des freudlosen Daseins eines einsamen, brutal mißhandelten schüchternen Knaben unter lauter harten Männern entrinnen wollte. Er spann sich ganz in diese Vorstellung ein und erging sich in selbstquälerischen Phantasien, wie er seinem Leben ein Ende machen wollte.
Wäre das Schiff in See gewesen, so hätte die Fülle der Arbeit von selbst alle dummen Gedanken aus den Köpfen dieser jungen Menschen verjagt; ein energischer Kommandant mit einem tüchtigen Ersten Offizier hätte es sogar vor Anker zuwege gebracht, die Besatzung so in Schwung zu halten, daß kein Mißstand aufkommen konnte. Aber Hornblower hatte eben leider das Pech, daß die Justinian in jenen bösen Januarwochen des Jahres 1794 unter einem todkranken Kommandanten und einem unfähigen Ersten Offizier untätig vor Anker lag. Selbst das bißchen gemeinsamer Dienst, an dem die Fähnriche teilnehmen mußten, hatte für Hornblower zuweilen Mißhelligkeiten zur Folge. Eines Tages gab zum Beispiel Mr. Bowles, der Steuermann, seinen Maaten und den Fähnrichen Navigationsunterricht. Wie es das Unglück wollte, kam der Kommandant dazu und sah sich die Lösungen der Besteckaufgabe an, die der Klasse gestellt worden war. Die Krankheit hatte Keene bitter und hämisch gemacht, überdies war ihm Simpson gründlich zuwider. Er warf nur einen Blick auf Simpsons Bogen und meinte dann mit sarkastischem Lächeln:
»Das ist ja großartig. Meinen herzlichen Glückwunsch. Endlich sind also die Quellen des Nils entdeckt.«
»Bitte, Sir?« fragte Simpson.
»Soweit ich Ihrem unmöglichen Geschreibsel entnehmen kann«, erklärte Keene, »befindet sich Ihr Schiff mitten in Zentralafrika. Jetzt will ich einmal sehen, welche terrae incognitae von den übrigen tapferen Seefahrern dieser Klasse dem Verkehr erschlossen wurden.«
Was nun kam, war eine Laune des Schicksals, das die Wirklichkeit oft dramatischer fügt, als es ein Dichter vermöchte. Hornblower wußte bereits, was ihm bevorstand, als Keene die übrigen Blätter, das seine eingeschlossen, zur Hand nahm. Seine Lösung war als einzige richtig, die anderen hatten entweder die Korrektur für Strahlenbrechung addiert statt subtrahiert oder Fehler beim Multiplizieren gemacht oder aber, wie Simpson, überhaupt die ganze Aufgabe verpfuscht.
»Meinen Glückwunsch, Mr. Hornblower«, sagte Keene. »Sie haben als einziger unter dieser Schar von Geistesriesen eine anständige Arbeit geliefert. Darauf können Sie sich etwas einbilden. Ich schätze, Sie sind etwa halb so alt wie Mr. Simpson. Wenn sich auch Ihre Kenntnisse noch verdoppeln, bis Sie so alt sind wie er, dann stellen Sie uns noch alle in den Schatten. Mr. Bowles, bitte sorgen Sie dafür, daß sich Mr. Simpson noch eifriger als bisher mit dem Mathematiklehrbuch befaßt.«
Damit wandte er sich ab und entfernte sich langsam durch das Zwischendeck. Sein unsicherer Gang verriet jedem, der ihn sah, daß er ein todkranker Mann war. Hornblower saß mit niedergeschlagenen Augen auf seinem. Platz, er fühlte sich einfach außerstande, den Blicken standzuhalten, die jetzt bestimmt von allen Seiten nach ihm zielten und deren Bedeutung er nur zu gut kannte. Am liebsten wäre er auf der Stelle gestorben, und in der Nacht darauf betete er sogar flehentlich zu Gott, er möge ihn zu sich nehmen.
Zwei Tage später befand sich Hornblower an Land, und zwar ausgerechnet unter dem Kommando Simpsons. Die beiden Fähnriche hatten eine Abteilung Matrosen unter sich, die zusammen mit Mannschaften von den anderen Schiffen des Geschwaders einen sogenannten Preßgang bildeten. Die Ankunft des Westindienkonvois stand dicht bevor, seine Besatzungen waren sicher schon zum größten Teil von der Flotte gepreßt, auf die er draußen im Kanal getroffen sein mußte, der Rest reichte dann gerade noch aus, die Schiffe vollends auf ihren Ankerplatz zu bringen. Diese Leute schlichen sich dann unter Anwendung jeder erdenklichen List an Land, um dort irgendwo ein sicheres Versteck zu finden. Die Landungsabteilung hatte die Aufgabe, ihnen diesen Fluchtweg abzuschneiden. Dazu wurde entlang der Wasserfront eine Postenkette aufgestellt, die jeden abfing, der sie passieren wollte.
Aber der Geleitzug war noch immer nicht gemeldet, als diese Vorbereitungen bereits getroffen waren.
»Ach, es ist eine Lust zu leben«, meinte Simpson.
Solche Reden war man von ihm nicht gewohnt, aber heute ging es ihm ja auch besonders gut. Er saß im Nebenzimmer des Gasthofs Zum Lamm in einem bequemen Ledersessel und hatte die Beine auf einen zweiten Sessel gelegt. Vor ihm prasselte ein gewaltiges Feuer im Kamin, neben ihm stand ein mächtiger Krug Bier mit einem Schuß Gin.
»Trinken wir auf den Westindienkonvoi«, sagte Simpson und nahm einen tiefen Schluck. »Daß er noch recht lange ausbleiben möge.«
Simpson war heute ganz umgänglich, die Führerrolle, die er spielen konnte, das Bier und das wärmende Feuer hatten ihn in Stimmung gebracht, und er hatte wiederum noch nicht so viel getrunken, daß er mit jedermann Händel suchte. Hornblower saß auf der anderen Seite des Kamins, auch er nahm ab und zu einen Schluck Bier, aber ohne Gin, und studierte unterdes sein Gegenüber. Er konnte es noch nicht fassen, daß die endlosen Schikanen endlich einmal für eine Weile unterblieben und nur ein dumpfes Unbehagen hinterließen, das mit dem abklingenden Schmerz in einem hohlen Zahn zu vergleichen war.
»Los, einen Trinkspruch, Knabe!« sagte Simpson.
»Nieder mit Robespierre!« sagte Hornblower schwunglos.
Gleich darauf öffnete sich die Tür, und zwei weitere Offiziere betraten das Zimmer. Der eine war Fähnrich, der andere trug das einzelne Epaulett eines Leutnants – es war Chalk von der Goliath, der den Befehl über sämtliche an Land gesetzten Preßgangs führte. Selbst Simpson fühlte sich bemüßigt, seinem Vorgesetzten einen Platz am Feuer einzuräumen.
»Der Konvoi ist noch immer nicht gemeldet«, verkündete Chalk und faßte alsbald Hornblower ins Auge. »Ich glaube nicht, daß wir bereits das Vergnügen hatten …«
»Mr. Hornblower – Leutnant Chalk«, stellte Simpson vor.
»Mr. Hornblower hat sich besonders dadurch vor allen anderen Fähnrichen hervorgetan, daß er hier im Spithead seekrank wurde.«
Hornblower hätte sich am liebsten in die Erde verkrochen, als ihn Simpson in dieser abgeschmackten Art lächerlich machte. Er war Chalk herzlich dankbar, daß er aus Höflichkeit sofort auf etwas anderes zu sprechen kam.
»He, Kellner! – Darf ich Sie zu einem Gläschen einladen, meine Herren? Ich fürchte, wir werden noch rechte lange zu warten haben. Haben Sie Ihre Leute auch alle richtig verteilt, Mr. Simpson?«
»Jawohl, Sir.«
Chalk war ein unruhiger Geist. Er rannte im Zimmer herum, starrte zum Fenster hinaus in den Regen und stellte den beiden anderen seinen Fähnrich Caldwell vor, als die Getränke serviert wurden. Das aufgezwungene Warten machte ihn sichtlich nervös.
»Wie wäre es zum Zeitvertreib mit einem Spielchen?« schlug er vor. »Sind Sie einverstanden? Ausgezeichnet. He, Kellner! Karten, einen Tisch und noch ein Licht!«
Man setzte den Tisch vors Feuer und rückte die Stühle zurecht, die Karten lagen bereit.
»Was wollen wir denn spielen?« meinte Chalk mit einem fragenden Blick. Da er als einziger Leutnant mit drei Fähnrichen am Tisch saß, war sein Wunsch natürlich für die anderen Befehl, und sie warteten respektvoll darauf, daß er ihn äußerte.
»Siebzehn und Vier? Nein, das ist ein Spiel für Schwachköpfe. Oder Loo? Das würde für Schwachköpfe mit dickem Geldbeutel passen. Aber wie wäre es mit einer Partie Whist? Das wäre wenigstens ein gutes Training für unsere eingerosteten Gehirne. Caldwell hat eine ungefähre Ahnung davon, das weiß ich. Wie steht es mit Ihnen, Mr. Simpson?«
Ein Mensch wie Simpson, der für Mathematik überhaupt kein Organ besaß, konnte wohl auch kein guter Whistspieler sein. Aber wahrscheinlich war er sich darüber nicht im klaren.
»Bitte, verfügen Sie über mich, Sir«, sagte er. Spielen war nun einmal seine Leidenschaft, und für seine Begriffe taugte ein Spiel dazu so gut wie das andere.
»Und Sie, Mr. Hornblower, spielen Sie auch?«
»Jawohl, Sir, mit größtem Vergnügen.«
Das war nicht etwa nur eine konventionelle Phrase, sondern ganz ehrlich gemeint. Hornblower hatte in Whist eine recht gute Schule genossen, da er seit dem Tode seiner Mutter immer als Vierter mit von der Partie gewesen war, wenn der Vater mit den Pastorseheleuten spielte. Allmählich wurde ihm dieses geistvolle Spiel fast zur Leidenschaft, es machte ihm Freude, den Ablauf einer Partie scharfsinnig vorauszuberechnen und die unzähligen Möglichkeiten auszukosten, die bald Vorsicht, bald Kühnheit von ihm verlangten. Seine Zusage verriet eine so ehrliche Freude, daß Chalk aufhorchte und sich den jungen Mann noch einmal ansah. Er war selbst ein guter Spieler und wußte darum sofort, daß er hier eine verwandte Seele gefunden hatte.
»Ausgezeichnet«, sagte er noch einmal. »Dann wollen wir gleich die Plätze und die Partner auslosen. Noch eins, wie hoch wollen wir denn spielen, meine Herren? Einen Shilling für den Stich, ein Pfund für den Rubber, ja? Oder ist Ihnen das zu hoch? Nein? Dann sind wir uns also einig?«
Eine Weile nahm das Spiel einen ruhigen Verlauf. Hornblower zog erst Simpson und dann Caldwell als Partner. Simpson war ein hoffnungsloser Fall. Er spielte ständig ein As aus, wenn er es hatte, oder die einzige Karte einer Farbe, wenn er vier Trümpfe hatte, dennoch gewann er mit Hornblower den ersten Rubber, weil sie beide unschlagbare Blätter in die Hand bekamen. Dann verlor Simpson den nächsten Rubber mit Chalk, bekam Chalk ein zweitesmal als Partner und verlor von neuem. Er ließ seine Freude an guten Spielen erkennen und seufzte bei schlechten. Es war klar, daß er zu jenen geistig nicht Erleuchteten gehörte, die Whist nur als gesellschaftliche Verpflichtung ansahen oder als ein mehr oder weniger grobes Mittel, willkürlich Geld von einer Hand in die andere wandern zu lassen, ähnlich wie das Würfelspiel.
Er sah im Spiel niemals einen geheiligten Ritus oder gar eine Geistesübung. Seine Verluste stiegen, er kippte einen Schnaps nach dem anderen hinunter und wurde offenbar immer nervöser. Auch die Röte, die sein Gesicht übergoß, rührte sicher nicht nur vom Widerschein des Feuers her. Er war eben das, was man einen schlechten Verlierer nennt, und konnte obendrein nicht viel vertragen. Sogar Chalk mit seinen unerschütterlichen Manieren wahrte nur mühsam die Haltung und atmete sichtlich auf, als er beim nächstenmal Hornblower als Partner erhielt. Sie gewannen ihren Rubber mit Leichtigkeit, und wieder wanderten ein Sovereign und eine Anzahl Shilling in Hornblowers schmale Börse. Er war bis jetzt der einzige Gewinner, Simpson hatte am schwersten verloren. Hornblower war ganz in sein Spiel vertieft und genoß das lange entbehrte Vergnügen mit vollen Zügen. Wenn Simpson neben ihm aufgeregt auf seinem Stuhl herumrutschte und leise vor sich hin fluchte, dann empfand er das höchstens als lästige Störung und vergaß ganz, wie gefährlich die Demütigung des anderen für ihn selbst noch werden konnte. In dieser Stunde kam ihm überhaupt nicht in den Sinn, daß er seinen Erfolg bestimmt mit neuen teuflischen Quälereien zu bezahlen hatte.
Noch einmal wurde gelost, er blieb auch diesmal der Partner Chalks. Sie bekamen beide gute Karten und gewannen damit das erste Spiel. Auch das zweite nahm einen günstigen Verlauf. Als es zu Ende ging, sah Hornblower, daß die letzten fünf Stiche ihm gehörten und legte daher seine Karten auf den Tisch.
»Der Rest ist für mich«, sagte er.
»Was soll das heißen?« sagte Simpson, der noch den Caro-König hatte.
»Fünf Stiche«, sagte Chalk erfreut. »Spiel und Rubber für uns.«
»Aber ich mache doch noch einen Stich!« ereiferte sich Simpson.
»Wird Caro oder Herz ausgespielt, dann steche ich mit Trumpf, außerdem mache ich drei Stiche in Treff.«
Für ihn war das so einfach wie das kleine Einmaleins, ein Endspiel, wie es hundertmal vorkam. Er konnte nicht so ohne weiteres begreifen, daß es einem stumpfen Menschen wie Simpson einfach nicht gelang, sich den Verbleib der zweiundfünfzig Karten des Spiels zu merken. Simpson warf seine Karten auf den Tisch.
»Das geht nicht mit rechten Dingen zu«, sagte er. »Sie müssen die Karten auch von hinten erkennen.«
Hornblower mußte schlucken. Er sagte sich, daß dieser Augenblick über sein ganzes ferneres Leben entschied, wenn er es darauf ankommen ließ. Vor einer Sekunde hatte er noch harmlos Karten gespielt und seinen Spaß daran gehabt, jetzt ging es auf Leben und Tod. Eine Flut von Gedanken wirbelte ihm durch den Kopf. Ungeachtet aller Annehmlichkeiten, die er zur Stunde genoß, stand ihm das elende Dasein an Bord der Justinian nur allzu deutlich vor Augen. Dorthin mußte er wieder zurück, ob er wollte oder nicht. Aber wie denn? War nicht jetzt die Gelegenheit da, dem Jammer so oder so ein Ende zu machen? Er hatte doch ohnehin mit dem Leben abgeschlossen, was gab es also noch zu bedenken? Das gab den Ausschlag. Ein Gedanke, zunächst kaum ernstlich ins Auge gefaßt, reifte ihm in Sekundenschnelle zum Entschluß.
»Das ist eine Beleidigung, Mr. Simpson«, sagte er. Als er sich umsah, begegnete er den Blicken Chalks und Caldwells, die beide sehr ernst geworden waren. Simpson starrte nur blöde vor sich hin. »Ich muß daher Satisfaktion verlangen.« »Satisfaktion?« warf Chalk hastig ein. »Das ginge denn doch zu weit. Mr. Simpson ist aus der Rolle gefallen, gewiß, aber ich bin überzeugt, daß er das einsieht und sich dafür entschuldigt.«
»Ich bin hier in aller Form des Falschspiels beschuldigt worden«, wandte Hornblower ein. »So etwas läßt sich wohl kaum mit ein paar Worten ungeschehen machen.«
Er gab sich alle Mühe, so entschieden aufzutreten, wie es sich für einen erwachsenen Mann gehörte, und versuchte dabei, die Rolle des tödlich Gekränkten zu spielen, obwohl ihn die Geschichte in Wirklichkeit völlig kalt ließ, weil er sich nur zu gut vorstellen konnte, wie es im Kopfe Simpsons aussah, als er seine unfreundliche Bemerkung fallen ließ. Aber ein solcher Vorfall kehrte so rasch nicht wieder, und er war fest entschlossen, ihn so gut es ging zu nutzen. Für ihn galt es jetzt nur, sich so in die Rolle eines Mannes hineinzuleben, dem eine tödliche Kränkung widerfahren war, daß sein Spiel auch wirklich überzeugend wirkte.
»Beim Wein fällt manches dumme Wort, das man nicht auf die Waagschale legen darf«, sagte Chalk, der immer noch hoffte, zu einem gütlichen Ende zu kommen. »Ich bin überzeugt, daß Mr. Simpson nur einen Scherz machen wollte. Das beste ist, wir bestellen noch eine Flasche und leeren sie in guter Kameradschaft miteinander.«
»Mit größtem Vergnügen«, sagte Hornblower und suchte eilends nach einem Vorbehalt, der jeden Versuch einer gütlichen Beilegung vereiteln mußte. »Ich muß allerdings die Bedingung stellen, daß sich Mr. Simpson vorher in Gegenwart aller anwesenden Herren bei mir entschuldigt und ausdrücklich einräumt, daß seine Bemerkung durch nichts gerechtfertigt und eines Gentleman unwürdig war.«
Während er das sagte, maß er Simpson mit dem herausfordernden Blick eines Toreadors, der seinen Stier mit dem roten Tuch zu reizen trachtet. Der Stier ging denn auch ungesäumt und voller Wut zum Angriff über.
»Was denkst du dir eigentlich? Ich soll mich bei dir entschuldigen, du lächerlicher Kakerlak?« Simpson ging förmlich in die Luft, der Alkohol und diese unerhörte Zumutung zusammen raubten ihm vollends jede Überlegung. »Lieber beiße ich mir in die Zunge.«
»Haben Sie das gehört, meine Herren?« sagte Hornblower.
»Mr. Simpson hat mich beleidigt. Er verweigert mir nicht nur jedes Wort der Entschuldigung, sondern beleidigt mich aufs neue. Unter diesen Umständen gibt es nur noch einen Weg, den Fall zu bereinigen.«
Während der beiden Tage, die bis zur Ankunft des Westindien-Geleitzugs noch verstrichen, taten Hornblower und Simpson unter Chalks Kommando weiter ihren Dienst. Höhere Gewalt schuf also für die beiden Duellanten die seltsame Lage, daß sie aufs engste zusammen leben und arbeiten mußten, ehe sie ihren Ehrenhandel austragen konnten. Hornblower nahm sich zusammen wie immer und führte jeden Befehl gewissenhaft aus, Simpson behandelte ihn als Vorgesetzter mit fühlbarer Zurückhaltung und auf eine etwas verlegene Art. Während dieser beiden Tage fand Hornblower reichlich Zeit, seinen Plan noch einmal gründlich und in allen Einzelheiten zu überlegen.
Bei kühler Betrachtung, deren auch ein Siebzehnjähriger in einer verzweifelten Lage fähig sein kann, war die Berechnung der Chancen so einfach wie beim Whist. Schlimmer als sein Leben auf der Justinian konnte nichts sein, auch nicht der Tod, den er sich schon oft herbeigewünscht hatte. Hier eröffnete sich ihm die Möglichkeit eines schnellen Todes, wenn nicht statt seiner Simpson sterben mußte.
Sein Denken nahm eine neue, überraschende Wendung; er blieb, ganz gebannt darin, plötzlich stehen, so daß die ihm folgenden Männer gegen ihn rannten.
»Verzeihung, Sir«, sagte der Maat.
»Macht nichts«, erwiderte Hornblower.
Gleich nach seiner Rückkehr an Bord der Justinian besprach Hornblower seine Überlegungen mit den Steuermannsmaaten Preston und Danvers und bat sie, seine Sekundanten zu sein.
»Sie können mit uns rechnen«, versicherte Preston und maß dabei Hornblowers schlaksige Gestalt mit einem zweifelnden Blick. »Wie wollen Sie denn gegen ihn antreten? Sie sind der Beleidigte, also steht Ihnen die Wahl der Waffe zu.«
»Das habe ich mir durch den Kopf gehen lassen, seit er mich beleidigte«, sagte Hornblower, um noch etwas Zeit zu gewinnen. Er fand es nämlich gar nicht so einfach, mit dürren Worten zu erklären, was ihm vorschwebte.
»Wie wäre es zum Beispiel mit dem Degen?« frage Danvers. »Können Sie gut damit umgehen?«
»Nein«, sagte Hornblower. In Wahrheit hatte er noch nie so ein Ding in der Hand gehabt.
»Dann ist es immer noch das beste, Sie wählen Pistolen«, schlug Preston vor.
»Simpson ist aber wahrscheinlich ein guter Schütze«, warf Danvers ein. »Ich würde mich nicht gerade darum reißen, ihm als Zielscheibe zu dienen.«
»Nicht doch, nicht doch«, hielt ihm Preston sofort entgegen, »wir dürfen unseren Mann nicht kopfscheu machen.«
»Sprechen Sie ruhig«, sagte Hornblower, »Sie machen mich nicht kopfscheu, ich habe selbst schon an Pistolen gedacht.«
»Ich muß schon sagen, Sie haben die Ruhe weg«, staunte Danvers.
Hornblower zuckte die Achseln.
»Mag sein. Jedenfalls rege ich mich nicht so leicht auf. Statt dessen habe ich mir durch den Kopf gehen lassen, wie man einen einseitigen Vorteil am besten ausschalten könnte.«
»Leider kann man das eben nicht.«
»Doch, es gibt einen Weg, die Chancen sogar mathematisch genau gleich zu machen.«
Hornblower sah die beiden anderen an und kam endlich mit seinem Plan heraus: »Es werden zwei gleiche Pistolen bereitgelegt, die eine davon ist geladen, die andere ungeladen. Nun wird gewählt, wobei natürlich weder Simpson noch ich wissen, welche von den beiden Waffen geladen ist. Ist das geschehen, so stellen wir uns mit einem Meter Abstand gegenüber und drücken auf Kommando ab.«
»Entsetzlich!« sagte Danvers.
»Ich glaube nicht, daß das zulässig ist«, sagte Preston, »denn hierbei käme doch einer der Gegner mit Sicherheit um.«
»Wozu duelliert man sich denn?« sagte Hornblower. »Doch nur um zu töten. Da im übrigen nichts Unbilliges verlangt wird, wüßte ich nicht, was man gegen diese Art des Zweikampfs einwenden könnte.«
»Sind Sie denn Manns genug, das durchzuhalten?« fragte Danvers verwundert.
»Mr. Danvers …«, begann Hornblower, aber Preston fiel ihm eilig ins Wort:
»Halt! Wir können kein zweites Duell brauchen. Danvers meinte nur, daß ihm so etwas wohl schwerfiele. Wir beide wollen den Vorschlag gleich mit Cleveland und Hether besprechen und hören, was sie dazu sagen.«
Innerhalb einer Stunde wußte auch der letzte Mann an Bord über die vorgeschlagenen Bedingungen für das Duell Bescheid. Wahrscheinlich wirkte es sich zu Simpsons Nachteil aus, daß er auf dem ganzen Schiff keinen richtigen Freund besaß, jedenfalls fühlten sich Cleveland und Hether, seine beiden Sekundanten, nicht bewogen, den Bedingungen der anderen Seite ein festes Nein entgegenzusetzen, sondern stimmten ihnen, wenn auch mit einer Geste des Bedenkens, zu. Jetzt mußte der Tyrann der Fähnrichsmesse seine Tyrannei entgelten. Einige Offiziere trugen eine zynisch-amüsierte Überlegenheit zur Schau; die meisten Offiziere und Männer empfanden vor den Duellanten den Schauder wie vor zum Tode Verurteilten. Mittags ließ Leutnant Masters Hornblower zu sich kommen.
»Mr. Hornblower, der Kommandant hat mich beauftragt, wegen des bevorstehenden Duells einige Fragen an Sie zu richten. Seine Weisung geht dahin, daß ich mich nach besten Kräften bemühen soll, doch noch eine friedliche Beilegung herbeizuführen.«
»Jawohl, Sir.«
»Warum bestehen Sie eigentlich auf diesem Waffengang, Mr. Hornblower? Soviel ich weiß, handelte es sich doch nur um ein paar unüberlegte Worte bei Wein und Kartenspiel.«
»Mr. Simpson hat mir Falschspiel vorgeworfen, Sir, und das in Gegenwart von Zeugen, die nicht Offiziere dieses Schiffes sind.«
Das war der springende Punkt, daß die Zeugen nicht zur eigenen Besatzung gehörten. Hätte Hornblower in ihrer Gegenwart Simpsons Worte als Fauxpas eines betrunkenen Rauhbeins genommen, so hätte man sie nicht zu beachten brauchen. Der Standpunkt, den er damals eingenommen hatte, erlaubte nun nicht mehr, den Vorgang zu vertuschen. Das wußte Hornblower ganz genau.
»Auch solche Dinge lassen sich ohne Duell bereinigen, meinen Sie nicht?«
»Wenn sich Mr. Simpson vor den gleichen Herren in aller Form bei mir entschuldigen würde, könnte ich die Angelegenheit als erledigt betrachten.«
Simpson war bestimmt kein Feigling. Er würde lieber sterben, als sich so zu demütigen.
»Schön. Wie ich ferner höre, haben Sie für den Kampf recht ungewöhnliche Bedingungen vorgeschlagen, nicht wahr?«
»Sie wurden nicht zum erstenmal gewählt, Sir. Als Beleidigter kann ich jede Bedingung stellen, die nicht als unfair gelten müßte.«
»Wenn man Sie so reden hört, Mr. Hornblower, könnte man meinen, Sie wären ein Winkeladvokat.«
Hornblower begriff sofort was das hieß. Das Mundwerk war soeben mit ihm durchgegangen und er beschloß, seine Zunge künftig besser im Zaum zu halten. Jetzt wartete er schweigend bis Masters die Unterredung fortsetzte.
»Sie sind also fest entschlossen, Mr. Hornblower, dieses mörderische Unternehmen bis zum Ende durchzuführen?«
»Jawohl, Sir.«
»Der Kommandant hat mir befohlen, dem Duell persönlich beizuwohnen, eben weil es unter so ungewöhnlichen Bedingungen ausgetragen werden soll. Ich muß Sie davon unterrichten, daß ich die Sekundanten ersuchen werde, hierzu alles Nötige zu veranlassen.«
»Jawohl, Sir.«
»Sonst wäre nichts, mehr zu sagen. Ich danke Ihnen, Mr. Hornblower.«
Während sich Hornblower zum Gehen wandte, folgte ihm Masters noch viel gespannter mit dem Blick als damals bei seinem Anbordkommen. Er lauerte geradezu darauf, eine Schwäche oder Unsicherheit an ihm zu entdecken, irgendein Anzeichen, das menschliches Fühlen verraten hätte, aber man merkte ihm nichts dergleichen an. Hornblower war zu seinem Entschluß gekommen, er hatte jedes Für und Wider sorgfältig erwogen, und nun sagte ihm sein logischer Verstand, daß es unsinnig wäre, sich nachträglich von irgendwelchen ungreifbaren Gefühlsregungen beeinflussen zu lassen, nachdem man sich einmal kaltblütig für eine wohlüberlegte Handlungsweise entschieden hatte. Die Bedingungen, auf denen er bestand, waren mathematisch als vorteilhaft anzusprechen. Wenn man in Betracht zog, daß er freiwillig in den Tod gehen wollte, um Simpsons Quälereien zu entgehen, dann war es doch schon ein ganz wesentlicher Vorteil, zu wissen, daß es nun eine genau fünfzigprozentige Chance gab, ihm sogar lebendig zu entrinnen. Sollte Simpson ferner der bessere Fechter oder der bessere Pistolenschütze von ihnen beiden sein, was im übrigen ganz bestimmt der Fall war, dann war die gewonnene Chance von fünfzig Prozent mathematisch wiederum ein Vorteil. Er hatte also gewiß keinen der jüngst unternommenen Schritte zu bereuen.
Allerdings, mathematisch waren Hornblowers Schlüsse unanfechtbar, aber zu seiner Überraschung fand er jetzt plötzlich heraus, daß Mathematik eben doch nicht auf alle Fragen Antwort gab. Er ertappte sich an diesem trüben, dunklen Nachmittag und Abend mehr als einmal dabei, daß ihn aufsteigende Angst zum aufgeregten Schlucken zwang, sooft er sich ausmalte, wie im Grauen des kommenden Morgens eine wirbelnde Münze darüber entscheiden würde, ob er weiterleben durfte oder nicht. Eine von zwei Möglichkeiten hieß, daß er tot sein würde, sein Bewußtsein erloschen, sein Leib erkaltet; und doch – kaum zu glauben – würde die Welt ohne ihn weitergehen.
Gegen seinen Willen erschauerte er bei dieser Vorstellung jedesmal bis ins Mark. Und Zeit blieb ihm genug für solche Vorstellungen, denn nach überliefertem Brauch durfte er vor dem Duell nicht mehr mit seinem Gegner zusammentreffen; so war er zwangsläufig isoliert, soweit man in dem von Menschen wimmelnden Deck der Justinian von Isolation sprechen konnte. In recht gedrückter Stimmung hängte er am Abend seine Hängematte auf; er fühlte sich ungewohnt müde und fror noch mehr als sonst, als er sich in der feuchtkalten Stickluft des Zwischendecks auszog. Er drehte sich fest in seine Decken ein, um in ihrer Wärme ein wenig Entspannung zu finden, aber der Druck wollte nicht von ihm weichen. Immer wieder, wenn der Schlaf ihn überkommen wollte, schreckte ihn die bange Erwartung des Morgen auf. Müde wie er war, warf er sich mindestens ein dutzendmal herum und hörte jede halbe Stunde die Schläge der Schiffsglocke. Dabei tobte er innerlich wegen seiner vermeintlichen Feigheit immer wütender gegen sich selbst. Am Ende mußte er sich sagen, daß es im Grunde ein Glück war, wenn morgen sein Schicksal rein vom Zufall abhing, weil er mit aller Bestimmtheit ein Kind des Todes gewesen wäre, wenn er sich nach einer solchen Nacht auf ein scharfes Auge und eine ruhige Hand hätte verlassen müssen. Wahrscheinlich trug diese Schlußfolgerung ein wenig dazu bei, daß er noch für ein paar kurze Stunden Schlaf fand. Jedenfalls fuhr er erst erschrocken hoch, als ihn Danvers wachrüttelte. »Fünf Glasen«, sagte Danvers, »in einer Stunde dämmert der Tag. Also, reise, reise!«
Hornblower rutschte aus seiner Hängematte und stand im Hemd. Im Zwischendeck war es fast völlig dunkel, so daß auch Danvers kaum zu erkennen war.
»Der Erste Offizier stellt uns den zweiten Kutter«, sagte Danvers. »Masters mit Simpson und seinem Verein fahren vor uns mit der Barkaß. Da kommt auch Preston.« Eine zweite Schattengestalt tauchte aus der Finsternis auf.
»Hundekalt ist es«, sagte Preston, »besonders angenehm, wenn man so früh heraus muß. Nelson, wo bleibt der Tee?« Der Steward kam damit an, als Hornblower eben in seine Hose fuhr. Er war wütend, weil er vor Kälte so stark zittern mußte, daß die Tasse in der Untertasse klapperte, als er den Tee entgegennahm. Dann aber goß er das heiße Getränk mit wahrer Gier hinunter.
»Noch eine Tasse!« verlangte er und war nun doch ein wenig stolz, daß er sich in diesem Augenblick für Tee interessieren konnte.
Es war noch dunkel, als sie in den Kutter stiegen. »Absetzen!« befahl der Bootssteurer, und das Boot kam vom Schiff frei. Der Wind wehte scharf und kalt und füllte das Luggersegel, daß das Boot überlag, als es auf die beiden Lichter zuhielt, die die Landungsbrücke bezeichneten.
»Ich habe eine Kutsche bestellt, die am George auf uns warten soll«, sagte Danvers, »hoffentlich ist sie da.«
Sie war da, und der Kutscher war, wenn ihm auch ein nächtlicher Trunk anzumerken war, nüchtern genug, um seine Pferde zu regieren. Als sie Platz genommen hatten und ihre Füße im Stroh vergruben, zog Danvers ein Reisefläschchen mit Schnaps aus der Tasche. »Wie wär’s mit einem Schluck, Hornblower?« fragte er. »Eine stetige Hand ist ja heute nicht vonnöten.«
»Nein, besten Dank«, sagte Hornblower. Sein leerer Magen revoltierte bei dem bloßen Gedanken an Schnaps.
»Die andern sind vor uns da«, bemerkte Preston. »Die Barkaß legte ab, kurz bevor wir anlegten.«
Nach den Gebräuchen des Duells mußten sich die Gegner getrennt zum Kampfplatz begeben. Für die Rückkehr war nur noch ein Boot nötig.
»Der Doktor ist mit den andern gefahren«, sagte Danvers.
»Was der heute helfen kann, weiß ich nicht.« Er kicherte, besann sich dann aber und unterdrückte es.
»Wie fühlen Sie sich, Hornblower?« fragte Preston.
»Danke, ganz gut«, erwiderte Hornblower. Am liebsten hätte er noch hinzugesetzt, daß er sich nur dann wohl fühlen könnte, wenn diese Art Unterhaltung nicht fortgesetzt würde.
Als der Wagen die Höhe gewonnen hatte, ging es noch eine Weile eben weiter. Am Ende hielt er am Rand einer Wiese. Dort stand bereits ein zweiter Wagen, seine Kerzenlaterne warf einen gelben Schein in das Grau des dämmernden Tages.
»Dort sind sie«, sagte Preston. In dem schwachen Licht erkannte man eine Anzahl Schattengestalten, die zwischen Ginsterbüschen auf der reifbedeckten Wiese standen.
Im Näherkommen erhaschte Hornblower einen Blick auf Simpson, der etwas abseits von den anderen stand. Er war blaß, und Hornblower bemerkte, daß er gerade in diesem Augenblick nervös zu schlucken begann, genau wie es auch ihm so leicht widerfuhr. Masters kam ihnen entgegen und musterte Hornblower wie immer mit einem scharfen, forschenden Blick, ehe er ihn ansprach: »Ich möchte Ihnen in dieser Stunde ein letztes Mal eindringlich nahelegen, den Streit zu begraben. England ist im Kriege, und ich hoffe, Mr. Hornblower, daß ich Sie doch noch dazu bestimmen kann, dem König und seiner Marine ein kostbares Menschenleben zu erhalten, indem Sie auf die letzte Konsequenz aus dem vorliegenden Streitfall verzichten.«
Hornblower suchte Simpson mit dem Blick, während Danvers für ihn antwortete.
»Hat Mr. Simpson die verlangte Entschuldigung angeboten?« fragte Danvers.
»Mr. Simpson bedauert den Vorfall und erklärt, daß er wünsche, dieser Vorfall hätte sich niemals zugetragen.«
»So geht es leider nicht«, sagte Danvers, »von einer Entschuldigung ist da keine Rede, und Sie müssen doch zugeben, Sir, daß die Angelegenheit ohne eine förmliche Entschuldigung nicht beizulegen ist.«
»Was sagt der Duellant selbst dazu?« beharrte Masters.
»Ein Duellant braucht unter den gegebenen Umständen keine Fragen zu beantworten«, sagte Danvers mit einem Blick auf Hornblower, der ihm bekräftigend zunickte. All das war so unvermeidlich wie die Fahrt auf dem Henkerskarren für den Verbrecher – und genauso qualvoll. Ein Zurück gab es jetzt nicht mehr, Hornblower hatte keinen Augenblick erwartet, daß sich Simpson noch entschuldigen könnte, ohne Entschuldigung aber mußte die Affäre ihren Verlauf nehmen bis zum blutigen Ende. Mit genau fünfzig Prozent Wahrscheinlichkeit war es mit ihm in weniger als fünf Minuten aus.
»Ihr Entschluß steht also fest, meine Herren?« fragte Masters, »ich muß diese Tatsache in meinem Bericht ausdrücklich erwähnen.«
»Jawohl, wir sind entschlossen.«
»Dann muß diese höchst bedauerliche Angelegenheit eben weiter ihren Lauf nehmen. Die Pistolen hat Dr. Hepplewhite in seiner Obhut.«
Er wandte sich ab und schritt ihnen voran auf die zweite Gruppe zu. Da stand Simpson mit Hether und Cleveland; etwas abseits von ihnen wartete Dr. Hepplewhite mit den Pistolen, die er, in jeder Hand eine, an den Mündungen festhielt. Er war ein massiger Mann mit dem roten Gesicht des unverbesserlichen Portweintrinkers, um seinen Mund spielte sogar in diesem Augenblick ein alkoholisches Grinsen, und wenn man genauer hinsah, dann merkte man, daß er ein wenig schwankte.
»Sind die jungen Hitzköpfe wirklich entschlossen, ihren Unfug fortzusetzen?« fragte er, aber die anderen taten wie auf Verabredung, als hätten sie nicht gehört. Das war auch ganz in Ordnung, weil seine Frage in diesem Augenblick höchst überflüssig und taktlos war.
»Hier sind also die beiden Pistolen«, sagte Masters, »beide mit Zündpillen versehen, aber nur eine geladen, die andere nicht, so wie es die Vereinbarung verlangt. Ich habe hier einen Sovereign und schlage vor, die Waffen nach Kopf oder Wappen auszulosen. Nun, meine Herren, bitte ich Sie noch über folgende Alternative zu beschließen: soll das Ergebnis des Wurfs sofort und unwiderruflich für die Verteilung der Waffen maßgebend sein, so daß zum Beispiel Mr. Simpson diese hier erhält, wenn die Münze Kopf zeigt, oder soll der Gewinner des Wurfs die Wahl zwischen den beiden Pistolen haben? Es geht mir dabei nur darum, jede Möglichkeit einer Manipulation von vornherein auszuschließen.
Hether, Cleveland, Danvers und Preston blickten einander eine Weile fragend an. Endlich schlug Preston vor:
»Ich meine, wir lassen den Gewinner des Wurfs seine Waffe wählen.«
»Einverstanden, meine Herren? Schön, Mr. Hornblower, bitte, wählen Sie.«
»Wappen«, sagte Hornblower, als das Goldstück in die Luft wirbelte.
Masters fing es auf und bedeckte es mit einer Hand.
»Wappen«, sagte Masters, hob seine Hand und zeigte die Münze den vier Sekundanten.
»Bitte treffen Sie Ihre Wahl.«
Hepplewhite streckte ihm die beiden Pistolen entgegen, er hielt in der einen Hand den Tod, in der anderen das Leben. Hornblower durchlebte einen grauenhaften Augenblick, blinder Zufall entschied jetzt über sein Schicksal, es kostete ihn Mühe, seine Hand zu heben.
»Ich möchte diese hier«, sagte er. Als er die Waffe in die Hand nahm, fühlte sie sich an wie ein Eisklumpen.
»Damit habe ich die mir übertragene Aufgabe erfüllt«, sagte Masters, »alles Weitere ist Ihre Sache, meine Herren.«
»Hier, nehmen Sie die andere, Simpson«, sagte Hepplewhite, »und Ihnen, Mr. Hornblower, möchte ich dringend zur Vorsicht raten, Sie gefährden sonst Ihre ganze Umgebung.«