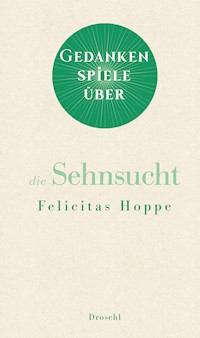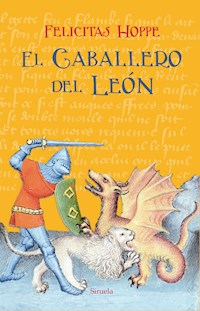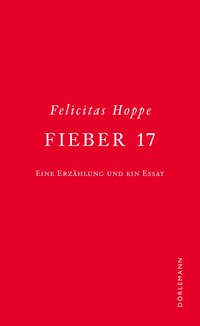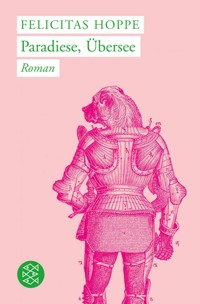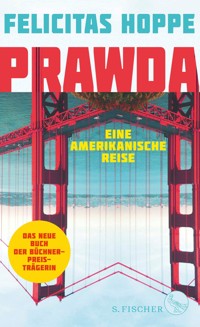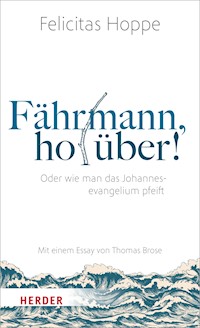
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Kaum eine Schriftstellerin verbindet Humor, Leichtigkeit und Tiefgang so wunderbar wie Felicitas Hoppe. Mit dieser unnachahmlichen Mischung blickt sie auf Themen, die sie seit ihrer Kindheit bis heute begleiten: Die Bibel, den heiligen Martin und die heilige Johanna, den Apostel Paulus und das Reich Gottes. Sie taucht ein in die Welt religiöser Zeichen und Geschichten, verbindet dabei auf so kühne wie geistesgegenwärtige Weise Spekulationen über die Paulusbriefe mit Kindheitserinnerungen und verrät uns nebenbei, wer eigentlich ihr Lieblingsheiliger ist. Sie pfeift sich durch das Johannesevangelium, erzählt von biblischen Karrieresprüngen, von einem geheimnisvollen roten Seil und einer revolutionären Botschaft im Sand. Ein Buch nicht nur für Sprachliebhaber, sondern für alle, die Lust auf die Nach- und Neuerzählung uralter Stoffe im hellen Licht einer scharfen Beobachtungsgabe haben. Ein literarischer Parforceritt, der mit Witz und Charme vermeintlich Vergangenes zurück in unsere alltägliche Gegenwart holt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Felicitas Hoppe
Fährmann, hol über!
Oder wie man das Johannesevangelium pfeift
Mit einem Essay herausgegeben von Thomas Brose
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2021
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Die Bibelverse wurden, soweit nicht anders angegeben, folgender Ausgabe entnommen:
Die Bibel. Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Bundes. Vollständige deutsche Ausgabe
© Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2005
Weiter wurden verwendet:
Die Zürcher Bibel © 2007 Zürcher Bibel/Theologischer Verlag Zürich
Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, vollständige durchgesehene und überarbeitete Ausgabe © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart, Alle Rechte vorbehalten (EÜ)
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: © vectortatu / shutterstock
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft, Timisoara
ISBN E-Book Epub 978-3-451-82253-7
ISBN E-Book PDF 978-3-451-82254-4
ISBN Print 978-3-451-39038-8
Inhalt
Thomas Brose: Hoppe – Hell und schnell
I. Das aufgespannte Ohr Gottes
II. Ohne Ansehen der Person
III. Das rote Seil
IV. Dein Reich komme
V. Der doppelte Martin
VI. Wie pfeift man das Johannesevangelium?
VII. Und schrieb in den Sand
VIII. Fährmann, hol über!
IX. Gliedermann oder Gott
X. Die Weihnachtsgeschichte
Literatur- und Quellenhinweise
Viten
Für Ulrike Rainer
Thomas Brose: Hoppe – Hell und schnell
„Also gut, lassen wir das ganze Getue und kommen gleich zum Wesentlichen: Glauben Sie an irgendeine Form des Göttlichen oder nicht?“ Auf diese unmissverständliche Weise bringt Slavoj Žižek die alte Gretchenfrage auf den Punkt (Die Puppe und der Zwerg, 2003). Der umtriebige Kulturphilosoph fährt fort: „Wir haben es heute mit einer Art ‚suspendiertem Glauben‘ zu tun, der sich nur dann entfalten kann, wenn er nicht vollständig eingestanden wird, sondern ein privates obszönes Geheimnis bleibt. Im Widerspruch zu dieser Haltung sollte man jedoch mehr denn je darauf beharren, dass die ‚vulgäre‘ Frage ‚Glauben Sie wirklich oder nicht?‘ von entscheidender Bedeutung ist“.
I.
Fährmann, hol über! – so ernsthaft wie komödiantisch, sicher und souverän ignoriert Felicitas Hoppe mit ihren Texten, Einsprüchen und fixen Einfällen das von Žižek konstatierte Religionstabu. Nach dem poetologischen Meisterwerk Sieben Schätze (2009) setzt die Büchner-Preisträgerin mit ihrer aktuellen Essaysammlung jetzt dazu an, mehr Bewegung und Lebendigkeit in das Gespräch zwischen Literatur und Religion zu bringen. So hell wie schnell verbindet die Schriftstellerin damit die beiden gegenüberliegenden Ufer; sie scheut keineswegs davor zurück, sich zu diesem Zweck – rudernd und die Fähre vorantreibend – literarisch ins Zeug zu legen und dabei Rechenschaft von ihrem eigenen Lesen und Schreiben zu geben.
Dass die Autorin keine Lust hat, über Alles oder Nichts zu plaudern, sondern – radikal im Sinne Žižeks – Stellung zu ihrem persönlichen Umgang mit der Gottesfrage bezieht, macht bereits der hier vorgelegte Eingangstext der miteinander kommunizierenden Essays deutlich: So ließe sich „Das aufgespannte Ohr Gottes“ als Bekenntnis, als Konfession im eigentlichen Sinn des Wortes lesen. Doch in dem Stück erfahren wir auch, dass sich bereits die Vorschülerin, die nach eigenem Bekunden aus einer Familie von „Vielrednern“ stammt, in ihrem religiösen Umfeld als ausgebuffte Erzählerin positioniert. Denn „die Möglichkeit einer persönlichen Beichte erschien mir geheimnis- und verheißungsvoll und der Beichtstuhl als ein Ort, an dem alles gesagt, aber nichts verraten wurde: das aufgespannte Ohr Gottes, dem ich straffrei anvertraute, was ich mir ausgedacht hatte. Ich sage ‚ausgedacht‘, weil alles, was ich dem Ohr Gottes zu sagen hatte, tatsächlich ausgedacht war, eine Mischung aus vagem Schuldbekenntnis und einer Erfindung von Sünden in Gedanken, Worten und Werken“.
In „Das rote Seil“ – einem Text, der von der Schriftstellerin ursprünglich bei einer Fachtagung für Alttestamentliche Exegese vorgetragen wurde – berichtet sie, dass das Buch Josua in ihrer Erinnerung „an einem einzigen Faden, genauer an einem roten Seil“ direkt an der Mauer der berühmten Stadt Jericho hänge. „Es ist das rote Seil meiner Erinnerung an die berühmte von Hermine Schäfer illustrierte Kinderbibel von Anne de Vries, von dem ich seit meiner Kindheit bis noch vor wenigen Wochen glaubte, er sei, seinem Namen nach, eine Frau.“
Die preisgekrönte Schriftstellerin, die im In- und Ausland mittlerweile fünfzehn Poetik-Dozenturen bekleidet hat, führt Leserinnen und Leser zu den Quellen eines Werkes, das mittlerweile in zehn Sprachen übersetzt wurde. In dem Aufsatz „Und schrieb in den Sand“ berichtet die studierte Literatur- und Religionswissenschaftlerin Folgendes über ihre Herkunft aus der niedersächsischen Diaspora:
Geboren als drittes von fünf Kindern schlesischer Flüchtlinge, komme sie aus einer katholischen Familie, in der unaufhörlich nicht nur gesprochen, sondern auch gezeichnet wurde. „Unsere Mutter las vor, wir zeichneten mit, während unser Vater für das Kaspertheater zuständig war, in dem Texte und Bilder in Szene gesetzt wurden (…). Meine ersten Erinnerungen an die Bibel sind also, vom Alten bis zum Neuen Testament, nicht nur durchweg mündlich, sondern auch durchweg bebildert: eine unmittelbare, intuitive und unzensierte Umsetzung vom Wort in die Zeichnung, also wahrhaft phantastisch“.
Den titelgebenden Ausgangspunkt von „Und schrieb in den Sand“ bildet eine entwaffnende Geste Jesu: Fast spielerisch gebraucht der Messias seine schreibende Hand, um die „beim Ehebruch ertappte Frau (Joh 8,4)“ durch eine Symbolhandlung vor Schimpf und Schande, aber vor allem vor der Steinigung zu bewahren. Diese im Johannes-Evangelium zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit angesiedelte Rettungsaktion hat für die Essayistin nichts mit Stummsein zu tun, sondern mit der Fähigkeit, auf überflüssige Worte zu verzichten und sich ganz auf die Sprache der Zeichen zu verlassen.
Welche Erkenntnis folgt daraus: „Das Bild zieht gleich mit der Schrift und die Schrift mit dem Bild, mit der Geste, dem Zeichen, die Innenwelt mit der Außenwelt, die gesprochene mit der geschriebenen Sprache, das Gespräch (um das inflationär gebrauchte Wort Dialog an dieser Stelle kurzfristig zu vermeiden) mit dem Text und der Text mit der Rede über den Text, der sich seinerseits in eine Handlung verwandelt, in ein neu erzähltes, belebtes Wort.“
Damit bestätigt die Autorin nach dem Ende der Epoche „Katholischer Literatur“ das, was Thomas Pittrof in dem 2016 publizierten Handbuch Literatur und Religion folgendermaßen kennzeichnet: „Vor allem in autobiographischen Zeugnissen wird das Katholische wieder erinnert, auch an überraschender Stelle, ohne dass es damit eigentlich immer bewahrt und weitergetragen werden wollte. (…) Dem Prägnanzverlust eines ungebrochen katholischen Weltbildes steht damit ein Prägnanzgewinn lebensweltlich dichter Milieubeschreibungen gegenüber, bei denen neben den belastenden Erfahrungen mit Religion im Umfeld einer katholischen Kindheit und Jugend auch deren entlastende und bereichernde Dimensionen zur Sprache kommen.“
II.
Das Lebensweltlich-Katholische verbindet sich bei Hoppe mit dem Hang zur Selbstexegese. Hinzu tritt ein unbändiger Spieltrieb, der – zur nicht geringen Frustration mancher Fachleute – nicht einmal davor zurückschreckt, sich in der Quasi-Autobiografie Hoppe (2012) gleich die eigene Literaturkritik mit zu erfinden: etwa in Form des Kulturwissenschaftlers Kai Rost, der bei der Schriftstellerin eine „verzweifelt ortlose Prosa“ konstatiert. Er wird an Schärfe jedoch noch von seinem – ebenfalls fiktionalen – Kritiker-Kollegen Reimar Strat übertroffen, der fundamentaler ansetzt und im Werk der Autorin „altmodische Schnitzeljagden im Gewand dürftiger postpsychoanalytischer Spielereien“ ausmacht.
Und wie sollen Literaturkritik und Feuilleton darauf reagieren? „Wo ‚Spiel‘ ausgemacht wird,“, so Julika Griem, „stehen häufig Vorstellungen von befreiendem Probehandeln und entlastender Kompensation im Raum.“ (Bleibt alles im Spiel?, in: Felicitas Hoppe. Text + Kritik, 2015) Tatsächlich positioniert sich die Schriftstellerin mit ihrem ganzen Œuvre gegen eine Überbewertung des Instrumentellen und am Fließband Produzierten (gegen „Fordismus“, Prawda. Eine amerikanische Reise). Gemäß einer solchen Logik dürfe nämlich nur das, was mit einem eisernen Arbeitswillen unter äußerster Schmerzbereitschaft vom homo faber hervorgebracht werde, als wirklich gültiges Werk gelten. Dagegen sei alles, was sich nicht mühevoller Plackerei, sondern einem spielerischen Umgang mit Wirklichkeit verdanke, mit größter Skepsis zu genießen.
Bei Hoppes hohem Einsatz für den homo ludens geht es nicht um Marginalien, sondern um Grundsätzliches: um eine Entscheidung von ethisch-literarischer Tragweite. Sie erliegt keineswegs der Faszination, die in exemplarischer Weise von Ernst Jüngers heroischer Vision Des Arbeiters ausgeht, wonach der Einzelne jeden Tag neu in den Kampf ziehen müsse, um sein Dasein in pausenloser, vierundzwanzigstündiger Aktivität – ohne jeden Sabbat – zu behaupten. Die Autorin folgt vielmehr einer christlich geprägten Wirklichkeitsauffassung. Danach besitze menschliche Existenz immer den Charakter eines Geschenks: einer nicht geschuldeten Gabe.
In Hoppes Kindheit und Jugend hat sich die Schriftstellerin im spielerischen Umgang ungezählte Texte und Töne erschlossen, aus denen die Schöpferin zahlreicher Kinderbücher, Erzählungen, Übersetzungen und Romane bis heute ihren inneren Reichtum bezieht. In ihrem 1996 erschienenen Debüt Picknick der Friseure verwandelt die Autorin z. B. Alltägliches in surreale Szenen und lebt dabei ganz aus jenen Energien, die durch Zeichen, Gleichnisse und – nicht zuletzt – Gesten freigesetzt werden.
Ein Jahr später unternahm die Schriftstellerin dann eine abenteuerliche Schiffsreise: für sie der Versuch, ihre „Literatur an der Wirklichkeit zu überprüfen, allerdings nicht auf einer Kreuzfahrt, sondern auf einem Containerschiff, auf dem ich in vier Monaten von Hamburg nach Hamburg um die Welt fuhr und danach meinen ersten Roman, Pigafetta, schrieb. In Pigafetta ist es der stotternde Schiffsmechaniker Nobell, der mit den Worten und Wörtern auf Kriegsfuß steht und sich deshalb ins Schweigen und Trinken zurückzieht. Besonders beredt ist das nicht, dafür aber hochgradig zeichenhaft (…). Das Schiff gleicht einer ozeanischen Einsiedelei, die Kabinen, ‚Kammern im Wasser‘, engen Mönchszellen; die Elemente sind übermächtig und lassen den Seemann verstummen“.
In dem 1999 erschienenen Pigafetta-Buch – zum Namensgeber kürte die Schriftstellerin dabei den Chronisten von Magellans Weltumseglung – geht es der Verfasserin nicht um ein artifizielles, möglicherweise postmodernes Werk, wie einige Literaturkritiker zuerst meinten. Das Buch sei vielmehr – so die Autorin wiederum in ihrem Essay „Und schrieb in den Sand“ – „nicht mehr und nicht weniger als das verspätete Logbuch einer katholischen Kindheit, die erst 30 Jahre später, auf eben jener Schiffsreise, in eine literarische Bewegung zwischen mündlicher Erinnerung und schriftlicher Beglaubigung gerät, die mit bewusster Motivarbeit wenig zu tun hat. Fast bin ich geneigt zu behaupten, jener Text sei, wenn nicht in Sand, so doch auf Wasser geschrieben, auf jenen beweglichen Untergrund, der Erkenntnis mit literarischen Mitteln freisetzt.“
Wer diesen Umstand weiter überprüfen möchte, braucht sich bloß einige der typologisch anmutenden Kapitelüberschriften anzuschauen. Die lauten: Gebete, Gesang, Erdbewohner, Vorbereitungen zur Taufe, Staub, Salz, Seemannssonntage, Zungen, Missionare und Heimkehr.
Wie sich Hoppes Figuren immer mehr freischwimmen, zeigt ihr drittes Buch: In Paradiese, Übersee (2003) werden der Kleine Baedeker und sein Bruder, der Pauschalist, vorgestellt. Diese weltanschaulichen Antipoden stehen für zwei Weisen des Umgangs mit Wirklichkeit. Mit anderen Worten: Sie sind gar keine individuellen Charaktere, sondern echte „Typen“; diese verdanken sich eher der Mündlichkeit, dem Nacherzählen sowie dem Umgang mit Märchen und Fabeln. In dem bereits zitierten Sammelband, der ihr Gesamtwerk beleuchtet, erklärte die Autorin dazu: „Wozu ein Charakter, wenn man auch ein Typ sein kann! Das ist das Hoppe-Verfahren: Geschichten mit Typen zu bevölkern und diese durch Situationen, durch Länder, durch Zeiten, durch Konstellationen reisen zu lassen“ (Gespräch mit Per Trilcke/Jana Wolf, in: Felicitas Hoppe. Text + Kritik, 2015).
Während der Kleine Baedeker, kindlich, leichtgläubig, ohne Schulabschluss, sein Geld als Reiseführer mit Ritterkostüm verdient, indem er Touristen spielerisch mit längst verblassten Luxemburger Traditionen vertraut macht, ist sein stets zweifelnder Bruder als angestrengt forschender Wissenschaftler in der weiten Welt unterwegs. „Doch kommen beide, die Literatur nicht weniger als die Wissenschaft“, so die Verfasserin, „an die Grenzen ihrer jeweiligen Erkenntnismöglichkeiten.“
III.
Es ist keineswegs ein Zufall, dass Hoppe auch auf J. D. Salinger (1919–2010) aufmerksam macht. In Franny und Zooey, so die Autorin in „Dein Reich komme“, gehe es nicht um ein abstraktes höchstes Wesen, sondern – fast eine fundamentalistische Provokation – um den Gottessohn Jesus Christus selbst. Geplagt von der Vorstellung, seine kleine Schwester könne im Sumpf amerikanischer Campusdiskurse ihre Seele verlieren, beginnt Zooey, kein Kirchenmann, sondern Schauspieler und Künstler von Beruf, Franny eine regelrechte Predigt zu halten; er stößt dabei in die Tiefe des theologischen Raumes vor:
„Jesus wusste, dass es keine Trennung von Gott gibt (…). Wer in der Bibel wusste, dass wir das himmlische Königreich in uns tragen, IM INNERN, wohin wir nie blicken, weil wir so verflucht dumm und sentimental und phantasielos sind? Man muss eben ein SOHN Gottes sein, um dieses Zeug zu wissen.“
Tatsächlich scheint auch Hoppe eine Menge von „diesem Zeug“ zu wissen. Wie die Rezeption ihres Werkes zeigt, gibt es kaum eine Gegenwartsautorin, bei der theologische Fragen wie die nach der „Fragilität der Ordnung“ (Andreas Anter), nach „Berufung“, „Erlösung“ und „Gnade“ derart Existenz und Identität ihrer Protagonistinnen und Helden prägen: so z. B. in Johanna, ihrer 2006 erschienenen Romanversion über die französische Nationalheldin Jeanne d’Arc, deren Kontext im vorliegenden Band in „Der doppelte Martin“ erörtert wird.
Zwei Jahre später, 2008, folgte der von Kindern und Eltern gleichermaßen geliebte und vielfach wiederaufgelegte Band Iwein Löwenritter, der von einem Artusritter erzählt, der frei nach Hartmann von Aue bereit ist, Ruhm und Ehre über alles auf der Welt zu stellen. Als dieser jedoch Gefahr läuft, seine Seele in der Finsternis des Immerwaldes auf ewig zu verlieren, stellt sich der „König der Tiere“ bedingungslos an Iweins Seite – der Löwe als Typus für eine den geschichtlichen Horizont übersteigende religiöse Wahrheit.
In analoger Weise erzählt die Geschichte Der Mönch und das Minimum (DiakoniaLebensschlüssel Literatur, 1/2020, herausgegeben von Thomas Brose) davon, wie ein Mönch das Minimum dabei begleitet, „ans Licht zu gelangen“. „Der Mönch macht sich so klein wie das Minimum“, erklärt die Literaturwissenschaftlerin Claudia Stockinger dazu. „Anders gesagt: Wie der christliche Gott in Jesus von Nazareth zum Menschen geworden ist, wird der Mönch selbst zu einem Minimum und begegnet diesem auf Augenhöhe. Er hilft ihm, Hindernisse aus eigener Kraft zu überwinden und die eigene Größe wahrzunehmen“ (Religion bei Felicitas Hoppe, in: Felicitas Hoppe. Text + Kritik, 2015).
Ein Gedicht von Robert Gernhardt trägt den Titel „Immer“ und beginnt folgendermaßen: „Immer einer behender als du / Du kriechst / Er geht / Du gehst / Er läuft / Du läufst / Er fliegt / Einer immer noch behender.“ Bekanntlich ist auch die Essayistin von einem großen Spiel- und Sportsgeist erfüllt. Dieser äußert sich auch darin, dass sie für diesen Band eigens einen Text über Christophorus, den stärksten aller Nothelfer, geschrieben hat. Mehr als jede andere Heiligengestalt wird dieser fromme Hochleistungssportler dem – übrigens von dem französischen Dominikaner Henri Didon erfundenen – Motto Olympischer Spiele in herausragender Weise gerecht: Citius, altius, fortius (Schneller, höher, stärker/weiter).
Die Autorin reagiert auf die für sie typische helle und schnelle Weise, indem sie schreibt: „Was Wunder also, dass man zwar nicht in der Kirche, dafür aber bei Porsche seinen wahren Warenwert schon vor siebzig Jahren erkannte: Seit 1952 ist das Firmenmagazin Christophorus der beste Begleiter eines der schönsten, hellsten und schnellsten Autos der Welt“.
Schließlich erhält die Autorin im Jahr 2021 – u. a. nach Loriot und Robert Gernhardt, zwei großen Vorkämpfern für einen spielerischen Umgang mit Sprache – den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor. Die Preisvergabe wird von der Jury mit Hoppes „einzigartigem und vielfältigem Œuvre“ begründet. Diesem liege „auf allen Ebenen des Schreibens Humor als Haltung zur Welt und als Quelle literarischer Einbildungskraft zugrunde.“ Tatsächlich ist die immer und überall – Schach, Karten oder Eishockey – spielende Protagonisten vor allem am „Spiel als Spiel“ (Uwe Dörwald), nicht aber am Siegen interessiert.
Vielleicht hat sich Felicitas Hoppe deshalb für das Schreiben entschieden und für alle damit verbundenen Niederlagen in der komplizierten Korrespondenz zwischen Diesseits und Jenseits. Denn auf die Einsicht, in einer unvollkommenen Welt zu leben, auf die sie in „Gliedermann oder Gott“ verweist, kann auch die Hellste und Schnellste nur mit Humor reagieren, wenn sie ihren fiktiven Eishockeytrainer sagen lässt:
„Was Sportsgeist betrifft (…) war sie bemerkenswert. Na gut, was ist Sportsgeist? Ich glaube, sie war einfach verliebt in das Wort, sie war andauernd verliebt in Wörter, was mir, ehrlich gesagt, auf die Nerven ging. Andauernd sagte sie Sachen wie: Was ist Sport ohne Geist und Geist ohne Sport? Geist ist, wenn du den Mund hältst. Und Sport ist, wenn du jetzt einfach mal deine Kufen polierst, die Schuhe anziehst und zusiehst, dass du warm wirst und aufs Eis kommst.“
Sind die Leser erst einmal mit Hoppe warm geworden, müssen sie zwar den Mund nicht halten, können am Ende aber begreifen, wie man Niederlagen in Siege verwandelt. Spätestens „Die Weihnachtsgeschichte“ erinnert nämlich daran, dass die Krippe, an der wir zweifelnd oder staunend stehen, jedes Jahr verlässlich Auskunft darüber gibt, dass das Allergrößte als Allerkleinstes erscheint – oder mit FH: Dass das Minimum in der Regel am Ende das Maximum ist.
I. Das aufgespannte Ohr Gottes
Ich komme aus einer katholischen Familie von Tag- und Nachtträumern, von schlesischen Vielrednern auf der Flucht, die auch ihre Träume einander nicht vorenthielten; Träume, von denen ich bis heute nicht weiß, ob sie wahr oder erfunden waren, sofern man überhaupt von erfundenen Träumen sprechen kann. Denn wo, wenn nicht im Traum, sind wir der Wahrheit am nächsten?
Aber es gab auch Momente der Gegenbewegung, der Selbstverteidigung und des Selbstschutzes, die darin bestanden, das Erzählte zurückzuweisen oder gelegentlich das Zuhören zu verweigern: „Nicht beim Frühstück!“, hieß es dann, oder: „Nicht jetzt, lieber später.“ Wohl wissend, dass es beim Erzählen eines Traumes kein Später gibt, weil Träume, sofern man sie nicht durch sofortiges Erzählen befestigt, sich bekanntlich in Sekundenschnelle ins nicht Erzählbare hin auflösen.
Der Wunsch, sich trotzdem zu offenbaren, ist so natürlich wie zweischneidig: ein Hin- und Hergerissensein zwischen einer Preisgabe, von der man sich Erleichterung oder Aufmerksamkeit erhofft, und der Wahrung eines Geheimnisses, das man lieber für sich behielte. Warum erzählen wir trotzdem? Wer oder was drängt uns dazu, unsere Geschichten unter die Leute zu bringen, und wer profitiert davon, wenn wir es tun? Und: Wie ist der Raum unseres Sprechens und unserer scheinbaren Selbstoffenbarung beschaffen? Wohin stellen wir unsere Geschichten?
Natürlich ist es ein Unterschied, ob wir in der Küche oder auf dem Podium sprechen, privat oder öffentlich. Wenn wir „privat“ bleiben wollen, heißt das nicht, dass wir etwas für uns behalten, weil wir es zu verbergen hätten, sondern dass wir von einem Sprechen in geschützten Räumen träumen. Diese Räume, falls es sie jemals gab, sind inzwischen ziemlich selten geworden, denn wir sind längst im Begriff, selbst die Illusion davon abzuschaffen. Sprechen, allem voran das unermüdliche Sprechen über uns selbst, ist das Gebot der Stunde: Wir sprechen mit Händen und Füßen und wie uns der Schnabel gewachsen ist.
Allerdings sprechen wir dabei meistens gar nicht über uns selbst, sondern folgen fest einstudierten Rollenmustern, die wir selten hinterfragen und kaum variieren. Weil es so schwer ist, wirklich von sich zu sprechen, ahmen wir Formen des Sprechens nach. Wir neigen dazu, unsere Person mit einer Rolle zu verwechseln, weil uns die Rolle leichter erscheint als die eigene Person. Von einem ernsthaften Interesse am anderen ganz zu schweigen: Ehrliches Interesse setzt Zuneigung voraus und eine Neugier, die mit Voyeurismus nichts zu tun hat. Als Teilnehmer eines zwanghaften Wettbewerbs, dabei unermüdlich auf Belohnung und Bestätigung aus, erzählen wir nur selten das, was wir wirklich wollen, sondern allem voran das, was andere von uns hören möchten.
Tückischerweise wird unser Selbstbekenntnis nie mit Erleichterung belohnt, von Absolution ganz zu schweigen. Absolution nämlich hieße, dass wir kurzfristig entlastet verstummen dürften. Doch die Medien sind nicht weniger unersättlich als die alten Märchendrachen unserer Kindheit, die bekanntlich unablässig auf den Verzehr von frischen Jungfrauen aus sind. Der Zustand der Sättigung und der Erlösung ist ihnen vollkommen unbekannt. Je mehr sie fressen, desto hungriger werden sie. Bleibt die Lieferung aus, bricht das System zusammen, und wehe einer Gesellschaft, die sich entschlösse, ihren Drachen die Geschäftsbeziehung aufzukündigen.
Um einem Missverständnis vorzubeugen: Dies ist keine Polemik gegen die Medien, kein Aufruf, womöglich öffentlich zu verstummen, von perverser Geheimhaltung oder Zurückhaltung von Informationen gar nicht zu reden. Und erst recht kein Plädoyer gegen das Sprechen selbst, sondern nichts als der Versuch, einen entscheidenden Unterschied zu bezeichnen: zwischen verkäuflich verwaltetem Sprechen und dem mehr als schwierigen Unterfangen, Dinge im wahrsten Sinn des Wortes zur Sprache zu bringen.
Meine erste Beichte legte ich im Alter von fünf Jahren ab, kurz bevor ich zur ersten so genannten Heiligen Kommunion ging, einer Frühkommunion, wie es damals hieß, der ich nicht im Geringsten gewachsen war. Doch die Möglichkeit einer persönlichen Beichte erschien mir geheimnis- und verheißungsvoll und der Beichtstuhl als ein Ort, an dem alles gesagt, aber nichts verraten wurde: das aufgespannte Ohr Gottes