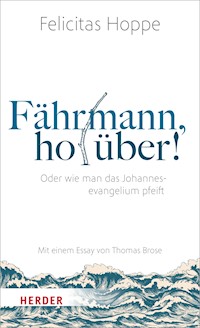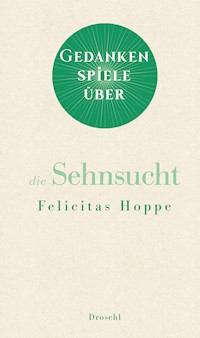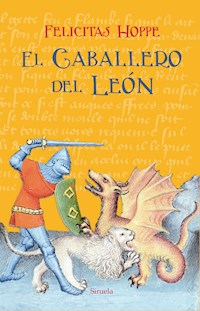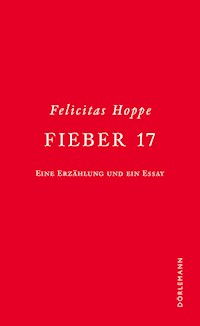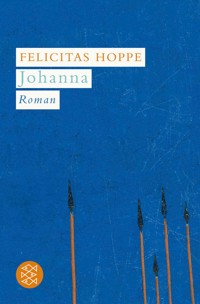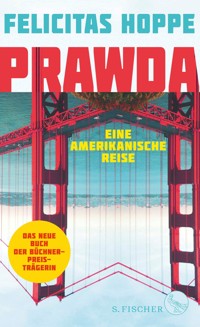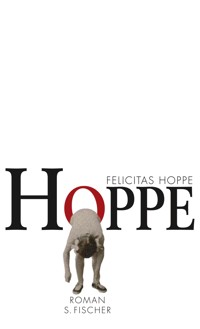
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Felicitas Hoppe zählt zu den klügsten Gegenwartsautoren. ›Hoppe‹ ist der Beweis.« Christoph Schröder, Journal Frankfurt ›Hoppe‹ ist keine Autobiographie, sondern Hoppes Traumbiographie, in der Hoppe von einer anderen Hoppe erzählt: von einer kanadischen Kindheit auf dünnem Eis, von einer australischen Jugend kurz vor der Wüste, von Reisen über das Meer und von einer Flucht nach Amerika. Hoppes Lebens- und Reisebericht wird zum tragikomischen Künstlerroman, mit dem sie uns durch die Welt und von dort aus wieder zurück in die deutsche Provinz führt, wo ihre Wunschfamilie immer noch auf sie wartet. Eine Geschichte über vergebliche Wünsche, gescheiterte Hochzeiten und halbierte Karrieren. Und über das unbestreitbare Glück, ein Kind des Rattenfängers aus Hameln zu sein. "Das ist ein Anlass für mich, vor Freude einen Flickflack zu schlagen. Das tut Hoppe mit ihrer Sprache auch. " Denis Scheck
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Felicitas Hoppe
Hoppe
Roman
Fischer e-books
Für Familienmitglieder gilt das gesprochene Wort!
0.
Felicitas Hoppe, *22. 12. 1960 in Hameln, ist eine deutsche Schriftstellerin.
Wikipedia
1.Die kanadischen Jahre
Weltweit, egal welcher Zeitung, hat Hoppe immer dieselbe Geschichte erzählt: wie sie als Ratte mit Schnurrbart und Schwanz versehen, Wurst in der Linken, Brot in der Rechten, den Marktplatz ihrer Heimatstadt Hameln betritt, um sich im Freilichttheater unter der Führung des Rattenfängers vor Touristen aus aller Welt ein Taschengeld zu verdienen. Wie sie das eben Verdiente sofort auf den Kopf haut, Blumen für ihre Mutter (»die Gastgeberkönigin«) und ein Päckchen Zigaretten für ihren Vater (»den Erbauer des ersten Kaspertheaters«) kauft, um danach mit dem verbliebenen Rest ihre vier Geschwister zu einem Ausflug ins Miramare zu überreden, eine Hamelner Eisdiele, »die sommers floriert und sich winters, wenn sich die Italiener saisonbedingt nach Süden verziehen, in einen Ausstellungsraum für Pelze verwandelt«. Bis Hoppe sich dreißig Jahre später »endlich erhebt«, um ein Schiff von Hamburg nach Hamburg zu besteigen und die Welt mit eigenen Augen zu sehen: »Ein Ausflug, nichts weiter, in ein paar Tagen bin ich zurück, sitze wieder am Tisch, der zweite Esser von rechts.« (Pigafetta,1999)
Sowenig beglaubigt ist, dass Hoppe jene vielzitierte Reise um die Welt auf einem Containerfrachtschiff tatsächlich persönlich unternahm, ist bekannt, dass sie bereits als Kind mehrfach die Weltmeere befuhr. Allerdings nicht als zweiter Esser von rechts, sondern als einzige Tochter eines Patentagenten, der das deutsche Kaspertheater vermutlich niemals von innen sah. Die Hamelner Kindheit ist reine Erfindung. Das Tagebuch des einzigen Vaters seines einzigen Kindes, akribische Auflistung äußerer Ereignisse unter entschiedener Weglassung der inneren, gibt Aufschluss über Arbeitsaufenthalte auf höchst unterschiedlichen Kontinenten. Dass die Tochter (Felicitas) dabei fast zwanzig Jahre lang mit von der Partie war, findet in seinen Aufzeichnungen vor allem dann Erwähnung, wenn es um Ausgaben geht, angefangen bei unnötigen Extras im Reiseproviant (»Nüsse und Schokolade«) über kindgerechte Reiselektüre (»Schiffsbibliotheken sind ein Desaster!«) und die Erfüllung »vollkommen überflüssiger Wünsche« während zu kurzer Landgänge (»Wozu plötzlich ein Fernrohr?«) bis hin zu der Last, nach der Ankunft in wechselnden Wohnungen und Häusern ein Kinderzimmer einzurichten. (»Hausaufgaben kann sie auch am Küchentisch erledigen.«) »Man will hier eine Art Schulgeld«, notiert missmutig der Agent in Übersee oder: »Felicitas braucht einen Ranzen. Optische Täuschung. Schließlich hat sie einen Rucksack, in den praktisch alles hineinpasst.« Und er fährt fort: »Heute Abend wieder ein weinendes Kind. Lästig. Felicitas verweigert den Schulbesuch, man verspottet sie, sagt sie, wegen des Rucksacks. Kinderklage. Ein Lederranzen kommt gar nicht in Frage.« Es folgen Auflistungen alltäglicher Ausgaben für Kleidungsstücke: »Gott sei Dank wächst sie langsam, der Mantel, an den Ärmeln ausgelassen, hält durchaus noch einen zweiten Winter.«
Es ist weder der fehlende Schreibtisch noch die Schokolade, auch nicht das Fernrohr, sondern der Rucksack, der zu Hoppes Erkennungsmerkmal werden wird, zu ihrer höchst persönlichen Rüstung. Bis zum Schluss ihrer Laufbahn (in rund vierzig Jahren weit über fünftausend Auftritte in über zweihundert Ländern in unterschiedlichen Kostümen und Rollen) ist kein einziger Auftritt ohne Rucksack vermerkt. Bis heute unvergessen ein frühes Eishockeyturnier in Edmonton, von dessen Teilnahme die damals zwölfjährige und überaus hoffnungsvolle Hoppe (»Superpuck«) ausgeschlossen wird, als sie sich beim entscheidenden Endspiel so unvermutet wie beharrlich weigert, auf dem Eis ihren Rucksack abzulegen. Sieben Jahre später die Verweigerung der Aufnahme in die Dirigentenklasse eines Konservatoriums in Adelaide: »Man dirigiert bei uns immer noch mit den Armen, nicht mit dem Rücken«, so die Begründung des Vorsitzenden der Auswahlkommission Melville Drugs, dem gegenüber Hoppe behauptet haben soll, sie brauche den Rucksack als Gegengewicht, da sie sonst von der Musik »weggetragen« werde. Und, last but not least, zwei Jahrzehnte später, Hoppes legendärer Auftritt auf einem Podium in Tokio, als sie aus dem Stegreif einen knapp zweistündigen Vortrag zum Thema Rucksack, Buckel, Fetisch hält. Die Presse spekuliert über den Inhalt des mittlerweile angewachsenen Gepäckstücks: »Reine Leere. Verbergungsstrategien. Warum macht sie nicht einfach den Reißverschluss auf und lässt uns einen Blick ins Innere werfen?«
Hoppe selbst, eine ausgewiesene Meisterin praktischen Packens, wusste genau, was sich in ihrem Buckel befand, und machte auch nie ein Geheimnis daraus: »Taktstock, Schläger, Lippenstift.« Und, so ist man versucht zu ergänzen, vier deutsche Geschwister, die das Einzelkind auf seinen Schiffsreisen erfand und denen sie mit einer bis heute unveröffentlichten Erzählung (Fünf zur See) ein eigensinniges Denkmal gesetzt hat: »Wir liebten uns, weil wir uns nicht ausweichen konnten, weil wir darauf angewiesen waren, einander ständig zu unterhalten. Das Wetter war schlecht, die Mannschaften rau, das Essen miserabel, die Kapitäne Analphabeten. Abends saßen wir in unserer Kabine, ich seekrank, sie aufrecht und unanfechtbar. Gegen das Wetter hielten wir uns an Erinnerungen fest, wobei sie mehr Halt bewiesen als ich. Im Gegensatz zu mir waren sie seetauglich und unanfechtbar.«
Während der Vater Listen und Abrechnungen schreibt, widmet sich Felicitas ganz der Erfindung ihrer vier Geschwister, um sich die Zeit an Bord zu vertreiben und um ein für alle Mal in der Mitte zu sein, denn »die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten«. Warm ist es folglich nur in der Mitte, »erzogen, beschützt und verteidigt von oben, geliebt und verstanden von unten«. Es sind Fünf zur See, die das Werk des Einzelkindes von Anfang an unterirdisch bevölkern. Je länger Hoppe schreibt, umso mehr gewinnen die Geschwister Gestalt, gleich in welchem Kostüm Hoppe sie auftreten lässt. Der faktische Vater des faktischen Einzelkindes dagegen verliert sich im Vagen: »Er mietete Häuser an, die er niemals bewohnte. Ich saß mutterseelenallein auf hohen Veranden in Schaukelstühlen, verhandelte mit Putzfrauen, Gärtnern und vorübergehenden Hauslehrern. Meinen Erfindervater habe ich nie gesehen.«
Das dürfte, in Abgleichung mit dem Tagebuch ihres Vaters, kaum der Wahrheit entsprechen. Die Mittel des reisenden Patentagenten waren begrenzt und ließen eine Haushaltsführung oben beschriebener Art nicht zu. Hoppes Unterschlagung überprüfbarer Fakten dient einzig der literarischen Ausformung ausufernder Phantasien, wie sie ihr gesamtes Werk prägen. Während der wirkliche Vater schrumpft, wächst der Erbauer des ersten Kaspertheaters und neben ihm die Gastgeberkönigin, die Sahne über Fruchtschalen und Quarkspeisen schlägt: »Was immer sie auftischte, alles machte sie schmackhaft.«
Über Hoppes leibliche Mutter wissen wir wenig, aber genug, um mit Sicherheit sagen zu können, dass sie, eine erzkatholische und hochtalentierte Klavierlehrerin aus Breslau, weder Sahne schlug noch jemals auf Tournee durch Niedersachsen gegangen sein dürfte, sondern sich nach der Trennung von Hoppes Vater in umgekehrter Richtung auf den Weg durch die Welt machte und bald aufhörte, Briefe zu schreiben. Die niedersächsische Welt der Felicitas Hoppe, ihre Kindheit in der katholischen Diaspora als drittes von fünf Kindern kleinbürgerlicher, aus Schlesien vertriebener Eltern, die sie immer wieder beharrlich gegen jene andere, unberechenbare Welt ihrer wirklichen Kindheit aufruft, entpuppt sich als Kulisse unaufhörlich neuorganisierter Fluchten nach innen: »Sobald es dunkel wurde, versammelten wir uns vor dem Vorhang des ersten und einzigen Kaspertheaters in der Erwartung, dass er sich auftun würde, um uns endlich das Krokodil zu zeigen. Und um die warme Stimme unseres Vaters zu hören, die uns jeden Sonntag von vorne fragt, ob wir alle noch da sind, und die uns jeden Sonntag aufs Neue verrät, dass es das Krokodil gar nicht gibt.«
Hoppes kanadische Kinderjahre dagegen sind verbrieft, das Haus in Brantford (Ontario) »mein erster Iglu«, der Eispalast des einzigen Kindes eines »Erfindervaters«, der morgens gegen sieben das Haus verlässt und selten vor sieben zurückkommt, während Felicitas vormittags in die Schule und nachmittags, ohne Wissen des Vaters, aufs Eis geht: »Es war Wayne (gemeint ist vermutlich der kanadische Eishockeyspieler Wayne Gretzky/fh), der mich überredete mitzukommen. Er war klein, dünn wie Docht (nur eine von zahlreichen Anspielungen Hoppes auf ihr Lieblingsbuch, Carlo Collodis Pinocchio/fh), konnte ukrainische Lieder und war ein Genie, auf dem Eis auf Siege von hinten fixiert, hinter dem Tor unberechenbar.«
Vor allem hatte er echte Geschwister und eine Mutter, die kochen konnte. Hoppe ist knapp sechs und verliebt. Ihre Ausrüstung bettelt sie sich Stück für Stück zusammen, erst die Handschuhe (secondhand), dann den Schläger (Leihgabe gegen Taschengeld), nach dem ersten Sturz (eine Narbe unter dem rechten Auge) bastelt ihr Vater, der bis dahin von ihren Umtrieben nichts gewusst haben will, »zähneknirschend das erste Gitter, damit sie nicht endet wie Sawchuk« (gemeint ist vermutlich Terry Sawchuk/fh). Der Rest interessierte ihn wenig: »Während er Patente für Bell Telephone Canada prüfte, erfand ich den Leuchtpuck. Denn mein Vater bestand darauf, alles selbst zu erfinden: ›Nimm nie in die Hand, was du nicht selbst erfunden hast.‹«
Ein Text mit dem Titel Meine Sonntagserfindungen legt ehrgeizig Zeugnis davon ab, dass Hoppe die Anweisungen ihres Vaters todernst nahm. Sie notiert in alphabetischer Reihenfolge alles, was ihr persönlich unentbehrlich scheint, und führt damit gleichzeitig Buch über private Beschwerden und Sehnsüchte. Unter A (wie Asthma) ein Gerät für »notfallbedingte Frischluftzufuhr«, ohne das sie in späteren Jahren kein Flugzeug besteigt (die Angst vor dem Fliegen ist ein Erbe ihres Vaters, der, nach einem Flugzeugabsturz in den fünfziger Jahren, für den Rest seines Lebens ausschließlich per Schiff reiste), unter B (wie Bett) die »kanadische Wärmflasche«, unter C (wie Canada) eine »Landkarte für Erstbesucher« mit dem Vermerk: »Für den Fall, dass sie doch noch kommen.« Unter D einen Dirigentenstab, der bei Lichtausfall im Orchestergraben im Dunkeln leuchtet. Und unter H Hoppes legendäre Hockeyhandschuhe, die, verfeinert und weiterentwickelt, in späteren Jahren eine Schweizer Damenmannschaft zum Erfolg führen werden. Unerreichbar in der Reihe Hoppe’scher Sonntagserfindungen bleibt bis heute der legendäre Leuchtpuck, dessen offizielle Erfindung Eberhard von der Mark wegen Hoppes unterlassener Anmeldung des Patents fünfzehn Jahre später (1983) für sich in Anspruch nehmen darf. (Eine einfache Hartgummischeibe, die, mit Leuchtdioden versehen, beim Schlag mehrere Sekunden lang ein blinkendes rotes Lichtsignal abgibt und in Europa unter der Nummer 0273944 patentiert ist.)
Hoppe selbst hat sich, soweit bekannt, niemals öffentlich zu diesem Fall von Patentdiebstahl geäußert, was darauf schließen lässt, dass sie sich mit ihrem Vater über Angelegenheiten solcher Art nicht besprach. Einzig ein später Brief (abgelegt unter der Rubrik Briefe an vier deutsche Geschwister) beweist, dass ihr die Angelegenheit nachging: »Ich komme einfach nicht drüber weg, dass man mich, wenn nicht um eine Erfindung, so doch um eine Idee gebracht hat, was weit schlimmer ist. Es missfällt mir, den Leuchtpuck in Umlauf zu sehen, ohne dass jemand weiß, wer tatsächlich Licht in dieses unmögliche Spiel gebracht hat. Lange Nächte auf Eis, ein dunkles Hin und Her von Bewegungen und Finten. Zeit meines Lebens habe ich davon geträumt, Goaly zu werden, König im Tor: Abwehren, Halten, Gewinnen. Stattdessen bin ich ein mittelmäßiger Stürmer geblieben, liege nachts im Bett und träume vom Hamelner Marktplatz, auf dem wir noch eine Zukunft hatten. Oder immerhin eine Gegenwart. Vergangenheiten ertrage ich schlecht.«
So unklar bleibt, von welchen Vergangenheiten Hoppe hier spricht, so deutlich ihr Missmut über das, was sie in ihrem Werk immer wieder als »die lästige Verwaltung der Zeiten« bezeichnet. Dass es hier um mehr als ein Lernproblem geht, beweist wiederum eine Stelle aus Fünf zur See: »Die Erde ist rund, die Zeit wird nicht lang. Also könnten wir endlos so weitermachen, weiterreisen, weiterleben und weiterschlafen. Trotzdem stehen wir auf, nicht weil die Sonne es will, sondern weil die Zeit es verlangt. Alle sprechen davon, dass die Zeit es verlangt, mein Vater, der Schulbusfahrer, der Lehrer. Du liebe Zeit. Allein die Tatsache, dass meine vier Geschwister noch schlafen, während ich sie erfinde, dass sie träumen, während ich ihnen Briefe schreibe, dass sie aufwachen, während ich mich ins Bett lege, dass ich im Bett liegen muss, wenn sie aufstehen, sagt mir, dass etwas nicht stimmt mit der lieben Zeit, dass es eine geographische Ordnung gibt, mit der ich mich niemals anfreunden werde. Ich bin und bleibe ein Gegner der Zeitverschiebung.« Dazu in den Sonntagserfindungen unter U der Hinweis auf ein »Gerät zum Zweck zeitgleicher Verständigung: Uhr, die auch bei Tageslicht leuchtet«, und unter Z wie Zeit der Entwurf eines »globalen Kalenders«, denn »wohin immer man die Inseln auf der Karte verschiebt, es gibt trotzdem nur ein Silvesterfest«.
Hoppes Kinderalltag bleibt von melancholischen Spekulationen solcher Art allerdings unberührt. Sie ist weit weniger unglücklich, als sie vorgibt zu sein. Der Ehrgeiz ihrer frühen Texte steht, das gilt auch für ihr späteres Werk, kaum im Verhältnis zu ihrem wirklichen Leben. Die frühen Jahre in Kanada sind faktisch beherrscht von ihrer Freundschaft zu Wayne, in dessen Familie sie, wie zahlreiche Fotos beweisen, ein und aus ging und ein so gerngesehener wie gut bewirteter Gast war. Ms Gretzky war großzügig in Sachen Sahne, und Hoppes Vater dürfte das Fehlen seiner Tochter am Mittags- oder Abendbrottisch kaum aufgefallen sein, waren sie doch seit ihrer Ankunft in Brantford schnell übereingekommen, einander weitgehend in Ruhe zu lassen, wie eine nachgelassene Sammlung von Zetteln beweist. Man verständigte sich über unaufwendige schriftliche Zeichen: »Komme um sieben.«, »Bleibe bis sechs.«, »Bin auf dem Eis.«, »Essen im Kühlschrank.«, »Nicht ins Labor gehen – Dämpfe!«. Oder: »Elternsprechtag fällt aus.«, »Umso besser.«. Und: »Mütze aufsetzen.«, »Briefkasten leeren!«, »Versuche nachher, ins Stadion zu kommen, weiß aber noch nicht, ob ich’s einrichten kann: Patentkonferenz.«
Selten genug, dass der Vater es einrichten kann, meistens bleibt er abends zu Hause, in seinem privaten Labor, und macht erst kurz nach Mitternacht »zwei bis drei Schritte, bleibt lauschend an meiner Zimmertür stehen und bildet sich ein, mich atmen zu hören. Ich halte die Luft an, krieche, die Uhr auf dem Herzen, unter die Decke, es tickt und klopft und leuchtet im Dunkeln. Im Licht der Uhr schreibe ich Briefe aus Übersee, in denen ich meine Geschwister frage, wie es ihnen und unseren Eltern geht, was die Sahne macht und das Miramare und wann sie mich endlich besuchen kommen.« Morgens auf dem Tisch die Notiz: »Brauche Briefmarken (die mit dem Schiffsmotiv!).«
Die Tage dagegen sind sportlich gefüllt. Wayne, ganz Praktiker, schreibt weder Briefe noch Zettel, springt stattdessen im Garten hinter dem Haus seiner Eltern, den sein Vater zu Trainingszwecken jeden Winter mit Hilfe des Rasensprengers gleichmäßig flutet und zum häuslichen Eisring einfrieren lässt (»Warum im Park frieren, wenn es im eigenen Garten kalt genug ist!«), zusammen mit seinen Geschwistern (»die furchtlosen Vier«) über leere Waschmittelbehälter, Bierdosen und umgestürzte Picknicktische, um den Puck im Flug zu nehmen und dahin zu bringen, wohin er gehört: ins Tor.
Die kaum sechsjährige Hoppe, fasziniert vom kanadischen Zirkus eiskalter Ritterspiele, ist regelmäßig mit von der Partie, um immer wieder von vorn zu verlieren. Trotzdem gibt sie nicht auf. Noch Jahrzehnte später sind es nicht die Parolen ihres Erfindervaters, sondern die ihres »ersten Trainers«, Walter Gretzky, die sie auf ihre Fahnen schreibt und mit denen sie noch Jahre später in einer Kompositionsklasse in Adelaide Eindruck zu schinden versucht, als sie in einem Vortrag zum Thema Schuberts Wanderjahre ein musikalisches Verfahren mit einem sportlichen Leitmotiv Walters veranschaulicht: »Try to skate where the puck is going, not to where it is coming from!« (»Aufs Ende hin, nicht vom Anfang her spielen!«) Denn: »Die Steine, selbst so schwer sie sind, sie wandern mit dem Mond herein und wollen immer schneller sein.« (Hier meint Hoppe offenbar Die schöne Müllerin./fh)
Musik ist in Gretzkys überflutetem Garten allerdings kein Thema, der Mond bestenfalls eine »Naturlampe«, die das Familienstadion winters spärlich ausleuchtet. In »Wally’s Coliseum«, so der Ring im Familienjargon, trainiert Walter nach Feierabend und an Wochenenden so unermüdlich wie gnadenlos nicht nur die eigenen, sondern sämtliche Kinder der Nachbarschaft, die »wenigstens einen Ansatz von Eignung und Leidenschaft« zeigen. Mit Erfolg, zumindest was Wayne betrifft, »alles geht vor ihm ins Knie, sogar der Picknicktisch«, wie Felicitas feststellt, deren Bewunderung für »meinen Zwilling« (Wayne ist, fast auf den Tag genau, einen Monat jünger als sie) keine Grenzen kennt.
Weniger Ehrgeiz als Eifersucht ist im Spiel, wenn sich die »Sonntagsverliererin« nach Feierabend auf ein anderes Feld verlegt, von dem sie genau weiß, dass Wayne, »ein schweigsamer Esser«, hier nicht mithalten kann. Sie schneidet auf und erfindet nach dem Training an Gretzkys Familientisch phantastische Geschichten: Von einer fernen Familie in der deutschen Provinz, von Geschwistern, die aus dem Stegreif vierstimmig singen, achthändig Klavier spielen (»schneller als Wayne übers Eis läuft«), und denen sie angeblich täglich Briefe schreibt. Von einer Mutter, die leichthändig Pucks (vermutlich Buletten) in Pfannen wirft, von einem Vater, der Kaspertheater baut, und von einem zweiten (»Entführervater«), der angeblich nicht der eigene ist, sondern sie vor Jahren »mit einem Schmetterlingsnetz vom Schulweg wegfing« und »auf ein Schiff nach Ontario verschleppte, um nicht länger einsam zu sein«.
Bereits hier wird Hoppes früher Hang zum Drama überdeutlich. Waynes Mutter Phyllis, mit Kindernöten und Ungereimtheiten von Grund auf vertraut, verzichtet auf faktische Korrekturen und pariert Felicitas’ Geschichten so instinktsicher wie tröstlich mit einer folgenreichen Neuschöpfung der Geschichte vom Rattenfänger: »Dann kommst du also aus Hameln und bist tatsächlich ein Glückskind«, sagte sie (und füllte die Teller), »aus der Stadt des berühmten Rattenfängers, der alle Ratten der Welt im Schlaf erlegt, jede ein Treffer, und den keiner für seine Patente bezahlt, weshalb er beschließt, die Stadt zu verlassen. Klar, dass er nur die Besten mitnimmt und das sind, natürlich, die Kinder. Ein großer Tag, das könnt ihr mir glauben (an dieser Stelle hebt Phyllis enthusiastisch die Stimme), kein Kind steht beiseite, alles steht Schlange vor dem großen Berg, in dem sie wenig später für immer verschwinden. Aber (Phyllis füllt nach) sie sind natürlich gar nicht verschwunden, sondern unterirdisch weitergewandert, bis sie am anderen Ende des Berges ein großes und strahlendes Licht sehen. Und, Kinder!, was soll ich euch sagen: Da stehen sie plötzlich in Kanada, auf frisch poliertem Eis, lauter glänzende Gesichter, gleich um die Ecke hinter unserem Haus. Damit hatte natürlich keiner gerechnet. Wie groß die Freude war, könnt ihr euch denken. Und das alles haben sie dem Rattenfänger zu verdanken. Denn hätte der sie nicht mitgenommen, säßen sie bis heute in Hameln und wüssten nichts mit sich anzufangen.«
Es ist also Phyllis Gretzky gewesen, die den Rattenfänger von Hameln erfand und Hoppe, die die Geschichte nicht kannte, damit das passende Stichwort gab, um zum Vorbild für jene über alles geliebte Hamelner Gastgeberkönigin zu werden, von der Hoppe nur träumt und die sie, im Gegensatz zu Walter, der unaufhörlich Sieg und Erfolge predigte, wohlwollend darauf aufmerksam machte, »dass das kanadische Eis dicker ist als das deutsche, auch für Anfänger leicht befahrbar« und dass »Ausrutschen nicht gleich Einbrechen ist«, während Walters unbarmherzige Devise lautete: »Let them always feel the uncertain ground they are skating.« (»Wir spielen alle auf dünnem Eis!«) Aber weil Phyllis mehr Mutter als Erzieherin war, »krönte sie selbst die schrecklichsten Niederlagen ausdrücklich mit Sahne, und dafür liebte ich sie«, schreibt Hoppe Jahrzehnte später in einem Entwurf zu einer ersten Autobiographie, den sie später entschieden und mit einem für sie typischen Kommentar verwirft: »Als Leben einfach zu kurz.«
Der Rattenfänger allerdings ist seit jenem Winterabend in Gretzkys Küche unwiderruflich in der Welt und bleibt Hoppes so treuer wie vertrackter Begleiter, literarischer Basso continuo über mehr als vier Jahrzehnte. Kaum ein Text im Werk, in dem, offen oder verdeckt, »der verdächtige Spielmann« keine Erwähnung findet. Ob Hoppe die Glocken am berühmten Hamelner Hochzeitshaus, über die sie in Ontario so kindlich wie enthusiastisch schreibt: »Zu ihrem Klang würde ich sogar Wayne heiraten, obwohl ich genau weiß, dass er mich niemals heiraten wird«, jemals mit eigenen Ohren gehört hat, ist bis heute ungeklärt. Zwar ist ihr Werk vollgestopft mit Anspielungen auf ihre vermeintliche Geburtsstadt, die Beschreibungen der Stadt und ihrer Umgebung aber bleiben durchgehend allgemein und vage. An keiner Stelle lässt sich ausmachen, ob sie tatsächlich auf eigener Erfahrung beruhen oder nicht doch nur angelesen sind.
Man tappt hier vor allem deshalb im Dunkeln, weil der Charakter des Angelesenen ein insgesamt prägendes Element in Hoppes Werk ist, das auch in jenen Arbeiten deutlich hervortritt, in denen sie über Orte, Länder und Gegenden schreibt, die sie nicht nur nachweislich selbst besucht, sondern in denen sie sogar ganze Jahre ihres Lebens verbracht hat. Und weil sie die Frage nach Authentizität ständig selbst thematisiert und dabei in Leben wie Werk permanent versucht, aus der Not ihrer Ignoranz eine literarische Tugend zu machen.
Hoppes (durch zahlreiche Schulzeugnisse belegte) äußerst mangelhafte Kenntnisse in Geographie und Landeskunde, die sie später durch »verzweifeltes Kartenstudium« und eine stattliche Sammlung verschiedener Weltalmanache aufzubessern versuchte, sind nicht Legende, sondern Fakt, und der in zahlreichen Interviews beharrlich immer wieder auftauchende Hinweis auf ihr literarisches Verfahren »ehrlicher Erfindung« ist weniger kokettes Versteckspiel als schlecht getarnte Verlegenheit. Ständig wirft sie Köder aus, um sie kurz darauf wieder einzuholen, bevor der Fisch seinen Haken findet. Ein Verfahren, das ihren Lesern bis heute abwechselnd Freude und Ärger bereitet: »Man war drinnen und bleibt doch draußen«, bemerkt schon früh ein verprellter Kollege.
Man gäbe ihm recht, würde man nicht auf den zweiten Blick sofort erkennen, dass Hoppes Werk die Unterscheidung von drinnen und draußen weder kennt noch sucht, dass der schroffe Ausschluss nicht kalkuliert, weder Masche noch Trick, sondern ehrliche Selbstbeschreibung ist. Hoppes vermeintliche Raffinesse ist alles andere als raffiniert, sondern unfreiwillig bekenntnishaft. Wie ihr Werk deutlich, gelegentlich fast aufdringlich vorführt, war die Autorin weder an Orten noch an Politik interessiert, sondern einzig auf Stimulanz aus: »Ich habe von Verhältnissen keine Ahnung«, erklärt sie in einem oft zitierten Interview, in dem sie unzweifelhaft deutlich macht, dass es nicht Orte, sondern bestenfalls deren Geschichten sind, die sie anziehen, »weshalb ich mich bis heute schuldig fühle, sobald irgendwer von mir wissen will, wo was liegt und was wie wo wirklich ist«.
Und doch ist es dieselbe Autorin, die einen der mit Abstand schönsten Texte über Hameln und das die Stadt umgebende Weserbergland geschrieben hat. In ihrer Erzählung Ich stehe ratlos vor dem Hamelner Hochzeitshaus besingt sie eine Landschaft, die sie womöglich weder gekannt noch jemals persönlich bewandert hat und in deren Beschreibung sie dennoch eine Kindheit und eine Familie heraufbeschwört, von der ihre Bewohner, wie sie selbst, nur träumen:
»Der Raps steht leuchtend hoch in unserer Gegend, ein Schock in Gelb, die Hügel, schön und eigensinnig, sind viel zu sanft, um eine bedrohliche Landschaft zu bilden. Keine Berge, kein Meer. Kein Eis, keine Wüste. Weder Schakale noch Araber. Kein schroffes Gericht, kein Urteil. Ich liebe, ich verehre die mittlere Landschaft, den Kompromiss, die Versöhnung, die leise Verabredung, sich unbemerkt ganz nebenbei zu treffen (für den Fall, dass es sich wie von selbst ergibt), auf ein Getränk, das nicht auf Eis liegen muss, um über die Zunge zu gehen. Jeder weiß, dass es diese Landschaft nicht gibt, aber wir alle träumen davon, meine vier Geschwister und ich, deren Namen an den Glocken des Hochzeitshauses hängen, von denen mein kanadischer Zwilling nichts weiß, weil er von Musik keine Ahnung hat, weshalb ich ihn niemals heiraten werde.«
Hochzeiten durchziehen das Werk Hoppes (die selbst angeblich mindestens dreimal verheiratet war) ebenso wie der Rattenfänger. In ihrem Debüt (Picknick der Friseure, 1996) beschreibt sie in der Erzählung Die Hochzeit eine ins Groteske verzerrte Hochzeitsfeier, in der der Sohn des die Feier ausrichtenden Gastwirts sich haltlos in die Braut verliebt und im Affekt den Hochzeitstrompeter erschlägt, in Paradiese, Übersee (2003) ein Zimmermädchen, das von den Hochzeitsreisenden daran gehindert wird, »ordnungsgemäß« seiner Arbeit nachzugehen, »weil sie (die Hochzeitsreisenden/fh) befürchten, schon durch die geringste Öffnung nach draußen einander wieder abhandenzukommen«. Und in Verbrecher und Versager (2004) ist andauernd von Hochzeitsflüchtlingen die Rede, deren Verlobte hinter deutschen Hecken sitzen und darauf warten, dass ihre Liebhaber, allesamt unterwegs auf den Weltmeeren, eines Tages doch noch zurückkommen.
In ihrer Erzählung Fakire und Flötisten (2001) schließlich, in der Hoppe die Reise einer unbekannten Protagonistin nach Indien schildert (Hoppe selbst unternahm in den Jahren zwischen 2000 und 2003 zwei große Indienreisen), wird ein am Flughafen unerwartet gegen den eigenen eingetauschter Koffer zum Objekt der Begierde, wenn Hoppe im Text ausführt: »Ich, sage ich laut und vernehmlich, bin der alleinige Finder, für eine Nacht gehört mir jetzt alles. Doch ich bin ganz ohne Gier, ohne Hast, eher gleicht mein Tun dem Gebet, einer Geste der Sanftmut, der Geduld, der reinen Erwartungslosigkeit. Denn in Wahrheit habe ich alle Hoffnung aufgegeben. Trotzdem hob ich den Koffer, als wäre dies ein Geschenk, meine Hochzeitsnacht, mit beiden Armen vor mich aufs Bett. Denn muss man schon heiraten, dann wohl nur so: Langes Betrachten des Gegenstandes, ratlos sowohl als auch voller Sehnsucht. Ich streichelte ihn sogar, meinen Koffer, betrachte das helle Verführungsleder, dann ließ ich die zierlichen Schlösser aufschnappen, das linke, das rechte, und wider Erwarten öffnet sich jetzt mein Koffer sofort. Kein Widerstand, kein Geplänkel, kein Zickzack, ganz ohne Vorspiel klappte der Deckel hoch, und ich stellte fest, dass ich einen phantastischen Tausch gemacht hatte. Vor mir im Koffer lag ein handliches Nagelbrett, nagelneu und zusammenklappbar. (…) Der Mechanismus beglückte mich, er funktionierte vorzüglich. Herrlich klappt sich das Brett vor mir aus und ruft mir zu: Leg dich hin, leg dich auf mich, und zeige mir, was du kannst, aber zeig es mir gleich, noch in dieser Nacht.«
Hoppes Werk, bis heute von der Kritik so hartnäckig wie wohlwollend in den Bereich »traumlogischer Reiseliteratur« verwiesen, speist sich nicht aus Träumen, sondern aus der Realität uneingelöster Versprechen und verlorener Wetten. Es pendelt zwischen geträumter Verheißung und erlebter Enttäuschung und ist nicht mehr und nicht weniger als ein getreues Abbild dessen, was wir auf jedem Hochzeitsbild sehen: Ahnungslos auf eine ungewisse Zukunft eingeschworene Paare.
Es gibt, tatsächlich, ein Urbild dazu, das Hoppes Erfindervater und ihre Mutter bei der Hochzeitsfeier in Breslau zeigt: Die Braut hält mit der ausgestreckten Rechten aufdringlich strahlend ein Glas in die Kamera, während links neben ihr, mehr Statist als Bräutigam, ein Ehemann (Felicitas’ Vater) steht. Das Paar wird flankiert von zwei wie nachträglich ins Bild montierten todernsten Trauzeugen in zu engen schwarzen Anzügen und mit streng nach hinten pomadisierten Haaren. Im Hintergrund, auf einem großen, mit einem weißen Tuch eingedeckten Tisch, steht zwischen billigen Sträußen eine als Konzertflügel stilisierte Hochzeitstorte (unter einem Deckel aus Schokolade abwechselnd Buttercreme- und Kakaotasten), hinter dem Tisch eine Dreimannkapelle, deren Geiger seinen Bogen wie einen Dirigentenstab in die Höhe hält. Ein wie zufällig ins Bild gebrachtes Zögern, ein versuchter Tusch, der, jedenfalls was Felicitas’ Vater betrifft, vermutlich auch jenseits des Bildes nie Wirklichkeit wurde.
Vor diesem Hintergrund versteht sich von selbst, wie sehr sich Hoppe bei den Gretzkys zu Hause fühlte. Walter und Phyllis bildeten eine eingeschworene Gemeinschaft. Der Zusammenhalt der Ersatzfamilie stand bei allen Konflikten zwischen den Eheleuten außer Frage. Walters frühe Krankheit, Folge eines Unfalls bei Bell Telephone Canada, der zu vorübergehender Taubheit führte, war Prüfstein und Herausforderung zugleich. Phyllis stand »rauchend wie ein Schlot« in der Küche und nahm die Aufgabe an. Walter war der Trainer, sie die Kämpferin. Sie war es, nicht Walter, die den »kanadischen Zirkus« so unbeugsam wie diskret zusammenhielt und an einem eiskalten Februartag loszog, um einen neuen Rasensprenger zu kaufen, weil der alte seinen Dienst versagt hatte und Walter den »Eisring familiären Ehrgeizes« nicht nachwässern konnte. Als sie nach Hause kommt, bemerkt sie lakonisch, ein zweites Mal werde sie sicher nicht gehen, weil der Verkäufer sie für verrückt erklärt habe: »Wer kauft im Februar in Brantford schon einen Rasensprenger.«
Jahrzehnte später, Phyllis ist längst nicht mehr am Leben, kommentiert Hoppe ihre Erinnerung an die »beste Stiefmutter von allen« so: »Warum ich Phyllis liebte, ist schnell gesagt. Weil sie wusste, dass ein Familientisch rund sein muss, damit es weder Vorzug noch Nachteil gibt. Ein unmöglicher Anspruch, weil Wayne immer Wayne bleiben wird, der Erste und Größte von allen, Sieger auf Lebenszeit, unanfechtbar die Neunundneunzig (99), weshalb wir ihn niemals erreichen werden. Er ist einfach zu schnell, zu treffsicher, zu elegant und, weit schlimmer, entsetzlich bescheiden. Höhere Eitelkeit: Die schwerste Sünde von allen. Phyllis wusste das, aber sie ging lässig drüber weg.«
Die wenigen Bilder, die aus den kanadischen Jahren geblieben sind, zeigen fünf bis zehn Kinder an einem runden Tisch, darunter, blond und überraschend zerbrechlich, Wayne. Neben ihm ein kleines gedrungenes Mädchen mit dicken Beinen in kurzen Stiefeln, das eine schlecht geschnittene Weste und Zöpfe trägt, die auf keinem Bild eine Frisur ergeben. Felicitas’ so verstockter wie nachsichtiger Blick geht ungerührt in die Kamera, der Blick eines Kindes, das genau weiß, dass es, wo auch immer, nur Gast ist.
Die für Hoppe typische Mischung aus Sehnsucht und Gleichmut findet sich auch auf anderen Bildern wieder. Schon als Kind wusste Felicitas genau, dass sie nicht fotogen war, dass sie, wie sie später gelegentlich kokett zu bemerken pflegte, »kein Talent zum Einheiraten« hatte. Aber es gibt auch jene anderen seltenen Bilder des Glücks, auf denen sie sich unvermutet im Freien befindet, nicht in der Küche und nicht am Tisch, sondern draußen, auf einem eiskalten Ring zwischen Wayne und Walter und Waynes Geschwistern, den berühmt-berüchtigten furchtlosen Vier. Bilder, auf denen ein strahlendes Mädchen zu sehen ist, das seinen Schläger entschlossen wie eine Fahne erhebt und auf geliehenen Schlittschuhen hinaus in den Raum schießt, als ginge es kurzfristig auf eine Reise, auf der kein Wayne es begleiten kann.
»Sie (Hoppe/fh) hatte den Hang, immer übers Ziel hinauszuschießen«, erzählt ihr späterer Trainer Bamie (Bamie Boots), der sie, längst Walters Eisring entwachsen, unter seine Fittiche nahm und ihr jenen Hang attestierte, »mit dem man nichts anfangen konnte, diese lästige Neigung, andauernd über das Spielfeld hinauszudenken. Ehrlich gesagt: Was macht man erstens mit einem, der andauernd denkt. Zweitens mit einem, der andauernd drüber hinausdenkt. Man sagt sich, okay, von mir aus, für den Fall des Falles ein guter Verlierer.
Aber was will man mit einem guten Verlierer, wenn man, de facto, gewinnen will. Was das betrifft, war Felicitas untauglich, ein Talent, das sich ständig selbst zurückpfeift. Lästig. Wie kann man gut sein und so wenig draus machen? So viel Begabung und so wenig aufs Tor. Wild entschlossen und niemals auf Sieg. Wobei das nicht ganz stimmt, denn sie war, wie wir alle, natürlich immer auf Sieg aus. Ehrlich gesagt habe ich nie eine Spielerin gesehen, die sich mehr über Siege freute, keine, die gieriger auf Triumphe aus war, immer drauf aus, ihren privaten Jubel unter die Leute zu bringen. Klein und großmannssüchtig zugleich. Wenn sie gewann, war sie wirklich unschlagbar. Und wenn sie nicht gewann, war sie es auch. Ein Trick, den ich nie ganz begriffen habe. Wir verloren ja damals andauernd, aber wenn Felicitas neben mir saß, und damals war sie nicht älter als zehn, hatte ich trotzdem das Gefühl, wir hätten jetzt irgendwas gewonnen. Keine Ahnung, was. Ein Hockeyspiel jedenfalls nicht.«
Bamie Boots, ein mittelmäßiger Trainer der B-Junior-Liga, war vermutlich alles andere als ein begabter Psychologe. Trotzdem lohnt es sich, seinen Äußerungen Aufmerksamkeit zu schenken. Er verbrachte viel Zeit mit Felicitas und kam ihrer Persönlichkeit dabei in mancher Hinsicht näher als spätere Exegeten ihrer Werke. »Was Sportsgeist betrifft«, so BB in einem Interview aus den späten achtziger Jahren, »war sie bemerkenswert. Na gut, was ist schon Sportsgeist? Ich glaube, sie war einfach verliebt in das Wort, sie war sowieso andauernd verliebt in Wörter, was mir, ehrlich gesagt, auf die Nerven ging. Andauernd sagte sie Sachen wie: Was ist Sport ohne Geist und Geist ohne Sport? Geist, sagte ich, ist, wenn du den Mund hältst. Und Sport ist, wenn du jetzt einfach mal deine Kufen polierst, die Schuhe anziehst und zusiehst, dass du warm wirst und aufs Eis kommst. Und läufst und triffst. Alles andere interessierte mich nicht.«
Was Boots dabei nicht in die Waagschale warf, weil er kein Ohr dafür hatte, war Felicitas’ Mehrsprachigkeit, die er gar nicht zur Kenntnis nahm. Ihr Umgang mit Wörtern war weniger sprachverliebte Spielerei als die frühe, wenn auch kaum reflektierte Erfahrung, dass Angelegenheiten sich verändern, je nachdem, wie man sie ausdrückt. Felicitas las und sprach längst in fließendem Englisch, schrieb aber, jenseits ihrer Schulaufsätze, ausschließlich in ihrer Vatersprache, also auf Deutsch. Und träumte in einer dritten Sprache, von der Bamie noch weniger Ahnung hatte: auf Polnisch, der Sprache ihrer Mutter, von der weniger die Sprache als die Erinnerung an eine ferne Klavierlehrerin übriggeblieben war, die längst aufgehört hatte, Briefe zu schreiben.
Vor dem Hintergrund von Hoppes Mehrsprachigkeit zeigt sich die Diskussion um ihr Werk heute unvermutet in einem neuen Licht. In einer Rezension zu Picknick der Friseure konnte der Rezensent Reimar Strat noch so ahnungslos wie polemisch bemerken: »Schönes Deutsch – aber ist es von heut?«, womit er nicht nur die Rezeption von Hoppes Debüt, sondern die Rezeption ihres Werkes insgesamt nachhaltig beeinflussen sollte. Fortan war nicht mehr von Hoppes Geschichten, sondern nur noch von »Hoppes Sprache« die Rede, die sich »in einem altmodischen Sonderraum« breitgemacht habe und, wie noch ein Kritiker der frühen zehner Jahre bemerkt, »nichts anderes als ein Museum der Wünsche« markiere, »die Besetzung eines verlorenen literarischen Raums, der keinerlei Schnittmengen mehr mit der Wirklichkeit bildet«.
Das entspricht, allerdings nicht im Sinn des Rezensenten, tatsächlich der Wahrheit. Hoppe war, was ihr Werk betrifft, damals wie später gar nicht daran interessiert, Schnittmengen mit der Wirklichkeit zu bilden. Bereits in ihren kanadischen Jahren schreibt sie wild entschlossen an Texten, die sie ebenso entschlossen mit niemandem teilt. Auch nicht mit ihrem Erfindervater, dem Einzigen, »der meine Sprache spricht und das lesen könnte«. Was zwar nicht der Wahrheit entsprach, aber folgenreich blieb: Das deutsche Kindheitswerk blieb ausdrücklich verschlossen, es hatte weder Zuhörer noch Leser.
Was Strat und seinen Kollegen (die Hoppe bis weit in die zehner Jahre hinein als »typisch deutsche Schriftstellerin« klassifizierten) ebenso entging wie Bamie Boots, war die Tatsache, dass Hoppes »Sonderraum« keineswegs imaginiert, sondern Realität war. Auf der Basis des aktuellen Forschungsstands erklärt sich die angelesene Sprache dagegen von selbst. Selbstverständlich war Hoppes Deutsch »nicht von heut«, besser gesagt, es war »nicht von hier«, weil sie selbst nicht von hier, sondern von dort war. Ihre Sprache ist, was sonst, nicht erlebt, sondern ambitioniertes Referat einer höchst persönlichen Sehnsucht, genau wie die erst fünfzehn Jahre nach Picknick entdeckten Briefe an vier deutsche Geschwister und die Postkarten an meine Eltern.
Von den Kindheitswerken ganz zu schweigen, die bis heute nur in Teilen zugänglich sind, darunter Häsi, das Hasenkind (1967), Roy Tiger (1967), Mecky, der Igel (1968), Pök, der kleine Marsmensch (1968), Veilchen und Kamille (1969), Der alte Herr Tabak (1969), Zirkus Petronelle (1972) und neben einer geradezu überwältigenden Fülle von Gedichten (von Der Stein über Das Lied von der Regentonne, Der Esel, Tanne im Wald und Schöne Tulpe bis hin zu Der Zauberberg und Satan in der Hölle) vor allem der Entwurf zu einer allerersten Autobiographie, die folgendermaßen beginnt: »ICH. Meine Familie. Mein Name und meine Wünsche und mein Leben. Felicitas Hoppe. Das bin ich. Im Augenblick, in der Zeit wo ich meine Erlebnisse schreibe, bin ich zehn Jahre alt. Ich habe trotz meiner erst zehn Jahre doch schon eine Menge erlebt.« (Zitiert nach dem handschriftlichen Manuskript.)
Wenige Zeilen später bricht die Autobiographie ab, vermutlich weniger aus Mangel an Stoff (Felicitas hatte tatsächlich schon eine Menge erlebt) als aus Mangel an Ausdauer. Die behauptete Dringlichkeit des Unternehmens bleibt davon unberührt. An jeder Stelle des Kindheitswerkes wird spürbar, wie ernst Felicitas bereits als Kind ihre Arbeit nahm. Der nur wenige Jahre später entstandene, zwar schmale, aber immerhin formal ernsthaft abgeschlossene Geschwisterroman (Die Unausstehlichen) macht mehr als deutlich, dass die vier deutschen Geschwister aus Hameln in Felicitas’ Schreiben längst einen festen und prominenten Platz eingenommen hatten. Bereits hier wird Hoppes sich später immer nachdrücklich ausprägender Hang zur Erfindung familiärer Idyllen deutlich, die allerdings ständig und beharrlich gegen die Strapazen des Familienalltags in einem zu kleinen Haus am Hamelner Stadtrand verteidigt werden müssen, die die junge Autorin nicht ohne Ehrgeiz und mit überraschend großer Genauigkeit und Detailtreue beschreibt. (Hier dürfte die Gretzkyfamilie zumindest in Teilen Modell gesessen haben.)
Ihr Erstlingswerk dagegen, Häsi, das Hasenkind, eindeutig ein Plagiat angelesener Kinderbücher, erzählt vor der märchenhaften Kulisse deutscher Waldeinsamkeit (oder sind es die Wälder Kanadas?), ist alles andere als ein Idyll. Hinweisend bereits der erste Satz: »Ich bin Häsi, das Hasenkind. Ich habe keine Geschwister mehr.« Die durch die entschiedene Liquidation der Geschwister auf die Vater-Mutter-Kind-Konstellation reduzierte Familie wird in der nun folgenden Geschichte von dramatischen Schicksalen heimgesucht. Eine Nacherzählung erübrigt sich, bereits die Kapitelüberschriften fassen die Geschehnisse bündig zusammen: Der Wald, Der böse Fuchs, Ein schlimmes Ereignis, Das neue Heim, Endlich erlöst, Neue Freunde und Endlich in Frieden betiteln treffend die kurze Strecke, die die Autorin so sprachlich schwungvoll wie erzählerisch ungeduldig hinter sich bringt. Am Ende heißt es lakonisch: »Nun lebten wir wie früher, nur dass es ein anderer Wald war, in dem wir neue Freunde gefunden hatten.«
Neue Freunde sind auf Kinderwunschlisten bekanntlich nicht die Ausnahme, sondern die Regel, ein schmerzhaftes Dauerthema, das in Hoppes Werk, noch Jahrzehnte später, verlässlich in immer neuen Varianten auftaucht. Verlust und Abschied, Vertreibung, Aufbruch, Ankunft und Hoffnung, wieder Verlust und immer wieder der Wunsch, Familien glücklich zusammenzuführen. Müßig, darauf hinzuweisen, dass weder Wünsche noch Verlusterfahrungen bündige Texte ergeben und dass darüber nur schreiben kann, wer dramatische Kippmomente nicht nur am eigenen Leib erfährt, sondern, darüber hinaus, tatsächlich in der Lage ist, sie sprachlich neu zu erfinden.
»Ein Autor«, schreibt der ausgewiesene Hoppekenner Richard Wagner in seinem 2004 veröffentlichten Essay Idylle und Drama, »ist nicht deshalb ein Autor, weil er ein Schicksal hat, sondern einzig und allein deshalb, weil er schreiben kann und schreibend Schicksale autorisiert. Talent und Erkenntnis sind nicht an Orte, Zeiten und Biographien gebunden. Auch wenn das Publikum, das auf so vieles hereinfällt, genau daran allzu gern glauben würde. Die vermeintliche Idyllenautorin Felicitas Hoppe wäre zweifellos weder eine bessere noch eine schlechtere Autorin, wenn sie ein anderes Schicksal hätte. Würden wir sie tatsächlich lieber lesen, wenn sie keine Hamelner, sondern, sagen wir, eine eiskalte sibirische Kindheit hätte? Gut möglich – nur dass Mängel und Qualität ihres Werkes davon vollkommen unberührt blieben.«
Genau wie Strat und seine Kollegen wusste auch Wagner, ein entschiedener Gegner des »so modischen wie unproduktiven Wettbewerbs in Sachen Schicksal«, nichts davon, dass sie ihre frühen Jahre nicht an der Weser, sondern in einer ganz anderen Landschaft verbrachte, in der sie sich in erster Linie nicht aufs Schreiben, sondern auf ganz andere Spielfelder verlegte, auf denen sie zwar nachweislich scheiterte, aber trotzdem hartnäckig weiterkämpfte. Neben der Schule zählte einzig der Sport, er war, jedenfalls kurzfristig, »das wirkliche Leben«. Einzig und allein der Eisring war jener Ort, an dem sich Leistungen sichtbar machen und nachweislich verbuchen ließen, er war die Arena ihres frühen kindlichen Ehrgeizes, der Schauplatz ihrer ersten großen Erfolge und ihrer ersten schmerzhaften Misserfolge.
Scheinbares Paradox: Der Sonntagserfinderin, die sich während ihrer späteren Laufbahn als deutsche Schriftstellerin immer wieder nachdrücklich als Stubenhockerin stilisierte und angeblich nichts weniger mochte als frische Luft (»Meine Mutter musste mich zum Spielen tragen!«), war das Team hoch und heilig, die Familie unentbehrlich, der Mitstreiter und Wahlbruder Wayne nicht nur erste Liebe, sondern höchstes Vorbild, und die Trainer, erst Walter und später Bamie, kleine Götter, für die sie »klaglos bei Wind und Wetter« spielte.
Bei allem behaupteten Widerspruchsgeist einer Einzelgängerin, die auf nichts mehr Wert legte als darauf, allein in der Landschaft zu stehen, wollte Felicitas gefallen, dazugehören, eine Rolle spielen, ihren Part übernehmen, dabei ständig verblüffen und überraschen. Falls sie wirklich eine Stubenhockerin war, dann jedenfalls eine, die in ihrer Stube von Öffentlichkeit und Wettbewerb nicht nur träumte, sondern dafür auch den entsprechenden Einsatz erbrachte. Sie wollte, wie sie selbst einmal sagte, »groß, schön und tüchtig sein«.
»Beim Training in Dad’s (Wally’s/fh) Coliseum«, erinnert sich Waynes Schwester Kim, »war sie grundsätzlich die Erste. Während wir andauernd versuchten, uns unter dem Kommando unseres Vaters wegzuducken und mit Hilfe unserer Mutter das Sonntagsfrühstück in die Länge zu ziehen, stand sie längst draußen im Ring und polierte die Kufen. Ich glaube, Wayne war der Einzige, der sie mochte, uns anderen ging sie einfach auf die Nerven. (…) Sie liebte das Training, sie war geradezu verrückt danach, und sie übertrieb andauernd – die Erste, die kam, die Letzte, die ging. Und die, die am häufigsten hinfiel und am häufigsten wieder aufstand. (…) Klar war sie schlecht ausgerüstet, miserable Schlittschuhe, brüchige Schläger und so weiter. Aber das war nicht der Grund, wir waren ja alle schlecht ausgerüstet. Außer unserem Wunderbruder Wayne, der ja damals schon schwer am Aufsteigen war, weshalb mein Vater so gründlich in ihn investiert hat. Aber auch auf besseren Kufen wäre Fly (Felicitas’ Spitzname bei den Gretzkys/fh) zehnmal so oft gefallen wie Wayne. Nicht weil sie, wie Dad gern behauptete, schlecht ausbalanciert war, sondern weil sie die Pferde immer von hinten aufgezäumt hat. (…) Sie machte ja buchstäblich alles, um andauernd zu fallen. Natürlich reines Theater. Klar, sie wollte gesehen werden, und sie wusste ganz genau, wie das geht: dramatisch stürzen, pathetisch aufstehen. Sie war einfach ins Fallen verliebt, weil sie so scharf aufs Aufstehen war, scharf auf die Bühne, die bei uns hinterm Haus natürlich lächerlich klein war. (…) Nichts als Show und Theater: wie sie hinfällt, bis zehn zählt (großartiges Timing!), vom Eis aufsteht, halb gebückt die Hände auf die Kniescheiben drückt, nach dem Schläger greift, dann so beiläufig den Helm nach hinten schiebt und dann wieder nach vorne schießt. Die reinste Hinterhofoper!«
Es ist Felicitas’ von Bamie Boots immer wieder bestätigte »Fallsucht«, die Gretzkys Fly in späteren Mannschaftsjahren ihren zweiten Spitznamen, Sawchy, einträgt. (Terry Sawchuk spielte vorzugsweise ohne Maske, sein Körper war, wie Zeitzeugen gern bestätigen, »das reinste Schlachtfeld«.) Dass Felicitas an den »größten Goaly von allen«, falls er jemals ein Vorbild war, nicht einmal entfernt heranreichte, versteht sich von selbst. Zwar brachte sie sich während ihrer kanadischen Hockeyjahre zahllose blaue Flecken, Blutergüsse, aufgeplatzte Lippen, Prellungen, eine prominente Narbe über der rechten Augenbraue und andere geringfügige Verletzungen bei, trug aber über all die Jahre nicht eine einzige nennenswerte größere Verletzung davon. Soweit bekannt, hat sich Hoppe nie auch nur einen einzigen Knochen gebrochen. Dazu Bamie Boots: »Ich glaube, ihre größte sportliche Leistung bestand darin, der unverletzbarste Verlierer von allen zu sein.«
Der Rest, das andere »wirkliche« Leben, fand im Verborgenen statt, an einem Ort, »an den mir so schnell keiner folgt«. Ein Ort, dem Hoppe allerdings umso nachdrücklicher Misstrauen entgegenbrachte, je bewusster sie sich der Tatsache wurde, dass sie sich dort womöglich wohler fühlte als im unerbittlichen Wettkampf auf dem Eis. Dort war sie allein, dort schrieb sie und tat gleichzeitig alles, um ihr Schreiben, allem voran vor ihrem Vater (»Ich schreibe nicht, ich mache Erfindungen!«), geheim zu halten.
Schon früh zeigt sich jenes quälende Unbehagen gegenüber jenem bequemen Wohlsein, das ihre späteren Beziehungen oft so nachhaltig belasten sollte, eine unglückliche Anlage zum unfreiwilligen Spielverderbertum, unter dem sie umso mehr litt, je mehr sie spürte, wie sehr sie das Alleinsein genoss, weil es sie kurzfristig von jeder Form der Verantwortung entband. Ein Genuss, der offenbar mit Angst vor Verlusten verbunden war: »Wo ist eigentlich Wayne, wenn ich schreibe?«, fragt sie in einem Brief an ihre vier deutschen Geschwister und fährt fort: »Was macht er, wenn ich Geschichten erfinde? Vergisst er mich, sobald ich das Eis verlasse? Vermisst mich Walter, wenn ich sonntags nicht komme? Reserviert Phyllis am runden Tisch trotzdem noch einen Platz für mich? Streicht mich Bamie aus seiner Liste, wenn ich nicht mehr zum Training komme? Was ist, wenn ich sonntags nicht da, sondern hier bin, am Schreibtisch meines Erfindervaters, der sonntags, genau wie ich, auch nicht da ist, sondern irgendwo anders. Das Sonntagshaus gehört mir allein: drei Zimmer, ein Bad, die Terrasse, die Küche. Und sein Labor.«
Aber wie abwesend war der Patentagent wirklich? War er wirklich nur da, um, wie Felicitas immer wieder behauptete, ihre Schulzeugnisse zu unterschreiben, während Walter Gretzky sie trainierte und der Hamelner Erbauer des ersten Kaspertheaters und seine Sahne schlagende Gastgeberkönigin die exklusiven Empfänger ihrer kanadischen Postkarten blieben? »Hier seht ihr mich und dort meinen Vater«, so ein inflationär häufig angeführtes Zitat aus Hoppes Erzählung Kopf und Kragen (Picknick der Friseure), in dem ein Vater sein Kind, wohin auch immer, entführt und unterwegs nebenbei zum Tanzbären ausbildet: »Er führt mich durch die Welt an der Kette seiner einbeinigen Abenteuer. Es riecht nach Wind und nach Wetter, die Sonne steht hoch am Himmel, und der Rucksack (sic!/fh) auf meinem Rücken ist leicht wie ein Päckchen Watte, nur mein Kopf auf dem breiten runden Kragen ist schwer wie ein Stein, der augenblicklich den Abhang hinunterrollen will.«
Eine bündige Antwort auf die Frage, welcher ihrer Väter hier tatsächlich Modell gestanden hat, sei den biographischen Ausdeutern von Hoppes Werk vorbehalten. Tatsache ist, dass die Geschichte von Kopf und Kragen bereits in den späten neunziger Jahren zu einem häufig nachgedruckten und von Schülern wenig geliebten Text in deutschen Schulbüchern für die erweiterte Oberstufe avancierte. Die Fragen zum Text sind über die Jahre, ganz im Sinn einer textimmanenten Interpretation, bis heute dieselben geblieben:
»1. Skizzieren Sie das Verhältnis zwischen Vater und Kind. 2. Deuten Sie das Motiv des Rucksacks. 3. Kommentieren Sie den hier verhandelten Welt- und Abenteuerbegriff. 4. Setzen Sie den Text mit der Ihnen bekannten Redewendung ›Es geht um Kopf und Kragen‹ in einen sinnstiftenden Zusammenhang. 5. Kommentieren Sie die Wettersymbolik und interpretieren Sie unter 6. folgenden Satz auf Seite 47: ›Nachts liege ich neben ihm unter der Decke und möchte warten, bis sein Atem so kurz wird, dass er ganz verschwindet, aber mein Schlaf ist noch kürzer.‹« (Aus: Wort und Sinn, 1999)
Durchwachte Nächte auf Grund von Kurzatmigkeit dürften durchaus den Tatsachen entsprechen. In seinem Tagebuch berichtet Karl Hoppe von in regelmäßigen Abständen wiederkehrender schwerer Bronchitis, von Nächten, in denen Felicitas buchstäblich »auf dem letzten Loch pfeift«, Anfälle, die ihn, genau wie ihre rätselhaften »Hauterscheinungen« (»rote und ganz entsetzlich juckende Flecken, nicht nur im Gesicht, sondern ausladend über den ganzen Körper verteilt«) offenbar in Unruhe versetzten, auch wenn Karl Hoppe, was die Gesundheit seiner Tochter betraf, nicht zu Panik neigte, nicht zuletzt deshalb, weil die Erscheinungen kamen und gingen und »weil sie sich durch nichts davon abhalten lässt, trotzdem wieder und wieder aufs Eis zu gehen«.
Dass ihr Vater nie versucht hat, sie davon abzuhalten, sollte allerdings nicht gegen ihn ausgelegt werden. Er war weniger gleichgültig als rat- und hilflos und versuchte regelmäßig, wenn nicht unter der Woche, so immerhin sonntags, Zeit mit seiner Tochter zu verbringen. Dass er dabei weder als Trainer noch als Geschichtenerzähler brillierte und keinen nennenswerten Hang zum Kaspertheater besaß, steht außer Frage. Dafür besaß er Qualitäten anderer Art, von denen Felicitas durchaus profitierte und die sie in höchst unterschiedlicher Weise immer wieder angeregt haben. So ist die Sonntagserfindung des Leuchtpucks, die Eberhard von der Mark später für sich in Anspruch nehmen konnte, nachweislich nicht Felicitas, sondern ihrem Vater gestohlen, der darum weit weniger Aufheben machte als seine Tochter. Es ist also Felicitas gewesen, die ihrem Vater den Diebstahl an seiner Erfindung stahl, den er in seinem späteren australischen Tagebuch ziemlich lakonisch mit folgender Notiz kommentierte: »Glückwunsch für Mark unter der Nummer 0273944. Einmal mehr im Rückstand.«
Glaubt man den Tagebüchern, so war Vater Hoppe spätestens seit seinem Flugzeugabsturz, »der ihn«, schreibt später die Tochter, »faktisch und praktisch aus dem Verkehr zog, weil unser Marktwert weltweit proportional zur unserer Geschwindigkeit wächst und fällt«, ständig im Rückstand, was darauf schließen lässt, dass er, genau wie seine Tochter, unter der Last unerfüllter Wünsche und unausgegorener Erfindungen litt. Während sie in der Schule war, ging der Patentagent seiner Arbeit bei Bell Telephone Canada nach, die ihm kaum mehr Befriedigung verschafft haben dürfte als die »leere, auf der Schulbank abgesessene Zeit« seiner Tochter. Sein Sonntagslabor glich ihrem Schreibtisch: Fluchtorte zweier Träumer, deren Träume sich, so sehr sie sich voneinander unterschieden, zu Lebzeiten nicht in klingende Münze verwandeln ließen.
Welchen Raum des gemeinsamen Hauses Hoppes Erfindervater auch immer bewohnte, seine Tochter hatte ihren festen Platz darin. Vorsicht ist also geboten gegenüber der sentimentalen Rhetorik, mit der uns Hoppe in ihren Briefen an vier deutsche Geschwister immer wieder weismachen will, ihr Vater sei seiner Tochter ausgewichen, sie sei ihm womöglich gleichgültig gewesen. Er dachte gar nicht daran, nachts nur zwei bis drei Schritte zu machen und lauschend an ihrer Zimmertür stehen zu bleiben, um seine Tochter atmen zu hören.
Karl Hoppe, nicht älter als fünfundzwanzig, als er mit Felicitas nach Kanada übersiedelte, mag als alleinerziehender Vater zwar unerfahren und unbeholfen gewesen sein, ein Lauscher an der Tür seines eigenen Kindes war er sicher nicht. Selbst misstrauischen und parteiischen Lesern seines Tagebuches kann, bei aller Nüchternheit, kaum entgehen, dass er seine Tochter liebte und spätestens sonntags an ihre Zimmertür klopfte, um zu überprüfen, ob Fly (er war entgegen Hoppes Behauptungen durchaus mit ihren zahlreichen Spitznamen vertraut) ihre Hausaufgaben erledigt und sich angemessen auf die neue Woche vorbereitet hatte.
Von einbeinigen Abenteuern wird dabei kaum die Rede gewesen sein. Karl hatte sich zwar auf höchst unkomfortable Weise aus seiner Heimat verabschiedet, über die Umstände seiner »ersten großen Reise« schwieg er sich aber auch in späteren Jahren hartnäckig aus. Dass seine Tochter ihn jemals genauer daraufhin befragt hätte, ist nicht bekannt, vermutlich »weil er nicht mein Vater, sondern bloß mein Entführer« war. Das Privileg der Zuneigung und des Geschichtenerzählens kam, jedenfalls offiziell, ausschließlich ihrem Traumvater, dem Hamelner Erbauer des ersten Kaspertheaters, zu.
Karl Hoppe, jüngster von drei Söhnen eines oberschlesischen Schneidermeisters aus Seifersdorf, der Einzige seiner Familie, der »den Mut aufgebracht hatte, seine Heimat zu verlassen«, war ein schweigsamer Esser, ein Ordnungsmensch, der nicht nur im Berufsleben klare Strukturen, Regeln und Formeln liebte. Regelmäßig fertigte er Wochenpläne an, ergänzt durch Siebentagepläne für Felicitas, die er seiner Tochter allerdings vorenthielt. Vielleicht schämte er sich der von ihm selbst so genannten Funktionslisten, in denen sich ein Erziehungsidealismus offenbart, der weit über die Verwaltung von Talenten und Anlagen hinausgeht, auch wenn der Ton seiner Aufzeichnungen zu der Annahme verführt, er sei ein Mensch ohne besonderes Einfühlungsvermögen gewesen, der nichts anderes im Sinn gehabt habe, als seine Tochter auf Linie zu bringen, und dabei übersehen habe, wofür sie »tatsächlich bestimmt« war.