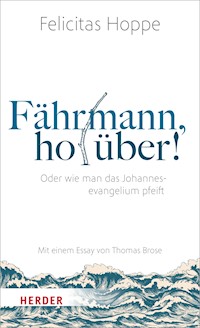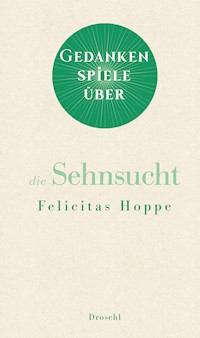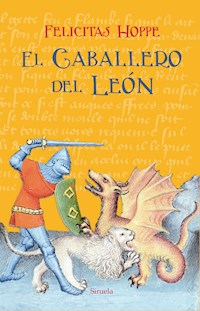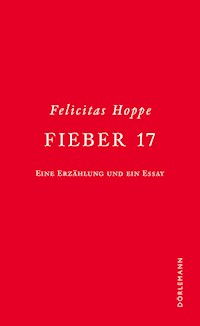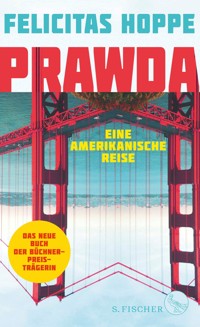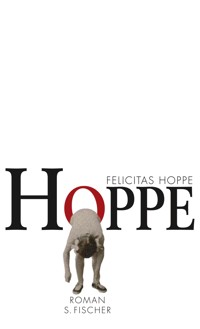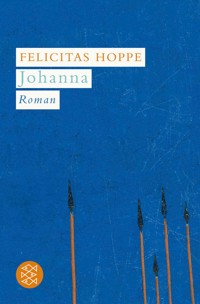
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1412 wird im lothringischen Domrémy ein Bauernmädchen geboren. Keine zwanzig Jahre später wird sie als Ketzerin verbrannt. Aber Felicitas Hoppes »Johanna« ist kein Buch über Johanna von Orléans. Dieses Buch ist Johanna selbst, die Geschichte unseres Aufbegehrens und der eigenen unersättlichen Sehnsucht. Wie geht man mit einer Figur um, die jeder zu kennen glaubt, und über die auch in der Kunst längst alles gesagt scheint? In einer Zeit, in der zwar viel erzählt, aber nichts gehört wird, bleibt Johanna eine Provokation. Dies ist ein Buch, das davon handelt, wie man Geschichte macht, wenn man erzählt. Auf den Gang der Geschichte antwortet diese »Johanna« mit der Passion der Literatur, auf die Passion der Johanna mit einem Gespräch über unsere eigene Angst. Felicitas Hoppe verzichtet auf die Rekonstruktion der Biographie. Sattdessen erzählt sie mit historischer Genauigkeit und poetischer Intensität einen Traum von der Wirklichkeit – denn was sind Bücher gegen die Welt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Felicitas Hoppe
Johanna
Roman
Über dieses Buch
Im Jahr 1412 wird im lothringischen Domrémy ein Bauernmädchen geboren. Keine zwanzig Jahre später wird sie als Ketzerin verbrannt. Aber Felicitas Hoppes ›Johanna‹ ist kein Buch über Johanna von Orléans. Dieses Buch ist Johanna selbst, die Geschichte unseres Aufbegehrens und der eigenen unersättlichen Sehnsucht.
Wie geht man mit einer Figur um, die jeder zu kennen glaubt, und über die auch in der Kunst längst alles gesagt scheint? In einer Zeit, in der zwar viel erzählt, aber nichts gehört wird, bleibt Johanna eine Provokation. Dies ist ein Buch, das davon handelt, wie man Geschichte macht, wenn man erzählt. Auf den Gang der Geschichte antwortet diese »Johanna« mit der Passion der Literatur, auf die Passion der Johanna mit einem Gespräch über unsere eigene Angst. Felicitas Hoppe verzichtet auf die Rekonstruktion der Biographie. Sattdessen erzählt sie mit historischer Genauigkeit und poetischer Intensität einen Traum von der Wirklichkeit – denn was sind Bücher gegen die Welt?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Par mon Martin!
Prolog
Mützen
Stimmen
Wunder
Prüfungen
Zeugen
Leitern
Himmel
[Danksagung]
Par mon Martin!
Prolog
Johanna wurde in der Dreikönigsnacht geboren. Die Tiere begannen zu sprechen, die Brüder hielten den Stern in die Höhe, nur die Könige konnten sich nicht einigen.
Neunzehn Jahre später, als der Bischof endlich begann, das Todesurteil zu verlesen, und der Scharfrichter sich mit dem Karren näherte, verließen Johanna die Kräfte. Sie unterbrach den Bischof und sagte, sie werde alles tun, was man ihr auferlege. Die Engländer empörten sich, warfen Steine und schrien, Bischof Cauchon sei ein Verräter. Johanna, die weder lesen noch schreiben konnte, unterzeichnete die Abschwörungsformel mit einem Kreuz. Dabei lachte sie, und die Engländer schrien noch lauter.
Am siebenundzwanzigsten Mai erhielt der Bischof die Nachricht, Johanna sei rückfällig geworden, habe wieder Männerkleider angelegt und alles widerrufen, was sie unterschrieben hatte. Am dreißigsten Mai, gegen neun, flankierten achtzig oder achthundert englische Soldaten ihren Karren auf dem Weg zum Alten Markt von Rouen. Trotzdem gelang es einem gewissen Loiseleur, auf den Wagen zu springen und Johanna unter Tränen um Vergebung für das ihr angetane Unrecht anzuflehen. Mit Not entkam er den Engländern.
Eine Stunde lang stand Johanna auf dem Marktplatz, während Nicolas Midi eine Predigt hielt und der Bischof ein zweites Mal das Urteil verkündete. Johanna verteidigte ein letztes Mal ihre Könige, die allerdings abwesend waren.
Bevor man sie auf den Scheiterhaufen führte, setzte man ihr eine Papiermütze auf, darauf standen für alle, die lesen können, drei Worte. Vornweg ging Bruder Ladvenu, der, auch für Abwesende gut sichtbar, das Kreuz in die Höhe hielt, bis Johanna ihn bat, von der Leiter zu steigen, weil das Kreuz in Gefahr stand, Feuer zu fangen. Sie selbst hielt ein kleines Holzkreuz in der Hand, das ein englischer Soldat für sie zusammengezimmert hatte.
Sie verbrannte lebendig, denn man hatte den Scheiterhaufen so hoch aufgerichtet, dass der Henker ihr keinen Gnadenstoß geben konnte, obwohl es ihm leid um sie tat, weil er um seine eigene Seele fürchtete. Einige auf dem Platz weinten, darunter auch Engländer.
Johannas Reste, Asche und das Herz, das den Feuertod manchmal übersteht, wurden vom Gerichtsdiener Jean Massieu in die Seine geworfen.
Mützen
Damen und Herren, was bleibt, ist ein Rätsel. Was ist das? Schwimmt wie ein Fisch, heult wie ein Hund, fällt auf die Knie wie ein Bettelbruder und feiert sich wie ein französischer König.
Das menschliche Herz, ruft Peitsche, der alles verträgt, nur keinen Rauch. Er weiß, dass mir Rätsel zuwider sind, also löst er sie rasch. Er verbringt seine Zeit nicht mit Innenfutter, sondern mit Stoff, mit der Nachbildung von Papiermützen, die er abends faltet, nachts beschriftet und morgens im Hörsaal prüfend ins Licht hält. Der schönste und beste Schüler von allen, der vorn in der ersten Reihe sitzt, wie auf dem Kutschbock, und längst keine Lust mehr hat mitzuschreiben, weil er weiß, dass Johanna nicht liest, oder weil er sich vor seiner Handschrift fürchtet, die sich vom Lernen nicht trennen kann.
Eine Linkshänderhandschrift aus Kränkung und Ehrgeiz, kleine, eng aneinandergedrängte Buchstaben, unruhig nach innen verdreht und verspiegelt, aber immer bergan und längst promoviert, summa cum laude. Über die Ökonomie der menschlichen Herzen, das eine verbrennt, das andere nicht.
Doktor Peitsche, mein Vorbild. Schnelle Zunge, helle Stimme, schlagende Rede, biegsamer Gang. Ich bin längst verliebt, zwar ohne Titel, aber Spitznamen darf ich trotzdem vergeben, und er trägt seinen Namen mit Stolz, vielleicht auch aus Trotz, wie ein unerwünschtes Geschenk, mit dem der Träger den Schenker bestraft.
Peitsche voran, und ich hinterher, die Zunge auf Grund. Kann auch sein, dass er fliegt. Wie sonst ließe sich das Tempo erklären, mit dem er so schwungvoll an Höhe gewinnt, dass ich ihn kaum noch erkenne, während ich am Boden klebe und versuche, Abschied zu nehmen. Erstens vom Henker, zweitens von Cauchon, drittens von Ladvenu, scheinbar leicht von Midi. Wie eine Feder entkommt Massieu.
Nur Loiseleur werde ich nicht los. Nacht für Nacht besteigt er meine Träume, als säße ich neben ihm hinter dem Vorhang, den der Bischof für uns aufgehängt hat, damit man uns im Gerichtssaal nicht sieht, wenn wir wieder gemeinsam die Unwahrheit schreiben, nicht das, was Johanna sagt, sondern das, was der Bischof hören will, um die Klarheit der Aussage zu verwischen.
Mai Vierzehndreieins. Wir frösteln, sobald wir zu schreiben beginnen. Kann auch sein, mir ist bloß die Decke verrutscht, oder Peitsche knirscht im Schlaf mit den Zähnen, wenn Loiseleur wieder auf den Karren springt und um Vergebung schreit. Im Halbschlaf werfe ich Steine, Bruder lauf, die Engländer kommen. Aber Loiseleur ist kein Läufer, sondern ein Hund, der sich duckt und nach Seelen schnappt. Nur hatte Johanna gar keinen Hund, sie war allein unterwegs. Ein Hund wäre ihr bis ins Feuer gefolgt, immer bellend voran, die Angst ins gesträubte Fell gewickelt, als wüsste er, wohin mit der Angst.
Wenn die Angst bei mir ist, habe ich keine Angst, die Angst nimmt mich bei der Hand und führt mich, aber wer sagt mir, dass man Hunde nicht täuscht? Womöglich genügt eine Mütze, ein Papiereimer über den Kopf gestülpt, um den Hund vom Weg des Herrn abzubringen? Ein leiser Befehl, schon folgt er uns überallhin, ins Zentrum der Hitze, in den Abgrund des Wassers, ein Stöckchen, grundlos ins Weite geworfen, spornt seinen Ehrgeiz an. Er stutzt, bleibt stehen und dreht sich im Kreis. Er kennt das Spiel nicht.
Nichts als ein altes Gesellschaftsspiel, ein Rätsel, das auch Peitsche nicht löst: Erkenne den König, den Mann am Klavier, die Zweitfrau am Ring, den Priester im Schaf, den Hund in der leichten Jacke des Dichters, den Souffleur in der Kiste, das Publikum am erschöpften Applaus, die Jungfrau in der gefütterten Rüstung. Lauter Hasen der Angst unterm stampfenden Schritt, ein Kind unterm Helm.
Von Helmen verstehe ich gar nichts. Ihr Gewicht von oben nach unten bedrückt mich, wozu überhaupt ein Dach überm Kopf? Ich träume von einem bescheidenen Sturm, wie die Nuss davon träumt, dass einer sie knackt, damit ich endlich aufwachen kann, damit endlich alles zum Vorschein kommt, wovon Johanna nichts weiß und was mich so gründlich mit Peitsche verbindet: Feigheit, Gewohnheit, Manieren, der Wunsch nach der besseren Hälfte des Mantels. Die Suppe, die Arbeit, das Bett. Und Mützen auf allen Fensterbänken.
Nacht für Nacht pocht Peitsche auf Aufmerksamkeit. Dabei weiß er genau, wie schlecht ich Wahrheit vertrage. Stecken und Dreck, immer aufs Auge und Zahn gegen Zahn. Hundert Jahre Krieg! Was soll ich in der Vergangenheit? Wo liegt übrigens Frankreich? Ich will nicht hinter Vorhängen hocken, ich will kein Wächter von Schatten sein, die alles vertragen, nur keinen Rauch.
Wie das Kreuz und die Hauben der Damen. Die Tür ist zu niedrig, die Haube zu hoch, die Lösung einfach. Nimm das Beil, schlag den Türrahmen himmelwärts aus, und die Dame kann gehen. Aber Johanna ist keine Dame.
Damen und Herren. Ein Tanz in den Mai. Ein kleines Kostümfest auf Peitsches Balkon. Lauter Nebenfiguren, jeder auf seine Art lächerlich. Ich unter Hauben und Peitsche in Rüstung, beide von oben bis unten in Blau, Johannas Lieblingsfarbe.
Wir erkannten uns gleich, am selben Thema. Seit Jahren schreiben wir über die Jungfrau, zwei falsche Priester kurz vor der Weihe, aber jeder eine Schwelle für sich, über die keiner kommt. Wächter in Waffen, die nichts zu verteidigen haben, nur Thesen und Mützen, nicht mehr als drei Worte, die trotzdem nicht über die Lippen kommen. Wozu sprechen, wir können ja lesen.
Peitsche stand in der Küchentür, wo er heute noch steht, wenn er glaubt, es ginge plötzlich ums Ganze. Vielleicht sprach er sogar eine Einladung aus, die ich nur nicht verstand, weil er einfach zu leise sprach. Stimmen, die sich niemals erheben, überhöre ich gern, diese biegsame Mischung aus Klugheit und Kränkung. Geliebter Spiegel, das bin ja ich selbst, die immer den Tisch deckt, und nie wird gegessen.
Plötzlich hob Peitsche das Visier. Achtzig oder achthundert englische Soldaten, sagte er fröhlich, das ist keine Kleinigkeit. Man fürchtet sie, also muss man sie füttern. Obenauf die Getränke. Danach achtzig frisch bezogene Betten, ein tiefer traumloser englischer Schlaf. Der Rest fällt unter den Tisch, schläft auf dem Gang, auf der Schwelle, auf dem Karren, vor der Tür, auf dem Platz. Sind Sie übrigens schon in Rouen gewesen? Auf dem Alten Markt? Vermutlich nicht, und das ist ein Fehler. Man muss schließlich sehen, was man beschreibt. Das Feuer, den Lärm, den Hunger, den Durst, die Feindschaft. Vor allem die Freude nach getaner Arbeit. Wie weich und sentimental alle werden, wenn der Scheiterhaufen langsam herunterbrennt und sich zurückverwandelt in das, was er ist. Nichts als ein englisches Lagerfeuer. Lieder werden gesungen, Stöckchen unter die Asche geschoben, auf der Suche nach Resten, nach Funden, nach Zeichen, nach irgendwas, das wir lesen können und das die ganze Geschichte erklärt. Aber Massieu hat ganze Arbeit geleistet, keine Spur. Alles ist in der Seine verschwunden. Tatsächlich, man müsste Gerichtsdiener sein. Ein Taucher.
Er schnappte nach Luft, hob sein Glas, und ich lachte, weil Peitsche kein Taucher ist, sondern ein Schwimmer, das sieht man doch gleich. Den Kopf immer oben, die Arme geschmeidig, zierliche Flossen, glänzend geschnitten, den Atem himmelwärts. Weshalb ich seiner Richtung schlecht folge. Kann auch sein, ich will nicht. Aber er prostete mir entschlossen zu, wobei er sogar ein wenig schwankte, obwohl er gar nicht betrunken war. Denn im Gegensatz zu mir trinkt Peitsche fast nie, und wenn, dann immer mit Sinn und Verstand, damit ihm die Gesten nicht verrutschen.
Geliebter Gegner, er dreht mir den Strick. Ich bin Spezialistin für Karrenritter, aber ich war nie in Rouen. Ich weiß auch nicht, wie man Paris buchstabiert, von Orléans ganz zu schweigen. Ich bin des Französischen nicht mächtig, eine herrliche, uneinnehmbare Sprache für Lehrlinge, die keine Meister werden, niemals kommt man ans Ziel. Lauter Spitzen und Sporen und Hauben und Ränder. Schlag den Türrahmen nach oben hin aus, die Dame bleibt trotzdem stecken, viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, wie immer, wenn zu viel Schönheit im Spiel ist. Schöne Sprache, schweres Visier, umständlich, wie der französische König, von dem ich nach drei Gläsern Wein nicht mehr weiß, der wievielte Karl dieser Karl wirklich ist.
Also stellte Peitsche sein Glas auf die Schwelle, weil er beide Hände auf einmal braucht, um sieben Finger nach oben zu halten. Die Linke wie einen Fächer gespreizt, zwei Finger der Rechten, addierend, daneben. Natürlich geht es ihm nicht um den König, er will mir nur seine Hände zeigen, Dirigentenhände, die ich anfassen möchte, weil sie nicht zu seiner Handschrift passen.
Achtzig oder achthundert englische Soldaten, sagte Peitsche, sieben Finger hoch in der Luft, Bischöfe und Priester gar nicht gerechnet. Lauter Loiseleure, eine Jungfrau, ein Henker, ein Scheiterhaufen. Aber weit und breit kein König in Sicht, das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man wissen will, wer dieser König ist. Karl der Siebte. Natürlich nahm er Johanna nicht ernst. Er hielt sie für eine Zugabe, für einen Einwurf vom Land, für ein Schäferkostüm, ein Gretchen in Waffen, das Mädchen von nebenan mit dem Schwert, das an Wochenenden den Erzengel gibt.
Und Sie, fragte ich. Für wen halten Sie sie?
Er sah mich an, ließ die Hände sinken, ging kurz in die Knie und griff nach dem Glas. Dann erhob er sich wieder. Ich halte mich an das, was ich anfassen kann, sagte er. Übrigens führt diese Frage zu nichts, weil sie den Kern der Sache verfehlt. Die Vergangenheit interessiert mich nicht, ich glaube an das, was ich sehe und höre. Seit Jahren schreibe ich nicht mehr mit. Ich sitze herum, falte Mützen und passe auf, dass mir niemand die Stimmung verdirbt. Und manchmal habe ich Gäste.
Er lehnte im Rahmen der offenen Küchentür, er sprach leise und schnell, wie ein ungeübter talentlose Lügner, der nicht weiß, wie man Wahrheit verbirgt und dass man beim Lügen ernsthaft sein muss.
Natürlich, Gäste, rief ich, fast hätte ich die Gäste vergessen, und das Spiel. Sie haben uns doch ein Spiel versprochen, ERKENNE DEN KÖNIG, höchste Zeit, dass wir endlich zu spielen beginnen. Was allerdings die Spieler betrifft: Viele schlechte Kostüme. Wie soll man den wahren König erkennen, mindestens sieben maskierte Karls. Von den Damen zu schweigen. Ein schlecht besetzter Hofstaat. Ein Herold in Schwarz, ein gelblicher Narr, zwei bräunlich grundierte Hundekostüme, drei Fackelträger und ein Mundschenk, der nebenbei den Vorkoster gibt und aussieht wie schon gestern vergiftet. Und hinten links, an der Tür zum Balkon, ein Schellengewand, das die Ohren auf Schritt und Tritt beleidigt und seinen Träger unnötig beschwert. Der Mantel zieht ihn beständig nach unten, bis er am Ende tatsächlich kniet, was die Erscheinung nicht besser macht. Eine Niederlage in Glocken, so drückt man doch keine Verehrung aus. Nur der Karrenritter schindet ehrlichen Eindruck. Perfekte Maske, als hätte er einen Preis gewonnen, die Schandmütze trägt er mit Stolz. Der Rest sind lauter haltlose Köpfe, alle nicht jung, alle scheinbar verliebt, aber nur in sich selbst. Alle erschöpft und schwach in den Gesten, vollkommen hoffnungslos im Gespräch. Ich habe das vorhin ausprobiert, keine einzige echte Krone im Spiel.
Sehen Sie sich diese Könige an, sagte ich laut, denn ich will, dass es alle Könige hören. Sie setzen auf nichts als die Wirkung der Farben, auf die Kraft der Verwechslung. Alle sieben in Grün, grüne Siebenlinge. Als wäre Grün eine Königsfarbe.
Das sehen Sie falsch, sagte Peitsche mit Nachsicht und goss nach, nicht sich, sondern mir. Das sind keine Könige, das sind fahrende Ritter auf der Suche nach Damen. Grün ist die Farbe der jungen Liebe, die die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben will. Darum steht es dem fahrenden Ritter an, immer grün gekleidet zu gehen. Aber das hat mit uns nichts zu tun, das geht vorbei. Gegen Mitternacht sitzen sie wieder am Tisch und gehen zu anderen Farben über, zum Beispiel zu Blau, der Farbe der Treue, der wirklichen Liebe.
Ein Atemzug, er pfiff durch die Zähne. Von der Treue hinüber zur Treulosigkeit, das ist ja nur ein Gedankensprung, das Gewand der Betrogenen ist die Cote Bleue. Der blaue Mantel der Torheit.
Und Weiß ist die Farbe der Einfalt, sagte ich laut und goss nach, tragbar nur für Kinder bis sieben. Ich wette, sobald Sie die Rüstung ablegen, tragen Sie nichts als ein weißes Hemd.
Und obwohl ich genau weiß, dass es da ist und, noch genauer, weiß, wo es sitzt, weiß ich, ich werde es heute nicht sehen. Denn natürlich legt er den Mantel nicht ab, der nur zum Schein eine Rüstung ist und bei näherem Hinsehen auch nicht ganz blau. Denn die Feindschaft trägt Gelb, ruft Peitsche, und das kommt ihm so zügig über die Zunge, als ließe er alle Würfel auf einmal fallen, die knallend über die Tischplatte rollen. Und immer hat er mehr Augen als ich.
Johanna wäre das nicht passiert. Johanna hasst Würfel. Sie hält sich auch nicht auf Kostümfesten auf, sondern trägt mühelos alle Farben auf einmal. Blau oder Grün oder Rot. Für England nur Gelb. Sie hält sich an das, was sie sieht und hört, zwei Augen, zwei Ohren. Haut und Kostüm fallen ländlich in eins. Sie erkennt ihn sofort, den König, der sich verstecken will, der sich duckt und errötet, weil er vor seinem Amt erschrickt.
Und Rot, sagte Peitsche, ist immer verfänglich, pompös und passt nie. Blason des Couleurs, altfranzösische Farbenlehre, das sollten Sie kennen. Sie wissen doch selbst, dass man Könige nicht mehr am Kopf erkennt, sondern nur an den Füßen, nicht an der Krone, sondern immer am Schuh.
Natürlich, rief ich, das herrliche Schwarz. Das Schuhwerk der Schriftsteller, Schiedsrichter und Nonnen. Rechthaberei, schwere Tritte, früher Tod, hochmütige Absonderung von fröhlicher Buntheit. Prunk und kraftvolle Düsternis! Blason des Couleurs. Schwarzes Wams, graue Hosen, gelbe Handschuhe. Nur dass hier niemand Handschuhe trägt, eine große Enttäuschung. Keine Dame, die einen Handschuh ausführt. Selbst Sie zeigen unbekleidete Hände, obwohl Sie den Blauen Ritter geben.
Wie schön, dass Sie mir den Ritter glauben, sagte Peitsche, weil er weiß, dass ich immer das Gegenteil meine. Nur blieb keine Zeit, das zur Sprache zu bringen, denn man hatte uns plötzlich prächtig umzingelt, alles drängte mit Macht in die Küche, alle hatten Hunger und Durst.
Und weil es auf Mitternacht ging und man kurz davor war, die Farben zu wechseln, hatte niemand mehr Sinn für Spiele. Die grünen Könige schwankten heftig und griffen zu. Dabei ließen sie sich von den Damen leiten, um genau zu sein, sie ließen sich stützen, während sie Häppchen auf Teller luden und auf dem Balkon verschwanden, wo man alles unbesehen verschlang, weil es dunkel und regnerisch war. Keiner der Esser sprach über Farben. Die Mahlzeit war einfach, aber nicht zu entziffern.
Haben Sie Hunger, fragte Peitsche leise, oder wollen Sie meine Mützen sehen? Dabei machte er sich im Türrahmen breit, sodass kein Platz blieb für meinen Hunger, auch nicht für Durst. Kein Wasser, kein Brot, nur sieben Finger, deutlich nach oben. Und das ist kein Spiel, jetzt geht es ums Ganze. Es geht um die Jungfrau. Ich stellte entschlossen mein Glas auf die Schwelle und sagte: Die Mützen.
So sind wir über die Schwelle gekommen, Peitsche voran und ich hinterher. Unerwartet und schwankend, in ein schlecht beleuchtetes Nebenzimmer, das womöglich ein Geheimnis enthält. Jedenfalls tut es so, oder wir tun so, oder ich tue so, und Peitsche tut nichts. Vielleicht hat er das Zimmer auch schon wieder verlassen und steht im Regen auf seinem Balkon, während ich auf die Fensterbank starre, dorthin, wo ich die Mützen vermute.
Lange, endlose Reihen von Mützen. Mützen in Schichten nach oben gestapelt, die einen sorgsam zusammengefaltet, die anderen himmelwärts aufgeklappt. Auf zum Gipfel des Fensterrahmens. Eine wachsende Kathedrale aus Papier, schwerelos und von größtem Gewicht. Schandmützen aller Sorten und Größen, alle vertraut und deutlich beschriftet, auch für Abwesende gut lesbar.
Eine Kinderhandschrift aus Ehrgeiz und Angst, Buchstaben wie nervöse Geschwister. Von links nach rechts die Mütze Loiseleurs mit der Aufschrift VERRAT, die Mütze Cauchons mit der Aufschrift ICH MUSS, die Mütze Midis mit der Aufschrift DAS URTEIL. Die Mütze Karls mit der Aufschrift DER SIEBTE. Die Mütze Trémoilles mit MESSER UND GABEL. Die Leibwächtermütze von Jean d’Aulon mit der Aufschrift KEIN BLUT, die Mütze des Henkers mit der Aufschrift UM GNADE. Die Mütze Massieus ruft ASCHE ZU ASCHE, die Mütze Dunois’ ES DREHT SICH DER WIND. Und der Wind dreht sich wirklich, denn die Mütze von Warwick ist doppelt beschriftet: WAS FÜR EINE FRAU! WÄRE SIE DOCH EINE ENGLÄNDERIN.
Aber Johanna ist keine Engländerin. Nicht Fisch, nicht Fleisch, nur Wasser und Brot. Schnelle Zunge, helle Rede, stürmischer Gang. Nicht groß, sondern klein, nicht lang, sondern kurz, nicht blond, sondern braun, nicht höflich, sondern eckig und schnell. Wie nebenbei geschmiedet. Ein Wochentagskind aus Lothringen. Nicht schön, sondern ländlich. Gefährlich wie die Mütze von Jacques, mit der Handschrift des Vaters ICH WILL DICH ERTRÄNKEN, bevor du mit den Soldaten gehst. Deren Aufschrift lautet WIR KÖNNEN AUCH ANDERS.
Daneben die Mützen der Ritter und Reiter. Gilles de Rais mit der Aufschrift EIN BLAUBART und die Mütze La Hires DER RASENDE ZORN, von Johannas Waffenbrüdern der schönste. Von oben bis unten in Glocken gehüllt, ein Mantel voller lärmender Glocken, eine siegreiche Niederlage. Ein Mann, der nicht kniet, sondern hinkend immer nach vorne stürmt und seine knappe Zeit nicht mit Beichten vertut. Ein kurzes Gebet im Chor mit den Stiefeln: Gott, ich bitt dich, dass du für La Hire tust, was du wünschtest, dass La Hire für dich täte, wenn er Gott wäre, und du wärest La Hire.
Auch ich beginne jetzt leise zu beten, damit ich endlich die Mütze des Bruders finde, der Johanna bis heute das Kreuz vorhält. Die Mütze von Bruder Ladvenu, die mehrfach gefaltete Feuerleiter mit der großen und praktischen Aufschrift DIE ANGST.
Die Angst nimmt mich bei der Hand und führt mich. Wenn die Angst bei mir ist, habe ich keine Angst. Aber wer sagt mir, dass man Brüder nicht täuscht? Dünnes Eis, leises Knacken unter den Sohlen, schon dreht sich der Wind und der Bruder im Wind. Und wie leicht der Bruder die Farbe wechselt, wenn der Wind aus der anderen Richtung weht. Alles verträgt er, nur keinen Rauch.
Auch ich würde jetzt gern die Richtung wechseln, aber die Angst hält mich fest und lässt mich nicht los. Ich kehre nicht um, ich gehe mit, um zu sehen, was ich nicht sehen will und was vielleicht nie jemand sehen sollte. Alle Mützen, die Peitsche gefaltet hat. Tag für Tag und von Woche zu Woche, in Wochen, aus denen Monate wurden, und die Monate, folgerichtig, zu Jahren. Ein Lebenswerk, eine Besessenheit, eine wilde Manie. Womöglich auch nur ein englisches Hobby, eine schrecklich verspätete Kinderkrankheit, die, wie jedes Hobby und jede Verspätung, ein eiskalt beleuchtetes Unglück ist. Als hätte jemand ein Licht angemacht, das sich nicht aus natürlicher Quelle speist und das den Betrachter kränkt und verletzt.
Aber bin ich mir sicher? Stehe ich wirklich im Licht? Für wen halte ich mich? Was will ich entziffern? Im Zimmer ist es stockdunkel, man sieht ja die Hand nicht vor Augen. Durch das Fenster, von oben bis unten von Mützen verstellt, dringt kein Schimmer. Ich höre nur leise und ferne Stimmen, Damen und Herren auf einem Balkon. Das Klappern der Messer, das Klirren der Gläser, das Gelächter der grünen Siebenlinge, das Bellen eines Hundekostüms, das vergeblich nach einem Stöckchen springt. Und den Vorkosterwitz des talentlosen Mundschenks, der schon im Erzählen für schlecht befindet, worüber ich nachher lachen soll.
Plötzlich wird es still. Als hätte mich die Gesellschaft verlassen, als wäre die Welt draußen eingeschlafen. Achtzig oder achthundert englische Soldaten, auf dem Flur, in den Gängen, unterm Tisch in der Küche. Sind Sie schon in Rouen gewesen? Alter Markt? Man muss nämlich sehen, was man beschreibt. Die Verzweiflung nach getaner Arbeit, wenn der Scheiterhaufen herunterbrennt und sich verwandelt in das, was er ist.
Ich stehe wie in den Boden geschraubt. Ist das hier wirklich ein Nebenzimmer? Ein Hobbyraum, eine harmlose Werkstatt? Oder tut es nur so, oder ich tue so, oder Peitsche tut so, weil er hofft, dass die Mützen nur Mützen sind und folglich nur eine Nebensache, die man in Nebenzimmern betreibt?
Als wüsste er nicht, was auch ich längst weiß. Dass Nebenzimmer die Hauptzimmer sind, Paläste des Unglücks. Das Schlafzimmer und das Kinderzimmer, das siebte Zimmer, das Zimmer der Angst. Man muss wohl Helme und Rüstungen tragen, um trotzdem über die Schwelle zu kommen, ein Schwert gegen Träume.
Damen und Herren, die Wahrheit, was ist das? Das Gesicht eines Mannes, der im Hörsaal auf einem Kutschbock sitzt und sich zu Hause in Schandmützen auflöst, in Aufschriften, die nur ein Professor entziffert, für den Fall, dass er doch noch zur Hinrichtung kommt. Aber viel zu tun und so lebhaft die Strecke, dass man auf Abstecher besser verzichtet.
Kann auch sein, ich täusche mich. Vielleicht ist der Professor längst angekommen, von oben bis unten fröhlich in Grün, und liegt mit unterm Tisch, einer von achthundertachtzig Soldaten. Während Peitsche frisches Feuer ans Holz legt, weil der Regen versucht, die Flammen zu löschen.
Die Wahrheit ist einfach und leicht zu ertragen, ich kann keinen Lichtschalter finden. Also taste ich mich von Wand zu Wand, am Regal vorbei bis zur Fensterbank, von der Fensterbank mutig weiter nach oben, an den oberen Rand des Fensterrahmens, wo ich auch nichts finde, weshalb ich mich bücke, um unten nach Verstecken zu suchen. Ich hob sogar die Teppiche an.
Weiß der Teufel, wo sich das Licht befindet, das ich brauche, um diese Mützen zu lesen. Aber nichts. Ich höre nur leises Knacken und Knistern, das Rascheln der Kleider der Siebenlinge, die sich im Traum auf die andere Seite drehen. Ich höre das Rauschen des Regens, das Schlagen eines Löffels ans Glas.
Plötzlich stand Peitsche hinter mir, ein weißes Hemd in der Dunkelheit, als wäre er gar nicht weg gewesen. Heilige Einfalt! Er fasste mich von links an der Schulter, von rechts hielt er mir einen Nachtisch hin. Mehr war nicht zu holen, sagte er leise und aß ihn dann selbst, weil er sah, dass ich keinen Hunger hatte. Dann ging er hinüber zur Fensterbank, schob mit leichter Hand ein paar Mützen beiseite und machte Licht.
Ein sanftes Licht, das das Zimmer in eine Dämmerung taucht, die den Schrecken der Mützen verschwinden lässt. Schlafende Tiere. Harmlose Falter, die halb tot verstaubt auf der Fensterbank liegen und darauf warten, dass jemand sie wieder zum Leben erweckt. Oder darauf, dass ich sie endlich berühre, damit sie in Frieden zerfallen können, um am Jüngsten Tag mit den Flügeln zu schlagen, wie ein absichtsloser Teil der Natur.
Ich halte mich hier nur selten auf, sagte Peitsche, als spräche er eine Entschuldigung aus. Vielleicht aber auch eine Liebeserklärung. An die Mützen auf sämtlichen Fensterbänken, an die aufrechten Mützen in den Regalen, an die verlorenen Mützen unter den Schränken, an die schlaflosen Mützen auf seinem Bett, auf Decken und Kissen. Ein Gebet für die zertretenen Mützen auf dem Boden, schmutzige unvollendete Mützen, über den ganzen Teppich verstreut.