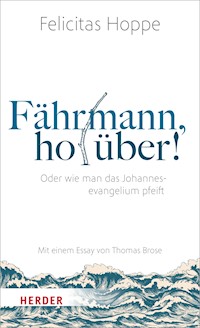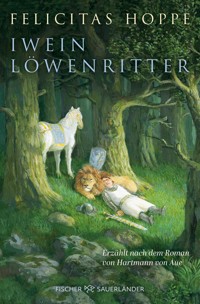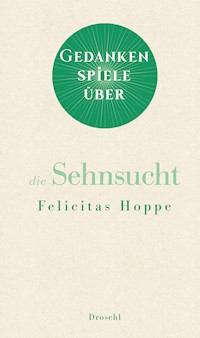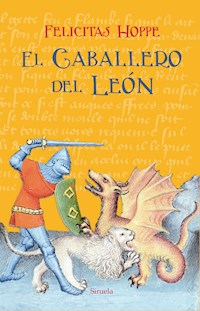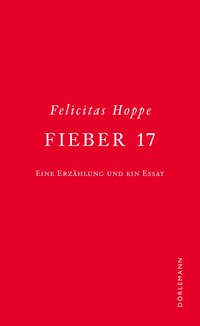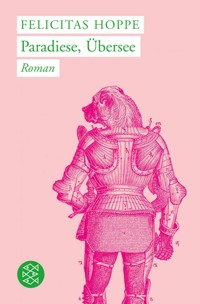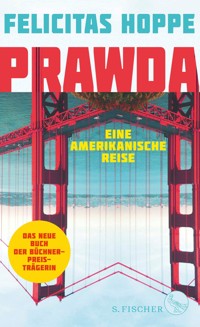
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Westen endlich was Neues: die Wahrheit über Amerika Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe auf Expedition in einem unbekannten Amerika: Zehntausend so komische wie hochpoetische Meilen reist Hoppe von Boston über San Francisco bis Los Angeles und zurück nach New York. Hellwach und hellsichtig begibt sie sich als literarischer Wirbelsturm auf die Spuren von Ilf und Petrow, zweier russischer Schriftsteller, die 80 Jahre vor ihr unterwegs waren und zu Kultfiguren wurden. Ob Hoppe mit ihnen die Ford-Werke und den ersten elektrischen Stuhl besichtigt, nebenbei den Zaun von Tom Sawyer streicht, in einem Tornado verschwindet oder im Auge des Sturms auf Quentin Tarantino persönlich trifft – »Prawda« (russisch: Wahrheit) lässt die Leser Dinge sehen, wie sie über das unglaublichste Land der Erde noch nie geschrieben wurden: eine literarische Weltentdeckung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Felicitas Hoppe
Prawda
Eine amerikanische Reise
Über dieses Buch
»Wir sind hier doch nicht in Amerika!« Von Boston nach San Francisco bis Los Angeles und zurück nach New York: Die Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe erkundet ein phantastisch unbekanntes Amerika. Zehntausend so komische wie hochpoetische Meilen – eine literarische Weltentdeckung.
»Ein Narr, wer sich nicht auf dieses literarische Abenteuer einlässt.« Aygül Cizmecioglu, Deutsche Welle
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2018S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Büro KLASS, Hamburg
Coverabbildung: Büro KLASS, Hamburg unter Verwendung eines Motivs von Rich Niewiroski
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401614-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Motto
3668IlfPetrow
Nordosten
Mitte
Twister
Russian America
Der begnadigte Truthahn
Danksagung
Die Reise ist noch nicht zu End, wenn man Kirch und Turm erkennt.
3668IlfPetrow heißt ein von der sowjetischen Astronomin Ljudmila Georgijewna Karatschkina entdeckter Kleinplanet, getauft auf die Namen des Schriftstellerduos Ilja Ilf und Jewgeni Petrow, die in den dreißiger Jahren des langsam versinkenden letzten Jahrhunderts vier Monate lang im Auftrag der Prawda unter der Führung von Mr und Ms Trone alias Adams, deren Geschichte hier nicht erzählt werden kann, die Vereinigten Staaten von Amerika in sechzig Tagen, über zehntausend Meilen, von Ost nach West und von Südwest nach Ost bereisten. Danach bestiegen sie ein Schiff, fuhren wieder nach Haus und schrieben ein Buch. Ihnen ist diese Reise gewidmet.
Nordosten
Wir sind hier doch nicht in Amerika! Schreiben Sie das in Ihre Notizbücher, Gentlemen, falls einer von uns tatsächlich noch einmal versuchen sollte, die Füße auf Ihren Schreibtisch zu legen. Nicht dass wir das wollen, wir können nicht anders, Amerika ist nun mal das Land unserer Träume: Ein freies Land mit sehr freien Menschen, jeder sein eigener Sheriff, einsam rauchend, ohne Manieren, mit einem eigenen Stern auf der Brust und einem Hut auf dem Kopf, den er auch beim Essen nicht abnimmt. Und mit einem windigen Schreibtisch hinter der Schwingtür, auf dem bis heute, wenn der Mörder von hinten die Stube betritt, gestiefelt, gespornt, übereinandergekreuzt, unsere nach Westen gerichteten Fersen liegen. Wir sind einfach unsterblich.
Schreiben Sie das in Ihre Notizbücher, Gentlemen: Wir sind unsterblich. Und ergänzen Sie, damit hier keine Verwechslung aufkommt, dass ich bis heute kein Sheriff bin, keinen Schreibtisch, keinen Stern und kein Hobby habe, keine Kuh, keine Firma und Sporen schon gar nicht. Aber schreiben Sie auch, dass mein Vater aussah wie Karl May und dass meine Mutter die schwarzen Haare einer Indianerin trug. Zum Fasching ging sie mit Stirnband, als Squaw, mit Zöpfen bis auf die Hüften hinunter, er als Orientale, mit aufgemaltem Schnurrbart und Fes. Sie reisten auf ihre eigene Art und auf eigene Kosten.
Karl May konnte mein Vater auswendig, nur das Land der Seen seiner Träume hat er niemals gesehen. Was braucht ein Land, wer den Kosmos hat? Er ging barfuß von Schlesien nach Niedersachsen und wurde, was er immer schon war, Filmvorführer und Missionar, in Gemeindehäusern und Kinozelten, wo man ausländische Namen bis heute so fröhlich mit deutscher Zunge ausspricht wie sein Großvater, der Kürschner, der wirklich (tatsächlich) nach Amerika ging, denn seine Frau war am Eselsfieber erkrankt und glaubte fest ans Schlaraffenland, bis er, im Angesicht unerfüllbarer Träume, die schlesische Flinte ins amerikanische Korn warf, weil er an deutsche Sprichwörter glaubte. Er gab einfach auf, kehrte um und verstarb.
Schuld daran sind natürlich die Russen. Diese abscheulichen Russen mit ihrem entsetzlichen Gegengewicht, mit ihren schrecklichen Büchern. Bücher wie Dynamit, die bis heute mit Schicksalen gegenhalten, die einer anderen, finsteren Schwerkraft folgen und meine Mutter tiefer und anders trafen als alle rauchenden Colts. Anna Karenina rezitierte sie, so händeringend wie lässig, aus dem Stegreif, auf langen Spaziergängen, durch sämtliche Winterlandschaften. Wir, die hungrigen vier, lauschten und blieben ergriffen schlaflos zurück, hinter dünnen Wänden in kleinen Zimmern, in die weder Schreibtisch noch Sporen passten, dafür endlose Selbstmörderzüge, die unablässig durch die Bahnhöfe unserer Träume rasten, ohne ein einziges Mal anzuhalten. Immer gegen die Sonne, von Westen nach Osten, einmal Sibirien, keinmal zurück. Warum ist es in Sibirien so kalt? Weil Gott es so will, sagt mein Bruder, der Kutscher.
Aber legt man erst einmal die Ketten ab, wozu haben wir schließlich Zähne und Zangen, fährt man ganz wie von selbst einfach weiter, was im Traum so leicht ist, wie durch Meere zu schwimmen, die Jahreszeit spielt keine Rolle mehr. Was scheren den Flüchtling, den Schwimmer, die eisige Scholle, das Beringmeer, die Aleuten, Alaska. Am Ende, denn die Erde ist rund, kommen wir durch die Hintertür zurück ins Land der Verheißung, ins freie Geschehen, und stehen plötzlich nicht mehr im Schnee, sondern unter der brennenden kalifornischen Sonne. Vier unauffällig gekleidete Gestalten, die, leicht erschöpft zwar und leicht gebückt von der beschwerlichen Reise, ihr kleines bescheidenes Glück machen wollen, das Gesicht nicht gen Himmel, sondern zu Boden gerichtet. Vier furchtlose Schürfer, die eines Tages garantiert jenen Schatz finden werden, den man bis heute vergeblich sucht.
Ein guter Plan, ziemlich gut sogar. Allerdings muss er erst ausgeführt werden, was zunächst heißt, von allen Zweifeln befreit. Platz für die Bühne, für frische Visionen! Vorbilder gibt es ja reichlich, schließlich sind wir hier drüben nicht die Ersten. Der Kürschner war jedenfalls vor uns da. Und nach dem Kürschner ein zweiter Kürschner, mit einer anderen, dritten Frau, die den Zweifel, nichts als die langsam fallende Feder einer halbtoten deutschen Brieftaube, entschlossen von ihrem schmutzigen Ärmel bläst, denselben Ärmel nach außen dreht, sich als Köchin in der Wüste verdingt, drei Jahre im Diner Zum letzten Kaktus entschlossen Buletten und Pfannkuchen wendet, nebenbei heldenhaft Kaffee aufgießt, danach ins höhere Management aufsteigt und den alten Kürschner beiseiteschiebt, um ihre eigene Kette zu gründen: Enjoy your personal prick any time! Damit warb sie und blieb.
Aber will man sich daran ein Beispiel nehmen? Will man wirklich Besitzer von Prickly Pears sein? Kamen nicht andere, Größere vor ihr? Geht nicht alles längst drunter und drüber in der großen Küche des dampfenden Fortschritts, in der, Hand in Hand mit meiner Erinnerung, meine Halbbildung so entschlossen alles in eins kocht und so rührend verherrlicht, die Lebenden wie die Toten: Tante Erika aus Amerika, Kolumbus und Tocqueville, John Jacob Astor und Levi Strauss, Karl Pfizer aus Ludwigsburg und Max Kade aus Steinbach, Rockefeller aus Rockenfeld, Steinweg und Söhne, MrundMsAdams, Ilf und Petrow, Martin L. King, Brecht und Adorno, da Ponte und Weber, Dixie und Jazz, Hustensaft und verwaschene Hosen, Meinung und Mode, Sklaven und Kunst, Geschäfte und Krieg, Dollar und Daten, Dr. Seuss, Dr. Apple und Dr. Jobs.
Ach, all diese fröhlichen Doppelagenten mit ihren schnell verderblichen Schatten und ihren zweiten und dritten Gesichtern, von den Durchgereisten gar nicht zu reden. Dann schon lieber ein Doktor wie Snowden, Spion und Schneemann in einer Person, der kurz vor der Sintflut mit knapper Not durch die Hintertür nach Russland entkam und, wenn er nicht gestorben ist, bis heute vor einem Bildschirm sitzt, Brieftauben füttert, Daten auf Trab bringt und darauf wartet, sich endlich in einen russischen Roman zu verwandeln, der mit dem einfachen Satz beginnt: Alle glücklichen Spione sind einander ähnlich, jeder unglückliche Spion ist unglücklich auf seine Weise.
Was allerdings sein Unglück betrifft, so muss man sich Edward wohl eher als Helden einer romantischen Ballade amerikanisch-irischen Ursprungs denken: The Whistleblower, zu singen von einem deutschen Tenor und am Steinway begleitet von einem gewissen Lang Lang. Die beiden trafen sich vermutlich in Boston, Grand Tour, wo sie, kurz vor Abflug bereits leicht außer Atem von den Strapazen der Reise, gemeinsam im Boston Harbor logierten, zusammen aßen und tranken, rauchten, entspannten und, immer wieder von vorn alte Filme von Tom und Jerry sahen, allem voran die berühmte Szene, in der Tom die Ungarische Rhapsodie Nr. 2 cis-Moll von Franz Liszt spielt, während Jerry versucht, ihm ins Handwerk zu pfuschen.
Das alte Spiel: Katz und Maus, Hund gegen Mond, Spion & Spion, die virtuose Kunst aller wirklichen Künstler, Arm in Arm mit ihrem akrobatischen Gegner ein letztes transatlantisches Bündnis zu schließen. Ein unverzichtbar tröstliches Stück im Kampf um Wahrheit und Schönheit, ohne das Lang Lang beim besten Willen nicht einschlafen kann. Schließlich, so die Legende, sei es die allamerikanische Katze gewesen, die ihn als Kind in Shenyang dazu verführt haben soll, sich für immer auf die Klavierkunst des Westens zu werfen. Schreiben Sie das in Ihre Notizbücher, Gentlemen: Ungarische Rhapsodie Nr. 2 cis-Moll.
Aber schreiben Sie auch, dass heute niemand mehr weiß, ob Ungarn wirklich (tatsächlich) im Westen liegt, dass Tom und Jerry in Russland inzwischen verboten sind und dass es, last but not least, an jenem legendären Abend in der Boston Symphony Hall nicht Liszt, sondern die kleine Zugabe war, die schlichte Ballade vom Whistleblower, die unerwartet für Aufruhr sorgte. Das Publikum tobte! Die eine Hälfte vor schierer Begeisterung, die andere Hälfte aus schlichter Empörung über ein Lied, das für eine Zugabe amerikanischen Zuschnitts einfach zu lang war. Denn der deutsche Tenor hielt nicht nur durch bis zur zehnten und letzten Strophe, sondern sang den Refrain am Schluss sogar zweimal, jenen berühmten Refrain, in dem der Whistleblower, kurz bevor er in Hongkong eine Maschine der Aeroflot Richtung Moskau besteigt, mit den Worten eines amerikanischen Heimatdichters auf ergreifende Weise Abschied nimmt:
The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep
Der Wald ist dunkel, süß und tief,
Doch da ist jemand, der mich rief,
Weshalb ich Meilen weiter lief,
Denn da war jemand, der mich rief
Aber der Dichter war nicht allein im Wald. Auch mich hat man gerufen. Jemand hat mich gerufen, jemand hat mich gezwungen aufzustehen, meinen Koffer zu packen und ein letztes Mal auf Reisen zu gehen. Das war am neunten September, zweihundert Jahre nach Tocqueville, achtzig Jahre nach Ilf und Petrow, drei Stunden nach meinem ersten Auftritt bei Radio Goethe und knapp sechs Stunden bevor ich, am Morgen danach, einen roten Ford Explorer bestieg, um in westlicher Richtung zwei Russen zu folgen, die ich beim besten Willen nicht einholen kann, zwei Altmeister der Tarnung, klug genug, sich gegen Rot und für einen mausgrauen Ford zu entscheiden.
So bin ich in Boston gelandet, allerdings nicht im Harbor, sondern im Newbury Guesthouse. Die Nacht war schlaflos und kurz. Hitze stand auf der Feuerleiter, die Kälte in hohen Stiefeln im Zimmer. Der alte Streit zwischen Drinnen und Draußen, zwischen Wachen und Schlafen, der erbitterte Kampf des schlaflosen Gastes gegen die hohe Herrschaft der Klimaanlage. Immer dieselbe kindliche Sorge um den kostbaren Reiseschlaf, immer dieselbe quälende Frage: An oder aus? Versengte oder erkältete Träume? Eine so einfache wie philosophische Frage, auf die es, auch zehntausend Meilen später, keine schlüssige Antwort gibt.
Ein scharfer doppelter Pfiff, und ich erhebe mich wieder, um mit Stiefeln und Sporen über meinen geöffneten Koffer zu fallen, in das hungrige Maul eines feindlichen Tieres, das mir zwischen Bett und Bad den Zugang zum Schreibtisch versperrt. Völlig unmöglich, meine Fersen hochkant in westliche Richtung zu legen, von meinem Wunsch zu rauchen gar nicht zu reden. Aber jemand hat mich gerufen. Weshalb ich mich, meinem schläfrigen Körper zum Trotz, ein letztes Mal gegen die mächtige Klimaanlage erhebe, aufstehe und ans Fenster trete, das Fenster langsam, behutsam nach oben schiebe und durch das halb geöffnete Fenster, jetzt fast schon erlöst, hinaus auf die Feuerleiter trete, um, endlich im Freien, in vollen, kräftigen Zügen, die erste Zigarette des langsam versinkenden Tages zu rauchen, eine kurzatmige American Spirit, orange, die sich, wenn man nicht schnell genug zieht, andauernd selbst zum Verlöschen bringt.
So rauchen nur Angestellte und Frauen. Denn ich bin nicht die Erste, die versucht, sich hier zum Verschwinden zu bringen. Im Hinterhof stehen zwei sehr müde Köche russischer oder asiatischer Herkunft hinter zwei fleckigen Schürzen unter sehr hohen Hüten, an den unteren Rändern leicht angesengt, die sich, im Rücken eine hohe Mauer aus schwarzen Plastiksäcken, gegenseitig über die Stirnen wischen und Blicke über die Schultern werfen, bevor sie sich endlich Feuer geben: zwei Zigaretten, die sich gierig aneinander entzünden, um danach um die Wette herunterzubrennen.
Zwei als Köche getarnte Verbrecher, denen die letzte Stunde schlägt, ohne Aussicht auf Rettung, ohne Hoffnung auf letzte Begnadigung, weshalb sie die Kippen, kurz vor Daumen, kurz vor Schafott, so entschieden wie schicksalsergeben zu Boden werfen, um sie, irgendwo unter der Feuerleiter, mit ihrem linken Turnschuh zu zertreten, als zerträten sie ein Insekt, als wären sie selber nichts als ein Insekt, eine Spinne, ein Käfer, ein Ungeziefer, dessen halbtoter Körper in einer Streichholzschachtel verschwindet, damit die Tat keine Spur hinterlässt. Ihre letzte freie Entscheidung.
Und ich der letzte und einzige Zeuge. Typisch kleiner Tourist, das Zimmer immer bescheiden zum Hinterhof raus, immer schön auf der Seite der kleinen Leute, da fühlt er sich sicher, geladen, gerufen, da glaubt er, Teil des wirklichen Lebens zu sein. Allerdings viel zu verzagt, viel zu sentimental, viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um Anteil zu nehmen. Ein schlechter Schöffe, ein Beisitzer, der nichts verhindern kann. Legt Zeugnis ab, aber erhebt sich nicht. Längst haben die Köche die Flucht ergriffen. Erst als ich sie nicht mehr sehen kann, drücke ich meine Kippe aus, werfe sie hastig übers Geländer, schlüpfe durchs Fenster ins Bett zurück und gebe mich meinen Träumen hin, meiner lachhaften Angst vor den nächsten zehntausend Meilen.
Als hätten nicht Tausende andere vor mir dieselbe Strecke zurückgelegt, in Trecks, auf Pferden, in Kutschen und barfuß, ohne Stiefel und Sporen, ohne Sattel und Bügel, bei Regen und Schnee, im Traum und im Schlaf, von Scholle zu Scholle, alle mutterseelenallein und alle insgesamt sehr schlecht bedichtet. Weil Gott es so will, sagt mein Bruder, der Kutscher. Weil wir alle nur Teil eines Films sind, dessen Betrachter, kurz vor Abspann, den Kasten schließt, um seinen müden Kopf auf ein Kissen zu legen, auf dem reichlich Platz für vier Köpfe ist, reichlich Platz für die Angst vor der Reise und vor denen, die mich begleiten werden.
Denn meinen Führerschein habe ich nur zum Schein, aus purem Trotz, aus reiner Gewohnheit und Angeberei. Weniger Ausweis als Erinnerung, trage ich ihn seit zwanzig Jahren mit mir herum, ein Souvenir aus vergangenen Zeiten, ein Dokument ohne Wert, mit einem Bild, auf dem mich niemand erkennt, auf dem ich mich selbst nicht wiedererkenne und das keinerlei Auskunft darüber gibt, was ich tatsächlich kann, sondern nur über das, was ich einmal wollte: mein eigener Herr sein, meine eigene Dame.
Aber ich bin keine Dame, nur ein reisender Gast, der letzte Möchtegernritter des langsam versinkenden letzten Jahrhunderts, der nicht weiß, was es heißt, eine eigene Firma zu gründen, eine Kuh zu melken, nebenbei ein Hobby zu haben und nach Feierabend Gedichte zu schreiben. Ich bin der, der einfach nur mitfährt, der klassische Windschattentyp. Nacherzähler und Trittbrettfahrer, Karl May und Frau Eckermann in einer Person, die sich überall dranhängt, an die erstbeste Kuh, die erstbeste Kutsche, die mit hängender Zunge auf den fahrenden Zug springt und sich nachher staunend beim Reisen zusieht.
Schreiben Sie das in Ihre Notizbücher, Gentlemen: Seit ich denken und schreiben kann, fahre ich einfach bloß mit. Aber ergänzen Sie auch, dass das keine geringe Aufgabe ist, dass mein Unwissen mich nicht unglücklich macht und dass ich, immer der Nase nach und die Nase immer nach vorn, in das Glück des Zufalls verliebt bin, dass ich auf alles vertraue, was mir reisend entgegenkommt, und dass ich auf alles ein ehrliches Auge habe, auf die Karten von früher und auf die kleinen smarten Geräte von heute, die immer kleiner und kleiner werden, bis sie am Ende verschwinden, um wieder so groß wie früher zu werden.
So vertrauen natürlich nur Frauen, weil Vertrauen ein Ding der Unmöglichkeit ist. Noch unmöglicher allerdings, nicht zu vertrauen, denn nichts lässt sich zum Verschwinden bringen, überall hinterlassen wir Spuren. Selbst meine Träume der vergangenen Nacht sind nicht verschwunden, sondern haben sich auf erstaunliche Weise in einen rauschenden Fluss von Daten verwandelt, in eine so schlichte wie einfache Suchanzeige, die schon morgen früh mein Schicksal besiegelt. Denn während ich schlief und noch glaubte zu träumen, ist meine Reiselust durch den Äther gewandert und hat sich in den Wunsch nach Gesellschaft verwandelt, in die Suche nach passenden Reisebegleitern.
Der Text, von dem ich bis eben nichts wusste, weil die Maschine ihn ohne mein Zutun verfasst hat, lautet so: Wanted: Deutsche Schriftstellerin auf der Suche nach einem russischen Kleinplaneten, sucht kundige fahrtüchtige Begleitung für eine Reise durch die USA in vierzig Tagen über zehntausend amerikanische Meilen von Ost nach West und zurück von Westen nach Osten. Fremdsprachenkenntnisse erwünscht, ebenso Kenntnisse in Navigation und Landeskunde, Flora und Fauna, Architektur, Baukunst und abbildenden Techniken. Bewerber mit Wahlkampferfahrung, Führerschein und Eigenmitteln bevorzugt. Keine Altersbegrenzung. Interessenten melden sich am zehnten September (7–8 a.m.) im Frühstücksraum des Newbury Guesthouse Boston oder bei Radio Goethe. Abfahrt verbindlich um 9 a.m. Wetterversprechen sonnig und warm. Erster Halt Sing Sing.
Sobald ein Wunsch in Erfüllung geht, rächt sich die Wirklichkeit an den Träumen. Am nächsten Morgen war ich nicht mehr allein. Die Geister, die ich gerufen hatte, drängten sich im Frühstücksraum des Newbury Guesthouse zwischen Rührei und Kaffee, französischem Toast und englischen Bohnen, lauter arbeitslose Goldsucher, alle kundig und enthusiastisch, die Jüngste sechs, der Älteste achtzig. Alle mit gültigem Führerschein, keiner krankenversichert, aber alle bis an die Zähne mit Ratschlag bewaffnet, mit Navigationsgeräten und handlichen Telefonen, mit Wünschelruten und Kameras, mit Reiseführern und Wörterbüchern, mit Fernrohren, Tablets und astronomischen Karten, mit Zeichenstift und Papier. Auch Staffeleien waren dabei, Angeln, Schaufeln und Schürfgerät, ein Schmetterlingsnetz und ein Jagdgewehr. Völlig unmöglich, eine Auswahl zu treffen. Alle glücklichen Reisenden sind einander ähnlich.
Nur was die Reiseroute betrifft, konnten sie sich nicht einig werden, jeder ein König in seinem eigenen Reich, ein Präsident von morgen, mit einer einzigartigen Route im Kopf. Lauter Reisebegleiter durch ein riesiges Land, das sie kennen wie ihre Westentasche, aber nie mit eigenen Augen sahen, keiner, der jemals cross country fuhr, aber alle ausdauernd damit beschäftigt, ihr Land zu verschönern und zu verbessern, zwischen Küste und Küste hier etwas zu streichen, um dort wieder etwas hinzuzufügen: God’s own country! So viele Gärtner für nur ein Paradies.
Schreiben Sie das in Ihre Notizbücher! Aber schreiben Sie auch, dass an jenem Morgen im Newbury Guesthouse große Einigkeit herrschte im Widerstand gegen die Route von Mr Adams alias Solomon Trone. Wer das überhaupt sei, dieser Ingenieur aus dem Baltikum, der nie einen eigenen Führerschein hatte, aber mehr als einmal behauptet hat, genau zu wissen, wo Amerika liegt. Schuld sind natürlich die Russen mit ihrer kommunistischen Reiselust, mit ihrem Zweimonatsplan, zwei als Erfolgsschriftsteller getarnte Spione, nicht auf Erlebnisse, sondern Ergebnisse aus, nichts als Handlanger und Erfüllungsgehilfen, Auftragsreisende ohne eigenes Auto, ohne Lizenz und Führerschein, ohne jede Kenntnis der englischen Sprache, reisende Knechte im Auftrag von Väterchen Stalin.
Revolutionstouristen. Trittbrettfahrer von Küste zu Küste, einmal hin und wieder zurück, um wenig später ein Schiff zu besteigen und für immer dorthin zu fahren, woher sie gekommen sind, nach Moskau, wo sie, kurz vor Schafott, ihr letztes gemeinsames Buch verfassen, in dem sich nichts von dem wiederfindet, was Amerika war, was Amerika ist, was Amerika hätte gewesen sein können, was Amerika wirklich bedeutet, was es mit Streifen und Sternen auf sich hat. Kleinplanetarier eben. Zwei russische Hunde, die offenbar immer noch glauben, dass der Mond eines Tages ihnen gehört.
Und da wir schon bei den Planeten sind: Wer ist eigentlich diese Ljudmila Karatschkina? Ljudmila Georgijewna Karatschkina, sage ich laut und vernehmlich, ist eine in Rostov am Don geborene ukrainische Astronomin, die neben IlfPetrow noch ein paar andere Kleinplaneten entdeckt hat: Tarkowskij, Achmatowa, Bulgakow. Und an diesem strahlenden Morgen des zehnten September bereits im Begriff ist, noch zwei weitere zu entdecken. Einen als Landschaftsgärtner getarnten Künstler aus Kiew, der, als Sohn eines russischen Generals auf der Suche nach dem größten Kaktus der Welt unter dem Decknamen Foma reist, und eine gewisse Frau Miller, alias Jerry, Tochter eines Hauptmanns aus Halle, die auf Hochzeitsreisende spezialisiert ist und ein Stipendium auf den Kopf hauen muss. Arbeitstitel: Bräute am Wegrand.
Wir waren uns bereits im Frühstücksraum nähergekommen, an einem kleinen Tisch in der Ecke, wo wir gemeinsam einen Turm Pfannkuchen unter Ahornsirup mit Speck und Spiegeleiern verschlangen, danach frisches Obst. Spätestens nach dem dritten Kaffee wurde mir klar, dass wir zwar unterschiedliche Absichten hatten, aber dasselbe Ziel verfolgten: Wir wollten alle von Osten nach Westen. Der Plan war im Handumdrehen geschmiedet, es fehlten nur noch die Mittel. Weshalb ich mich für die einfache Lösung entschied, für die Wahl durch Zufall, für drei deutsche Sprichwörter auf einer Serviette. Wer ihre Bedeutung errät, sagte ich, muss mit, ohne Ausstieg, unwiderruflich gefangen für die nächsten zehntausend Meilen.
Und schon fangen die Reihen an, sich zu lichten, die Begeisterung zieht sich zurück, die Karten und Wörterbücher verschwinden, der Führerschein löst sich langsam in Luft auf, die Staffelei klappt zusammen, das Schmetterlingsnetz verliert seine Aussicht auf Beute, die ganze gesammelte Reiselust geht im Halbschlaf zurück nach Hause, zum Lunch. Der Abenteurer schaltet den Fernseher ein, und die Freiheit wird häuslich. Nur der portugiesische Wasserhund bellt im Garten des Weißen Hauses weiter den Mond an. Alle unglücklichen Hunde sind einander ähnlich.
Doch genügt in der Regel ein leiser Pfiff, schon hebt er den Kopf und spitzt seine Ohren. Und ein zweiter, doppelter Pfiff, um ihn aus seiner Deckung zu holen. Da kommt er, der große Meister des Wartens, denn er hat sämtliche Punkte für MsAnnAdams gesammelt, gebürtig aus Wien, seit vierzig Jahren am Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, letzter Gast meines gestrigen Vortrags bei Radio Goethe, die an diesem strahlenden Morgen des zehnten September einfach sitzen geblieben ist, Sprichwörter aus dem Stegreif entziffert und jetzt, so nebenbei wie entschlossen, ihren Steckbrief in die Waagschale wirft: Deutsch als Fremdsprache, erweiterte Weltkartenkunde, Verkehrsgeschichte, Literatur der Romantik und einen gültigen Führerschein. Hat beide Augen im Segel, schert die Mitreisenden, aber schindet sie nicht und wirft die Flinte niemals ins Korn, weil sie nicht an Sprichwörter glaubt. Glaubt fest an fast gar nichts, versucht nicht, den Teufel aufs Kissen zu binden, drängt sich nicht auf, ist mit Eigenbeteiligung krankenversichert und weiß, wie man Tauben in Spatzen verwandelt.
Eingewandert ohne Spuren von Heimweh, setzt sie auf Selbstvernichtung durch Metamorphosen: Raucht nach wie vor wie ein Sheriff, fährt wie ein Ranger, braucht keinen Schlaf und träumt davon, Mitglied der Royal Geographic Society zu werden. Fährt bei Wind und Wetter, schließt niemals die Augen. Ist jederzeit vorbereitet auf alles, was kommt. Unbestechlich. Weiß immer Bescheid und weiß fast alles besser. Hält Vorträge ausschließlich privat.
Ein überzeugend schlichtes Profil. Nur mit dem Namen stimmt etwas nicht. Dass im Paradies jeder Zweite ein Adams ist, ist zwar bekannt, aber AnnAdams ist ebenso wenig ein Adams wie Solomon Trone, sie hält sich seit vierzig Jahren bedeckt und reist nach wie vor unter falschem Namen, was im Paradies der ewigen Selbsterfindung alles andere als eine Seltenheit ist. Aber noch bevor mein Misstrauen sich Raum schaffen konnte, zog AnnAdams ihren letzten Trumpf aus dem Ärmel, einen fabrikneuen Ford, der seit gestern Nacht fahrbereit im Hinterhof des Newbury Guesthouse steht. Denn sie reist nach wie vor auf eigene Kosten.
Ein kurzer Blick aus dem Fenster bewies, dass der Ford weit mehr war als ein bloßes Versprechen. Da steht er und glänzt wie ein Hochzeitsgeschenk, wie eben erschaffen, taufrisch vom Band. Kein Ford Escape, kein Ford Expedition, sondern die goldene Mitte, der Goldene Schnitt: ein Ford Explorer! Nicht mausgrau, sondern rubinrot wie Dorothys magische Schuhe, mit denen man jederzeit ins Land des Wizard of Oz entkommt. So reisen nur Frauen, denen es völlig unmöglich ist, dem rubinroten Zauber nicht zu verfallen und der Versuchung zu widerstehen, auf Reisen zu gehen.
Doch nicht nur ich war entzückt, nicht nur Jerry hatte plötzlich glänzende Augen, auch Foma verbarg seine Begeisterung nicht, es hatte uns alle auf einmal erwischt, in einem einzigen Augenblick hatten wir uns alle in Red Ruby verliebt. Und aus lauter Ehrfurcht vor dem herrlichen Anblick zog Foma den Strohhut und deutete eine Verbeugung an, wobei nicht ganz klar war, ob er sich vor Ruby oder vor AnnAdams verbeugte, die in sicherer Entfernung stand und rauchte.
Schreiben Sie das in Ihre Notizbücher, Gentlemen, und ergänzen Sie, dass wir achtzig Jahre nach Ilf und Petrow und zweihundert Jahre nach Alexis de Tocqueville endlich den passenden Wagen gefunden haben, die perfekte Kreuzung aus Kutsche und Pferd, das einzige Auto, das uns wirklich durch Amerika bringt und in dem tatsächlich Platz genug für uns alle ist. Ab sofort und für die nächsten zehntausend Meilen sind wir die Schrecklichen Vier: Foma, Jerry und ich, unter der strengen Führung von MsAnnAdams, die ihre Zigarette entschieden auf dem Boden zertrat, bevor sie die Kippe wie nebenbei wieder aufhob und in einer silbernen Büchse verschwinden ließ.
Denn jemand hat uns erkannt, jemand hat uns gerufen, irgendjemand hat uns für die nächsten sechs Wochen beurlaubt, um einen rubinroten Ford zu besteigen und zwei Russen zu folgen, die wir womöglich doch noch einholen werden, nicht nur weil einer von uns fließend Russisch spricht, sondern weil wir weit besser gerüstet sind als Ilf und Petrow und das Ehepaar Adams, weil wir nicht fünfzig Meilen pro Stunde fahren, sondern mehr als siebzig, und das große Land, von Küste zu Küste, nicht in sechzig, sondern in vierzig Tagen erobern werden.
Denn wir haben mehr als nur einen Führerschein, was uns erlaubt, bei Tag wie bei Nacht zu fahren, bei Regen, Hitze und Schnee, begünstigt durch Klimaanlage und Heizung, in jede Richtung verstellbare Sitze, perfekte Innenbeleuchtung, leichte Musik, Trost und Erbauung, Bibelradio rund um die Uhr, Mulden für Kaffeebecher und Chips, kleine Netze mit Platz für Werkzeug und nostalgische Karten, für diverse Stecker und Ladegeräte, wo früher Aschenbecher und Anzünder waren. Plus drei Extraplätze für Gäste, obwohl es längst keine Tramper mehr gibt, und einen riesigen Kofferraum, Platz jede Menge für unsere harmlosen Hobbys, für die Welt von gestern, die Kunst von morgen, für Stative und Staffeleien, für Rucksack und Koffer und eine Kiste mit Büchern, für all das Gute, Schöne und Wahre. Und für die Kühltaschen von MsAnnAdams, bis zum Rand gefüllt, obwohl sie sich ausschließlich von Tabak ernährt.
Es fehlte an nichts, sie hatte alles dabei, als führen wir, mit einem kleinen Abstecher nach Russian America, von Boston aus direkt nach Alaska, danach ohne Halt nach Sibirien weiter und von dort aus direkt auf den Mond. Wozu sonst das interplanetarische Cockpit und die kleine Maschine, unwiderruflich mit dem Körper des russischen Gärtners verwachsen, aus der die vertraute Stimme von Becky ertönt, unserer Navigatorin für die nächsten zehntausend Meilen, die all die fremden englischen Namen so fröhlich mit deutscher Zunge ausspricht, eine dauerhaft freundliche Stimme, die uns unbeschadet durch ein Land bringen wird, das wir endlich mit eigenen Augen sehen.
Allerdings nur, solange AnnAdams nicht fährt. Denn solange AnnAdams am Steuer sitzt, muss Becky verstummen, weil gelegentlich eine leise Eifersucht aufkommt, zwischen Stimme und Stimme, zwischen der ersten und der zweiten Frau Adams. Denn AnnAdams hält nichts von Becky, sie folgt ausschließlich ihrer eigenen Stimme, ihrer eigenen Nase, ihren eigenen Karten, ihrem eigenen Kopf und ihrem amerikanischen Pass.
Während Foma Kopilot spielte und Jerry ihre Hochzeitsbilder sortierte, saß ich auf dem einzigen Platz, der für mich übrig geblieben war: hinten links, gleich hinter dem Fahrer, im akademischen Volksmund auch als Tocquevilleerker bekannt. Rein statistisch betrachtet der sicherste Platz, weil man von dort aus den Fahrer beim Fahren nicht sieht und sich, lesend, schreibend und schlafend, einfach seinen Gedanken hingeben kann. Toter Winkel, ein perfektes Künstlerversteck für den, der nur zum Schein einen Führerschein hat und die Dinge gern etwas anders betrachtet, immer leicht nach hinten verschoben und damit immer der Zeit voraus.
Aber vergessen Sie eins nicht, Frau Eckermann: Sobald hinten ein Wunsch in Erfüllung geht, beginnt vorne der Streit um den Schlüssel zur Herrschaft. Kaum hatten wir Boston verlassen, begann Foma auf dem Beifahrersitz unruhig zu werden, der Gärtner wollte mit Macht ans Steuer, denn er hatte sich längst mit der Stimme von Becky gegen die Führung von MsAnnAdams verbündet. Aber AnnAdams fuhr ungerührt weiter, immer stur geradeaus, während neben mir Jerry ihre Hochzeitsbilder in immer höhere Ordnungen brachte, lauter Bräute, die, ohne mit der Wimper zu zucken, in immer denselben Kostümen in eine fremde Kamera starren, in die Mündung des ewigen Glücks, um sich endlich in den Traum von sich selbst zu verwandeln.
Dann begann es zu regnen, Nieselregen in einer farblosen Landschaft, leichter Verkehr, der amerikanisch dahinfloss, nichts, was das Auge gefangennahm, nichts, was mich wirklich in Stimmung brachte. Bis ich plötzlich den Abzweig nach Springfield entdeckte und laut und begeistert Springfield rief, als wäre ich auf eine verborgene Quelle gestoßen, auf ein Frühlingsfeld im September, obwohl ich genau wusste, dass dieses Springfield nur das erste von mindestens hundert weiteren Springfields war, die uns auf dieser Reise begegnen würden. Aber wo, wenn nicht hier, an einem Ort, dessen Name sich unendlich vervielfachen kann, muss das wahre Amerika sein?
Schreiben Sie das in Ihre Notizbücher, Gentlemen. Aber erwähnen Sie auch, dass es kein Zufall war, dass bereits hier, wenige Meilen vor Springfield, AnnAdams zum ersten Mal Opfer ihres entsetzlichen enzyklopädischen Wissens wurde. Unvermittelt brach sie ihr Schweigen und begann aus dem Stegreif einen Vortrag zu halten, den ersten von endlosen weiteren Vorträgen über das wahre Amerika, das überall sei, nur nicht hier in Springfield, in Springfield, Massachusetts, schon gar nicht. Hier gäbe es nämlich, außer Smith and Wesson, dem größten Hersteller amerikanischer Handfeuerwaffen, überhaupt nichts zu sehen. Selbst der berühmteste Sohn der Stadt, Theodor Geisel alias Dr. Seuss, der größte Kinderbuchautor der Welt, Erfinder des Grinch, der Weihnachten stahl, Erfinder von Füchsen und Katzen in Socken, natürlich kein Doktor, sondern lediglich in Hochstapelei promoviert, habe die Stadt beizeiten verlassen, um in den Goldenen Westen zu ziehen, in eine Villa bei San Diego, umgeben von Mauern, elektrischen Zäunen und einem riesigen Garten mit Kakteen und Palmen, bewässert rund um die Uhr.
Von der Inneneinrichtung gar nicht zu reden: Zeichentische aus Eiche und Teak, Staffeleien aus Marmor, im Hinterzimmer ein Kabinett voller Hüte, Denkkappen zum Zweck der Inspiration. Doch weder Kappe noch Kunst, noch sein vager Titel vermochten den Doktor zu retten, denn in seinem Inneren lauerte eine heimtückische Krankheit, verwaltet von einer Frau in rubinroten Schuhen, die seidene Hauben und Schürzen trug und, mit der Rolle der Künstlergattin vertraut, jeden Morgen einen neuen Vertrag mit dem Tod unterzeichnete.
Was längst nicht mehr Teil ihres Vortrags war, sondern bereits Teil meiner lauschenden Phantasie, die sich im Tocquevilleerker zunehmend Raum schaffte und haltlos auszuufern begann. Denn so hätte AnnAdams es niemals gesagt, nie im Leben drückt sich AnnAdams so aus, Übertreibungen sind ihr vollkommen fremd. Ihre Vorträge sind eindeutig von Fakten gesättigt, immer nüchtern und auf den Punkt, ohne Sinn für die phantastischen Seitenstraßen des Lebens. Aber sie hatte sich längst verstrickt und erreichte genau das Gegenteil von dem, was sie hatte erreichen wollen. Je länger sie sprach, umso mehr wurden wir Feuer und Flamme, denn jetzt wollten wir wirklich (tatsächlich) nach Springfield. Ich, um das Geburtshaus des Doktors zu sehen, Foma, um endlich ans Steuer zu kommen, und Jerry, um das erste Bild ihrer Sammlung Bräute am Wegrand zu machen, das mich, mutterseelenallein, vor einem verlassenen Haus in Springfield zeigt.
In letzter Sekunde bogen wir ab und landeten auf einem trostlosen Parkplatz, gleich neben dem ersten amerikanischen Aldi, und fanden uns umzingelt von einer freundlichen Schar fröhlicher Helfer. Wer wir sind, was wir wollen? Reisende Künstler. Aha. Gleich will man was bieten. Hat man nicht neulich von einem Garten gehört, in der Nähe der städtischen Bibliothek, wo man die Figuren des Doktors bewundern kann? Nicht dass man dort selbst je gewesen ist, doch der Eintritt, so hört man, ist frei. AnnAdams hörte gar nicht erst hin. Sie hatte sich längst von der Truppe entfernt, um sich in sicherer Entfernung neben einem hüfthohen Papierkorb rauchend zum Verschwinden zu bringen, mit einer kompromisslosen Double Red Road, die sie tief inhalierte, wobei sie nervös auf die Armbanduhr blickte, wiederholt den Distanzplan aus ihrer Handtasche zog, die mit ihrer rechten Schulter verwachsen schien, und uns so diskret wie deutlich zu verstehen gab, dass wir keine Zeit zu verlieren hatten.
Was Jerry nicht daran hinderte, zurück auf die Straße zu laufen, bis ans Ende der Welt, das in Springfield, Massachusetts, deutlich markiert ist, links vom Highway und rechts von einer Reihe verlassener Häuser. Ich lief hinterher wie ein Kind, das letzte Buch von Dr. Seuss in der Hand, das Buch eines toten Millionärs, der auch posthum nicht aufhören darf, weiter zu schreiben und weiter zu zeichnen, mit dem schönen Titel: What pet should I get? Zu gut Deutsch: Wer wird mich streicheln und trösten, wenn ich nach der Schule nach Hause komme, und niemand ist da?
Außer Jerry und mir war niemand zu sehen. Aber Jerry, der Profi, wusste genau, was sie wollte: Du nimmst jetzt einfach mal dieses Buch in die Hand, sagte Jerry, und hältst es nach vorn in die Mündung, und jetzt such dir das nächstbeste Haus aus, ein Haus, von dem du dir vorstellen kannst, hier wäre der Doktor wirklich geboren, von hier aus wäre er morgens tatsächlich zur Schule gegangen. Stell dir das einfach mal vor, sagte Jerry. Dann drückte sie ab.
Die ersten Bilder der Serie Bräute am Wegrand beweisen erstens, dass Jerry wirklich eine Künstlerin ist und dass zweitens die Rechnung gelegentlich aufgeht, dass es also tatsächlich möglich ist, einen Kompromiss zwischen Mensch und Bild zu finden. Das erste Foto zeigt mich, vor dem Ortsschild von Springfield, ein überfordertes Kind kurz nach Reisebeginn. Das zweite zeigt wiederum mich, in einer Nebenstraße am Ende der Welt, im Vorgarten eines verlassenen Hauses in einem verrotteten Schaukelstuhl sitzend, auf dem außer mir nie jemand sitzt, in der Hand wie die Einschulungsfibel ein Buch, dessen erster und wichtigster Merksatz lautet: Make up your mind.
Wer allerdings etwas genauer hinschaut, wird im Hintergrund, erstes Stockwerk, zweites Fenster von links, ein unbekanntes Gesicht entdecken, das Gesicht jenes unbekannten Bewohners von Springfield, der, kurz bevor er zum Angriff überging, an einem verregneten Nachmittag im September offenbar langfristig arbeitslos war und seine Zeit vermutlich damit verbrachte, eine Sammlung kleinerer Handfeuerwaffen in eine höhere Ordnung zu bringen, wobei er verständlicherweise nicht gestört werden wollte.
Weshalb ich, ängstlich, wie ich nun einmal bin, Jerry, den furchtlosen Profi, dazu antrieb, den Ort möglichst schnell wieder zu verlassen, um zu Foma und AnnAdams zurückzukehren, die auf dem Parkplatz zwischen Ruby und Aldi immer noch den Distanzplan studierten und sich, während unserer kurzen Abwesenheit, über die Schlüsselgewalt verständigt hatten.
Wie der Distanzplan von AnnAdams beweist, ist es zwar möglich, aber nicht machbar, von Boston aus an einem einzigen Tag erst Sing Sing und danach die elektrische Stadt, Schenectady, Upstate New York, zu besuchen, wo sich das Museum für Fortschritt und Wissenschaft befindet. Weshalb ich bereits kurz hinter Boston beschloss, darauf zu verzichten, 125 Jahre nach seiner Erfindung, den ersten elektrischen Stuhl der Welt mit eigenen Augen zu sehen, und mich stattdessen darauf beschränkte, im Tocquevilleerker, von hinten links, laut und ergreifend zum Besten zu geben, wie Ilf und Petrow vor achtzig Jahren, unter der Führung von Ehepaar Adams und auf Vermittlung von Ernest Hemingway, das berühmteste Gefängnis aller Zeiten betreten:
Wie der Direktor, Hemingways Schwiegervater, sie freundlich empfängt. Wie er sie in den Raum mit dem Eichenstuhl führt. Ein Wohnzimmer ohne Fenster nach draußen. In der Mitte der Stuhl, auf den das erbarmungslose elektrische Licht fällt. Wie plötzlich die große Stille eintritt. Wie Mr Adams entschlossen das Schweigen bricht und sich, nach langem Bitten und Betteln, endlich auf den Stuhl setzen darf. Wie man ihn auf dem Stuhl platziert. Wie man ihm den Vorgang erklärt. Wie er beflissen die Arme, erst links, dann rechts, auf die abgewetzten Stuhllehnen legt. Wie man ihn feierlich fesselt und bindet. Erst an den Armen, dann an den Beinen. Mit Gurten aus Leder. Wie sich Schweißperlen auf seiner Stirn versammeln, als man die Gurte fester zieht. Wie seine Frau erblasst, als er nach dem elektrischen Helm verlangt. Wie eine zweite, größere Stille eintritt, bevor man ihm, kurz vor Schafott, schließlich entschieden den Helm verweigert, weil der Helm kein Spielzeug, sondern tödlicher Ernst ist.
Und wie Ilf und Petrow einfach weiterschreiben, während Ms Adams entschlossen ihr Taschentuch zieht, eine kleine Fahne privater Ergebung, weil Mr Adams einfach nicht aufhören kann, weiter zu betteln und weiter zu drängeln, weil er das wahre Amerika endlich am eigenen Leib spüren möchte, weil man fühlen muss, was man nicht wissen kann. Bis man ihm, um seine hartnäckige Neugier zu belohnen, statt des Helms zwei Elektroden auf der nackten Kopfhaut seiner Glatze befestigt, damit endlich Ruhe einkehrt, damit er das Ziel seiner Wünsche erreicht und sich vom Zuschauer in einen Täter verwandelt, um endlich selbst das Opfer zu werden, dem erst hier auf dem Stuhl, im allerletzten Moment, blitzartig klar wird, dass die Erfindung des elektrischen Stroms wenig Licht in die Sache des Lebens bringt.
Denn plötzlich herrscht jene Dunkelheit, in die die Geschichte des menschlichen Fortschritts bis heute gehüllt ist, jene kurze Geschichte zwischen Leben und Tod, die von einem Leben erzählt, das irgendwo in der Prärie begann, in einem Planwagen unter freiem Himmel, um nach verzweifeltem Hauen, Schürfen und Stechen in einer geschlossenen Kammer zu enden, auf einem aus Eiche gezimmerten Stuhl, den ein amerikanischer Zahnarzt namens Southwick erfand, nachdem er auf dem Nachhauseweg einen Betrunkenen sah, der Halt an einem Stromgenerator suchte und wie vom Blitz getroffen zu Boden fiel. Woraus Dr. Southwick messerscharf schloss, dass ein einziger Stromstoß genügt, um ein menschliches Leben zum Stillstand zu bringen.
Ein Zahnarzt, an dessen Namen sich vermutlich niemand erinnern würde, hätte nicht Thomas Alva Edison seine Entdeckung mit großer Entschlossenheit in die Praxis vom menschlichen Sterben verwandelt. Als wäre das Sterben ein Geistesblitz, ein Patent auf den letzten Augenblick des menschlichen Lebens, reinste und schönste Erfindung, als hätte Edison nicht schon damals gewusst, was jeder Indianer am Marterpfahl weiß: dass Tod und Sterben zweierlei sind, weil wir erst über die Schwelle müssen, die zwischen dem Wohn- und dem Schlafzimmer liegt, zwischen hier und jenem Land Nebenan, in dem wir endlich allein sein dürfen.
Doch unterschätze man die Entfernung nicht, denn so einfach kommen wir nicht davon. Auch wenn die Tür nach drüben weit offen steht und die Klinke fast schon zum Greifen nah ist, ist der kürzeste Weg nicht selten der längste: Dead man walking! Wer totgesagt ist, muss länger laufen, selbst wenn er, von Kopf bis Fuß angeschnallt, auf einem Eichenstuhl sitzt, während sein Mörder von hinten die Stube betritt, mit Elektroden und einer Kapuze bewaffnet, in der sich ein freundlicher Ausschnitt für die empfindliche menschliche Nase befindet, die die Gefahr schon von weitem riecht. Genau wie die Henkersmahlzeit davor, die in der Regel weit über dem Durchschnitt liegt, angeblich um Längen besser als alles, was man auf den Raststätten zwischen den Küsten sonst so serviert, weshalb man in Texas nach wie vor diskutiert, ob es wirklich (tatsächlich) zulässig ist, einen Mann, der in seinem Wappen die Axt trägt, kurz vor der Schwelle so reich zu bewirten. Ob es stattdessen nicht besser und billiger wäre, ihn vollkommen nüchtern sterben zu lassen.
Aber jetzt sitzt er hier, auf einem Eichenstuhl amerikanischer Bauart, 125 Jahre nach William Kemmler, der seine Freundin mit einer Axt erschlug und die Ehre hatte, der Erste zu sein, dem viele andere folgten. Wobei er fest daran glaubte, mit Hilfe des Stuhls blitzartig in den Himmel zu kommen oder wenigstens auf dem Mond zu landen. Bis heute wissen wir nicht, wohin es diesen Kemmler verschlug, sicher ist nur, dass er, als man ihn festband, seine fortschrittsgläubigen Schergen mit den beherzten Worten begrüßte: Nicht nervös werden, Joe! Ich möchte, dass jetzt gute Arbeit geleistet wird. Dann zog man ihm die Kapuze über. Und der Henker legte den Hebel um.
Allerdings wird selten gute Arbeit geleistet. Denn niemand tritt nüchtern vor seinen Schöpfer, der Henker schon gar nicht. Weshalb dem Delinquenten in der Regel die Augen übergehen, bis sie unkontrolliert aus den Höhlen springen. Aus Nase und Poren strömt frisches Blut. Anstatt gnädig vom Blitz getroffen zu werden, verschmort er langsam, ohne Nachsicht und Gnade, bei lebendigem Leib unter dem Leder, das seine Glieder umschließt, bis er endlich langsam in Rauch aufgeht, während die Fotografen pathetisch in Ohnmacht fallen und die fleißigen Schreiber nicht müde werden, immer wieder von vorn zu erzählen, dass Thomas Alva Edison nicht nur den Tod in die Kammer brachte, sondern, allem voran, Licht und Strom für die bessere Hälfte der Welt, für all die Frauen in all ihren Küchen mit all ihren Backöfen, in denen sie bis zum Jüngsten Tag Gänse und Truthähne braten, wenden und drehen, um sie am Ende mit schmackhaften Soßen zu begießen, als wäre das Leben ein einziger Festtag.
Weshalb es mich an diesem verregneten Nachmittag im September nicht überraschte, dass Sing Sing auf AnnAdams Distanzplan vorsätzlich nicht auf der Strecke lag und dass sie uns umgehend nach Schenectady brachte, obwohl sie längst nicht mehr hinter dem Steuer saß, sondern vorne rechts neben Foma, der durch die Verleihung der Schlüsselgewalt unvermutet gewachsen war. Mir jedenfalls kam es so vor, während ich, hinten links im Tocquevilleerker, die Geschichte von der Erfindung der Glühbirne vortrug und Jerry mit ihrer Kamera auf die langsam bunter werdenden Bäume zielte, auf den falschen Sommer der Indianer des Volksmunds, die den trostlosen Parkplatz vor dem Museum für Wissenschaft und Fortschritt säumten, in dessen Keller sich das Archiv von General Electrics befindet, wo uns Chris Hunter erwartet, um uns die wahre Geschichte des Lichts zu erzählen.
Alle glücklichen Archivare sind einander ähnlich. Das verborgene Leben zwischen Regalen ohne Anfang und Ende, in Kellern, in die selten Tageslicht dringt, der ständige Umgang mit Staub und Papier, mit Akten und langsam zerfallenden Blättern, mit vergilbten Zeitungsausschnitten und Fotografien, die sich mit den Jahren in einen Strom nie versiegender Daten verwandeln, macht sie bucklig und klein, zu Dienern einer höheren Ordnung, unter der sie notwendig schrumpfen müssen, das ist ihr Schicksal. Schreckhafte Nachttiere, schlecht ernährt, unrasiert, nachlässig gekleidet und selbstvergessen neigen sie zu Pedanterie, weshalb sie sich ungern zur Unzeit aufscheuchen lassen.
Also kein Wunder, dass Chris Hunter, der meine elektronische Post niemals beantwortet hatte, erst nach dem dritten Aufruf durch eine freundliche Dame vorne am Tresen in der kleinen Empfangshalle des Museums erschien. Das späte Tageslicht, das auf seine Frisur fiel, die keine Frisur, sondern nichts als ein leiser Hinweis war, dass er dazu verdammt ist, auf Dauer allein zu leben, schien den Maulwurf zu blenden, weshalb er keinem von uns in die Augen sah, sondern, leicht schielend, schräg an uns vorbei, wobei er ständig von einem Fuß auf den anderen trat, ohne ein Wort zu verlieren. Wahrscheinlich hatte er nicht mehr mit uns gerechnet, wie wir nicht mit ihm. So standen wir uns jetzt gegenüber: AnnAdams mit hochgezogenen Schultern, Foma mit Rubys Zweitschlüssel spielend und Jerry mit ihren Objektiven beschäftigt.
Aus Angst, die Erscheinung Hunters könnte sich unvermutet wieder in Luft auflösen, begann ich von großen Projekten zu reden, von Prawda, von einem historischen Auftrag, von Empfehlungsschreiben, die wir nicht hatten, von unserer Suche nach Ilf und Petrow und, allem voran, von einem Film über das Leben von Solomon Trone alias Mr Adams, den irgendein Großneffe dritten Grades über seinen historischen Onkel gedreht hatte und in dem Chris Hunter eine persönliche Rolle spielte. Der Film war keine Erfindung, es gab ihn tatsächlich, ich hatte ihn mehr als einmal gesehen und jederzeit greifbar im Handgepäck.
Jetzt war ich mir allerdings nicht mehr ganz sicher, ob der bucklige Mann in der Halle tatsächlich derselbe Hunter war, denn im Film war er ein anderer Hunter gewesen, eine Art jüngerer Bruder, schlanker, mit einem richtigen Haarschnitt und einer anderen Brille, mit Händen, die in weißen Handschuhen steckten, mit denen er mit theatralischer Sorgfalt und vor laufender Kamera in geheimen Akten geblättert hatte, während er lebhaft Rede und Antwort stand. Beim Reden geriet ich ins Schwärmen über Hunters große persönliche Leistung, über die allgemeine Bedeutung von Archiven weltweit, über die besondere Bedeutung des Archivs von GE und über die unverzichtbare Arbeit der Archivare, die ich die Schatzhüter der Erinnerung nannte, die, wie ich mehrfach betonte, zu Unrecht im Schatten der großen Geschichte stehen, wobei ich mir selber verdächtig wurde.
Der Erfolg blieb nicht aus: Nicht dass Hunter plötzlich gesprochen hätte, doch begann er unter meiner sich steigernden Rede allmählich zu wachsen, sein Rückgrat straffte sich, der Buckel verschwand, er rückte seine Brille zurecht, sein Gesicht begann zu glänzen, und obwohl er mir immer noch nicht in die Augen sah, hörte er immerhin auf zu schielen. Stattdessen begann er zu zwinkern, drehte sich zweimal um die eigene Achse, strich sich verlegen durchs Haar, verbeugte sich vor meiner deutschen Geschwätzigkeit und gab uns endlich das erhoffte Zeichen, ein leichtes, kaum merkbares Winken in Richtung Keller.
So sind wir über die Schwelle gekommen hinunter zum Hort der Elektrifizierung. Im Treppenhaus wurde Jerry wieder lebendig und zögerte keine Sekunde, ihre Kamera auf alles zu richten, was links und rechts an den Wänden hing und ihr irgendwie historisch vorkam. Was Hunter weder zu stören noch zu beeindrucken schien. Schließlich wusste er, was jeder Schatzwächter weiß: dass sich die Schätze weltweit nur scheinbar abbilden lassen, denn sie genügen sich selbst. Genau wie das Archiv und die Archivare. Lauter freundliche Gesichter langsam alternder Kinder, aus denen sich nichts herauslesen lässt, allzeit bereit, alles zu teilen und vor uns auszubreiten, um am Ende das Beste für sich behalten. Denn sie sind die Hüter der Ewigkeit.
Doch jetzt sind wir da. Und tatsächlich, da liegt sie, da fließt sie vor unseren staunenden Augen dahin, die Geschichte des elektrischen Stroms, das Abenteuer der Elektrifizierung, auf immer und unwiderruflich verbunden mit der Geschichte einer Kleinstadt in Upstate New York, deren Namen, Schenectady, Jerry und Foma bis heute nicht aussprechen können und die bei Licht besehen keine Stadt, sondern nichts als ein Musterhaus ist, bewohnt von einer kleinen Gemeinschaft, die bis heute an die fröhliche Wissenschaft glaubt, weil sie nicht nur den elektrischen Stuhl erfand, sondern auch den runden elektrischen Tisch, an dem wir in Zukunft, alle erleuchtet und elektrifiziert, in froher Runde beisammensitzen, um die Welt in eine höhere Ordnung zu bringen, auf den nächsten und neusten Stand, in eine gründlich ausgeleuchtete Lage, in einen Zustand definitiver Erkenntnis. Und das alles zur höheren Ehre Gottes, der endlich aufhören darf, ein Gott zu sein, und sich erleichtert von seinem Thron hinab in den endlosen Datenstrom wirft, um schwimmend rund um die Uhr die immer selbe Parole auszugeben: Es werde Licht!