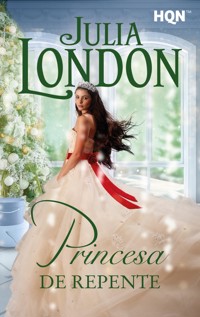Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei mutige Frauen in den Stürmen des Schicksals: Die Familiensaga »Fairchild – Die Regency-Schwestern« von Julia London jetzt als eBook bei dotbooks. Glanz und Schatten der englischen Regency-Epoche … Nach dem Tod ihrer Eltern bleiben die drei Schwestern Ava, Greer und Phoebe völlig mittellos zurück – einzig die Nachricht von einem mysteriösen Erbe ihres Vaters gibt ihnen Hoffnung. Mutig reist Greer nach Wales, um dort bei einem gewissen Lord Radnor mehr in Erfahrung zu bringen: einem Mann, um den sich ebenso faszinierende wie finstere Gerüchte ranken … Ava muss sich derweil in London immer mehr unliebsamer Freier erwehren – und schmiedet schließlich den cleveren Plan, eine Scheinehe einzugehen. Sie hat allerdings nicht damit gerechnet, für ihren »Ehemann« bald höchst unziemliche Gefühle zu entwickeln … Und Phoebe, die jüngste Fairchild-Schwester? Die gerät in eine Zwickmühle, als sie von einem geheimnisvollen Gentleman bei einer gewagten Schwindelei erwischt wird: Wird sie einen Weg finden, um zu verhindern, dass er sie vor der gesamten Londoner Gesellschaft bloßstellt? Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Fairchild – Die Regency-Schwestern« von New-York-Times-Bestsellerautorin Julia London vereint ihre »Regency Kisses«-Saga mit den Bänden »Gefangen von einem Lord«, »In den Fesseln des Dukes« und »In den Händen des Earls«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1315
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Glanz und Schatten der englischen Regency-Epoche … Nach dem Tod ihrer Eltern bleiben die drei Schwestern Ava, Greer und Phoebe völlig mittellos zurück – einzig die Nachricht von einem mysteriösen Erbe ihres Vaters gibt ihnen Hoffnung. Mutig reist Greer nach Wales, um dort bei einem gewissen Lord Radnor mehr in Erfahrung zu bringen: einem Mann, um den sich ebenso faszinierende wie finstere Gerüchte ranken … Ava muss sich derweil in London immer mehr unliebsamer Freier erwehren – und schmiedet schließlich den cleveren Plan, eine Scheinehe einzugehen. Sie hat allerdings nicht damit gerechnet, für ihren »Ehemann« bald höchst unziemliche Gefühle zu entwickeln … Und Phoebe, die jüngste Fairchild-Schwester? Die gerät in eine Zwickmühle, als sie von einem geheimnisvollen Gentleman bei einer gewagten Schwindelei erwischt wird: Wird sie einen Weg finden, um zu verhindern, dass er sie vor der gesamten Londoner Gesellschaft bloßstellt?
Über die Autorin:
Julia London ist eine »New York Times«- und »USA Today«-Bestsellerautorin und hat bislang mehr als 30 Romane veröffentlicht. Aufgewachsen in Texas, arbeitete die passionierte Hundebesitzerin viele Jahre lang in Washington für die amerikanische Regierung. Als sie ihre Liebe zum Schreiben entdeckte, machte sie diese jedoch zum Hauptberuf. Für den besten historischen Liebesroman erhielt sie bereits den »Romantic Times Book Club Award« und war sechs Mal unter den Finalistinnen für den begehrten »RITA Award«. Heute lebt sie wieder in Texas.
Mehr Informationen zu Julia London finden Sie unter julialondon.com.
Bei dotbooks veröffentlichte sie ihre »Regency Kisses«-Trilogie, die in diesem Sammelband enthalten ist, sowie ihre »Lockhart Clan«-Trilogie mit den Bänden:»Highland Passion – Fieber der Leidenschaft«»Highland Passion – Sturm der Sehnsucht«»Highland Passion – Fesseln des Verlangens«Die Reihe ist auch im Sammelband »Regency Passion« erhältlich.
***
Sammelband-Originalausgabe März 2022
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Eine Übersicht über die Copyrights der einzelnen Romane finden Sie am Ende dieses eBooks.
This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © Period Images sowie © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-272-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Fairchild« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Julia London
Fairchild – Die Regency-Schwestern
Die große Saga in einem Band
dotbooks.
Gefangen von einem Lord
Aus dem Amerikanischen von Margarethe van Pée
Wales 1820. Nach dem Tod ihrer Eltern stehen Greer Fairchild und ihre Schwestern vor dem Ruin. Die letzte Rettung könnte eine mysteriöse Erbschaft ihres Vaters sein, doch dafür muss Greer nach Wales reisen, zum düsteren Schloss des Lords von Radnor. Die schöne Lady hat bereits Gerüchte über ihn gehört – und seinem ungestümen Ruf wird der Lord gerecht: Er bezichtigt sie der Lüge. Bis sie ihre Identität bewiesen hat, soll sie seine Gefangene sein – doch Greer denkt gar nicht daran, sich seinem Willen zu unterwerfen. Stattdessen ist sie fest entschlossen, das Geheimnis des Lords zu lüften … aber kann sie auch sein Herz aus Eis zum Schmelzen bringen?
Für Klo, Nagno und Sanman.
Bessere Geschwister als euch kann ich mir nicht vorstellen.
***
Wrth gicio a brathu, mae cariadyn magu.
Walisisches Sprichwort
(Beim Treten und Beißen entwickelt sich die Liebe.)
Kapitel 1
Llanmair Wales, 1820
Als drei Männer – Räuber vermutlich – die Kutsche anhielten, in der Greer Fairchild und Mr Percy reisten, fiel Greer aus einem unerklärlichen Grund als Erstes ein, dass der Tod von Mrs Smithington, deren Reisebegleiterin sie war, nicht nur tragisch, sondern höchst ungelegen war.
Sie befanden sich schon ganz in der Nähe von Llanmair, nachdem sie fast den gesamten Nachmittag über auf holperigen Straßen durchgeschüttelt worden waren. Trotz des düsteren Tags konnte Greer noch die Umrisse des alten, grauen Schlosses erkennen, das auf einem Felsvorsprung inmitten von Wäldern und Bergen thronte.
Es war ein imposantes Gebäude, vier Stockwerke hoch, mit vier Türmen in jeder Ecke. Sie waren schon so nahe am Schloss! Und jetzt das!
»Bleibt hier!«, sagte Mr Percy grimmig, als die Kutsche auf Aufforderung von den drei Reitern ächzend zum Stehen kam. »Ich werde mit ihnen sprechen.« Er stieg aus, schloss die Tür fest hinter sich und trat auf die drei Männer zu, die jetzt zwischen Greer und dem Schlossherrn standen, in dessen Besitz sich Greers Erbe befand.
»Ich halte es nicht aus«, murmelte sie unterdrückt. Nicht nach allem, was sie im letzten Jahr ertragen hatte. Nicht nach dem Tod ihrer Tante und den endlosen Stunden, die sie mit Mrs Smithington in öffentlichen Kutschen mit Leuten verbracht hatte, die sich nichts dabei dachten, wenn sie ihre Hühner und Hunde mitnahmen. Nicht, nachdem sie Tag für Tag durchgerüttelt worden war, einsame Moore oder stockdunkle Wälder durchquert hatte. Und jetzt stand sie kurz vor dem Ziel und wurde aufgehalten.
Es war wirklich äußerst ärgerlich.
Greer spähte aus dem Fenster. Mr Percy stand breitbeinig und mit verschränkten Armen vor den drei Reitern. Stöhnend legte sie den Kopf zurück. Vermutlich sollte sie Angst vor den Männern haben, aber sie empfand nur Erschöpfung und den Schmutz der anstrengenden Reise. Ganz zu schweigen von dem Ekel, den sie verspürte, weil sie seit drei Tagen das gleiche Kleid trug, denn es war verdammt kalt in Wales, und das armselige Kleid war das wärmste Kleidungsstück, das sie besaß.
»Absolut ungelegen«, sagte sie laut.
Wirklich, wenn die arme Mrs Smithington nicht gestorben wäre, hätte Greer diese Reise nach Wales wahrscheinlich im Sommer unternommen, wenn es warm gewesen wäre und die Sonne geschienen hätte. Nicht jetzt, im Spätherbst, wo es so grässlich kalt und feucht war. Und sie hätte Llanmair, wo der König der Diebe – als solchen sah sie ihn mittlerweile – vermutlich lebte, in der Hälfte der Zeit erreicht, weil die Straßen noch nicht so schlammig und voller Schlaglöcher gewesen wären.
Aber die arme Mrs Smithington hatte sich genau an dem Tag, als Greer am verfallenen und lange gesuchten Anwesen ihres Onkels ankam, zu einem Mittagsschlaf hingelegt. Die alte Frau hatte sich einfach niedergelegt und war nicht mehr aufgewacht. Es war eine schreckliche Art zu sterben – allein, ohne Verwandte, abgesehen von einem entfernten Neffen, ihrem Erben, in London. Und obwohl Mrs Smithington einem manchmal auf die Nerven gehen konnte, hatte Greer eine Art unduldsamer Zuneigung zu ihr gefasst und hätte ihr so einen einsamen Tod sicher nicht gewünscht.
Und als Mrs Smithington tot war, wünschte sich Greer, nie nach Wales gekommen zu sein. Wenn nicht der gute Mr Percy gewesen wäre, wäre sie bestimmt zusammen mit Mrs Smithingtons Nachlass nach London zurückgekehrt. Aber Mr Percy hatte sie ermutigt, die Reise fortzusetzen.
Ihre Reise hatte vor einem Jahr begonnen, als Greers gesetzlicher Vormund, Tante Cassandra, Lady Downey, plötzlich und unerwartet gestorben war. Tante Cassandras zweiter Ehemann, Lord Downey, hatte nicht das Verlangen, Greer oder ihre Cousinen Ava und Phoebe zu unterstützen, und er erklärte freiheraus, er würde sie an jeden verheiraten, der um ihre Hand anhalten würde, ungeachtet der sozialen Stellung, des Vermögens oder ihrer Wünsche in dieser Hinsicht.
Das war schon unerträglich genug, aber da Greer nur das Mündel von Lady Downey gewesen war, war sie in der denkbar schlechtesten Lage. Sie hatte weder Familie noch Vermögen, um einen geeigneten Verehrer anzulocken, und aus ihrer Vergangenheit besaß sie nur einen alten Brief und ein paar wenige Habseligkeiten, die ihrer Mutter gehört hatten, und verblasste, schwache Erinnerungen an ihre verstorbene Mutter, einen alten Onkel und einen fernen Vater. Geschwister hatte sie ebenfalls keine.
Um ihren Cousinen und sich das Schicksal zu ersparen, zu dem Lord Downey sie verdammen wollte, hatte Greer sich auf diese verflixte Reise begeben, da sie wusste, dass ihr Vater vor ein paar Jahren verstorben war, ohne einen Erben zu zeugen. Nun wollte sie nach seiner Hinterlassenschaft forschen und dazu ihren Onkel ausfindig machen. Zwar wusste sie nicht, ob ihr Vater überhaupt Vermögen besessen hatte, aber irgendetwas musste doch von seinem Leben übrig geblieben sein, und das hätte dann doch bestimmt der Bruder ihres Vaters geerbt.
Es war zwar nur eine zerbrechliche Hoffnung, aber immerhin eine Hoffnung.
Leider konnte sie sich die Reise nach Wales nur als Begleiterin der uralten, ständig jammernden Mrs Smithington leisten, die »die wilden Gegenden von England« sehen wollte.
Nach monatelanger Reise als Gesellschafterin von Mrs Smithington hatte Greer schließlich Bredwardine erreicht, einen englischen Ort an der Grenze von Wales, wo sie das Anwesen ihres Onkels in einem schockierend verfallenen Zustand vorgefunden hatte. Die vage Erinnerung an ein prächtiges Gebäude mit weiten Rasenflächen und Springbrunnen hatte sich als Fantasie herausgestellt. Man konnte das Haus kaum als Villa, geschweige denn als Schloss bezeichnen, und es gab überhaupt keine Rasenflächen darum herum, nur einen kleinen Garten, in dem ein altes Schwein ziellos umherwanderte.
Die einzigen Bewohner des Hauses waren ein betagter Verwalter mit seiner Frau. Die meisten Räume standen leer – es gab keine Möbel, man konnte sich nirgendwo hinsetzen oder hinlegen, außer in zwei Zimmern im obersten Stockwerk, in denen es, aus was für Gründen auch immer, sogar noch zwei alte, klumpige Federbetten gab. Und an jenem Nachmittag, als Greer verzweifelt überlegt hatte, was sie denn nun tun sollte, hatte Mrs Smithington angefangen zu jammern, sie fühle sich nicht wohl.
Damals hatte Greer sich noch nichts dabei gedacht. Mrs Smithington hatte ständig gejammert, seit sie London verlassen hatten, über das Wetter (zu regnerisch), den Zustand der Straßen (zu viele Schlaglöcher) und die Tatsache, dass es außer Landschaft nicht viel zu sehen gab.
Zuerst hatte Greer das dauernde Nörgeln noch amüsant gefunden, aber bald schon war sie es leid geworden, zumal sie diejenige war, die in den engen, öffentlichen Kutschen Hutschachteln und kleine Kisten auf dem Schoß halten musste.
Aber dann war in Ledbury Mr Percy zugestiegen, hatte Mrs Smithington Komplimente über ihr jugendliches Lächeln gemacht und so getan, als könnte er gar nicht glauben, wie alt sie schon war. Dem lieben Mr Percy, groß und gut aussehend, mit braunen Locken und glänzenden braunen Augen, hätte Mrs Smithington alles geglaubt, so bezaubert war sie von ihm.
Als sie in Herefordshire ankamen, hatte Mrs Smithington Mr Percy überredet, sie nach Wales zu begleiten. »Niemand wird sich an zwei armen, unverheirateten Frauen vergreifen, wenn sie in Begleitung eines Gentleman reisen«, hatte sie erklärt.
Greer hingegen dachte, dass selbst die niederträchtigsten Schurken durch Mrs Smithingtons ständiges Jammern abgeschreckt würden, aber dass Mr Percy Mrs Smithington so viel Aufmerksamkeit schenkte, war doch eine willkommene Erleichterung für sie gewesen.
Er war nicht nur überaus charmant, sondern auch ein sehr angenehmer Begleiter, weil er sich bemühte, all ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
Ihr widmete Mr Percy besonders viel Aufmerksamkeit, und bei dieser Gelegenheit erfuhr Greer auch, was mit ihrem Onkel passiert war. Gelegentlich, wenn Mrs Smithington sich früh zurückzog, saßen Greer und Mr Percy noch ein Weilchen am Kamin des Gasthofes, in dem sie übernachteten. Unweigerlich machte er ihr dabei Komplimente – ihre Augen seien so blau wie das tiefe Meer, ihre Haare so schwarz wie Tinte. Greer fand seine Komplimente ganz reizend, aber da sie schon zwei Saisons in London verbracht hatte, ließ sie sich von solchen Sätzen nicht einwickeln.
Schließlich waren sie einander so nahegekommen, dass er ihr erklärte, wie ein Gentleman seines Standes dazu kam, in einer öffentlichen Kutsche zu fahren. Er war auf dem Weg nach Wales, um sich mit einem skrupellosen Verwandten auseinanderzusetzen, der ihm sein rechtmäßiges Erbe gestohlen und ihn aus dem Familienbesitz geworfen hatte, nur weil sein Vater Engländer war. Es war eine schlimme Geschichte, und obwohl Mr Percy sich sehr tapfer hielt, fand Greer seinen Verwandten kriminell.
Anschließend fühlte auch sie sich bemüßigt zu gestehen, dass sie nach ihrem Onkel suchte, dem letzten bekannten männlichen Verwandten aufseiten ihres Vaters, der auf Bredwardine gelebt hatte. Aber als sie Mr Percy gegenüber den Namen ihres Onkels erwähnte, schaute Mr Percy sie seltsam an. »Randolph Vaughan?«, wiederholte er ungläubig. Er beugte sich vor, ergriff Greers Hand, blickte sie voller Mitgefühl an und sagte: »Miss Fairchild, es ist meine traurige Pflicht, Euch mitzuteilen, dass Mr Randolph Vaughan … verstorben ist.«
Greer keuchte. »Verstorben?«
»Er wurde von einem Pferd getreten, das er gerade kastrieren wollte. Der arme Mann rang tagelang mit dem Tod, unterlag jedoch.«
»Oh«, hatte Greer geantwortet. »Ach, du liebe Güte.«
»Ah, aber Ihr müsst Euch nicht sorgen.« Mr Percy hatte ihre Hand gedrückt. »Ich weiß, dass Ihr noch mehr Verwandtschaft in Wales habt.«
»Noch mehr?«, hatte sie verwirrt gefragt. »Aber ich habe geglaubt, dass mein Onkel Vaughan der letzte war.«
»Von Eurer Familie vielleicht. Aber seine Frau stammte aus einer recht großen Familie.«
Greer hatte der Kopf geschwirrt. »Wenn ich mir erlauben darf, Sir … woher wisst ihr so viel über die Familie Vaughan?«
»Oh, das ist nicht weiter schwer«, hatte er mit seinem charmanten Lächeln gesagt. »Wales ist wie eine Kleinstadt – Waliser kennen einander.«
Waliser.
Greer blickte aus dem Fenster der Kutsche und sah plötzlich, wie sich einer der Männer vom Pferd schwang und eine Waffe zog. Sie keuchte, als Mr Percy den Hut abnahm, sich mit der Hand durch das dichte, braune Haar fuhr und dann den Hut wieder aufsetzte. Die Pistole schien ihn nicht sonderlich zu erschrecken.
Aber Mr Percy war sowieso nicht leicht zu erschüttern. Als Greer Mrs Smithington kalt und steif in Bredwardine im Bett vorgefunden hatte, hatte sie sich der Verzweiflung hingegeben. Sie hatte nur sehr wenig Geld, war meilenweit von der Zivilisation entfernt und ihrem Erbe nicht nähergekommen, seit sie London verlassen hatte. Aber sofort war Mr Percy an ihrer Seite, beruhigte und unterstützte sie und kümmerte sich um alles.
Und als Mrs Smithington auf dem Kirchhof beerdigt war und ihre Habseligkeiten nach London zurückgeschickt worden waren, hatte Mr Percy gefragt: »Ihr wollt doch weiterreisen, nicht wahr?«
»Weiterreisen?«, hatte Greer geschrien. »Wohin soll ich denn fahren? Meine Begleiterin ist tot, mein Onkel ist tot, und sein Anwesen verfällt. Ich kann nur nach London zurückkehren, aber selbst dafür fehlt mir das Geld.«
»Ich werde Euch natürlich überallhin begleiten«, hatte Mr Percy sofort erwidert. »Ich stehe zu Euren Diensten, Miss Fairchild.«
»Das kann ich doch nicht von Euch verlangen.« Und sie konnte auch keineswegs den Skandal riskieren, mit einem Mann zu reisen, der nicht mit ihr verwandt war. Phoebe und Ava würde der Schlag treffen, wenn sie wüssten, dass Mrs Smithington gestorben war und sie mit einem Mann durch die Weltgeschichte reiste, den sie kaum kannte.
Mr Percy war jedoch sehr überzeugend gewesen. »Aber ich tue es gerne, ich versichere es Euch. Ich habe keine festen Termine. Des Weiteren kenne ich einen Anwalt, der Euch den Weg zu der Person weisen kann, die die Geschäfte Eures Onkels übernommen hat.« Als Greer ihn neugierig anblickte, sagte er: »Euer Onkel ist zwar gestorben, aber Ihr habt vielleicht trotzdem das Recht auf ein Erbe.«
Und als Greer immer noch Einwände hatte, hatte er mit großer Autorität gesagt: »Nun, Miss Fairchild! Ihr habt den weiten Weg zurückgelegt und könnt jetzt nicht aufgeben, ohne wenigstens mit dem Gentleman gesprochen zu haben. Wenn er Euch nichts Neues sagen kann, werde ich Euch helfen, die erste Kutsche nach London zu besteigen. Aber es kann nichts schaden, wenigstens zu fragen, oder?«
Dem konnte sie nicht widersprechen.
Der Anwalt, Mr Davies, war ein älterer Herr, dessen Kanzlei sich in einem uralten Gebäude mit durchhängenden Holzdielen befand. Mr Percy staubte mit seinem Taschentuch galant einen Stuhl für sie ab, und nachdem Greer Platz genommen hatte, erklärte sie dem Mann ihr Anliegen. Sie vermutete, die einzige Erbin ihres Vaters zu sein, aber da sie von frühester Kindheit an nicht mehr bei ihm gelebt hatte, war sie sich nicht sicher.
Mr Davies hörte ihr schweigend zu. Dann setzte er seine Brille auf, fuhr sich mit beiden Händen durch die grauen Haare und begann, aus einem Stapel von Papieren etwas herauszusuchen. Schließlich stieß er auf eine große Ledermappe, aus der er Unterlagen zog, die er leise murmelnd eingehend betrachtete. Greer saß ungeduldig dabei, während Mr Percy aufmerksam hinter ihr stand.
Nach einer Weile setzte Mr Davies die Brille ab und blickte Greer an. »In der Tat, Ihr seid die einzige lebende Erbin Eures Vaters«, sagte er.
Greer gab einen Laut der Überraschung und der Freude von sich.
»Da jedoch leider keine Vorkehrungen getroffen wurden, um Euch ausfindig zu machen, ging der Besitz Eures Vaters, Mr Yorath Vaughan, an seinen Bruder über, Mr Randolph Vaughan, der Euer verstorbener Onkel ist. Auch Mr Randolph Vaughan hatte keine lebenden Erben, und so ging sein gesamter Besitz – zu dem natürlich auch der Teil Eures Vaters gehört – an den Gatten der verstorbenen Schwester seiner verstorbenen Frau über, an seine Lordschaft Rhodrick Glendower.«
Greer blinzelte und versuchte zu folgen. Mr Davies schob die Brille wieder auf die Nase und faltete die Hände auf der Schreibtischplatte. »Er ist in England, und auch in Bredwardine, als der Earl of Radnor bekannt. Aber nur drei Meilen von hier, in Wales, kennt man ihn unter einem anderen Namen.«
Der Druck von Mr Percys Hand auf Greers Schulter verstärkte sich. »Verzeiht, aber Ihr meint ja wohl nicht …«
»Doch, in der Tat, Mr Percy!«, erwiderte der Anwalt, der recht zufrieden mit sich wirkte. »Miss Fairchilds Erbe – wenn es tatsächlich existiert – befindet sich im Besitz des Prinzen von Powys!«
»Wer?«, fragte Greer.
»Der Prinz von Powys«, artikulierte Mr Davies überdeutlich. »In den Augen der Engländer mag dies ein ererbter Titel sein, aber in Wales, Madam, kennt man ihn nur als ›Der Prinz‹. Er ist ein Mann, mit dem nicht zu spaßen ist.«
Und wenn er der König von England wäre – er hatte ihr Erbe. »Wie kann ich ihn finden?«
Mr Davies schlug den Lederordner so heftig zu, dass eine Staubwolke aufstieg. »Natürlich auf Llanmair, wo alle Prinzen von Powys vor ihm residiert haben und wo sie auch noch residieren werden, wenn er schon lange tot ist.«
»Und wo genau liegt Llanmair?«, wollte Greer wissen.
Der Anwalt schmunzelte leise und wies auf das kleine, schmutzige Fenster. »Im Westen. Am Fuß der kambrischen Berge, in einem wildreichen Wald.«
Greer blinzelte den alten Mann an. Er hielt ihrem Blick stand, ohne seiner poetischen, aber unpraktischen Richtungsangabe eine genauere Erklärung hinzuzufügen. Greer erhob sich, kramte in ihrem Retikül nach einer Krone und reichte sie Mr Davies. »Danke, Sir. Sie haben mir sehr geholfen.«
Mr Davies streckte seine knochige Hand aus und griff nach der Münze. »Viel Glück, Miss Fairchild«, krächzte er. Greer lief ein Schauer über den Rücken.
Natürlich überredete Mr Percy sie, in einer Privatkutsche weiterzureisen. Greer zögerte zunächst, in Anbetracht ihrer schwindenden Mittel, aber Mr Percy hielt es für absolut notwendig, da sie ja schließlich so weit nach Wales hinein reisen wollten. »Wie Ihr gehofft habt, Miss Fairchild, ist noch etwas übrig vom Besitz Eures Vaters! Natürlich müsst Ihr dorthin fahren. Aber es ist eine anstrengende Reise, und in einer Mietkutsche seid Ihr doch weniger Spekulationen über Eure Person ausgesetzt.«
Das war eine sehr höfliche Erinnerung daran, dass sie einen Skandal vermeiden musste. Und doch rang sie mit sich – sie hatte gerade noch genug Geld, um entweder zurück nach London zu fahren oder, mit ein wenig Glück, ihr Erbe zu beanspruchen. Aber letztlich hatte Mr Percy wohl recht. Sie hatte schon so einen weiten Weg zurückgelegt, dass sie ihre Reise ebenso gut fortsetzen konnte. Also machte sich Greer wider besseres Wissen mit Mr Percy in Richtung Llanmair auf.
In einer Privatkutsche.
Die sie gemietet hatte.
Erst als sie fernab jeder Zivilisation dahinrumpelten, hatte Mr Percy ihr gestanden, dass der Prinz von Powys niemand anderer als sein verfluchter Onkel war, der Mann, der ihn ruiniert hatte.
»Das kann ja wohl nicht wahr sein!«, hatte Greer schockiert ausgerufen.
»Das sollte Euch eigentlich nicht überraschen«, war Mr Percys Antwort gewesen. »Der Mann hat beträchtlichen Einfluss in dieser Gegend. Wie sonst hätte er …« Er brach ab und presste, mit einem Seitenblick auf Greer, die Kiefer zusammen.
»Wie sonst hätte er was?«
»Das kann ich nicht sagen, Miss Fairchild. Ihr seid zu … zu rein, um von der gemeinen Natur dieses Mannes zu erfahren.«
Greer hatte bloß geschnaubt. Über so etwas brauchte sie sich keine Gedanken zu machen, schließlich reiste sie mit einem Mann, der nicht ihr Gatte oder sonst wie mit ihr verwandt war, nach Wales. »Ich habe meine Entscheidung getroffen, Sir. Ihr müsst mir sagen, was Ihr von diesem Mann wisst, denn er hat nicht nur Euer Erbe, sondern auch meins.«
»Ja, natürlich, Ihr müsst auf dem bestehen, was rechtmäßig Euch gehört«, pflichtete er ihr sofort bei. »Ihr seid wirklich sehr mutig, Miss Fairchild.«
Besonders mutig kam sie sich gar nicht vor, eher verzweifelt. »Dann erzählt mir jetzt bitte, was ich wissen muss.«
Seufzend blickte er auf seine Hände. »Der Schuft hat mir nicht nur meine Ländereien genommen, sondern auch die Tochter eines Rechtsanwalts in Rhayader kompromittiert und sich hartnäckig geweigert, sich ehrenhaft zu verhalten.«
Greer blinzelte. Mr Percy beugte sich vor, legte ihr die Hand auf das Knie und fuhr leise fort: »Aber das war noch nicht einmal das Schlimmste. Bald nach seiner Weigerung war die junge Frau verschwunden. In der gesamten Grafschaft wurde nach ihr gesucht … aber sie war nirgends zu finden.«
»Ach, du lieber Himmel!«, rief Greer aus. Was konnte einer Frau in einem so fernen Land wie Wales wohl alles zustoßen?
»Aber dann, wie durch ein Wunder, fand er sie schließlich, mitten in einem riesigen, undurchdringlichen Wald.« Er lehnte sich wieder zurück und nahm die Hand von ihrem Knie. »Sie war natürlich tot. Gebrochener Hals.«
»O Gott, nein!«
»Er allein führte die Behörden zu ihrer Leiche, meilenweit von Llanmair entfernt.«
»Wie tragisch!«
Mr Percy kniff die Augen zusammen und beugte sich erneut vor. »Ich glaube, Ihr erfasst nicht ganz, was ich sagen will, Miss Fairchild. Llanmair ist von zehntausend Hektar Wald umgeben, der zum Teil recht unzugänglich ist. Und doch ist es ihm gelungen, sie in einer sehr abgelegenen Schlucht zu entdecken.«
Greer riss die Augen auf. »Ihr meint … Mord?«, flüsterte sie.
Mr Percy zuckte mit den Schultern und lehnte sich wieder zurück. »Es gibt viele, die daran glauben. Dieser Mann ist niederträchtig.«
Und jetzt, einige Tage später, lief Greer ein Schauer über den Rücken, als sie aus dem Fenster der Kutsche auf das hoch aufragende Schloss und die drei Männer blickte. Sie verspürte plötzlich das Bedürfnis, Mr Percy nahe zu sein, und stieg aus. In diesem Moment kam ein weiterer Reiter auf sie zu galoppiert. Auch Mr Percy hatte ihn gesehen, denn er drehte sich sofort um und sagte zu ihr: »Bleibt in der Kutsche, Miss Fairchild.«
Aber Greer rührte sich nicht. Wie gebannt starrte sie dem Reiter entgegen.
Er ritt in einem solchen Tempo, dass sich sein Umhang bauschte wie die Schwingen eines riesigen Vogels. Er war tief über den Hals seines großen, schwarzen Pferdes gebeugt, dessen Hufe über die Erde donnerten. Fast schien es, als sähe der Mann sie nicht und wollte sie über den Haufen reiten. Greer schrie auf und schoss hinter Mr Percy, als der Reiter schließlich so abrupt anhielt, dass sein Pferd sich aufbäumte.
Er hielt seinen tänzelnden Rappen im Zaum und blickte sie finster an. Als Greer hinter Mr Percy hervortrat, richtete er seine eisigen grünen Augen auf sie.
Ein Frösteln überlief sie.
Der Reiter war etwa zehn Jahre älter als sie. Über eine Seite seines Gesichts zog sich eine Narbe vom Augenwinkel bis zur Wangenmitte, die in seinem Bartschatten verschwand. Er hatte ein energisches Kinn, und unter seinem Hut sah sie schwarze Haare, die an den Schläfen bereits grau wurden. Man konnte ihn nicht als gut aussehend bezeichnen, ja noch nicht einmal freundlich – er wirkte ziemlich grimmig.
Und wütend.
Mr Percy trat sofort vor Greer und sagte etwas auf Walisisch. Daraufhin trieb der Mann sein Pferd ein paar Schritte vorwärts und betrachtete Greer aus seinen erschreckend kalten, grünen Augen.
In diesem Moment traf ein dicker Regentropfen Greers Haube und erschreckte sie. Ein weiterer folgte, und dann noch mehr, und impulsiv sagte sie zu dem Mann: »Bitte, wir möchten weiterfahren. Wir müssen …«
Mr Percy packte sie am Unterarm, sagte etwas auf Walisisch, und wieder sah der Mann Greer an.
»Verzeihung«, flüsterte sie Mr Percy zu. »Ich glaube, wir sollten erklären, wer wir sind.«
»Was glaubt Ihr, was ich in der letzten Viertelstunde getan habe?«, gab er leise zurück. »Wenn Ihr erlaubt.«
»Aber es fängt zu regnen an«, unterbrach Greer ihn verzweifelt. Wieder wandte sie sich an den Mann auf dem Pferd. »Ich möchte Euch nicht drängen, Sir, aber ich fürchte, wir geraten in den Regen.«
Der Mann schwieg. Greer trat einen Schritt vor. »Wir haben eine wichtige Angelegenheit mit dem Earl of Radnor … dem, äh … dem Prinzen … zu besprechen, würdet Ihr also bitte so freundlich sein, uns passieren zu lassen?«
Ihre Bitte traf auf kaltes Schweigen. Greer warf Mr Percy einen besorgten Blick zu. »Glaubt Ihr, er versteht mich überhaupt?«, flüsterte sie.
»Oh … ich bin mir ziemlich sicher, dass er Euch versteht«, erwiderte Mr Percy.
Der Mann gab jedoch nichts zu erkennen, und Greers anfängliche Furcht verwandelte sich in Zorn über seine Grobheit. Sie reckte das Kinn und blickte ihn böse an.
In diesem Augenblick sagte er etwas auf Walisisch zu den drei Männern. Dann lenkte er sein Pferd herum und ritt davon.
»Was hat er gesagt?«, fragte Greer überrascht.
Mr Percy bedeutete ihr seufzend, in die Kutsche zu steigen. »Er hat uns Erlaubnis gegeben zu passieren«, murmelte er, ergriff sie am Arm und half ihr in die Kutsche. »Weiterfahren«, rief er dem Kutscher zu, bevor er ebenfalls einstieg.
Greer wischte die Regentropfen von ihrem Umhang und sagte: »Seine Lordschaft mag ein Mörder sein, aber ich werde mich auf jeden Fall bei ihm darüber beschweren, wie unerträglich grob sein Mann war.«
Mr Percy seufzte gereizt. »Miss Fairchild, dieser unerträglich grobe Mann war der Prinz von Powys.«
Ach, du liebe Güte.
Kapitel 2
Die drei Reiter eskortierten die Kutsche auf der kurzen Strecke in einen Schlosshof, der so groß war, dass mit Leichtigkeit mehr als ein Dutzend Kutschen hineingepasst hätten.
Llanmair war riesig, eher ein Palast als ein Schloss. Um eine große Rasenfläche standen uralte Bäume. Es war ein unerwarteter Anblick, weil Greer nach der langen Fahrt durch wilde Wälder eher mit Bauern, Schweinen und Hühnern gerechnet hätte, nicht mit einer so gepflegten Anlage.
Als sie aus der Kutsche stieg und nach oben blickte, bemerkte sie auf Vorsprüngen und in Nischen überall an der Mauer Vogelnester, in denen große Vögel saßen. Manche waren schwarz, manche rot, einige schliefen, und andere beobachteten das Treiben im Hof.
Unwillkürlich musste Greer an eine Zeile aus Macbeth denken: »Selbst der Rabe, der Duncans schicksalsvollen Eingang krächzt unter mein Dach, ist heiser …«
Ein Schauer lief ihr über den Rücken. An den Eingangstüren zum Schloss erschienen zwei Lakaien in schwarzer Livree und kamen zur Kutsche geeilt. Hinter ihnen kam ein Mann in der schwarzgrauen Uniform eines Butlers auf sie zu. Als er sie erreicht hatte, verneigte er sich und sagte: »Bonjour.«
»Bonjour«, erwiderte Greer höflich, aber Mr Percy antwortete auf Walisisch.
Der Butler sagte etwas in freundlichem Tonfall, und Percy bot Greer seinen Arm. »Wir werden hineingeführt.«
Leise Furcht stieg in ihr auf – es gefiel ihr nicht, dass sie die Sprache nicht verstand und das Haus eines Mörders betrat –, aber Percy drückte ihr beruhigend die Hand, und wieder einmal fügte sie sich.
Im Schloss kam es ihr beinahe vor wie in einem anderen Jahrhundert. Es wirkte mittelalterlich – das Innere war dunkel und eng, die Steinmauern feucht. Durch einen schmalen Gang kamen sie in eine große Halle, mit so vielen Waffen und Rüstungen an den Wänden, dass man ein ganzes Regiment damit hätte ausstatten können. Es gab auch Fahnen und Standarten mit walisischen Worten und dem Symbol eines fliegenden roten Drachens, an das sich Greer vage aus ihrer Kindheit erinnerte. An einer Wand hing ein riesiger Spiegel, der das wenige Licht reflektieren sollte.
Der Butler ging durch einen dunklen Korridor, durch einen der Türme und einen weiteren Korridor, in dem düstere Gemälde und weitere Waffen hingen.
Am Ende dieses Ganges öffnete er eine Flügeltür aus Eiche und sagte etwas auf Walisisch.
Sie traten ein.
Der Raum wäre prächtig gewesen, wenn die richtigen Möbel darin gestanden hätten. Er war in einem warmen Gelb gestrichen, die Vorhänge waren aus geblümtem Chintz, und das Deckengemälde stellte jemanden dar, der zu den Engeln emporgetragen wurde. Am hinteren Ende des Raums stand eine kleine Polstergruppe um einen geschnitzten Marmorkamin, der mindestens zwei Meter hoch war. Mehr Möbel gab es nicht. Keine Stühle, keine Konsole, keine Kommoden und keine großen Kunstwerke.
Greer legte den Kopf in den Nacken, um das Deckengemälde zu betrachten, während Percy kurz mit dem Butler sprach. Als der Mann den Raum verlassen hatte, wandte er sich zu ihr und blickte ebenfalls nach oben. »Der Künstler ist Sir Thomas Lawrence«, sagte er und trat an ein Fenster. »Er hat einige der Porträts hier im Schloss gemalt.«
Sir Thomas Lawrence!
Er war ein berühmter englischer Maler, und Greer, die Kunstwerke liebte, ging zweimal im Kreis darunter her, um sich kein Detail in der Ausführung entgehen zu lassen. Es war großartig, weitaus beeindruckender als alles, was sie bisher in London gesehen hatte.
Dann trat sie zu Mr Percy und blickte hinunter in den Garten, der ihr einen Schrei des Entzückens entlockte. Obwohl es schon langsam dunkel wurde, konnte sie sehen, wie weit er sich erstreckte – Reihen um Reihen sorgfältig gestutzter und gepflegter Sträucher, Rosen, Bäume und Springbrunnen zogen sich über einen sanften Abhang zum Waldrand hinunter. Die Anlage stand in starkem Kontrast zu dem kalten Eingangsbereich von Llanmair. »Ich habe selten etwas so Schönes gesehen«, sagte Greer andächtig.
»Der Prinz ist für seine Gartenanlagen berühmt«, erwiderte Percy. »Bemerkenswert, nicht wahr, wenn man seine Natur bedenkt.«
Es war in der Tat schwer zu verstehen, wie ein Dieb und Mörder ein solcher Gartenliebhaber sein konnte. Sie hatte eigentlich eher erwartet, dass er in seiner freien Zeit kleine Tiere quälte oder Kinder erschreckte.
Percy musste ihr Misstrauen gespürt haben, denn er blickte sie lächelnd an und sagte: »Ihr braucht keine Angst zu haben, Miss Fairchild. Bei meiner Ehre, ich werde Euch beschützen – er kann Euch nichts tun, das versichere ich Euch.«
»Danke«, erwiderte sie und verdrängte die Frage, wie Percy ein Ungeheuer wie den Prinzen eigentlich aufhalten wollte. »Aber je eher wir verlangen, dass er uns zurückgibt, was rechtmäßig uns gehört, umso rascher können wir diesen Ort wieder verlassen«, fügte sie hinzu.
»Ja«, sagte er gedankenverloren. Er blickte aus dem Fenster und wandte sich plötzlich wieder ihr zu. »Darf ich?«, fragte er und ergriff ihre Hand. Zärtlich blickte er sie an. »Wenn ich so kühn sein darf, Miss Fairchild. Ich habe über unsere recht einzigartige Situation nachgedacht, und Ihr sollt wissen, dass ich …«
Die Tür wurde plötzlich mit solcher Wucht aufgestoßen, dass Percy zusammenzuckte, Greers Hand losließ und einen Schritt zurückwich, als das Untier in Begleitung von zwei riesigen Wolfshunden den Raum betrat. Er trug immer noch seinen Reitumhang. Sein Gesicht war finster, und seine dunklen Haare fielen ihm auf die Schultern. Er humpelte unmerklich. In der Mitte des Raumes blieb er stehen und musterte sie kühl mit wachen, grünen Augen, die er leicht zusammenkniff, als er etwas auf Walisisch sagte. Die beiden Hunde gehorchten sofort und setzten sich.
Seine Augen brachten Greer heute schon zum zweiten Mal zum Erschauern.
Allerdings würdigte er Greer gar keines Blickes, sondern redete Percy mit tiefer, leiser Stimme auf Walisisch an. Greer hatte den Eindruck, er bräuchte seine Stimme gar nicht zu erheben – der Angesprochene zitterte schon vor Angst, wenn er ihn nur ruhig anredete.
Mr Percy jedenfalls errötete leicht. »Ich darf Euch Miss Greer Fairchild vorstellen«, sagte er.
Unwillkürlich versank Greer in einen Knicks.
Der eisige Blick des Mannes glitt über ihre Gestalt.
Er faszinierte sie und weckte ihre Neugier. Ein wenig wurden ihr die Knie weich bei dem Gedanken, ihn nach ihrem Erbe fragen zu müssen, da er eine solche Macht ausstrahlte, dass niemand ihn infrage zu stellen wagte.
Aber fragen musste sie.
So kurz vor dem Ziel konnte sie nicht auf einmal feige werden.
Am liebsten wollte sie die hässliche Angelegenheit so schnell wie möglich hinter sich bringen, damit sie diesen Ort so schnell wie möglich wieder verlassen konnte. »Euer Hoheit«, sagte sie und nahm all ihren Mut zusammen.
Er zog eine Augenbraue hoch. »Ich bin Earl, Miss Fairchild, kein König.«
Greer wusste nicht, was sie mehr erschreckte – sein perfektes Englisch oder sein Blick, der sie förmlich zu durchbohren schien. »M-mylord«, stammelte sie, »vergebt bitte, wenn wir hier so eindringen … aber es war notwendig, dass wir hierher gekommen sind.«
Er nickte knapp und wandte sich ab, um leicht humpelnd an die Konsole zu treten. Er schenkte sich einen Whiskey aus einer der Kristallkaraffen ein und warf Percy einen Blick zu. »Whiskey?«
»Ja, bitte«, erwiderte Percy. Radnor – Powys –, wie auch immer sein Name sein mochte, wies vage auf die Konsole und bedeutete Percy, sich selbst zu bedienen.
Was für schlechte Manieren! Warum demütigte er Percy so?
Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder Greer zu und musterte sie, während er den Whiskey hinunterkippte. »Ihr seid aus Wales«, sagte er und stellte das Glas beiseite.
War das nun eine Frage oder eine Feststellung? »Ja.« Sie verschränkte die Hände hinter dem Rücken. »Meine Eltern stammten aus Wales, lebten aber in dem englischen Ort Bredwardine. Vaughan war ihr Name.«
»Und wie seid Ihr dann zu dem englischen Namen Fairchild gekommen?«
Sie musste daran denken, was Percy von diesem Mann zu erleiden hatte, nur weil er ein halber Engländer war. »Meine Mutter starb, als ich noch sehr klein war, Mylord. Mein Vater, Yorath Vaughan, wollte seine Tochter nicht allein aufziehen, deshalb gestattete er der Halbschwester meiner Mutter, Lady Bingley, mich aufzunehmen. Sie lebte in England, und als mein Vater starb, gab Lord Bingley mir seinen Namen, Fairchild.«
Der Prinz nickte nachdenklich. Unverblümt musterte er ihre Figur, und sein Blick ruhte auf ihrem Dekolletee. »Und welche Angelegenheit wollt Ihr mit mir besprechen?«, erkundigte er sich mit kalter Stimme.
Greer hätte nicht sagen können, was mit ihr in diesem Moment geschah. Vielleicht war sie einfach erschöpft von der langen Reise, oder vielleicht war es auch die Tatsache, dass er mit ihr sprach, als hätte sie kein Recht, ihn aufzusuchen, auf jeden Fall stieg leise Empörung in ihr auf. »Das kann ich Euch sagen«, erwiderte sie mit ruhiger Stimme. »Ihr habt, was rechtmäßig mir gehört.«
Er schien beinahe zu lächeln, aber Percy sagte rasch etwas auf Walisisch. Der Unmensch beachtete ihn jedoch gar nicht, sondern richtete seinen Blick weiterhin auf Greer. Sein finsterer, stoischer Gesichtsausdruck machte sie wütender als alle seine Verbrechen zusammen.
Als Percy geendet hatte, kniff der Prinz die Augen zusammen und fragte Greer: »Was könnte ich denn haben, was Euch gehört?«
Wieder sagte Percy etwas auf Walisisch, aber der Prinz unterbrach ihn mit einer Handbewegung und wartete darauf, dass Greer antwortete.
»Ihr habt …«
»Miss Fairchild!«
Percys laute Stimme erschreckte sie. Erneut redete er in der fremden Sprache auf den Prinzen ein, und was er sagte, schien den Mann aufzubringen. Voller Verachtung antwortete er grollend. Percys Tonfall stand seinem in nichts nach, und er wurde immer lauter, während die Stimme des Unmenschen immer kälter wurde.
Aber dann sagte Percy etwas, das anscheinend einen Nerv traf, denn der Prinz warf ihr einen bösen Blick zu.
Unwillkürlich wich Greer einen Schritt zurück.
»Es ist bereits zu spät, als dass Ihr sicher nach Rhayader zurückkehren könnt. Wir werden Euch hier unterbringen.«
»Hier?«, echote Greer und warf Percy einen besorgten Blick zu. »Wir können doch bestimmt noch nach Rhayader zurückkehren – es ist noch nicht dunkel, und der Regen …«
»Es geht nicht«, unterbrach sie der Prinz. »Und was Eure … Angelegenheit … angeht, so werde ich mich morgen darum kümmern.« Er schnippte mit den Fingern, und sofort waren die beiden Hunde an seiner Seite. Sie trotteten hinter ihm her aus der Tür, noch bevor Greer überhaupt ein Wort herausbringen konnte.
Als sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, wirbelte sie zu Percy herum. »Was … was ist geschehen?«
»Ich habe ihm erklärt, dass wir wegen unseres Erbes gekommen sind«, sagte er und trat auf sie zu. »Natürlich will er es Euch nicht kampflos überlassen.«
Greer stöhnte. Sie war mittlerweile zu wütend und erschöpft. Sie hatte ihn selbst fragen wollen, hatte mit ihren eigenen Worten diesem bösen Mann darlegen wollen, was sie von ihm wollte, und jetzt hatte sie noch nicht einmal verstanden, dass ihr Fall überhaupt dargelegt worden war. »Mr Percy, ich muss wirklich darauf bestehen …«.
»Miss Fairchild … Greer«, unterbrach er sie. »Ihr kennt ihn nicht so gut wie ich. Er ist entsetzlich skrupellos – er hat keine Gnade mit einer hilflosen jungen Frau.«
Als sie ihm einen skeptischen Blick zuwarf, ergriff er ihre Hände. »Ich möchte Euch so gerne helfen, Euch beschützen. Miss Fairchild – Greer –, was ich Euch zu sagen habe, mag unziemlich erscheinen, aber … aber ich habe schon einige Zeit darüber nachgedacht.«
Die Intensität seines Blickes und sein feierlicher Tonfall ließen in ihr einen Verdacht keimen. Er wollte doch nicht etwa …? Jetzt? »Mr Percy!«, rief sie und versuchte, ihm ihre Hände zu entziehen. »Ich bitte Euch, bitte nicht …«
»Ihr wisst sicher, dass ich Euch hoch schätze«, fuhr er ungerührt fort. »Ich hätte es zwar vorgezogen, richtig um Euch zu werben, aber da das Schicksal uns zusammengebracht hat, kann ich es nicht mehr länger aufschieben, Euch meine Gefühle zu erklären. Und es ist wichtig, dass ich es jetzt ausspreche, denn gemeinsam werden wir erfolgreicher sein als getrennt.«
Dieses plötzliche Geständnis musste sie erst einmal verdauen. Natürlich waren ihr seine Aufmerksamkeiten aufgefallen, aber ein so tiefes Gefühl hatte sie nicht erwartet. Sie fand ihn zwar charmant und mochte ihn ganz gern – schließlich war er ihr während der Reise eine große Hilfe gewesen –, aber sie hatte nie auch nur im Entferntesten daran gedacht, dass er ihr Ehemann werden könnte.
Und wirklich, es war doch ein schrecklicher Augenblick, um ihr einen Antrag zu machen. Sie konnte ja kaum an etwas anderes denken als an diesen verflixten Prinzen! Es war eine absurde Situation – sie stand mitten in einem mittelalterlichen Schloss in Wales, als Gast eines Mörders und eines Diebes und hatte gerade einen Heiratsantrag bekommen, den sie weder wollte noch vorausgesehen hatte. »Mr Percy, ich kann auf keinen Fall …«
»Ihr braucht jetzt nichts zu sagen«, unterbrach er sie und küsste ihr die Hand. »Aber gebt mir die Ehre, meinen Antrag wenigstens zu bedenken. Ihr könnt Euch meiner Wertschätzung gewiss sein. Ihr habt mich gefangen genommen und bezaubert, Greer, und ich bete dafür, dass Ihr meine Gefühle erwidert und einwilligt, meine Frau zu werden.«
»Mr Percy, bitte!«, rief sie und entzog ihm ihre Hand. »Das ist ein äußerst schlecht gewählter Zeitpunkt.«
»Ich weiß, aber wenn Ihr seine Natur bedenkt, so ist dies vielleicht die allerbeste Zeit. Überlegt doch nur, was dies bedeutet, Greer! Gemeinsam werden wir mit unserem Erbe ein angenehmes Leben führen können. Wir könnten uns in einem Herrenhaus auf dem Land niederlassen und unsere Kinder großziehen.«
»Was maßt Ihr Euch an, Sir!«
Er lächelte süß und fuhr mit dem Knöchel über ihre Schläfe. »Ich bitte Euch doch nur, darüber nachzudenken.«
O Gott! Wenn doch nur Ava und Phoebe hier wären! Wenigstens eine der beiden hätte sie sicher vor Percy gewarnt, aber Greer hatte es nicht kommen sehen. Sie hatte einzig und allein ihr Ziel vor Augen gehabt, und nicht einmal im Traum daran gedacht.
»Ich habe Euch offensichtlich erschreckt«, sagte Percy. »Aber es kann Euch doch nicht so sehr überrascht haben. Ihr wusstet doch sicher.«
Hinter ihnen öffnete sich die Tür, und Greer fuhr schuldbewusst herum.
Der Butler trat ein und sagte etwas zu Percy. Dieser Percy seufzte und blickte Greer an. »Er hat ein Zimmer für Euch vorbereitet«, sagte er ärgerlich. Dann jedoch lächelte er. »Ihr müsst mir versprechen, über das, was ich Euch gesagt habe, nachzudenken.«
»Ja, das tue ich«, erwiderte sie und eilte erleichtert aus dem Zimmer, dem Butler hinterher, der bis jetzt noch kein einziges Wort Englisch gesprochen hatte.
Kapitel 3
Der Butler führte Greer durch einen dunklen Gang in ein kleines, karges Zimmer mit einem Bett, einem Teppich und einem Tisch. Aus dem Fenster blickte man auf die Schafpferche. Der Butler – klein, dunkelhaarig und stoisch – sagte ihr auf Französisch, das Essen würde ihr auf dem Zimmer serviert.
»Merci«, erwiderte sie, und da ihr Französisch nicht besonders gut war, fragte sie nach jemandem, der Englisch sprach. »T a-t-il quelquun qui parle anglais ici?«
»Ich spreche Englisch«, erwiderte der Butler ernst.
Das wurde ja immer seltsamer! »Danke«, sagte sie und blickte ihn neugierig an. »Kann ich Feuer im Kamin haben?«
»Ich schicke Euch einen Lakaien vorbei.« Er verbeugte sich und ging.
Seufzend warf Greer ihre Haube auf das Bett und trat ans Fenster. Sie starrte auf die schlammigen Pferche und die Schafe, die trotz der Kälte und der Nässe zufrieden an ihrem Futter kauten. Wenn sie doch auch nur so sorglos sein könnte! Aber im Moment kamen ihr ihre Probleme unüberwindlich vor. Und sie hatte sich selbst in diese missliche Lage gebracht.
Es klopfte an der Tür, und der angekündigte Lakai trat ein, um Feuer im Kamin zu machen. »Entschuldigung, könnt Ihr mir sagen, ob Mr Percy in der Nähe ist?«
Der Lakai warf ihr einen seltsamen Blick zu. »Saesneg nicht gut«, sagte er.
»Oh.« Greer lächelte schwach und drehte sich wieder zum Fenster.
Es wurde langsam dunkel, und der Wind frischte auf und heulte ums Schloss. Es klang, als ob jemand in der Ferne schrie, stellte Greer nervös fest. Fast erwartete sie, dass die Hexen aus Macbeth hinter dem Vorhang vorspringen würden.
Wann treffen wir drei uns das nächste Mal
Bei Regen, Donner, Wetterstrahl?
Wenn der Wirrwarr ist zerronnen,
Schlacht verloren und gewonnen.
Seufzend wandte sie sich ab vom Fenster und trat an den Kamin.
Sie dachte an Ava und Phoebe, an ihr Haus in London, an die Soireen und Bälle, an denen sie teilgenommen hatten, an das sorglose Leben, das sie geführt hatten. Sie vermisste die beiden schrecklich, vermisste ihre Gespräche und Ratschläge. Sie dachte an ihre Tante Cassandra, die immer fröhlich gewesen war und ihnen großartige Dinge versprochen hatte.
Sie dachte an Bingley Hall, wo sie als Kinder gelebt hatten, an die Bälle, die ihre Tante und ihr Onkel gegeben hatten. An diesen Abenden war Tante Cassandra immer im Abendkleid zu ihnen gekommen, um ihnen gute Nacht zu sagen. In Greers Augen hatte sie immer ausgesehen wie eine Königin.
An einem dieser Abende hatte Phoebe gebettelt: »Ich möchte auch mitmachen, Mama!«
»Heute Abend nicht, Liebling, aber eines Tages wirst du auf allen Bällen tanzen«, hatte Tante Cassandra sie beruhigt. Sie hatte die Kinder an den Händen genommen und mit ihnen im Kreis getanzt. »Eines Tages werdet ihr nach Herzenslust tanzen.«
»Wo?«, hatte Phoebe misstrauisch gefragt.
»Wo? In Avas Haus natürlich!«, hatte Tante Cassandra geantwortet. »Ava wird ein sehr schönes Haus besitzen, und sie wird Bälle, Soireen und elegante Dinners geben, um die sie jeder in London beneiden wird.«
»Wen werde ich heiraten, Mama?«, hatte Ava, die ein Jahr älter als Greer war, gefragt.
»Einen Lord. Einen sehr gut aussehenden und reichen Lord, Liebling, und er wird dich anbeten.«
»Und ich?« Phoebe, die jüngste von ihnen, hatte die Stirn gerunzelt.
»Du bist mein ganz besonderes Kind, Phoebe«, hatte Tante Cassandra lächelnd gesagt, während sie langsam im Kreis herumgingen. »Wenn du erwachsen bist, wirst du so schön sein, dass jeder Mann in Großbritannien dich zur Frau begehrt. Aber du wirst deine Zuneigung nur einem schenken, denn du wirst ein bedeutendes Geheimnis haben. Und nur ein ganz besonderer Mann kann dein Geheimnis erkennen.«
»Was für ein Geheimnis ist das?«, hatte Phoebe aufgeregt gefragt.
»Woher soll ich das wissen, mein Liebling?«, hatte Tante Cassandra fröhlich geantwortet. »Es ist ja dein Geheimnis. Aber es wird ein ganz besonderes Geheimnis sein, und du wirst es mit dem Mann teilen, den du liebst.«
»Was ist mit Greer?«, hatte Ava gefragt.
»Greer!« Tante Cassandra hatte gelacht und zärtlich Greers Hand gedrückt. »Das ist ganz leicht. Greer ist klug und witzig und wird bei allen bedeutenden sozialen Anlässen sehr gefragt sein. Alle Gentlemen werden hinter ihr her sein, aber sie wird es vorziehen, mit ihnen Katz und Maus zu spielen.«
»Werde ich denn nicht heiraten?«, hatte Greer gefragt.
»Doch, natürlich, Liebling! Aber nicht einfach irgendeinen Mann – er wird mindestens so klug sein wie du und sofort erkennen, was für ein Juwel du bist.«
Die drei Mädchen hatten sich angeschaut und versucht, sich vorzustellen, wie das Leben sein würde, wenn sie erwachsen waren.
»Ich will nicht heiraten«, hatte Phoebe schließlich gesagt. »Ich will bei Ava und Greer bleiben.«
Tante Cassandra hatte gelacht und Phoebe einen Kuss auf den blonden Scheitel gedrückt. »Es wird Männer in eurem Leben geben, meine Schätzchen, aber ihr werdet immer zusammen sein und euch gegenseitig beschützen. Ihr werdet euren Kummer und eure Hoffnungen miteinander teilen, und eure Kinder werden gemeinsam aufwachsen. Ihr werdet eure Männer und eure Kinder lieben, aber vergesst niemals, dass niemand euch näher stehen wird als eure Schwestern.«
»Greer ist nicht unsere Schwester, Mama!«, hatte Phoebe erklärt. »Sie ist unsere Cousine.«
»Danke, Liebling, ich weiß, dass sie dem Namen nach eure Cousine ist. Aber sie ist eure Schwester im Herzen.«
Sie hatte ihnen allen einen Gutenachtkuss gegeben und sie dann in der Obhut ihres Kindermädchens zurückgelassen.
Greer vergaß jenen Abend nie.
In vieler Hinsicht hatte Tante Cassandra recht behalten – sie wurde zu allen gesellschaftlichen Anlässen eingeladen und war eine gefragte Partnerin bei Spielen, Tanzveranstaltungen und Essenseinladungen. Die Gentlemen schienen sie zu mögen, aber sie war bisher dem Einen, der ihr Interesse für länger weckte, noch nicht begegnet. Es machte sie traurig, denn sie wollte Kinder und in der Nähe von Ava und Phoebe in London leben. Und sie wollte einen Mann heiraten, der klug und freundlich war und sich vor allem nicht von ihrem vielseitigen Wissen abschrecken ließ.
Tante Cassandra fehlte ihr sehr, vor allem jetzt. Ihre Tante würde wissen, was sie tun sollte – wegen des Erbes, wegen Percy und wegen dieses schrecklichen Schlosses.
Und natürlich dachte Greer auch an ihre Mutter, eine Frau, die in der Erinnerung immer so aussah wie auf dem winzigen Porträt, das Greer bei sich trug. Von ihrem Vater hatte sie kein Bild, und sie konnte sich nicht mehr erinnern, wie er ausgesehen hatte. Eigentlich konnte sie sich überhaupt nicht mehr an ihn erinnern. Aber an ihre Mutter – Tante Cassandras Halbschwester – erinnerte sie sich lebhaft.
Jetzt jedoch dachte sie trübsinnig, dass sie einem Geist nachjagte. Ein paar Erinnerungen, ein winziges Porträt und nur der immer wiederkehrende Traum, den sie in den letzten Jahren von ihrer Mutter gehabt hatte. Im Traum stand ihre Mutter im Sonnenlicht in der Tür eines weißen Herrenhauses und winkt Greer hinein. Und Greer lief auf sie zu, um sie zu erreichen, bevor sie im Haus verschwand. Aber es gelang ihr nie.
Und dieser Traum hatte sie ganz bestimmt nicht hierher gebracht, in dieses ferne, düstere Schloss, das mit dem Wales ihrer Erinnerung gar nichts zu tun hatte.
Und dabei hatte sie doch immer mit beiden Beinen fest auf der Erde gestanden. Sie war eine hervorragende Schülerin gewesen und konnte nie genug Mathematik, Wissenschaft und Literatur lernen. Sie war doch eigentlich nicht der Typ für flüchtige Launen und Moden. Warum riskierte sie nun ihr Leben und ihre Tugend für so eine abenteuerliche Jagd?
Trotz des Feuers im Kamin wurde es im Zimmer immer kälter. Zum Glück erschien ein weiterer Lakai mit Greers Reisetruhe. Sie zündete eine Kerze an und öffnete die Truhe, um ein geeignetes Gewand für die Nacht und einen Kaschmirschal gegen die Kälte herauszuholen. Für die Abendtoilette begnügte sie sich mit dem eiskalten Wasser im Becken. Kurz darauf kam ein Lakai mit ihrem Abendessen. Sie hob die Silberkuppel ab. Darunter verbarg sich ein Fischeintopf. Sie setzte die Silberkuppel wieder darauf; sie hatte keinen Appetit.
Als der Lakai weg war, versuchte sie Hände und Gedanken damit zu beschäftigen, dass sie sich die Haare bürstete. Der Wind war noch stärker geworden, und der Regen peitschte gegen die Fensterscheibe, als würde jemand Kieselsteine dagegen werfen. Die Geräusche waren so nervenaufreibend, dass Greer sich schließlich die Haare zusammenband und im Zimmer auf und ab ging.
Die Kerze flackerte, und Greer musste plötzlich an einen Roman denken, den Phoebe ihnen einmal vorgelesen hatte. Die Geschichte eines Mädchens, das mit einem Gespenst in einem Schloss eingeschlossen war, hatte die drei jungen Frauen nächtelang bewogen, in einem Bett zu schlafen.
Erneut rüttelte der Wind am Fenster, und Greer fuhr vor Angst fast aus der Haut. Sie blickte auf die kleine Uhr, die sie an der Brust trug. Es war viertel vor zehn. Bestimmt würde sie in den Gängen des Schlosses um diese Uhrzeit keinen mehr stören – sie wollte sich nur schnell auf die Suche nach Mr Percy machen, damit er ihr Gesellschaft leisten konnte, bis der Sturm vorüber war.
Vorsichtig öffnete sie die Tür und spähte hinaus. Am Ende des Korridors flackerte ein Licht, und wo Licht war, war vielleicht auch ein anderes menschliches Wesen.
Sie ergriff ihren Kerzenleuchter und trat in den Gang, um den Weg einzuschlagen, den der Butler sie hierhergeführt hatte. Am Ende des Korridors konnte sie sich jedoch nicht mehr erinnern, ob sie von links oder rechts gekommen waren.
Sie entschied sich für rechts.
Das Herz klopfte ihr bis zum Hals, als sie durch einen Gang huschte, in dem Bienenwachskerzen in Wandhalterungen flackerten. Nur wenige Leute konnten sich diese Extravaganz leisten, aber Greer war froh darüber. Sie blies ihre Kerzen aus, stellte ihren Leuchter beiseite und ging leise den Korridor entlang, wobei sie sich die Gemälde ansah.
Sie fand es interessant, dass der Prinz zwar eine beeindruckende Kunstsammlung in seinem Schloss zu haben schien, anderweitig jedoch kaum eingerichtet war.
Am Ende des Ganges hing das Gemälde einer Frau, die unter einem Baum saß. Greer erkannte sofort, dass es sich um ein Werk von Thomas Gainsborough handelte, und blieb stehen, um es zu bewundern. Die Frau trug ein weißes Reifrockkleid mit blauer Schärpe. Auf ihrem Kopf saß ein breitkrempiger Sommerhut, und juwelenbestickte Pantöffelchen blitzten unter dem Saum ihres Kleides hervor. Zu ihren Füßen lag ein kleiner Hund.
Greer trat näher, um das Bild eingehender zu betrachten, als hinter ihr die Dielen knarrten.
Mit einem erschreckten Aufschrei drehte sie sich um, woraufhin die beiden Hunde hinter ihr in heftiges Gebell ausbrachen.
Direkt hinter ihnen tauchte ein Mann im Türrahmen auf, und Greer blieb das Herz stehen. Er sagte in scharfem Tonfall etwas zu den Hunden, die sich sofort hinlegten.
Erschreckt keuchte Greer auf und drückte die Hand an den Hals. Der Prinz hatte seinen Umhang abgelegt, auch Jacke, Weste und Halstuch. Er trug nichts weiter als eine Hose und ein offenes Hemd, unter dem sie einen Blick auf die dunklen Haare erhaschte, die sich auf seiner muskulösen Brust kräuselten. Mit bloßen Füßen lehnte er am Türrahmen, eine Flasche in einer Hand. Er wirkte nicht besonders zivilisiert und blickte sie finster an.
»Verzeihung«, sagte Greer und wandte sich zum Gehen.
»I ble rydych chi’n mynd?«, sagte er mit scharfer Stimme.
Greer unterdrückte ein Schaudern und warf ihm einen misstrauischen Blick zu.
Wieder sagte er etwas zu den beiden Hunden, die auf sein Kommando hin im Zimmer verschwanden. Der Prinz bewegte sich jedoch immer noch nicht. Er musterte sie eingehend, ihr Nachtgewand, den Schal, der ihr von einer Schulter gerutscht war, ihre Pantoffeln und ihre Haare. Dann senkte er die Flasche und blickte ihr in die Augen. »Ich weiß, wer Ihr seid«, sagte er. »Was macht Ihr hier?«
»Ich habe …« Im letzten Moment besann sie sich noch, bevor sie ihm erzählte, dass sie unruhig und ängstlich gewesen war und das kleine Zimmer verlassen musste, bevor sie wahnsinnig wurde. »Ich habe mich verirrt«, log sie.
»Verirrt«, wiederholte er. »Ihr habt Euch noch nie verirrt.«
Seine Antwort verwirrte sie. »Ich, äh.« Sie blickte den Korridor entlang. »Ich wollte Wasser«, sagte sie, um zu erklären, wie sie hierherkam. »Ich habe nach dem Butler gesucht, aber ich bin wohl falsch abgebogen.«
Ohne den Blick von ihrem Busen zu wenden, stieß sich der Prinz vom Türrahmen ab. Er war nicht mehr so ganz sicher auf den Beinen. »Habt Ihr nicht daran gedacht, Eure Magie einzusetzen«, fragte er und wackelte mit den Fingern. »Oder zumindest die Klingelschnur?«
Die Klingelschnur. Sie hatte noch nicht einmal nachgesehen, ob es in ihrem Zimmer eine gab. Sie antwortete nicht und beobachtete, wie er schwankend auf sie zukam. Anscheinend hatte der Mann zu tief ins Glas geschaut, und Gott allein wusste, zu was er unter dem Einfluss von Alkohol fähig war. Panik stieg in ihr auf, und hektisch überlegte sie, wie sie ihm am besten entkommen konnte.
Aber er war sicher schneller als sie. Greer schluckte ihre Angst hinunter, wich jedoch instinktiv einen Schritt zurück und prallte gegen die Wandtäfelung.
Er blieb dicht vor ihr stehen und starrte sie an. Sein Blick fiel auf ihre Lippen. »Bethydy’ch enw chi?«
Greer blinzelte und hielt den Atem an.
Er hob den Blick. »Seid Ihr nicht aus Wales?«
Sie wagte es nicht zu antworten.
Der Prinz ließ den Blick wieder auf ihren Busen sinken, und tief in Greer breitete sich Hitze aus.
Er neigte leicht den Kopf und seufzte. »Wie heißt Ihr?«, fragte er. »Euer Vorname«, fügte er hinzu und blickte ihr wieder in die Augen. Verblüfft stellte sie fest, wie grün seine Augen waren – grün wie der Frühling. Aber diese Augen musterten sie auch, und ihr Herz hämmerte vor Angst. Was hatte er mit ihr vor?
»Greer«, antwortete sie mit schwacher Stimme.
»Greer«, wiederholte er leise. Er hob die Hand, als wollte er ihre Haare streicheln, und Greer schloss die Augen und wandte den Kopf.
Aber der Prinz berührte nicht ihre Haare – er berührte sie. Er besaß die Unverfrorenheit, sie zu berühren, und seine Finger glitten über die Haut ihres Busens. Greer riss die Augen auf. »Mylord!«, keuchte sie.
Er ignorierte sie. Er nahm das Amulett, das sie um den Hals trug, in die Hand und studierte es aufmerksam. Tante Cassandra hatte es ihr vor Jahren geschenkt, ein Kreuz, umgeben von drei Kreisen. Greer versuchte, noch weiter zurückzuweichen, indem sie sich fester an die Wand drückte, aber er schüttelte warnend den Kopf. Seine Finger wirkten dunkel vor der glatten blassen Haut ihres Busens.
Ihr Atem kam stoßweise, und ihre Panik stand kurz davor, in Hysterie umzuschlagen. Sie überlegte, ob sie ihn schlagen, zurückdrängen oder um Hilfe schreien sollte – aber sie stand da wie erstarrt und brachte keinen Ton hervor.
»Es ist walisisch«, sagte er. »Ein Amulett.« Er ließ es wieder sinken, wobei seine Finger heiß ihren Hals streiften. Greer legte die Hand über die Kette. »Das glaube ich nicht«, sagte sie heiser. »Ich bin sicher, dass es in London gekauft wurde.«
»Es ist walisisch«, wiederholte er. »Ich kenne Euch. Ihr verfolgt mich«, hauchte er. Seine Augen leuchteten. Sie konnte seinen Blick nicht ertragen und wandte wieder den Kopf ab, aber er legte ihr die Hand unter das Kinn und zwang sie, ihn anzusehen.
Sie standen ganz dicht voreinander. »Ich weiß, was Ihr wollt«, murmelte er. »Aber Ihr werdet keinen Erfolg haben.« Und dann küsste er sie, zu ihrem Entsetzen. Seine Lippen waren warm und feucht und glitten verführerisch über ihre. Seine große Hand lag in ihrem Nacken, und sie hatte das Gefühl, er könne sie mit einem Griff erwürgen, wenn er wollte. Dann glitt seine Hand zu ihrer Schulter und von da aus über die Rundung ihres Ausschnitts. Die leichte Berührung ließ sie vor Erregung erschauern.
Der Kuss war sanft und fordernd zugleich, und er war außergewöhnlich erotisch. Ihr Körper reagierte darauf, wurde heiß unter seiner Berührung und bebte vor Lust.
Gerade als sie dachte, sie müsse in Ohnmacht fallen, trat er plötzlich zurück und löste sich von ihr. Sein Mund verzog sich zu einem gefährlichen Lächeln, er hob seine Flasche und trank noch einen Schluck. Mit dem Flaschenhals zeigte er auf sie. »Ihr werdet nicht gewinnen«, sagte er. Noch einmal glitt sein Blick über sie. Er trank noch einen weiteren Schluck aus der Flasche, dann wandte er sich schwankend um und humpelte in das Zimmer, aus dem er gekommen war.
Als sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, holte Greer tief Luft und sank völlig erschöpft an der Wand zusammen. Es dauerte eine Weile, bis sie wieder stehen konnte. Dann raffte sie ihren Schal und lief denselben Weg zurück, den sie gekommen war. Im Vorbeigehen ergriff sie ihren Kandelaber, zündete jedoch nur eine Kerze an, damit sie so schnell wie möglich in ihr Zimmer kam, wo sie vor dem wahnsinnigen Prinzen geschützt war.
In seinem Studierzimmer nahm der Prinz einen weiteren Schluck aus der Flasche. Er trank sie aus und setzte sich wieder auf seine Chaiselongue. Müßig kraulte er einem der Hunde den Kopf, dann legte er die Hand auf sein Knie. Vergeblich versuchte er, den Schmerz wegzureiben, gab jedoch rasch auf und sank zurück gegen die Lehne. Müde legte er einen Arm über die Augen und wartete darauf, dass der Schlaf ihn von seiner Qual erlöste.
Kapitel 4
Greer machte kaum ein Auge zu. Bei jedem Geräusch wachte sie auf und fürchtete, der Prinz käme ins Zimmer. Und sie fürchtete auch ihre Reaktion auf ihn. Sie hatte solche Angst gehabt und war zugleich so erregt gewesen – und das verstörte sie mehr als alles andere.
Und so fuhr sie auch am nächsten Morgen erschreckt aus dem Schlaf auf, als jemand sie in die Zehen zwickte. Ein Mädchen stand am Fußende ihres Bettes.
»Wer … wer bist du?«, fragte sie.
Das Mädchen, ein schmächtiges, kleines Ding, blickte sie aus großen, dunklen Augen an. »Ich bin Lucy, Ma’am. Aber meistens werde ich Lulu gerufen. Ich bin Eure Zofe.«
Das einfache Englisch des Mädchens überraschte Greer. Sie setzte sich auf und zog die Beine an. Misstrauisch musterte sie das Mädchen. »Woher kommst du? Du klingst nicht walisisch.«
»Oh nein, Ma’am, ich komme aus Shrewsbury.«
Shrewsbury lag wenigstens auf der richtigen Seite der Grenze, und Greers Misstrauen ließ ein wenig nach. Sie schwang die Beine aus dem Bett. »Und wie bist du nach Llanmair gekommen?«, fragte sie. »In einer Mietkutsche?«
»Oh nein, Miss. Mein Vater hat mich hierher gebracht, damit ich hier arbeiten kann.«
Sie wies auf die Waschschüssel. »Ich habe Euch frisches Wasser gebracht. Seine Lordschaft bittet Euch zum Frühstück in den großen Speisesaal, und wenn Ihr fertig seid, sollt Ihr in sein Studierzimmer kommen.«
Greer errötete leicht bei der Erwähnung des Prinzen; sie wich dem Blick der Kleinen aus und trat an die Waschschüssel, wo sie sich eiskaltes Wasser ins Gesicht spritzte, um wach zu werden. Als sie sich umdrehte, hatte Lulu die Vorhänge zurückgezogen, und Sonnenlicht flutete ins Zimmer.
»Es hat aufgehört zu regnen«, murmelte Greer, mehr zu sich selbst als zu Lulu.
»Ja«, erwiderte Lulu mit einer Fröhlichkeit, die in dem trostlosen kleinen Zimmer unangebracht schien. »Es ist ein schöner Tag. Soll ich Euch beim Anziehen helfen?«, fragte sie und ergriff ein weiches, bernsteinfarbenes Morgengewand, das Phoebe für Greer aus einem alten Kleid von Tante Cassandra genäht hatte.
»Danke … aber ich brauche ein Reisekleid«, antwortete Greer. »Ich verlasse Llanmair heute.«