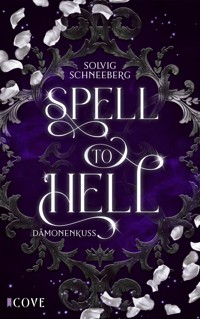5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Liebe macht nicht vor Polizisten halt. Und auch nicht vor Vampiren.** Lucy Barlow ist die einzige menschliche Frau der Paranormal Investigation Unit. Als neu ernannte Detective soll sie ausgerechnet unter Sergeant Kieran Davenport arbeiten. Kieran ist nicht nur heiß und eisern diszipliniert, sondern auch ein Halb-Vampir in einem Team von Werwölfen und anderen übernatürlichen Wesen. Während nächtlicher Ermittlungen kommt Lucy Kieran näher als gewollt, doch die Spannung zwischen ihnen ist ebenso elektrisierend wie kompliziert. Denn als ein Konflikt in der Unterwelt sich zuspitzt, muss Lucy feststellen, dass sie nicht die ganze Wahrheit über ihren geheimnisvollen Boss kennt ... »Fangs and Claws« erzählt die spicy Grumpy x Sunshine-Romance zwischen Boss Keiran und Detective Lucy. //»Fangs and Claws« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Solvig Schneeberg
Fangs and Claws
**Liebe macht nicht vor Polizisten halt. Und auch nicht vor Vampiren.**
Lucy Barlow ist die einzige menschliche Frau der Paranormal Investigation Unit. Als neu ernannte Detective soll sie ausgerechnet unter Sergeant Kieran Davenport arbeiten. Kieran ist nicht nur heiß und eisern diszipliniert, sondern auch ein Halb-Vampir in einem Team von Werwölfen und anderen übernatürlichen Wesen. Während nächtlicher Ermittlungen kommt Lucy Kieran näher als gewollt, doch die Spannung zwischen ihnen ist ebenso elektrisierend wie kompliziert. Denn als ein Konflikt in der Unterwelt sich zuspitzt, muss Lucy feststellen, dass sie nicht die ganze Wahrheit über ihren geheimnisvollen Boss kennt …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
© Foto Studio Carl
Solvig Schneeberg studierte Literaturwissenschaften in ihrer Heimatstadt Erfurt, bevor sie beschloss, sich einzig dem Schreiben zu widmen. Bereits in jungen Jahren entdeckte sie die Liebe zum geschriebenen Wort und fing bald an, ihre eigenen Geschichten aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Sie ist eine verträumte Romantikerin, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass ihr ganzer Fokus auf Fantasy- und Liebesromanen liegt. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten, einem Hund und den Katzen lebt sie am Waldrand von Weimar.
Für die Liebe meines Lebens
Vorbemerkung für die Leser*innen
Liebe*r Leser*in,
dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Aus diesem Grund befindet sich hier eine Triggerwarnung. Am Romanende findest du eine Themenübersicht, die demzufolge Spoiler für den Roman enthält.
Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest. Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du während des Lesens auf Probleme stößt und/oder betroffen bist, bleib damit nicht allein. Wende dich an deine Familie, Freunde oder auch professionelle Hilfestellen.
Wir wünschen dir alle Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.
Solvig Schneeberg und das Impress-Team
1.Kapitel
Ich wischte mir die verschwitzten Hände an meinen alten Leggings ab. Dankbar drehte ich mich zu den Umzugshelfern um, die allerdings schon in ihrem LKW verschwanden. Offensichtlich wollten sie sich hier nicht länger als nötig aufhalten.
Irritiert darüber wandte ich meine Aufmerksamkeit dem Gebäude zu, in das ich gerade einzog und blickte an der Fassade hinauf. Roter Backstein, heller Stuck und gepflegte Grünflächen vermittelten einen Wohlfühlcharakter. Hinter dem Haus gab es einen privaten Parkplatz, auf dem bereits mein Mietwagen stand. Bis ich mich entschieden hatte, ob ich wirklich ein eigenes Auto wollte oder brauchte, würde es der tun müssen. In vielen Reisebroschüren über New Orleans hatte ich gelesen, dass es schwer sein würde, Parkplätze zu finden, und die Straßen waren auch nicht die modernsten. Aber als Detective konnte ich nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sein. Vielleicht würde mir mein neuer Boss ja einen Tipp geben. Ich wusste, dass Sergeant Davenport hier geboren und aufgewachsen war. Nachdem ich die Stelle angenommen hatte, war eine Art Exposé über mein neues Team auf meinem Schreibtisch gelandet. Viele Informationen hatte ich nicht bekommen, nur dass mein neuer Chef ein Halbvampir war und dass ein Werwolf sowie zwei weitere Vampire zu meinen Kollegen zählen würden. Ich hatte ihre Namen erfahren und wie lange sie schon bei der Polizei waren.
Die Hektik der Umzugshelfer lenkte meine Aufmerksamkeit wieder zurück auf die aktuelle Situation. Sie schienen sich hier unwohl zu fühlen, dabei konnten sie wohl kaum sehen, was um sie herum wirklich passierte, aber sie spürten es. Man lebte eben nicht in New Orleans und blieb von all dem Übersinnlichen unberührt.
»Danke für die … Hilfe«, schloss ich matt, doch der Wagen hatte sich bereits in Bewegung gesetzt, bevor die Umzugskisten überhaupt alle im Haus waren. Und dafür hatte ich jede Menge Geld bezahlt! So ein Umzug quer durchs Land war nicht gerade billig. Ich war froh, dass die Möbel in meinem Apartment von einem anderen Unternehmen geliefert worden waren und ich damit nicht allein dastand.
Frustriert schüttelte ich den Kopf, nahm einen der verbliebenen Kartons und schleppte ihn ins Haus zu den restlichen, die sich vor dem Fahrstuhl stapelten. Eines meiner vielen Armbänder verhedderte sich an der oberen Ecke und zwang mich beinahe in die Knie, weil das schwarze Leder mit einem Zauber belegt war, damit es nicht zerriss.
Ich stolperte gegen die Wand und schaffte es endlich, meinen Arm zu befreien. Mit einem leisen Ping öffnete sich die Fahrstuhltür und ich zuckte zusammen. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass ich den Rufknopf gedrückt hatte. Aber immerhin gab es einen Fahrstuhl in dem alten Haus! Schwere Bücherkisten in den dritten Stock zu tragen, gehörte nicht zu meinen Hobbys.
Unter meinen Füßen knarrte das Holz des Bodens, der vermutlich aus der Originalzeit des Gebäudes stammte.
Ich holte die letzte Kiste ins Haus und stellte sie zu den anderen in den großen Fahrstuhl. Irgendwie hatte ich das Gefühl, auf Zehenspitzen laufen zu müssen, um niemandem mit dem lauten Geräusch zu stören. Was ich spürte, waren aber lediglich Restenergien. Vollkommen harmlos und ich hätte mich schon bald daran gewöhnt. Solche Energien waren schließlich in fast jedem alten Gebäude vorhanden. Besonders in solchen, in denen viele Emotionen aufeinandertrafen. Soweit ich wusste, war das hier früher eine Schule gewesen. Und wenn ich an meine Schulzeit zurückdachte, kamen einige Gefühle zusammen, obwohl ich größtenteils zu Hause unterrichtet worden war. Als Kind einer Schaustellerfamilie war ich in Wohnwagen aufgewachsen und daher nicht auf eine reguläre Schule gegangen.
Im dritten Stock stand die Tür zu meinem Apartment offen. Irritiert blieb ich stehen. Ich war mir sicher, die Flügeltür hinter mir zugezogen zu haben, als ich vorhin nach unten gegangen war. Den Schlüssel hatte ich an einem Band um meinen Hals hängen. Er klimperte gegen das silberne Schutzamulett.
»Jetzt dreh nicht gleich durch, Lucy«, murmelte ich mir selbst aufmunternd zu und ging weiter. Meine eigene Nervosität trieb meinen Puls in die Höhe und erinnerte mich einmal mehr daran, dass dies meine eigene erste Wohnung war. Mein eigenes Leben. Das erste Mal auf mich allein gestellt. Vielleicht war ich doch nicht bereit dafür? Vorsichtig lugte ich um die Ecke in meine Wohnung. Niemand zu sehen. Nichts zu hören. Natürlich nicht. Was hatte ich auch erwartet?
Ich betrat den kleinen Flur. Links von mir standen die Schiebetüren zu einer schmalen Nische offen, in der sich eine Waschmaschine und ein Trockner befanden. Durch die vielen Fenster im Küchen- und Wohnbereich schien die Frühlingssonne. Einmal mehr war ich dankbar, dass es in New Orleans kaum hohe Gebäude gab, die mir die Aussicht verdarben. In Los Angeles war das anders gewesen.
Seufzend betrachtete ich die vielen Kisten, die sich überall stapelten, sogar auf der hellblauen Sofalandschaft. Ich beeilte mich, die restlichen zu holen, dann schloss ich die Tür hinter mir. Fest. Ich schloss direkt ab.
»Also wirklich, die Jugend von heute.«
Erschrocken drehte ich mich um. Mitten in meinem Wohnzimmer stand eine ältere Dame, tiefe Falten im Gesicht, aber hübsch geschminkt. Die kurzen Haare wurden von einem einfachen Satinband zurückgehalten. Sie trug ein Abendkleid aus dunkelblauer Seide, dazu weiße Handschuhe, die bis zum Oberarm reichten. Um den Hals hing ein auffälliges Diamantcollier. Eine Pelzstola rundete ihr Outfit ab.
Jetzt wusste ich, wieso diese Wohnung so preiswert vermietet wurde, obwohl es im restlichen Komplex teurer war. Hier spukte es.
Im Gegensatz zu gängigen Meinungen waren Geister keine durchsichtigen Gestalten, die geräuschlos über den Boden schwebten. Deshalb war es für junge und unerfahrene Medien auch so schwer, sie von den Lebenden zu unterscheiden. Auf den ersten Blick wirkten sie wie normale Menschen. Ältere Geister konnten mit ihrer Umwelt agieren, Gegenstände bewegen und sich dabei vor den Augen der Menschen verbergen oder auch nicht. Letzteres führte zu den vielen Spukgeschichten, in denen sich Dinge wie von Geisterhand bewegten. Ich hatte schon Geister getroffen, die sich einen Spaß daraus machten, Leute zu erschrecken. Aber es gab auch solche, die ihre Gestalt nicht verfestigen und nur Gegenständen bewegen konnten. Es kam immer auf die Erfahrung des Geistes an. Der Geist vor mir war offensichtlich erfahren genug, beides zu tun.
»Immer diese Schundliteratur. Nichts Gescheites mehr.«
Sie schien mich nicht wahrzunehmen, während sie den Inhalt meiner Bücherkiste inspizierte. Sie griff nach einem Buch, auf dem ein halbnackter Highlander eine ebenso leicht bekleidete Jungfrau in den Armen hielt. Zumindest war sie am Anfang des Romanes eine Jungfrau gewesen, erinnerte ich mich.
»Kann ich dir helfen?«
Ertappt ließ die Frau das Buch fallen und löste sich in Luft auf. Es gab kein verpuffendes Geräusch, keinen Lichtblitz, sie war einfach verschwunden. Nur der Hauch von teurem Parfüm lag in der Luft. Und das Buch, das mit einem lauten Knall auf dem Boden gelandet war.
»Super.« Ich verdrehte die Augen. »Hey, ähm …« Ich hob das Buch auf und legte es wieder zu den anderen in die Kiste. »Ich wollte dich nicht erschrecken. Offenbar bist du es nicht gewohnt, dass man dich sehen kann.«
Wie immer kam ich mir etwas dämlich vor, wenn ich mit einem Geist redete, der nicht gesehen werden wollte. Aber ich war mir sicher, dass sie hier noch in der Nähe war, ich roch noch immer ihr Parfüm. Süße Vanille.
»Mein Name ist Lucy. Lucy Barlow«, stellte ich mich vor und drehte mich einmal im Kreis, in der Hoffnung, sie wiederzusehen. Aber sie blieb verborgen.
»Ich werde jetzt meine Sachen auspacken. Wenn du mit mir reden willst, kannst du das jederzeit tun. Ich bin ein Medium.« Vielleicht würde ihr das Selbstvertrauen geben, wenn sie wüsste, dass ich das professionell machte. Mit Geistern reden. Doch die alte Frau blieb verschwunden und jetzt verblasste auch der Duft nach Vanille. Ich war allein.
»Okay. Dann also …« Ich seufzte. »Ist ja auch gar nicht merkwürdig, den ganzen Tag Selbstgespräche zu führen.«
Tatsächlich war es das für mich nicht. Bereits im Alter von sieben Jahren hatte ich angefangen, mit den Geistern in meiner Umgebung zu reden. Für Außenstehende wirkte das stets wie Selbstgespräche. Was im Kindesalter noch mit imaginären Freunden zu erklären gewesen war, verursachte mit zunehmendem Alter Probleme. Obwohl ich zu Hause unterrichtet wurde und wir viel umhergezogen waren, sorgte meine Eigenheit irgendwann immer für Aufmerksamkeit, inklusive Beleidigungen und Spott.
Kopfschüttelnd fing ich an, meine Bücherkisten auszuräumen. Interessanterweise, bemerkte ich, hatte ich viele Bücher, die ähnliche Cover aufwiesen, wie das vom Geist verschmähte. Und die Titel verrieten genauso viel über den Inhalt wie die freizügigen Cover. Ich weigerte mich, deswegen beschämt zu sein. Solche Romane halfen mir, vom Alltag abzuschalten und mal nicht an das Übernatürliche zu denken, das mich stets umgab.
Jedes Mal, wenn ich mich umdrehte, rechnete ich damit, meine neue Mitbewohnerin zu sehen, doch sie blieb verschwunden.
Da mein Kühlschrank bis auf ein paar Flaschen Wasser leer war, bestellte ich mir Pizza zum Abendbrot. Richtig traditionell, aber da ich noch keine Restaurants in der Gegend kannte, wollte ich kein Risiko eingehen. Und was konnte bei einer Gemüsepizza mit extra Käse schon schief gehen?
Etwas später lag ich in der Badewanne, ein Schaumbad mit Erdbeerduft umgab mich und dichter Schaum bedeckte meinen Körper. Mit feuchten Fingern umklammerte ich mein Telefon. Es wäre richtig gutes Timing, wenn mir mein Handy ausgerechnet in die Badewanne fiel, kurz bevor ich meinen neuen Job antrat.
»Ja, Mum, ich bin gut angekommen. Wie oft denn noch?« Ich griff nach dem Glas Weißwein, das auf dem Badewannenrand stand und trank einen Schluck. Für die Zukunft würde ich mir wahrscheinlich so ein praktisches Tablett kaufen, auf dem ich Wein und Buch ablegen konnte. Bisher hatte ich nie eine Badewanne gehabt. Und damit auch keine wasserdichte Hülle für mein Handy.
»Ich denke eben nicht, dass ein Umzug nach New Orleans die beste Entscheidung war.«
Was sie nicht sagte, war die Tatsache, dass sie meinen Job für eine schlechte Entscheidung hielt. Bereits im Laufe des Tages hatte ich meiner Mutter mehrere Textnachrichten und Bilder geschickt, aber ihre Sorge um mich nahm nicht ab.
»Du bist einfach viel zu jung, um allein auf dich gestellt zu sein.«
Ich verdrehte die Augen. Schließlich war ich bereits zweiundzwanzig. Die Prüfung zum Detective hatte ich schon so früh ablegen dürfen, weil meine übersinnlichen Fähigkeiten mir geholfen hatten. Sonst hätte ich warten müssen. Mein alter Captain in Los Angeles hatte mich direkt mit meiner Beförderung versetzt. Er war vermutlich froh, mich los zu sein. Meine Art, Fälle und Probleme zu lösen, hatte oft mit meiner übersinnlichen Gabe zu tun gehabt. Und das war für einen Unwissenden schwer zu verstehen. Meines Wissens gab es in jeder größeren Stadt Abteilungen für übernatürliche Fälle, wieso ich nicht in L. A. bleiben konnte, erschloss sich mir daher nicht. Zumal ich mit der dortigen PIU, der Paranormal Investigation Unit, schon Kontakt gehabt hatte. Der Leiter hatte ein paar Strippen gezogen und es mir ermöglicht, meine Detectiveprüfung zu machen. Ich nahm an, dass er mich für das Team haben wollte und deshalb meine Beförderung forciert hatte. Aber ich erhielt noch am selben Tag meine Versetzung.
So oder so war der Umzug für mich eine gute Gelegenheit, auch wenn ich hier viel mehr mit der Welt des Übernatürlichen zu tun haben würde, als im Kreis meiner Familie.
»Mum, wir hatten das Gespräch schon so oft«, sagte ich sanft, um sie zu beruhigen. Sie zu reizen, wäre keine gute Idee. Obwohl meine Mutter selbst nicht zu den übernatürlichen Wesen zählte, kannte sie genug Leute, die mir einen fürchterlichen Fluch an den Hals wünschen könnten und würden.
Sie schwieg einen Augenblick. »Du hast keine Ahnung, was dich in der wahren Welt erwartet. Dein Vater mag ja denken, dass du schon bereit bist, aber …« Sie zögerte. »Ich würde mich einfach wohler fühlen, wenn du zurückkommen würdest.«
Natürlich fände sie das schöner. In L. A. gab es nur wenige gefährliche Wesen. Für Vampire und Werwölfe war das Wetter einfach nicht geeignet. Mit Hexen und Geistern kam ich stattdessen dauernd in Berührung. Die stellten keine Bedrohung für mich dar. Aber ich würde nie erwachsen werden, wenn ich nicht endlich meinen eigenen Weg ging. Sie war schon nicht begeistert gewesen, als ich mich kurz nach meinem achtzehnten Geburtstag bei der Polizei gemeldet hatte. Sie hätte mich lieber weiterhin in unserem Wanderzirkus gesehen, wo ich als Wahrsagerin ahnungslosen Menschen das Geld aus der Tasche ziehe. Das hatte ich schon immer gehasst. Manchmal konnte ich Angehörigen wirklich helfen, wenn ich einen Geist in ihrer Nähe antraf. Aber zum größten Teil hatte ich meine sensiblen Sinne genutzt, um Menschen und ihre Stimmung zu lesen. Dann hatte ich ihnen irgendetwas erzählt und sie waren glücklich.
Ich hatte das gehasst.
»Okay, okay. Ich sehe schon, es ergibt keinen Sinn mit dir zu reden. Ruf mich einfach an, wenn du vernünftig geworden bist.« Sie legte auf, bevor ich antworten konnte.
Seufzend starrte ich mein Handy an, bevor ich es weglegte. Ausgerechnet jetzt entschied sich meine neue Mitbewohnerin, wieder aufzutauchen. Zuerst hielt ich den Vanilleduft für Einbildung, aber er wurde stärker. Die Kleiderbügel in meinem begehbaren Kleiderschrank klapperten gegeneinander.
»Ich freue mich, dass du dich entschieden hast, zurückzukehren«, rief ich über den Flur. Augenblicklich verstummten die Geräusche. »Ich würde mich gern mit dir unterhalten, aber vorher komme ich aus der Wanne, ja?« Das Wasser schwappte um mich herum, als ich aufstand. Nach dem Telefonat mit meiner Mutter könnte ich jetzt eh nicht mehr entspannen.
Ich wickelte mich in ein großes Handtuch und ging ins Schlafzimmer rüber. Vorsichtig beugte ich mich vor und sah in meinen Kleiderschrank. Die Frau stand still zwischen den Regalen, ein Top von mir in der Hand, das ich zum Schlafen anzog. Es war abgetragen und hatte mehr Löcher als vertretbar.
»Trägt man das heutzutage?« Sie klang pikiert. Super, noch jemand, der meine Entscheidungen in Frage stellte.
»Ich schon«, antwortete ich schnippisch und riss ihr das Top aus der Hand. »Und man stellt sich außerdem vor, wenn man unbekannterweise in einer Wohnung spukt.« Ohne mich richtig abzutrocknen, schlüpfte ich in einen Slip und das Top. Achtlos ließ ich das Handtuch auf dem Boden liegen.
»Louise Beaufort.«
»Freut mich, dich kennenzulernen.« Ich war immer noch verstimmt.
»Lebst du allein hier?« Sie kam näher. Manche Geister liebten es, zu schweben, aber Louise trat fest auf. Auch wenn ich ihre Schritte nicht hörte, war ich mir sicher, dass sie mörderische High Heels trug.
»Nun, offenbar nicht, denn du lebst noch hier.«
Sie machte eine wegwerfende Handbewegung und ließ sich elegant auf den hellen Polstersessel in der Ecke fallen. »Das kannst du ja kaum als leben bezeichnen.«
»Dann bist du nicht gern hier?« Vielleicht konnte ich sie ja überreden, weiterzuziehen, wenn sie unglücklich war. Allerdings gab es auch Geister, die sich in der Welt der Lebenden wohl fühlten.
»Ach, es macht schon Spaß. Hin und wieder.« Sie zwinkerte mir verschwörerisch zu, als würden wir ein pikantes Geheimnis teilen. »Vor dir hat hier ein netter junger Mann gewohnt. Groß, muskulös – so einer wie auf diesen fürchterlichen Büchern, die du augenscheinlich so gern liest.«
Aha. Louise war also eine kleine Spannerin.
»Aber er ist leider ausgezogen, bevor ich ihn näher kennenlernen konnte.«
Ich fragte mich, wie genau sie ihn wohl schon kennengelernt hatte, bevor er den Spuk bemerkte.
»Werden wir zwei ein Problem bekommen?«, fragte ich vorsichtig, weil ich mir einen weiteren Umzug derzeit nicht leisten konnte.
Louise überlegte für meinen Geschmack etwas zu lange, dann schüttelte sie den Kopf. »Ich nehme an, als Medium kennst du Mittel und Wege, mich loszuwerden.« Als ich nicht antwortete, sprach sie weiter. »Daher würde ich es vorziehen, wenn wir uns arrangieren.«
So wie sie es sagte, klang es wie eine furchtbare Idee. Zugegeben, ich war auch nicht begeistert, aber im Moment hatte ich nicht viel Lust, mich mit einer Geistervertreibung zu beschäftigen. Bei einem Wesen, das nicht bereit war, überzutreten, war das schwierig und ich brauchte meine Energie für den morgigen Tag.
»Willst du das nicht aufheben?« Louise zeigte auf das Handtuch und kurz überlegte ich, doch etwas gegen ihre Anwesenheit zu unternehmen.
»Vielleicht sollten wir ein paar Regeln aufstellen«, schlug ich vor, während ich das Handtuch aufhob und ins Bad ging, um es aufzuhängen. Anschließend spülte ich die Badewanne noch aus. Schade um den schönen Schaum, den ich gar nicht richtig genossen hatte.
»Wie wäre es, wenn wir mein Schlafzimmer zur Tabuzone erklären? Und alles, was damit zu tun hat.« Ich traf sie wieder in dem begehbaren Kleiderschrank an, wo sie ungeniert meine Mode einer Prüfung unterzog. Offenbar war sie mit dem Großteil einverstanden, hauptsächlich allerdings mit meinen Kleidern und Röcken. Die Jeanshosen strafte sie mit einem abwertenden Blick.
»Was noch?« Sie drehte sich anmutig zu mir um. Die Diamanten an ihrem Hals glitzerten. Unwillkürlich fragte ich mich, wie sie hier gelandet war. In einem alten Schulhaus. Oder war sie erst gestorben, nachdem das hier ein Apartmentkomplex wurde?
»Mein Kleiderschrank ist auch tabu.«
Sie verzog schmollend die roten Lippen, folgte meiner stummen Aufforderung aber. Im Wohnzimmer setzte sie sich auf das Sofa, strich ihr Kleid glatt und sah mich abwartend an. Vielleicht würde das hier ja doch einfacher werden als befürchtet.
»Offensichtlich kommen wir aus unterschiedlichen Zeiten.« Sie schnaubte undamenhaft. »Und haben eine unterschiedliche Auffassung von Mode.«
»Das ist kaum zu übersehen.« Elegant deutete sie auf mein Schlafshirt und meine nackten Füße. Ich überging die versteckte Beleidigung.
»Du weißt doch sicher, dass sich die Zeiten geändert haben. Frauen tragen jetzt Hosen.«
»Ich bin tot, nicht blöd.«
Ich setzte mich ihr gegenüber in den Sessel. Im Schneidersitz. Kurz verblasste ihre Gestalt, so geschockt war sie. Sofort veränderte ich meine Position. Ich musste sie nicht vollkommen aus dem Konzept bringen. Louise wurde wieder greifbarer.
»Wie lange bist du schon tot?«
Manche Geister reagierten geschockt oder gar pikiert, aber Louise lächelte sogar etwas. »Das war im Jahr 1951. Einmal im Jahr veranstaltete das St. Vincent Hospital für die Ärzte und Schwestern eine Gala und natürlich sind wir hingegangen.« Unnötigerweise deutete sie auf ihr Kleid. Sie war also Krankenschwester gewesen. »Auf dem Heimweg bin ich wohl gestolpert.« Ihr Lächeln verrutschte etwas, aber sie fing sich schnell. »Als ich aufgewacht bin, lag ich hier auf dem Wohnzimmerboden.«
»Dann hast du hier also gewohnt?« Ich wollte mehr über sie erfahren. Nicht nur, um sie irgendwann vielleicht doch auf die andere Seite zu schicken, sondern weil sie eine Faszination auf mich ausübte. Sie war eine Dame durch und durch. Von ihrer eleganten Haltung bis hin zu ihrer Kleidung.
»Erst ein paar Wochen, aber es war ein ganz wunderbares Leben. Das Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, war nicht weit weg und die Nachbarn waren alle so nett.«
Ich nickte und musste ein Gähnen unterdrücken. Entsetzt starrte Louise mich an, ich hatte die Hand nicht vor den Mund genommen.
»Tut mir leid.« Ich lächelte sie entschuldigend an. »Ich würde wirklich gern mehr darüber erfahren, aber das war ein anstrengender Tag und ich muss morgen früh raus.«
Ohne sich zu verabschieden, verschwand Louise. Für einen Moment hing ihr Parfüm noch in der Luft, dann verblasste auch der Duft.
Müde ging ich ins Schlafzimmer und fiel in das frischbezogene Bett. Der Geruch von Weichspüler hüllte mich ein, es roch nach meiner Kindheit und Geborgenheit. Heimweh überkam mich und für den Augenblick ließ ich die Trauer und den Schmerz zu. Tränen brannten in meinen Augen, die ich allerdings vehement wegblinzelte. Ich wischte mir über das Gesicht und drehte mich auf die andere Seite. Das Licht von der Straßenlaterne malte Muster auf die Wände. Ich hatte noch keine Vorhänge angebracht. Das landete auf meiner To-Do Liste für die nächsten Tage. Gähnend kuschelte ich mich tiefer in die Kissen und fiel letztendlich in einen unruhigen Schlaf.
2.Kapitel
Ich wachte am nächsten Morgen noch vor dem ersten Weckerklingeln auf.
Meine erste Schicht im New Orleans Police Department begann erst in drei Stunden. Noch während ich im Bett lag, googelte ich in meinem Handy nach der Adresse eines kleinen Cafés oder Supermarktes. Obwohl ich nichts gegen kalte Pizza zum Frühstück hatte, brauchte ich zum Abendessen doch mehr als das, was in meinem Kühlschrank lagerte. Oder eben nicht dort lagerte.
Meine Mitbewohnerin ließ sich den ganzen Morgen nicht blicken. Sie tauchte erst auf, als ich vom Einkaufen zurückkam.
Sie starrte mich an und tippte mit dem Fuß ungeduldig auf den Boden. »Wo bist du gewesen?«
Sie klang fast schon wie meine Mutter. Erklärend hielt ich die vielen Plastiktüten hoch. »Kühlschrank auffüllen.«
»Du hättest Bescheid sagen können.«
Mitten in der Bewegung hielt ich inne und drehte mich zu ihr um. »Bescheid sagen? Louise, ich bin erwachsen. Soll ich dir jetzt jedes Mal einen Zettel schreiben, wenn ich meine Wohnung verlasse?« Ich räumte den Kühlschrank ein. Louises Kopf tauchte neben meiner Schulter auf.
»Kein Fleisch? Kein Fisch?«
»Ich bin Vegetarierin.«
»Kein Wunder, dass du so dünn bist.« Sie zog sich schmollend zurück.
Dünn? Ich überlegte. Eigentlich hatte ich mich nie als dünn gesehen, eher als weiblich. Trotz meines Kampftrainings bei der Ausbildung waren bestimmte Stellen an meinem Körper einfach nicht weniger geworden. Seufzend schüttelte ich den Kopf und räumte die Lebensmittel ein.
»Du wirst hier Probleme kriegen.«
»Ach? Und wieso?« Der Gedanke, Louise auf die andere Seite zu schicken, erschien mir immer verführerischer. Würde sie sich etwa die ganze Zeit in meine Angelegenheiten einmischen?
»Wir lieben Fisch. Du wohnst direkt an der Quelle für die besten Gerichte. Jambalaya, Gambo …« Sie schloss genießerisch die Augen.
»Für alles gibt es Alternativen«, entgegnete ich und trank einen Schluck Wasser. Trotz der frühen Uhrzeit waren es bereits über zwanzig Grad. Das war ich Gott sei Dank bereits aus L. A. gewohnt.
»Alternativen?« Sie schüttelte sich, als hätte ich vorgeschlagen, Kaffee mit Ketchup statt Milch zu trinken. »Das ist einfach nicht das Gleiche.«
Ich ignorierte sie und packte stattdessen meine Sachen für den Tag. Meine Dienstwaffe würde man mir im Department aushändigen, meinen Ausweis hatte ich bereits bekommen. Als ich die Marke an meinem Gürtel befestigte, zitterten meine Hände. Wieso war ich so nervös? Ich war bereits seit Jahren bei der Polizei, Kriminalität war mir nicht fremd.
»Die rote Jacke würde ich entsorgen.«
Louises Stimme erschreckte mich. Sie stand in der Tür zum Schlafzimmer, hielt sich also an die Grenzen, die ich letzte Nacht aufgestellt hatte. Ich hielt die alte Lederjacke in der Hand, die ich eigentlich anziehen wollte.
»Sie passt nicht zu deiner Haarfarbe«, erklärte sie, weil ich nicht antwortete.
»Meine Haarfarbe? Du weißt, dass ich eigentlich blond bin?«
»Als ob an diesem Blau irgendetwas natürlich wäre«, murmelte sie im Weggehen.
So sehr ich ihr widersprechen wollte, ich hielt mich zurück. Ich wollte an meinem ersten Tag einen guten Eindruck machen und wenn meine Jacke nicht zu meiner Haarfarbe passte, würde mir das sicherlich nicht helfen. Sie landete also in der hinteren Ecke meines Kleiderschrankes und ich griff stattdessen nach der schwarzen Lederjacke. Obwohl tagsüber mehr als zwanzig Grad herrschten, waren die Nächte noch ziemlich kühl und da ich nicht wusste, wie lang meine erste Schicht gehen würde, war ich lieber vorbereitet.
Brauchte ich sonst noch etwas? Ich zog am Saum meines T-Shirts, das mir plötzlich zu kurz vorkam, dabei hatte ich es in L. A. ständig getragen. Deshalb gab es auch einen ganzen Stapel dieser praktischen Shirts in meinem Schrank.
»Bist du dann mal endlich fertig oder brauchst du noch eine Modenschau?«
»Louise, wirklich!« Wütend kam ich zurück ins Wohnzimmer. »Du nervst!«
Entrüstet sah sie mich an, dann löste sie sich auf. Nicht einmal ihr Parfüm hing noch in der Luft.
»Super. Das hast du ja ganz toll hinbekommen, Lucy.«
Ich machte mir gar nicht die Mühe, sie zu rufen, so genervt war ich von ihr. Stattdessen packte ich meine Sachen für den Arbeitstag und machte mich früher auf den Weg als notwendig.
Der Weg zum Department dauerte etwa eine Viertelstunde und auch das nur, weil ich einmal eine falsche Abzweigung nahm. Je näher ich kam, umso bewusster wurde mir, dass ich mich dem berühmten French Quarter näherte. Der Verkehr wurde dichter und Fußgänger bevölkerten die Fußwege. Der St. Louis Cemetery I, die letzte Ruhestätte von Delphine LaLaurie, einer Serienmörderin, bekannt für das Foltern und Töten von Sklaven in ihrem Haus, und vermutlich auch von Voodoo-Priesterin Marie Laveau, lag gegenüber vom Polizeirevier. Es kribbelte in meinen Händen, als ich dort vorbeifuhr. Am liebsten hätte ich sofort umgedreht und mich mit all den ruhelosen Seelen dort unterhalten. Abseits von den Touristentouren, die in engen Zeitplänen durch die Mausoleen streiften.
Stattdessen zügelte ich meine Ungeduld und konzentrierte mich auf den Weg zum Parkplatz. So weit, so gut. Das Revier war früher winzig gewesen, doch mit der Einführung der PIU hatte sich die Polizei das angrenzende Gebäude ebenfalls zunutze gemacht und sich erweitert. Was mir die Suche nach dem Haupteingang jetzt erschwerte. Ich wollte nicht inkompetent wirken, wenn ich blöd herumlief und fragte, aber mir blieb keine andere Wahl.
Ich schulterte meinen Rucksack und umrundete das Gebäude, bis ich einen Eingang fand. Hinter einem langen Rezeptionstresen saßen zwei Polizistinnen. Eine von ihnen sah mich freundlich an, die andere ignorierte mich. Vielleicht lag es an dem Geist eines alten Mannes, der zerfetzten Kleidung nach zu urteilen, ein Obdachloser, der ihr auf der Schulter lehnte und mit ihr flüsterte. Sie schien ihn nicht zu hören, aber alle paar Sekunden zuckte sie zusammen oder wischte mit der Hand in der Luft herum, als würde sie eine Fliege verscheuchen wollen.
»Kann ich Ihnen helfen?« Die freundliche Polizistin lächelte und ich trat näher. Sie musterte mich. Angefangen bei meinen blau gefärbten Haaren, die in einem hohen Zopf steckten, die zwei Ketten um meinen Hals in Gold und Silber, die vielen Armbänder mit verschiedenen Anhängern und Kristallen. Ich fragte mich, was sie wohl von mir hielt.
»Ja, hi. Guten Morgen.« Mit einem Blick auf die große Uhr hinter ihr stellte ich fest, dass es schon fast Mittag war. »Ich bin Detective Barlow.« Ich zeigte ihr meinen Ausweis, den sie gewissenhaft kontrollierte, bevor sie ihn mir zurückgab.
»Willkommen, Detective. Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Ich fange heute hier an, Paranormal Investigation Unit.«
Ihr Lächeln verblasste beinahe sofort und ihre Kollegin sah interessiert auf. »Ist das Ihr Ernst?«
Verwirrt blickte ich zwischen den beiden hin und her. Ich verstand ihren plötzlichen Sinneswandel nicht. »Ja?«
Jetzt lachte die vorher so freundliche Polizistin laut los. Der Geist des Obdachlosen schüttelte beinahe mitleidig den Kopf. Mir war natürlich bewusst, dass mein Department Gesprächsstoff bildete, aber ich hatte mir ein wenig mehr Offenheit erhofft. Schließlich war das hier New Orleans. Keine fünfzig Meter von hier wurden Gespenstertouren über einen Friedhof angeboten und im French Quarter gab es ebenso viele Spuk- und Geistergeschichten. Sollte das nicht auf die Menschen abfärben? Selbst in Los Angeles wurde die PIU von den Kollegen akzeptiert. Oder ich war einfach nicht lange genug mit ihnen zusammen gewesen, um etwas anderes mitzubekommen.
»Tut mir leid, Detective.« Sie wischte sich eine Lachträne aus dem Auge. »Ich hätte es gleich sehen müssen.« Sie zeigte auf mich, als würde das alles erklären. Tat es nicht. Meine Jeans war sauber und hatte keine der modernen Schnitte oder war sonst wie kaputt oder gar dreckig. Die schwarzen Turnschuhe waren nicht neu, aber gut eingetragen. Ja, ich trug etliche Armbänder, die mit Edelsteinen besetzt waren und einige hatten Schutzsymbole eingraviert. Dinge, die im esoterischen Bereich gern verkauft wurden und von den meisten Menschen belächelt wurden. Ich schien nicht die typische Polizistin für sie zu sein.
Ich versuchte, mir die Beleidigung nicht anmerken zu lassen, und schluckte einen sarkastischen Kommentar herunter. Stattdessen lächelte ich weiterhin freundlich.
»Wollen Sie das wirklich? Das Department ist«, sie beugte sich vor, senkte ihre Stimme aber nicht, sodass uns alle Umstehenden weiterhin gut hören konnten, »nicht sehr erfolgreich. Sie wollen doch nicht in so einer Abteilung versauern.«
Ihre Kollegin sah mich traurig an, der Geist an ihrer Seite schüttelte erneut den Kopf.
»Danke für Ihre Sorge«, rang ich mich durch, zu sagen. »Würden Sie mir jetzt bitte einfach sagen, wo ich hin muss?«
Seufzend, als hätte ich sie enttäuscht, lehnte sie sich zurück. »Also gut, aber sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt.« Sie beschrieb mir den Weg in den dritten Stock und wünschte mir dann noch viel Glück. Der Geist folgte mir durch die Halle, sprach aber nicht mit mir. Als sich die Fahrstuhltüren öffneten und ich eintrat, blieb er zurück. Vielleicht war er an einen Ort oder eine Person gebunden und konnte sich nicht weit davon entfernen. Er wirkte so unfassbar traurig und einsam, dass ich nicht anders konnte, als ihn aufmunternd anzulächeln.
»Du – du kannst mich sehen?!«
Als ich antworten wollte, schlossen sich die Türen, doch jemand schnellte mit seiner großen Hand hervor und hielt den Mechanismus auf. Ein junger Mann trat ein. Seine schiere Größe passte nicht ganz zu seiner schmalen, aber kräftigen Figur. Er sah mich merkwürdig an, als ich den Knopf für die dritte Etage drückte. Die Türen schlossen sich und der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung.
»Sind Sie neu hier?« Er beugte sich ein Stück vor und deutete mit einem Nicken auf meiner Marke. »Ich habe Sie hier noch nie gesehen.«
Würde er mir jetzt auch von meinem Job abraten? Würde das am Ende des Tages hier vielleicht sogar jeder tun? Das half meiner Nervosität überhaupt nicht.
Ich betrachtete ihn genauer. Er hatte braune Haare, die in alle Richtungen abstanden, seine dunklen Augen strahlten Gefahr aus. Als würde ich einem wilden Tier gegenüberstehen. Mein Puls beschleunigte sich und ich versuchte, ihm in der Enge der Kabine auszuweichen. Ich schluckte und griff nach den Ketten um meinen Hals. Weder das silberne Schutzamulett noch das goldene Kreuz würden mich vor ihm schützen, aber sie gaben mir ein Gefühl der Sicherheit.
Vor mir stand ein Werwolf.
Ich hatte noch nie einen persönlich getroffen, sondern nur Bilder und Videos während meiner Ausbildung gesehen. Es war tatsächlich so, wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Unheimlich. Beängstigend. Sein raubtierhafter Blick fixierte mich, als ob er überlegte, ob ich sein Frühstück werden könnte.
Er atmete tief durch und grinste breit. Offenbar gefiel ihm meine Angst.
Um mich abzulenken, vielleicht auch, um mich etwas zu beruhigen, studierte ich die Anzeige über den Aufzugsknöpfen. Der Name meines Departments stand nicht dabei, was ich merkwürdig fand. Vielleicht war das ein weiteres Zeichen, wie angesehen die PIU war. Oder eben nicht.
»Also?« Er trat näher, weit in meinen persönlichen Bereich hinein. Ich wich zurück und stieß gegen die metallene Rückwand des Fahrstuhls.
Wahrscheinlich bildete ich mir den wilden Geruch an seiner Kleidung nur ein. Es roch nach Leder und Wald, dabei trug er eine einfache Jeans und ein Buttondown-Hemd, das sich über seinem muskulösen Oberkörper spannte und den Stoff auf eine harte Belastungsprobe stellte.
»Ich bin Detective Barlow und arbeite ab heute in der PIU. Also bin ich Ihre neue Kollegin.« Ich hoffte, das würde ihn auf Abstand bringen und hatte recht.
»Shit.« Er fuhr sich durch die Haare, brachte sie dadurch nur mehr durcheinander. »Ich wollte dich nicht bedrängen.«
Die gefährliche Aura umgab ihn immer noch, aber jetzt eher subtil. Fast schon, wie bei einem Hund, bei dem ich weiß, dass er beißen könnte, aber ansonsten harmlos war.
»Ich bin Officer Grayson Gonzales.« Er schien zu überlegen, ob er mir die Hand reichte, ließ es aber dann sein. Ich war ohnehin noch nicht bereit, ihm so nahe zu sein. Selbst als sich seine Ausstrahlung veränderte, war ich noch auf der Hut.
Ich konzentrierte mich auf seine Aura. Ein rötlicher Schimmer schmiegte sich an seinen massiven Körper. Sie hatte nichts mit der ruhigen und sanften Aura einer Elfe gemein, wie ich sie so oft getroffen hatte. Oder dem unruhigen Flackern bei Hexen. Ich war gespannt, wie sich die Aura eines Vampirs anfühlen würde.
»Hör mal, ich wollte dich echt nicht erschrecken.« Selbst die vertrautere Anrede beruhigte mich nur minimal.
»Wolltest du doch«, erwiderte ich, bevor ich darüber nachdenken konnte. Für einen Moment fürchtete ich, zu weit gegangen zu sein, dann lachte er.
»Touché.« Er lehnte jetzt an der gegenüberliegenden Wand und betrachtete mich schweigend. Bevor einer von uns noch etwas sagen konnte, glitten die Türen zwischen uns auf.
»Dann führe ich dich mal rum.«
Ich folgte ihm durch die Gänge.
»Wir sind ganz hinten untergebracht, wo uns niemand sieht«, erklärte er. »Sicherlich kannst du dir denken, wieso.«
Wir trafen auf einige Kollegen, die aus ihrer Belustigung keinen Hehl machten. Sie tuschelten so laut, als ich vorbei ging, dass sogar ich sie hörte.
»Unser Team ist klein, aber effektiv. Zumindest für unsere Umstände.«
Ich begriff, was er sagen wollte. Die PIU klärte übernatürlich Fälle auf, aber nicht offiziell. Es würde kein Gericht der Welt durchgehen lassen, dass ein junger Werwolf eine Schafsherde angefallen hatte. So einen Fall hatte ich in L. A. einmal und war dezent überfordert gewesen, weil ich den jungen Mann nicht anklagen lassen konnte. Die Abteilung für Übernatürliches hatte dann übernommen und dafür gesorgt, dass ich früher als üblich meine Detectiveprüfung ablegen konnte.
Das Leben in L. A. war einfach gewesen, im Vergleich zu dem, was mich hier in erwartete, das wurde mir mit einem Schlag bewusst.
Werwölfe und Vampire waren in meiner Ausbildung zum Detective nicht vorgekommen. Zumindest nicht ausgiebig genug, offensichtlich war das sommerliche Klima in Los Angeles nicht zuträglich für Vampire und Werwölfe. Dadurch fehlte es einfach an praktischem Unterrichtsmaterial und wir hatten uns nur auf einen kleinen theoretischen Teil konzentriert.
Wieso hatte ich nicht daran gedacht, bevor ich nach New Orleans gezogen war? Gab es eigentlich einen Fortbildungskurs dafür? Beißer für Anfänger oder so was? Ich hatte nur die menschliche Ausbildung durchlaufen: Waffenkunde, Bürokratie, Analytik und all diesen Kram. Erst als ich diesen einen Fall bekommen hatte, wurde die PIU auf mich aufmerksam und ich erhielt tiefere Einblicke in die Welt der übernatürlichen Ermittlungsarbeit. Aber eben nicht tief genug. Meine Informationen beliefen sich auf Elfen und Hexen, mit denen ich fast täglich zu tun hatte. Ich konnte stundenlang über die Eigenheiten der Elfen reden, oder die verschiedenen Gattungen der Hexen erklären, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich mich gegen einen Werwolf wehrte. Geschweige denn gegen einen Vampir.
Mittlerweile hatte mich Grayson in den hintersten Winkel des Police Departments geführt. Der helle Teppichboden war fleckig und ausgetreten, einige Deckenlampen funktionierten nicht mehr. Offensichtlich gab sich hier niemand Mühe, wenigstens den Anschein zu erwecken, dass die PIU dazugehörte.
»Willkommen im Abgrund, Honey.« Grayson öffnete lächelnd die Doppeltür und ließ mich vorausgehen.
3.Kapitel
Ich stand in einem großen Raum, in dessen Ecken kleine Büroräume eingerichtet waren. Durch die Scheiben konnte ich einen Blick auf meine neuen Kollegen werfen. Im linken Eckbüro saß ein junger Mann an seinem Schreibtisch. Er hatte helle blonde Haare, fast schon weiß. Seine Haut war blass. Die Jalousien nach draußen waren zugezogen.
Im benachbarten Büro stand ein großer Mann, dessen Anblick mir eine Gänsehaut bescherte. Seine dunklen Haare wirkten in dem abgedunkelten Büro wie flüssige Seide. Innerlich verdrehte ich die Augen bei diesem kitschigen Vergleich. Vielleicht las ich doch zu viel von diesen Romanen, die Louise so ablehnte.
Mein neuer Chef trug eine dunkle enggeschnittene Stoffhose, dazu ein helles Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln und eine schwarze Weste darüber. Es betonte seine muskulösen Oberarme auf eine Weise, die mir nicht hätte auffallen dürfen. Er hätte genauso gut aus einer anderen Zeit stammen können. Fehlten nur noch eine goldene Taschenuhr und ein protziger Siegelring an seinem Finger.
Mit zwei großen Schritten war er bei seiner Bürotür und kam zu uns. Es war nicht seine beachtliche Größe oder der ablehnende Blick, mit dem er mich bedachte. Es war diese eiskalte Ausstrahlung. Hatte Grayson mich im Fahrstuhl geängstigt, war ich jetzt der Panik nahe, nur weil mich dieser Mann ansah.
»Kieran, das ist unsere neue Kollegin. Lucy Barlow.«
Jupp. Da war er. Der silberne Siegelring prangte an seinem rechten Mittelfinger. So viel also zu dem Thema, dass Silber Vampire verletzte. Ach nein, das galt ja für Werwölfe. Verdammt, ich hatte wirklich keine Ahnung, wo ich hier reingeraten war.
»Oh, Frischfleisch, wie toll!« Hinter mir knallte die Tür ins Schloss. Ich zuckte zusammen und drehte mich um. Ein Mann, äußerlich um die vierzig, stand hinter mir. In seine roten Haare mischten sich ein paar graue Strähnen. Er hatte Falten um die Augen. Sein Aussehen wollte nicht richtig zu seiner jugendlichen Aura passen. Ich war mir sicher, dass er ein Vampir war. Und ein alter noch dazu. Ich wusste noch nicht viel über diesen Teil der übernatürlichen Welt, aber ich wusste, dass sich alte Vampire während des Tages problemlos bewegen konnten. Also musste auch mein neuer Boss bereits ein gewisses Alter erreicht haben. Sofort fühlte ich mich noch unbedeutender und kleiner als durch meine menschliche Natur ohnehin schon.
Bevor ich antworten konnte, richtete sich Sergeant Davenport an mich. »Wir brauchen Sie hier nicht.«
Seine Stimme war genauso kalt und abweisend wie seine Ausstrahlung. Mein Herzschlag beschleunigte sich. Dieses Mal aber nicht aus Angst, sondern aus Wut. Ich ballte die Hände zu Fäusten.
»Das haben Sie nicht zu entscheiden.«
Kurz flackerte Überraschung in seinem Blick auf. Offenbar hatte er nicht damit gerechnet, dass ich ihm widersprach.
»Ich wurde hierher versetzt, weil man der Meinung war, ich könnte helfen.«
»Helfen?« Seine Stimme hatte einen bedrohlichen Unterton angenommen.
»Ich glaube, das wird witzig«, murmelte Grayson hinter mir und zog den anderen Vampir mit sich zur Seite. »Fünfzig auf das Frischfleisch.«
»Du bist ein Baby. Unerfahren. Du würdest uns nur behindern«, meinte Davenport.
Oh, jetzt war aber mal gut! Musste ich mich jetzt mit einem vampirischen Macho herumschlagen? Davon hatte in meiner Versetzung nichts gestanden.
»Ich bin vielleicht jung, aber verdammt gut in dem, was ich mache.«
Er schnaubte abfällig. »Du bist ein Medium.«
Der blonde Vampir kam aus seinem Büro und gesellte sich zu den anderen beiden, die unseren Schlagabtausch interessiert verfolgten.
»Wer ist das?«, fragte er leise.
»Die Neue.«
Ein leises Pfeifen war seine Antwort. Ich hatte keine Ahnung, ob das gut oder schlecht war, aber im Moment konzentrierte ich mich auf Sergeant Davenport.
»Und du ein Vampir«, antwortete ich Kieran. »Nachdem wir das also geklärt haben, gibt es sonst noch etwas? Mein Horoskop? Schuhgröße? Oder lieber gleich die Blutgruppe?«
Was war eigentlich in mich gefahren, einen Vampir zu provozieren? Oh, was hätte ich dafür gegeben, mich jetzt so auflösen zu können wie ein Geist. Puff, und weg wäre ich. Aber dieses Talent war mir nicht gegeben. Also, Augen zu und durch. Wobei, lieber Augen offenlassen, dann würde ich das Ende kommen sehen.
Stattdessen blickte mich Davenport stumm an, als überlegte er, auf welche Art er mich bestrafen sollte. Sein markanter Kiefer mahlte und anstatt es merkwürdig zu finden, fiel mir nur das Wort sexy ein. Irgendetwas stimmte doch nicht mit mir.
Rechts von uns brachen die Männer in lautes Lachen aus. Die Spannung im Raum löste sich etwas. Der Sergeant schüttelte den Kopf und sah zum restlichen Team. »Ich habe keine Ahnung, was wir mit der anstellen sollen.«
»Sie ist vielleicht hilfreich.« Der blonde Schönling stieß sich von der Wand ab. »Hi, ich bin Tanner.« Er reichte mir die Hand. Zu perplex, um anders zu reagieren, erwiderte ich seine Geste. Seine Haut war kalt und er hielt mich länger fest, als höflich gewesen wäre. Mit seinem Daumen strich er über meinen Handrücken. Ich versuchte, mich zurückzuziehen, aber er war deutlich stärker. Er zog an meiner Hand und ich stolperte gegen ihn. Sein freundliches Lächeln verwandelte sich in ein fieses Grinsen, bevor er mich endlich losließ.
»Tja, zumindest körperlich ist sie zu schwach, um uns wirklich zu helfen.«
Moment. Dieses Getue diente nur dazu, mich bloßzustellen?
»Aber als Lockvogel könnte sie zu gebrauchen sein«, warf Grayson ein. Er zwinkerte mir zu. »Sie riecht zumindest süß genug.«
Was erklärte, wieso er mich eben Honey genannt hatte.
»Ich weiß nicht.« Der rothaarige Vampir trat ebenfalls zu uns. »Mit der Haarfarbe und dem Outfit? Wen wollen wir damit anlocken?«
»Niemanden!« Ich trat einen Schritt zurück und entriss Tanner meine Hand. Ich brauchte definitiv etwas Abstand. »Ich bin nicht hier, um irgendetwas anzulocken, sondern um zu arbeiten. Wäre es einfacher für euch, wenn ich ein Vampir wäre?« Ich sah den Sergeant wütend an. »Oder ein Werwolf?« Mein Blick glitt zu Grayson. »Oder liegt es nur daran, dass ich eine Frau bin?«