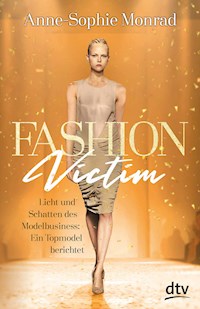
Fashion Victim – Licht und Schatten des Modelbusiness: Ein Topmodel berichtet E-Book
Anne-Sophie Monrad
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Immer in Top Shape? Insiderblick eines Models 10 Jahre lang war Anne-Sophie Monrad auf den Laufstegen der Welt zu Haus und lief für Givenchy, Gaultier, Karl Lagerfeld u.v.m. Bis sie im Herbst 2018 mit einem Instagram Post und einem FAZ-Artikel gegen die unmenschlichen Zustände hinter den Kulissen des Model-Business protestierte und ihrem Leben eine neue Richtung gab. In ›Fashion Victim – Licht und Schatten des Modelbusiness‹ schildert sie ihren Weg von der normalen Schülerin zu einem der gefragtesten Laufstegmodels und setzt sich mit den Problemen auseinander, die der Traumberuf vieler Teenager bei allem Glamour und Glitzer mit sich bringt: Magerwahn, finanzielle Ausbeutung, Konkurrenzdruck und sexuelle Belästigung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Ähnliche
Über das Buch
»Ich habe meine Waage weggeworfen und das Maßband zu meinem Nähzeug gelegt. Weg damit! Ich habe beschlossen, mich in den Agenturen nicht mehr messen zu lassen. Entweder man will mich so, wie ich jetzt bin, oder nicht.«(Anne-Sophie Monrads Instagram-Post vom Oktober 2018)
Als sie 18 war, bekam Anne-Sophie Monrad ihren ersten Modelvertrag und gehörte jahrelang zu den meist gebuchten deutschen Models. Bis sie mit einem Instagram-Post gegen die Zustände hinter den Kulissen des Modelbusiness protestierte und ihrem Leben eine neue Richtung gab.
Nun redet sie Klartext: Sie schildert ihren Weg von der normalen Schülerin zu einem der gefragtesten Laufstegmodels – und stellt offen und ehrlich die Probleme dar, die der Traumberuf vieler junger Menschen bei allem Glitzer und Glamour mit sich bringen kann: Magerwahn, finanzielle Ausbeutung, Konkurrenzdruck und sexuelle Belästigung.
Einleitung
Mit diesem Instagram-Post beendete ich im September 2018 ein Kapitel meines Lebens, das zehn Jahre zuvor mit einem Traum begonnen hatte. Ich wollte um die Welt reisen, auf Modenschauen laufen, gestylt, fotografiert, berühmt werden, auf Partys gehen, viel Geld verdienen, kurz: Ich wollte ein Model sein.
Mein Traum ging in Erfüllung, ich wurde eines der am besten gebuchten deutschen Models. Nur hatte dieser Traum auch unzählige dunkle Episoden. Es war ein ständiges Auf und Ab. Mal war ich der Star, mal der Loser. Mal war ich Anni, mal »Darling«, mal nur ein Kleiderständer. Mal war ich in Topform, aber meistens »zu dick«. Mal fragte ich mich, wofür ich das alles machte, mal ergab alles Sinn. Mal wollte ich alles hinschmeißen, mal nur noch diese eine Saison mitnehmen, um Geld zu verdienen und noch einmal eine der großen Shows zu laufen.
Ich merkte schnell, was es heißt, ein Model zu sein: Ich musste funktionieren, jederzeit bereit sein – auch nachts. Ich musste Körpermaße haben, die kaum eine erwachsene Frau von Natur aus hat. Alle sagten, ich müsse in shape sein, aber keiner sagte mir, wie das ging.
Tokio, New York, London, Mailand, Paris. Ich war nirgends alleine mit meinen Figurproblemen. Wir Models redeten ständig von Diäten. Kein Wunder, wurden wir doch dauernd für unsere Körper kritisiert. Ich zum Beispiel wurde »Fatty« genannt, andere »Fuckface«, meine Beine wurden als »Löwenschenkel« bezeichnet, mir wurde geraten, meinen Hüftspeck absaugen zu lassen, man bot mir Drogen an, damit ich den Hunger nicht mehr spürte. Ich versuchte, stark zu bleiben, die Kritik an meinem Körper nicht persönlich zu nehmen, und fuhr gleichzeitig fort, ihn zu zerstören. Das eigene Körpergefühl überhörte ich, die Stimmen, die riefen, ich sei das perfekte Paket – der Look, die Größe, die Ausstrahlung, die Persönlichkeit und die Figur, so ich denn die richtigen Maße hatte –, waren lauter.
Ich hungerte, machte Sport bis zum Umfallen, wickelte mir Folie um die Beine und Hüfte, weil man damit angeblich das Fett ausschwitzte, trank nur noch Saft, spuckte das Essen nach dem Kauen wieder aus, teilte mir mit einem anderen Model einen Muffin, der ohnehin nur 80 Kalorien hatte.
Es hieß: »Bring your personality«, aber eigentlich wirst du in einen Rahmen gepresst, in den du passen musst. Du musst abliefern. Du musst stark sein, weil es so viele Unsicherheiten, so viel Warterei, so viel Konkurrenz gibt. Das Motto ist: immer lächeln, immer freundlich sein. Wer gekränkt oder abgelehnt wird, geht auf die Toilette und heult dort. Heimlich. Niemals Schwäche zeigen.
In all dieser Zeit hat meine Umgebung meinen psychischen und physischen Zustand geprägt – und zwar nachhaltig. Ich habe nach wie vor Schwierigkeiten, ungezwungen mit Essen umzugehen und mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Ich bekam über Jahre hinweg meine Periode nicht. Wer weiß, ob ich je Kinder kriegen kann.
Ich gebe niemandem die Schuld dafür. Ich habe mich freiwillig dafür entschieden, Model zu werden und zehn Jahre lang Model zu bleiben. Keiner setzte mir eine Pistole auf die Brust und zwang mich dazu. Und zweifelsohne hatte ich auch tolle Begegnungen und Momente, die ich weder missen noch in diesem Buch verschweigen möchte.
Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. So ist das auch im Mode- und Modelbusiness – und zwar in jedem Department: Agenten, Booker, Fotografen, Stylisten, Make-up-Artists, Art-Direktoren, Casting-Direktoren, Designer und natürlich auch Models, sie alle kämpfen um ihren Platz im Licht, der so winzig ist, als zünde man ein Streichholz in einer Höhle an und alle stürzten sich darauf, um in dessen Licht zu strahlen. Natürlich schaffen es einige – pures Glück spielt hierbei übrigens eine entscheidende Rolle. Und natürlich wollen sie ihren Platz, so lange und gut es geht, verteidigen, was am einfachsten ist, wenn man sich selbst die Nächste ist. In diesem Business geht es um Macht, die als Traum verkauft wird. Wer sie nicht hat, kämpft darum. Wer sie hat, zeigt sie und setzt alles daran, sie zu behalten. Es ist kein Wunder, dass weibliche Models »Mädchen«, »Mädels« oder »Girls« genannt werden. Es klingt nett, macht uns rhetorisch aber klein, ahnungslos und schwach. Dort, im kindlichen Stadium, in dem wir unsere Karrieren häufig beginnen, sollen wir gehalten werden, damit wir mitspielen und nicht aufbegehren.
Ich hatte immer wieder Momente, in denen ich kurz innehielt und alles infrage stellte. Richtig aufgewacht bin ich allerdings spät. Warum? Weil niemand etwas sagt. Weil alle weiter- und weiter- und weitermachen und all das als so normal verkaufen, dass man eher an sich selbst zweifelt als am System. Ich lebte in einer Blase voller Träume und Erwartungen. Der größte dieser Träume war es, einmal für Chanel zu laufen – er ging in Erfüllung. Und nicht nur dieser. Ich arbeitete für viele andere Top-Designer und -Labels, was immer wieder zu Hoch- und Glücksgefühlen führte.
Dann wurden innerhalb kurzer Zeit mein Vater und eine enge Freundin schwer krank. In dieser Zeit lebte ich in Paris, bildete mir ein, glücklich zu sein in meiner Welt, die aus Sport, strenger Ernährung und Geldverdienen bestand. Ich begriff, wie sehr ich mit meinem Körper und meiner Gesundheit spielte und dass ich es selbst in der Hand hatte, mich darum zu kümmern – ein schwer kranker Mensch hat diese Möglichkeit oft nicht mehr.
Ich fragte mich selbst immer öfter, was wirklich wichtig im Leben war und nach dem Sinn von alldem, was ich täglich tat und mir verbat – und entschied mich am Ende für mich, für meine Gesundheit, für mein Leben. Ich begann eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin, um zu lernen, wie man richtig isst, was der menschliche Körper braucht und was nicht. Ich warf meine Waage weg und legte das Maßband zu meinem Nähzeug.
In der Vorstellung vieler Menschen haben wir Models vor allem Spaß, werden ständig umsorgt, gestylt, gehen auf Partys, feiern mit Prominenten und fliegen First Class. Ja, das gibt es! Auch! Aber oft nur ganz oben. Und von den vielen, die es versuchen, werden nur sehr wenige Topmodels.
Was wir allerdings alle gemeinsam haben, ist, dass die negativen Seiten unserer Welt – der Druck, das Warten, die Einsamkeit, das Hungern, die Rückschläge, die (Vor-)Urteile, die Ohnmacht – nur selten gezeigt oder überblendet werden. Soziale Medien wie Instagram etwa verstärken den Gegensatz von Schein und Wirklichkeit. Dort, wo das Leben als glücklicher und schöner inszeniert wird, als es eigentlich ist, bilden Models keine Ausnahme. Im Gegenteil. Auch ich habe immer wieder Bilder gepostet, auf denen ich mit Schokocreme, Kuchen oder Popcorn zu sehen bin. Auch ich habe gesagt: »Ich mache nur ein bisschen Sport und kann alles essen, was ich will«, während mein Magen seit Stunden knurrte. Auch ich habe der Welt zu verstehen gegeben, Modeln sei der pure Spaß. Ich habe die Menschen geblendet – aber warum? Damit die Branche weiterhin ihre coole Fassade bewahrt?
Natürlich kann man einwenden, dass niemand Model werden muss. Auch ich nicht. Aber man kann ja mal die Frage stellen: Ginge es ohne uns? Wäre diese Welt, in der wir ständig von Werbung umgeben sind, ohne Models denkbar? Und wenn nein, ist es dann nicht wichtig, darüber zu sprechen, unter welchen Bedingungen wir arbeiten? Und ist es nicht wichtig, darüber zu sprechen, dass wir ein Schönheitsideal transportieren, das kaum erreichbar ist? Der Versuch, dieses Schönheitsideal tatsächlich zu erreichen, kann physisch krank machen. Und der Gedanke, es niemals erreichen zu können, kann psychisch krank machen.
Ich werde in diesem Buch auf zwei Reisen gehen. Die eine führt mich in meine Vergangenheit. Ich erzähle dabei von den Stationen meiner Karriere, von den Heimweh- und Glücksmomenten, von Bewunderung und Spott, von Geldsegen und -sorgen, von Disziplin und Zügellosigkeit, von Hunger und Sattsein, von Kalorien und Sport, Essstörungen, Sucht und Sehnsucht, von Freundinnen und Konkurrentinnen, vom Druck, von Maßbändern, ausbleibenden Perioden, von Schönheitsidealen, die krank machen und in der Modeindustrie dennoch als Norm gelten, von Depressionen, Übergriffen, Macht und Ohnmacht – und meinem Entschluss, aus der Branche auszusteigen.
Auf meiner zweiten Reise treffe ich Akteure aus der Branche, mit denen ich über das Modelbusiness und ihre Sicht darauf spreche, unter anderem Wolfgang Joop, Kristian Schuller und Jacob Mohr. Ziel dieser Reise ist es, das Business und seine Mechanismen besser zu verstehen.
1. Tokio I:Prolog
Juli 2010: Ich saß auf dem winzigen Balkon meines Apartments. Es war heiß, so heiß, dass ich kaum Luft bekam. Und es war laut. Das Rauschen der Großstadt wurde begleitet von Hupen, Sirenen und dem Feierabendverkehr, von Lautsprecherdurchsagen und dem Lärm um den U-Bahnhof Akasaka herum, der nur ein paar Schritte von meinem Haus entfernt war. Mein Laptop lag auf meinem Schoß, ich skypte mit meinen Eltern und meinem Bruder in Deutschland. Wir schrien gegen den Lärm an: »Alles Gute zum Geburtstag«, riefen sie.
Ich lächelte. Dann nahm ich meinen Computer, drehte ihn um und zeigte ihnen die Stadt und die untergehende Sonne. »Geh doch rein, dann hören wir dich besser«, rief meine Mutter. Aber ich wollte draußen sein, nicht drinnen, wo meine Mitbewohnerin auf ihrem Bett saß und jedes Wort mitbekommen hätte, obwohl sie sowieso nichts von dem verstand, was ich sagte. Sie war Russin, auch Model, und sprach weder Englisch noch Deutsch oder Japanisch. Sie sprach nur Russisch.
In unserem Apartment standen zwei Betten, an jeder Seite des Raums eines. Dazwischen und daneben war kaum Platz. Außerdem gab es eine Pantryküche – versteckt in einem Schrank, den wir nie öffneten, weil wir nie kochten –, ein Bad und diesen Balkon, den man eher als Austritt bezeichnen musste. Ich sah, dass mit meiner Familie etwas nicht stimmte, obwohl alle versuchten, fröhlich auszusehen. Immerhin hatte ich Geburtstag.
»Was ist los?«
Kurze Stille.
»Wir wollten es dir eigentlich nicht sagen.«
»Was denn?«
»Emmi ist eingeschläfert worden.«
Emmi, mein Hund. Mein Herz zog sich zusammen.
»Es musste sein.«
Ich merkte, wie mir Tränen in die Augen schossen, versuchte aber sofort, sie zu unterdrücken. Meine Eltern sollten sich schließlich keine Sorgen um mich machen. Sie sagten noch irgendetwas, wahrscheinlich, dass es ihnen leidtäte und dass sie mich lieb hatten, aber genau kann ich es nicht mehr sagen. Meine Gedanken waren nur bei Emmi und dem Gefühl, mich zusammenreißen zu müssen.
Als wir auflegten, brachen die Tränen und die Trauer aus mir heraus. Ich schrieb meiner Schwester eine Nachricht, sie antwortete: »Gönn dir jetzt was!« Und in diesem Moment wurde mir alles egal. Ich ging zurück in die Wohnung. Meine Mitbewohnerin, die sah, dass ich weinte, versuchte, mich zu umarmen, aber ich wollte nur raus, die Treppen runter, ins Freie.
Am Bahnhof gab es einen Platz, an dem man alles Mögliche zu essen kaufen konnte. Ich dachte an die Worte meiner Schwester, kaufte einen Corn Dog – ein Würstchen am Stiel, das von Teig umhüllt ist –, biss einmal rein und warf ihn weg. Ich kaufte mir Donuts, das gleiche Spiel: einmal reinbeißen, wegwerfen. So konnte ich mir hinterher einreden, ich hätte es eigentlich gar nicht richtig gegessen. Einmal reinbeißen zählte nicht. Ich kaufte Onigiri, einen Milch-Tee-Shake, Fast Food, Süßigkeiten, setzte mich auf eine Bank, biss rein, schmiss es weg. Ich fühlte mich verloren. Und während ich weinte, merkte ich, dass es bei meiner Traurigkeit nicht nur um Emmi ging, sondern auch um mein Heimweh, meine Einsamkeit und den Wunsch, das alles nicht machen zu müssen.
Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr.Keiner versteht mich hier – und ich verstehe keinen.
Ich fiel und fiel. Doch da war niemand, der mich auffing. Da waren nur die Stimmen im Hinterkopf: Du hast so viel Potenzial, du wirst groß rauskommen, du wirst reich. In zwei Wochen sollte ich weiterreisen nach New York zur Fashion Week. Der Flug war schon gebucht, nur abnehmen musste ich noch, sonst hatte ich dort keine Chance.
2. Flensburg I:»Ich kann das alleine«
Hochs und Tiefs wechseln sich im Leben eines Models so schnell ab, dass man manchmal selbst nicht hinterherkommt. Es ist ein Glücksspiel, Einfluss darauf hat man kaum. Manche verkraften das nicht, einige zerbrechen daran. Auch ich hatte Tage wie jene in Tokio, die ich ohne bestimmte Eigenschaften nicht durchgestanden hätte: Offenheit und Optimismus gehören genauso dazu wie Zähigkeit und eine fast bockige Eigenständigkeit. »Ich kann das alleine«, das hörten meine Eltern oft von mir, als ich klein war.
Ich bin das jüngste von drei Geschwistern, geboren 1991, aufgewachsen in einer kleinen Gemeinde in Norddeutschland, fast Dänemark, in einem Pastorat – was verstaubter klingt, als es war. Mein Vater, Däne, war ein gefeierter Solo-Oboist im Odense Symphony Orchestra und nur am Wochenende zu Hause. Meine Mutter war Pastorin.
Es gibt Cooleres, als die Tochter einer Pastorin zu sein, das stellte ich früh fest, denn von anderen Kindern bekam ich oft den »Pastorenkindstempel«, was nichts anderes bedeutete, als dass sie mich links liegen ließen. Was diese Kinder nicht wussten: Meine Mutter ist eine ebenso witzige wie starke Frau. Sie war es, die mir beibrachte, an mich selbst zu glauben und mich durchzusetzen. Und nein, nur weil sie Pastorin ist, hieß das nicht, dass wir den ganzen Tag beten und immer nur ernst und brav sein mussten. Sie zwang uns auch nicht, zum Gottesdienst mitzukommen, doch weil ich sie immer gerne in meiner Nähe hatte, ging ich trotzdem hin, setzte mich in die letzte Bank, hörte ihre Stimme und schlief irgendwann ein. Das führte zu einem Gefühl von Geborgenheit, das sich in mir ausbreitete, wann immer ich eine Kirche betrat. Es fühlte sich für mich an, als sei Mama in der Nähe. Und auch wenn mein Glaube an die Kirche und Gott nicht so stark ist wie der meiner Mutter, hat mir dieses Gefühl in einsamen Momenten oft geholfen, egal, ob in Deutschland oder am anderen Ende der Welt.
Wir wohnten in einem riesigen alten Haus mit einem ebenso riesigen Garten. Darin hatte ich ein eigenes Beet, um das ich mich kümmerte und auf dem ich, mal mehr, mal weniger erfolgreich, Radieschen und Kürbisse anpflanzte.
Neben unserem Haus gab es einen Festsaal, in dem sich häufig das ganze Dorf traf. Manchmal half ich beim Ausschank und verdiente so ein bisschen Taschengeld. Oder meine Geschwister spielten Klavier – sie taten das beneidenswert gut – und ich hüpfte in einem Tutu vor den Leuten herum, tat so, als könne ich tanzen, und schaute dabei in ihre lachenden Gesichter.
Dritte Kinder, heißt es oft, laufen einfach nur mit. Das stimmt insofern, als ich von uns dreien die Eigenständigste war. Mein Bruder, drei Jahre älter als ich, und meine Schwester, fünf Jahre älter als ich, waren damals sehr eng miteinander. Ich war das Nesthäkchen, das in seiner eigenen Welt lebte. Trotzdem waren die beiden meine Vorbilder und ich beobachtete genau, was sie taten. Bekamen sie für etwas Ärger, wusste ich: Das lass ich lieber sein.
Ich genoss das Landleben und meine Kindheit sehr. In meiner Erinnerung laufe ich, proper, fast schon pummelig, auf jeden Fall gut genährt, mit meinem Puppenwagen durch die Dorfstraßen, rede mit meiner Puppe – und mit mir selbst –, bin fröhlich, frech, zufrieden.
Ich war elf, als das alles aufhörte und eine Zeit begann, die sehr aufwühlend war.
Meine Mutter hatte einen Job als Krankenhauspastorin und Seelsorgerin in Schleswig bekommen, weshalb wir nicht länger in dem Pastorat wohnen konnten und in die Nähe von Flensburg zogen. Mama freute sich sehr auf die neue Arbeit. Ich nicht. Sosehr ich es versuchte, es gelang mir nicht.
Ich will nicht weg.Das hier ist doch mein Zuhause.
Etwa zur gleichen Zeit zog mein Bruder, damals 14, nach Leipzig. Er war im renommierten Thomanerchor aufgenommen worden – was ihn freute und meine Mutter wiederum nicht.
Doch Ruhe kehrte danach nicht ein. Im Gegenteil. Bei meinem Vater wurde Arthrose diagnostiziert und er musste in den Vorruhestand, wobei Ruhestand dabei wörtlich zu nehmen war: Er wurde zur Ruhe gezwungen. Spielen verboten. Ende seiner Karriere. Ende seiner Leidenschaft. Von da an war er zu Hause und ich hatte häufig das Gefühl, ihm würde die Decke auf den Kopf fallen.
Man möchte meinen, wenigstens die Schule sei eine verlässliche Konstante gewesen, aber nein. Auf meiner neuen Schule, einer dänischen Grundschule, war ich ein Überflieger und völlig unterfordert, weshalb meine Eltern nach einem halben Jahr beschlossen, mich auf eine Gesamtschule in Flensburg zu schicken. Sie meinten es gut. Ich weiß. Doch diese Schule nahm mir all meine Fröhlichkeit.
Zuerst hatte ich mich noch auf die neue, viel größere Schule gefreut und schnell Freunde gefunden. Doch als sie alle in der siebten Klasse – ein halbes Jahr nach meiner Ankunft dort – aufs Gymnasium wechselten, fühlte ich mich zurückgelassen mit einer Lehrerin, die mich nicht mochte, und Mitschülern, die mir drohten, mich auf dem Weg zum Bus zu verprügeln, und die es lustig fanden, mir Kondome zu Weihnachten zu schenken. Für meine verbliebenen Mitschüler war ich das uncoole Landei. Für meine Lehrerin war ich ein Opfer: eine Legasthenikerin, die Spezialunterricht brauchte. Gab sie mir Diktate zurück, sagte sie laut vor der ganzen Klasse: »Schlecht, Anni! Wenn du so weitermachst: Hauptschule. Weißt du, ne?« Ich sah nur rote Ausrufezeichen auf dem Papier und fühlte mich elend, dumm und nutzlos. Meine Geschwister waren beide talentierte Musiker, gingen aufs Gymnasium – und ich? Hatte rote Ausrufezeichen auf meinen Klassenarbeiten.
Ich wurde ruhiger, mein Lachen verschwand. Tag für Tag für Tag waren es entweder meine Lehrerin oder meine Mitschüler oder alle zusammen, die mir zu verstehen gaben, dass ich in ihren Augen nichts wert war. Ich versuchte, mich mit der Situation abzufinden, und war, weil es mir nicht anders gelang, viel allein zu Hause und weinte heimlich. Die Schule, die Klasse: der Horror.
Wann ist endlich der Tag vorbei?Wann muss ich da nicht mehr hin?
Die Wende brachte ein trauriger Anlass. Silvester 2003 war meine Cousine ermordet worden. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, weil es schlimm genug war. Nur: Als ich meiner Lehrerin sagte, ich könne nicht in die Schule kommen, weil ich zur Beerdigung müsse, fing sie an, irgendeine Geschichte vom Freund eines Freundes zu erzählen. Ich weiß nicht mehr, was sie da sagte. Ich hörte gar nicht richtig zu, so fassungslos war ich. Da kam kein »Wie geht es dir?«, oder »Kann ich etwas für dich tun?«. Kein Funken Anteilnahme. Keine Empathie. Nichts. Selbst als meine Mutter sie ein paar Tage später zur Rede stellte und fragte, warum sie so kalt reagiert habe, erwiderte sie nichts. Meiner Lehrerin war das alles egal. Sie zuckte nur mit den Schultern.
Was war das für ein Signal für ein Kind?
Ein paar Wochen später kam mein Schulleiter ins Klassenzimmer, stellte sich vor mich und sagte: »Du kannst deine Sachen packen.« Ich schaute ihn verunsichert an, wusste nicht, was los war. Vor der Tür standen meine Eltern. Sie sagten: »Du wechselst die Schule. Und zwar sofort.«
Das war meine Rettung. Zu diesem Zeitpunkt war ich überhaupt nicht mehr ich selbst und versuchte nur noch, irgendwie durchzuhalten.
Ich kam auf die Waldorfschule. Dort war alles anders und mein Leben wurde endlich wieder ruhiger. Ich durfte wieder Kind sein, ich selbst sein, hatte Freiräume und Freundinnen, echte Freundinnen, mit Mädelsabenden und allem, was dazugehört. Ich wurde zum Klassenclown, was ich genoss. Ich sang im Chor, spielte Musikinstrumente – wenn auch keines wirklich gut. Kontrabass, Fagott, Klavier, Gitarre: Ich probierte wirklich alles. Irgendwann sahen meine Eltern ein, dass meine Geschwister darin sehr viel mehr Begabung hatten als ich, und ließen mich gewähren. Ich sollte Spaß an den Dingen haben, und so machte ich Musik fortan nur noch mit meiner Stimme: Ich hatte Gesangsunterricht und sang im Chor.
Mit der Zeit merkte ich, dass mein wahres Ich zurückkehrte, weil ich der Mensch sein durfte, der ich war. Heute denke ich oft an diese Zeit zurück und sehe Parallelen zum Modelleben. Menschen blühen auf, wenn man sie sein lässt, wer sie sind, wenn man ihre Persönlichkeit unterstützt und fördert, anstatt sie zu unterdrücken. Das Absurde am Modelbusiness ist, dass dir alle sagen: »Du brauchst Persönlichkeit.« Aber eigentlich musst du uniform sein in Größe, Funktionswillen und Temperament.
Im Januar 2006, ich war inzwischen 15, lief die erste Staffel von Germany’s Next Topmodel. Meine Schwester und ich durften dafür donnerstags nach dem Chor extra länger aufbleiben, meine Eltern schauten mit. Sie fanden die Methoden, wie mit jungen Mädchen dort umgegangen wurde, verletzend, verachtend und demütigend. Für meine Eltern waren das Kinder wie meine Schwester und ich, die sich dieser Oberflächlichkeit und Degradierung nicht aussetzen sollten. Natürlich sprachen meine Eltern mit uns darüber. Ich stimmte ihnen zu – oder blieb still. Insgeheim aber fand ich es faszinierend, was ich dort sah: Mädchen, die überall hinreisten, in einem luxuriösen Haus wohnten und ständig schön gestylt wurden. In meiner Vorstellung führten sie ein Jetset-Leben, wurden immer auf die coolsten Events eingeladen, verdienten Geld, gutes Geld. Glamour total. In meiner Fantasie malte ich mir eine Traumwelt aus, dachte, das sei der beste Job überhaupt. So wurde es verkauft. Und genau so kam es bei mir auch an.
Von Zehn-Bett-Model-Apartments redete dort keiner, auch nicht von der Einsamkeit, dem Hunger oder der andauernden Bewertung deiner Figur und deines Wesens. Ich ahnte von alldem nichts und hatte mich in eine Scheinwelt verguckt, an die so viele Mädchen glauben.
Inzwischen war ich ganz schön gewachsen und sehr groß, was mir selbst eigentlich gar nicht so sehr gefiel. Aber als Model, dachte ich, könnte ich wenigstens etwas daraus machen. Ich fand mich nicht unbedingt schön und auch keine meiner Freundinnen kam zu mir und sagte: »Wow, du bist so hübsch!« Trotzdem. Heimlich stellte ich mir vor, ich könne es damit allen beweisen: meinen Eltern, für die ich oft das Sorgenkind war, meinen Geschwistern, die so musikalisch und gut in der Schule waren, meinen ehemaligen Mitschülern, meiner ehemaligen Klassenlehrerin – und vor allem mir selbst. Ich schrieb in mein Tagebuch: »Modeln – das mach ich!«
Ich will auch etwas können,ich will auch etwas sein.
Mein Traum war es, irgendwo angesprochen, also entdeckt zu werden. Heidi Klum war es schließlich auch so ergangen. Das hörte sich besser an als: »Ich habe mich als Model beworben.« Fragte sich nur, wie mir das gelingen sollte. Ich konnte ja nicht jeden Tag durch die Innenstadt von Flensburg schlendern in der Hoffnung, es käme ganz zufällig jemand vorbei. Und ob meine Eltern mir das überhaupt erlauben würden nach alldem, was sie im Fernsehen gesehen hatten?
3. Flensburg II:Der Modelwettbewerb
Es vergingen zwei Jahre. Der Wunsch, Model zu werden, verging hingegen kein bisschen. In meinen Tagträumen sah ich mich immer wieder auf dem Laufsteg oder vor einer Kamera.
Mein Leben war inzwischen wieder unbeschwert. Ich fühlte mich wohl auf der neuen Schule, hatte gute Freundinnen und arbeitete im Kinderspielpark eines Einkaufszentrums, um finanziell unabhängig zu sein. Im Funpark machte ich alles: stand am Klettergerüst, frittierte Pommes, saß an der Kasse. Und dann gab es noch dieses Kostüm, in das an vollen Tagen immer einer von uns schlüpfen musste. Es stellte das Maskottchen des Einkaufszentrums dar: Mr. Scandi. Weil ich die Größte war, fiel die Wahl meistens auf mich. Manchmal wurde ich von den Kindern geboxt oder sie versuchten, mich zum Stolpern zu bringen, und außerdem schwitzte man fürchterlich darin. Aber eigentlich fand ich es total lustig, in einem Hero-Kostüm zu stecken. Man musste ja auch nichts machen, außer zu winken und mit Daumen hoch für Fotos zu posieren.
Es war eine glückliche Zeit, in der ich kein Kind mehr war, aber auch noch keine erwachsene Frau. Einerseits schmierte mir meine Mutter noch Schulbrote – so gesund, dass es mir manchmal peinlich war – und mein Vater holte mich immer von der Schule ab. Andererseits ging ich nachmittags mit meiner Freundin Katja ins Fitnessstudio oder in die Stadt und trank Latte macchiato, wie die Erwachsenen. Einmal, wir waren gerade shoppen, sagte Katja plötzlich zu mir: »Komm, wir verwandeln dich jetzt.«
Ich lachte. »Ja, verwandel mich mal.«
Ich ging in eine Umkleidekabine, zog mein Blümchenkleid aus und das an, was Katja mir reinstreckte: eine Leggins, einen Minirock, ein Longsleeve und ein Spaghettiträger-Top. Dann stellte ich mich vor den Spiegel.
Wow, das ist cool.
Ich sah so anders aus. »Kauf das! Unbedingt!«, sagte Katja und zog mich zur Kasse. Als ich die Sachen später meiner Mutter zeigte, fand sie sie im ersten Moment »schlimm, ganz schlimm«. Vielleicht wollte sie nicht, dass ihr jüngstes Kind jetzt auch groß und flügge wurde. Das Outfit trug ich trotzdem und merkte, wie ich mich damit erwachsener, cooler und auch schö-ner fand. Die Blicke der anderen bestätigten mir das. Meine Haltung und mein Körpergefühl hatten sich verändert, als sei ich in diesem Moment wirklich verwandelt worden.
Natürlich sah das auch meine Mutter und freute sich im zweiten Moment doch mit mir. Und natürlich wusste sie von meinem großen Traum, Model zu werden. Aber: Zu sehen, wie die eigenen Kinder erwachsen werden, hat eben oft zwei sich widersprechende Gefühle zur Folge. Einerseits den Wunsch, sie auf der Suche nach ihrem Glück ziehen zu lassen und sie dabei zu unterstützen. Und andererseits den Wunsch, sie weiterhin zu beschützen und noch eine Weile das Alte zu bewahren.
Ende Juni 2008: Kurz vor meinem 17. Geburtstag sahen meine Eltern zufällig die Talkshow 3 nach 9. Dort saß Toni Garrn neben ihrer – und später auch meiner – Agentin und sprach über ihr Leben als Model. Sie war erst 16, aber schon seit zwei Jahren im Geschäft. Der Moderator, Giovanni di Lorenzo, fragte die beiden, wie Toni damals entdeckt worden war und wie sie das jeweils wahrgenommen hatten. Dann ging es ums Dünnsein. Ob Toni denn eine »Nichtesserin« oder eine »Nichtzunehmerin« sei, wollte di Lorenzo wissen.
Toni sagte, sie esse eigentlich alles, was sie wolle, ihre Mutter sei schlank, ihr Vater groß, sie selber mache viel Sport. Dann erzählte sie, dass keine ihrer Freundinnen neidisch sei: »Meine ganzen Freundinnen unterstützen mich da total, sind supernett, […], also bei mir ist eigentlich alles supercool.« Sie sprach auch darüber, wie einfach es sei, in der Schule zu fehlen, weil alle sie unterstützten. Nur ihre Mutter, die sei nach wie vor etwas skeptisch und mache sich Sorgen, »wie jede normale Mutter auch«, und deshalb müsse sie sie auch jeden Tag anrufen, wenn sie weg sei.
Alleine durch die Welt zu reisen? Kein Problem! Einsam, sagte Toni, sei sie nie, die Mitarbeiter in den Agenturen und die anderen Models seien fast wie eine Familie. Außerdem gebe es ja Fernsehen, aber eigentlich sei sie sowieso den ganzen Tag nur am Set. Dann fragte di Lorenzo nach schmierigen Agenten und Fotografen, und alle waren sich einig, die existierten nicht, das sei alles sehr professionell. Es hörte sich traumhaft an.
Am Ende ging es noch darum, dass viele Models wirklich üben und ihre Scheu abbauen müssten, weil sie von Natur aus zurückhaltend seien, und dass manche schon ein, zwei Jahre bräuchten, um aus sich herauszukommen. Es klang, als würde man in der Branche Rücksicht darauf nehmen. Es klang, als würde man beschützt werden.
»Alles wirkte so leicht, fast spielerisch«, sagt meine Mutter heute. »Toni, ein Mädchen aus gutem Haus, dazu eine sympathisch wirkende Chefin der Agentur.« Die negativen Eindrücke von Germany’s Next Topmodel brachte sie damit gar nicht in Verbindung. So wie Toni es beschrieb, dachte sie, sei das wirkliche Leben als Model, wenn man denn nur an die richtige Agentur geriete.
Am nächsten Tag sagte meine Mutter zu mir: »Du, da war gestern so eine Toni von einer Hamburger Modelagentur im Fernsehen. Ich glaube, das kannst du auch!« Ich schaute sie nur an und dachte, ich höre nicht recht. Hatte sie wirklich gesagt, »das kannst du auch«?
Endlich! Sie glaubt an mich!
Dass meine Eltern diese Sendung gesehen hatten, sollte mir ein paar Wochen später zugutekommen. Im August hing in meinem Fitnessstudio in Flensburg ein Plakat, auf dem stand: »DIE EINE 2008. Der Center Modelwettbewerb«. Die Siegerin sollte einen Vertrag mit einer Agentur bekommen, keiner geringeren als der Agentur von Toni Garrn. War das meine Chance? Meine Freundinnen redeten mir gut zu: »Bewirb dich da. Du musst das versuchen, Anni!«
Ich sprach mit meiner Mutter, nicht nur, weil ich eine Unterschrift von ihr brauchte – ich war ja erst 17 –, ich wollte, dass sie wirklich hinter mir stand, wenn ich mich bewarb: »Schau mal, in zwei Wochen ist da ein Wettbewerb. Der ist von dieser Agentur aus dem Fernsehen. Darf ich mitmachen?«
Sie meinte nur: »Ja, kannst du machen« und unterschrieb. Einfach so.
Heute sagt meine Mutter darüber: »Ich dachte damals, warum nicht, die Agentur ist seriös und niemand wird mir meine Tochter sofort entreißen oder sie auf die schiefe Bahn ziehen. Ich fand es spannend, hatte im Kopf die Karriere eines Models, von dem ich meinte, es habe Ähnlichkeit mit Anne-Sophie. Warum sollte sie es nicht auch schaffen?«
Flensburg war die dritte von insgesamt zwölf Stationen des Wettbewerbs. In jeder Stadt gab es drei Runden, in denen nach und nach ausgesiebt wurde, bis schließlich zwei Gewinnerinnen pro Stadt feststanden, die ins Finale in Bremen einzogen.
Als ich mit meinen Freundinnen im Einkaufszentrum ankam, standen dort schon unglaublich viele Bewerberinnen. Hatte ich überhaupt eine Chance? Ich schaute sie mir an, überlegte, ob ich hübsch genug war, besser als sie laufen würde oder die bessere Figur hatte. Das Konkurrenzdenken hatte begonnen.
Bevor es losging, wurden zum ersten Mal in meinem Leben Maße von mir genommen. Es war vielleicht das letzte Mal, dass dies ohne den Hinweis blieb, ich müsse unbedingt an meiner Figur arbeiten. Meine Hüfte jedenfalls hatte einen Umfang von 104 Zentimetern. Das ist nicht ungewöhnlich für ein 17-jähriges Mädchen – für ein 17-jähriges Model schon, aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Mitten im Einkaufszentrum war ein Laufsteg aufgebaut, vor dem eine Jury saß, die aus drei Männern be-stand: einem Vertreter des Einkaufszentrums, einem Vertreter des Optikers, der das Ganze sponserte, und einem Vertreter der Modelagentur. Es lief laute Musik und wir mussten alle in verschiedenen Outfits auf und ab laufen. Ich hatte keine Ahnung vom Laufen, ich machte es einfach, und meine Freundinnen standen daneben und klatschten und jubelten, wenn ich an ihnen vorbeikam.
Was für ein wahnsinniges Gefühl. Gänsehaut!
Die erste Runde war vorbei. Alle standen in einer Reihe und warteten auf das Ergebnis.
Bitte lass mich nicht rausfliegen.Nicht jetzt, nicht in der ersten Runde.
Ich hörte meinen Namen. Ich war weiter.
Vielleicht schaffe ich es.Vielleicht gewinne ich das!
In der Pause lief uns unser Deutschlehrer über den Weg.
Wir sagten: »Hallo.«
»Oh, hallo«, antwortete er. »Wie geht’s?« Dann zeigte er auf den Laufsteg: »Wer macht denn bei so einem Scheiß mit?«
Wir blickten erst uns, dann ihn an und zuckten mit den Schultern. »Keine Ahnung«, sagte ich, grinste innerlich und zog die anderen weg.
Als ich auch in der zweiten Runde weiterkam, rief ich meine Eltern aufgeregt an: »Ihr müsst kommen. Aber jetzt sofort.« Rechtzeitig zur dritten und letzten Runde waren sie da, was mich noch entschlossener machte. Ich lief, nein, ich schwebte fast über den Laufsteg. Mit jedem Schritt fühlte es sich dort oben besser an.
Dann war die Runde vorbei – und ich flog raus. Fünfter Platz. Als sei ich mit Vollgas gegen eine Wand gefahren, war es mir auf einmal wahnsinnig peinlich, bei »so einem Scheiß« mitgemacht zu haben.
Dieses plötzliche Wechselbad der Gefühle sollte ich später noch häufig haben. In einem Moment fühlt sich alles richtig an und im nächsten komplett falsch. Jubeln sie dir zu, ist alles richtig, jubeln sie einer anderen zu, ist alles falsch. Das liegt unter anderem daran, dass man so fremdbestimmt ist. Du kannst talentiert sein, wunderschön und diszipliniert, und am Ende liegt es an deiner Haarfarbe, dass du einen Job nicht bekommst, oder an deiner Nase oder einfach an der Laune deines Gegenübers. Du kannst noch so viel gehungert und gegeben haben, um die richtigen Maße zu bekommen; wenn sie am Ende nicht stimmen, bist du raus.
Wer immer nur nach Kriterien beurteilt wird, die er selber kaum beeinflussen kann, ist permanent unsicher, obwohl man sich Unsicherheit in diesem Business nicht leisten kann. Selbstbewusst auftreten, aber gleichzeitig bescheiden sein: Das ist das, was von dir erwartet wird. Eine dauerhafte Zerreißprobe. Doch auch das wusste ich damals noch nicht.
Ich wollte schon nach Hause gehen, als einer der Juroren auf mich zukam. Er sagte, er sei von der Agentur. »Du bist mir aufgefallen. Du hast Potenzial. Hier ist meine Karte. Melde dich, wenn du an der Hüfte im Neunzigerbereich bist.«
Ich konnte mein Glück kaum fassen. »Ja klar, mach ich. Aber wie schaff ich das?«
Seine Antwort: »Knäckebrot, keine Schokolade, bisschen Sport.«





























