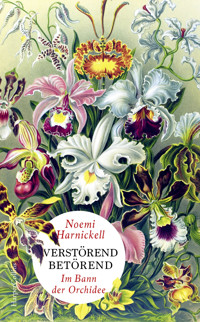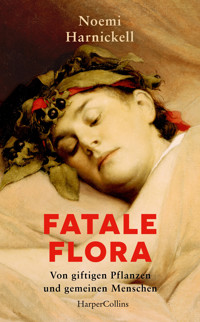
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Willkommen im gefährlichsten Garten der Welt!
Auf den ersten Blick wirkt der Schlossgarten von Alnwick ganz harmlos: gepflegte Hecken, blühende Beete, saftiges Grün. Doch hinter seinen Toren verbirgt sich der tödlichste Garten der Welt: Poison Garden. Gegründet von Jane Percy, Herzogin von Northumberland.
Hier beginnt Noemis Reise in die Welt der Gifte. Fasziniert folgt sie John Knox, der den Besuchern von Alraune bis Rizinusbaum die Pflanzen und ihre verheerenden Wirkungen erklärt. Und Noemi versteht: Wo Gift wächst, sind auch Mörder.
Eisenhut im Currygericht, Atropin im Gin Tonic, Rizin in einer Tasse Tee. Nicht selten trifft Gift auf kulinarischen Einfallsreichtum. Spannend erzählt Noemi von den schönsten, skurrilsten und legendärsten Giftmorden der Geschichte, ihren Protagonisten und bis heute unterschätzten Mörderinnen.
Über das tödliche Potenzial in unseren Gärten und menschliche Abgründe – das sind mörderisch gute Geschichten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Noemi Harnickell
Fatale Flora
Von giftigen Pflanzen und gemeinen Menschen
HarperCollins
Originalausgabe
© 2025 by HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Covergestaltung von Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Coverabbildung von Gabriel von Max, »Atropa Belladonna« (1887) © akg-images, bilwissedition, Quagga Media UG / akg-images | ruskpp / Depositphotos, Yevheniia Lytvynovych / Shutterstock
E-Book Produktion von GGP Media Gmbh, Pößneck
ISBN 978-3-365-00487-6
www.harpercollins.de
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Autorin und des Verlags bleiben davon unberührt.
Für meinen Vater, Bernhard Harnickell, der nicht mehr zum Essen vorbeigekommen ist, seit ich mit der Recherche für dieses Buch begonnen habe.
»He told them tales of bees and flowers, the ways of trees, and the strange creatures of the Forest, about the evil things and the good things, things friendly and things unfriendly, cruel things and kind things, and secrets hidden under brambles.«
J. R. R. Tolkien, Lord of the Rings
Bevor’s losgeht … eine Warnung
Es geht in diesem Buch um Pflanzen, Pflanzengifte und Pflanzengiftmorde. Ich habe mir Mühe gegeben, einen leichten humorvollen Erzählton beizubehalten, aber leider sind viele der Geschichten weder leicht noch witzig. Es geht oft um Mord, vor allem an Frauen und manchmal an Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern. Es geht um Tierversuche, und es geht um Abtreibungen. Es geht auch um vieles mehr, zum Beispiel, wie die alte Betty Miller in ihrer Seniorenheimküche Rizin in Marmeladengläser füllte. Wer sich durch die oben genannten Themen in irgendeiner Weise getriggert fühlt, dem empfehle ich, dieses Buch zur Seite zu legen. Vielleicht ist dann ja mein Buch Verstörend betörend, eine Reise in die wundersame Welt der Orchideen, eher was für dich!
Obwohl mir fast alle Geschichten, die in diesem Buch vorkommen, als erstes von Gärtnerinnen und Gärtnern erzählt wurden, habe ich mich bei den vertiefenden Recherchen auf die Literatur anderer Autorinnen und Autoren gestützt. Besonders nennenswert dabei sind Neil Bradburys »A Taste For Poison«, »A Is For Arsenic« von Kathryn Harkup sowie Caroline Cramptons Podcast »Shedunnit«.
»Der Schauerliche Mordgarten in Eldritch!«, rief Francis und schnipste mit den Fingern. »Dort wächst fast jede Giftpflanze, die man sich nur vorstellen kann. Ich habe dort schon mal Grüne Wulstlinge gekauft. Die haben da nämlich einen kleinen Souvenirladen.«
Morrigan rümpfte die Nase. »Was sind ›Grüne Wulstlinge‹?«
»Extrem giftige Pilze. Sie sind ziemlich schmackhaft … allerdings nur in äußerst kleinen Mengen.«
»Du hast Giftpilze von einem Ort namens Schauerlicher Mordgarten gekauft?«, fragte Mahir und starrte ihn ungläubig an.
Francis zuckte die Schultern und wiederholte nur: »Die haben da einen kleinen Souvenirladen.«
Jessica Townsend, Nevermoor. Das Geheimnis des Wunderschmieds
Eins: Willkommen im Poison Garden
Eins
Willkommen im Poison Garden
»Alle Pflanzen hinter diesen Toren haben die Fähigkeit, euch zu töten. Ihr dürft sie nicht berühren, an ihnen riechen oder ihnen zu nahekommen.« John Knox schenkt den Gästen seiner Nachmittagstour einen strengen durchdringenden Blick. Dann entriegelt er mit einem Schlüssel die schwarzen, mit Totenschädeln dekorierten Eisentore. Die Scharniere quietschen, die Besucher lachen verhalten, man hört fast, wie manche von ihnen förmlich die Luft anhalten. Gleich werden sie den gefährlichsten Garten der Welt betreten.
Der Poison Garden von Alnwick in der nordenglischen Grafschaft Northumberland beherbergt über hundert giftige Pflanzenarten, von hochgiftigen Tropengewächsen über Psychedelika bis hin zu Hauspflanzen, mit denen man an diesem Ort nicht gerechnet hat. Vor einem Beet mit prächtigen grünen Blättern an roten Stängeln bleibt John Knox stehen. Er muss sie erst zur Seite schieben, damit man das kleine Schild sehen kann, auf dem steht: Rheum rhabarbarum. Gemeiner Rhabarber. Ein ungläubiges Tuscheln geht durch die Menge. Rhabarber? Eine tödliche Pflanze? John Knox verzieht keine Miene, als er erklärt, dass sich in den Blättern Oxalsäure1 befindet, die man sich wie »zahnstocherförmige Kristalle« vorstellen müsse: »Wenn ihr den Rhabarber roh esst, zerfetzen die euch den Mund, die Zunge und den hinteren Teil des Rachens!«
Die wenigsten Menschen denken bei Giftpflanzen an den eigenen Garten. Dabei sieht der Poison Garden einem englischen Schrebergarten nicht unähnlich. Das ist kein Zufall: Den meisten Pflanzen, die er beherbergt, begegnen wir im Alltag beim Spazieren oder Wandern und nicht selten eben auch: beim Gärtnern zu Hause!
Der Poison Garden wurde 2005 als Teil der Schlossgartenanlage von Alnwick Castle eröffnet. Treibende Kraft hinter dem Projekt ist Jane Percy, die Herzogin von Northumberland. Ihre Familie residiert bis heute in dem mittelalterlichen Schloss, das sich hinter dem Poison Garden erstreckt. Für Percy bieten die Giftpflanzen einen Zugang zu einer Vielfalt von Geschichten, mit denen sie das Interesse der Menschen wecken kann. »Kindern«, sagt sie, »ist es doch egal, ob Aspirin aus der Rinde eines Baums gewonnen wird. Was sie wirklich spannend finden, ist, wie eine Pflanze jemanden töten kann!«
Jedes Gewächs auf den fünfhundertsechzig Quadratmetern, auf denen sich der von Lorbeerhecken gesäumte Poison Garden erstreckt, erzählt eine Geschichte. Ein gepflasterter Weg führt zwischen den Beeten hindurch, ein Apfelbaum spendet Schatten vor der Mittagssonne (Apfelkerne enthalten giftige Blausäure). Eine Holzbank steht zwischen den Beeten. Das Plätschern eines Springbrunnens ist zu hören. Aber das Idyll täuscht: An der Mauer am äußeren Rand des Gartens hängen Infotafeln, die an schauerliche Giftmorde erinnern. »The Curry Killer« steht da oder »Doctor Death«.
John Knox ist um die fünfzig und der »main guide« des Poison Garden. Ohne Führung dürfen Besucherinnen und Besucher den Garten nicht betreten. Lohnt sich aber auch nicht, denn John Knox und seine Kolleginnen haben ein immenses Repertoire an Wissen und Geschichten, ohne die man selbst aufgeschmissen wäre. Ein Highlight der Tour ist der Rizinusbaum, auch Wunderbaum genannt, in der Mitte des Gartens. Er steht in einem eisernen Käfig, der Besucher davon abhalten soll, sich an seinen Früchten zu vergreifen. »So!«, donnert John fröhlich in die Runde. »Das ist die giftigste Pflanze der Welt!«
In den stacheligen roten Früchten befindet sich die Bohne, aus der Rizinusöl gewonnen wird. Das Öl wird in der Medizin unter anderem als Entzündungshemmer eingesetzt. Was aber nach dem Extrahieren ebenfalls in der Bohne übrig bleibt, ist das Toxin Rizin. »Eine einzige Bohne«, sagt John, »enthält genug Rizin, um hundert Menschen zu töten. Die Pflanze in diesem Käfig könnte an die achttausend Leute umbringen.«
1978 fiel der bulgarische Schriftsteller und Regimekritiker Georgi Markow einem Attentat des bulgarischen Geheimdiensts zum Opfer. Während er auf der Waterloo Bridge in London auf den Bus wartete, wurde er von einem Regenschirm scheinbar zufällig ins Bein gepikst. In der Spitze des Schirms befand sich ein winziges Kugelfass-Injektionsgerät, das einen Tropfen Rizin in der Größe eines Salzkorns enthielt. Innerhalb von Stunden entwickelte Markow hohes Fieber und heftige Übelkeit. Seine Schleimhäute trockneten aus, und seine inneren Organe begannen, sich zu zersetzen. Nach drei Tagen war er tot. »Ein Gegengift«, sagt John, »gibt es nicht.« Die Wahrscheinlichkeit, dass Gartenbesucher und Gartenbesucherinnen den Giftstoff destillieren können, ist aber sehr gering. Nur geübte Chemikerinnen und Chemiker, Laboranten und Laborantinnen haben das dafür nötige Know-how.
Das erste Mal hörte ich vom Poison Garden während des Lockdowns 2021. Sie erinnern sich an diese Zeit, als alle Tage in grauer Monotonie ineinanderflossen? An das Grau erinnere ich mich ganz besonders, weil ich damals in Hamburg lebte und die ersten drei Monate des Jahres tiefe Wolken über der Stadt hingen. Einmal die Woche traf ich mich mit zwei Freundinnen an der Binnenalster, und wir tranken billigen Rosé aus mitgebrachten Bechern, während wir versuchten, nicht zu nah beieinanderzustehen, weil drei Leute aus verschiedenen Haushalten nicht gemeinsam unterwegs sein durften. Man durfte zu jener Zeit in Hamburg eigentlich auch keinen Alkohol in der Öffentlichkeit trinken. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Gesetze auf einmal gebrochen.
Weil ich keine Freunde treffen durfte und die gesamte Redaktion von GEO, für die ich damals arbeitete, im Homeoffice war, verbrachte ich viele Stunden damit, Reiseblogs zu lesen. Must-sees, die natürlich alle geschlossen waren, Interrail-Routen, die nicht länger bedient wurden, die schönsten Strände, die von wilden Hunden zurückerobert worden waren. Eine kleine Obsession von mir war, Urlaube zu planen, die ich niemals machen würde. Irgendwo in diesem Strudel aus Pinterest-Posts und alten Reiseblogs stieß ich auf ein YouTube-Video über den »gefährlichsten Garten der Welt«.
Das Video war bei blauem Himmel gedreht worden und ist mit fröhlicher Streichermusik unterlegt, während ein Gärtner aus dem Voiceover aufzählt, wie verschiedene Pflanzen einen umbringen können. »Atropa belladonna wird dich töten. Datura wird dich in den Schlaf versetzen … für immer. Aconitum wird dich töten. Lorbeer erzeugt Zyanid … und wird dich töten.« 2Man sieht einen Gärtner, wie er in einem weißen Ganzkörperanzug durch die schweren Eisentore geht. Die Kamera bleibt kurz an den goldenen Totenköpfen hängen und der Aufschrift an beiden Toren, die warnt: »These plants can kill.« Dann schwenkt sie zum Inneren des Gartens und zeigt in einer schnellen Abfolge zarte lila Blüten, grüne Blätter, eine Biene, die am Nektar einer weißen Blume saugt. Es ist ein Bild perfekten Idylls, gepaart mit gruseligen Geschichten und einem Hauch schwarzen britischen Humors. Wenn dieser Lockdown vorbei war, versprach ich mir, würde ich nach Nordengland reisen und diesen Garten besuchen.
Giftpflanzen üben eine ganz besondere Faszination auf mich und viele andere aus. Ich glaube, das liegt zum einen an dem Widerspruch zwischen der auffallenden Schönheit vieler Blüten und der Gefahr, die ihnen innewohnt; er verdeutlicht das empfindliche Gleichgewicht zwischen Leben und Tod. Zum anderen verbergen sich hinter ihren Blättern die absurdesten, furchtbarsten und witzigsten Geschichten.
Was Geschichten angeht, bin ich sehr sensibel. Ich mag Krimis, aber keine Thriller. Ich mag Whodunnits, aber keine Howdunnits. Ich mag Spannung, aber kein Blut. Giftpflanzen sind darum die perfekten Protagonisten. Sie lassen mehr Raum für die Handlung, sich zu entfalten, als das Geschichten von Axtmördern tun. Ein Mensch mit abgehacktem Kopf ist tot, darüber brauchen wir nicht zu rätseln. Bei Gift sind die Folgen nicht nur weniger absehbar, sondern auch vielfältiger.
Ein Beet weiter mahnt John die Gäste, ihre Hände nun dicht am Körper zu halten, denn die Blätter der nächsten Pflanze, dem Riesen-Bärenklau, wirken phototoxisch. Bei der bloßen Berührung gelangt Gift auf die Haut und baut deren UV-Schutz ab. An diesem sonnigen Junitag ist das besonders gefährlich, denn wenn Sonnenlicht auf die infizierte Haut gelangt, können sich faustgroße Blasen bilden. Bei einer Infektion steigt das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken, um fünfundzwanzig Prozent. »Vor einigen Jahren«, erzählt John, »arbeitete eine unserer Gärtnerinnen an diesem Beet. Sie trug Handschuhe, um sich zu schützen, aber weil es ein warmer Sommertag war, hatte sie die Ärmel hochgekrempelt. Ein Besucher stolperte über sie und schubste sie mitten in den Riesen-Bärenklau!« John macht eine dramatische Pause. »Am nächsten Tag hatte sie riesige Blasen am Arm. Seither kann sie nur noch mit bedeckten Armen nach draußen gehen.«
Der Riesen-Bärenklau stammt ursprünglich aus dem Kaukasus und wurde im 19. Jahrhundert in Mittel- und Westeuropa eingeschleppt. Er kommt oft entlang von Flüssen und Kanälen vor und kann mehrere Meter hochwachsen. Seine Größe hat dem Riesen-Bärenklau seinen lateinischen Namen Heracleum mantegazzianum eingebracht, der an den griechischen Helden Herakles erinnert. Die Staude wird heute als invasiver Neophyt eingestuft, der andere Pflanzenarten verdrängt. Da er allerdings bis zu fünfzigtausend Samen pro Pflanze produziert, ist es fast unmöglich, den Riesen-Bärenklau wieder loszuwerden, wenn er einmal in einem Gebiet Wurzeln geschlagen hat.
»Seine eigentliche Heimat ist Transsylvanien«, erklärt John der faszinierten Gruppe. »Weiß jemand, wer da sonst noch gewohnt hat?«
Ein Murmeln geht durch die Menge, dann ruft eine Frau: »Dracula!«
Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. »Richtig. Und was passiert, wenn Vampire dem Sonnenlicht ausgesetzt sind? Ihre Haut fängt an zu brennen!«
Viele Märchen seien ursprünglich als Horrorgeschichten entstanden, um Kinder von giftigen Pflanzen und anderen Gefahren fernzuhalten. »Vielleicht«, mutmaßt John, »hat die Vampirlegende ja mit dem Riesen-Bärenklau begonnen.«
Natürlich stirbt, wer einmal mit dem Riesen-Bärenklau in Berührung gekommen ist, nicht gleich wie ein Vampir. Aber wie das Beispiel der Gärtnerin zeigt, braucht es nicht viel, um sich im Sonnenlicht schwere Verletzungen zuzuziehen. Die Stärke des Gifts hängt von der Intensität der Sonnenstrahlung ab, weshalb die Vergiftungsgefahr im Sommer deutlich größer ist als im Winter.
Unfälle dieser Art sind zum Glück selten. Für die Besucherinnen am gefährlichsten ist das Bilsenkraut, Hyoscyamus niger. Der starke Geruch dieser münzgroßen, cremefarbenen Blüten kann Schwindel und Ohnmacht auslösen. Zur Sicherheit steht hier eine hölzerne Bank. Ersthelfer sind jederzeit zur Stelle, um die Opfer des Bilsenkrauts zu versorgen. Zwei Besucher mussten sich allein an diesem Tag schon hinsetzen – und es ist erst früher Nachmittag!
John Knox hat jedoch Zweifel, ob es wirklich die Blumen sind, die den Besucherinnen den Rest gegeben haben, und nicht einfach nur die Aufregung. »Den Leuten wird auch im Winter schwindelig, wenn gar nichts blüht«, berichtet er. »Einmal hatten wir einen jungen Mann auf einer Tour, der nach der Hälfte der Führung ohnmächtig wurde. Ein paar Wochen später kehrte er zurück, diesmal mit seiner Freundin. Aber da schaffte er es noch nicht einmal durchs Tor!« John lacht. »Er hat es an diesem Nachmittag bestimmt zwanzigmal versucht, aber er kam einfach nicht rein, ohne ohnmächtig zu werden!«
Ich weiß zum Zeitpunkt meines Besuchs nicht viel über Giftpflanzen. Mein Wissen stammt vor allem aus Agatha-Christie-Romanen und True-Crime-Podcasts. Aber was ich weiß, fasziniert mich. Zum Beispiel die Tatsache, dass viele Giftpflanzen auch als Medizin verwendet werden. So ist die Rinde der Pazifischen Eibe beim Verzehr hochgiftig, aber eben dieser Giftstoff hemmt auf zellulärer Ebene das Fortschreiten vieler Krebsarten. Sogar Brennnesseln, die bekannt für ihre ätzende Wirkung sind, werden in Reiztherapien gegen Entzündungen eingesetzt.
Wie ist das möglich? Wie kann eine Substanz sterbenskrank machen, aber in veränderter Dosis oder Zubereitung jemandem das Leben retten?
Selbst Affen und Schimpansen nehmen bei Magenschmerzen pharmakologisch wirksame Pflanzen zu sich. Dieses atavistische Wissen über die Natur haben wir über die Jahrtausende von Generation zu Generation weitervererbt. Die ersten Menschen, die Wunden, Krankheiten und Vergiftungen zu heilen versuchten, müssen dabei zuweilen reihenweise tot umgefallen sein. Ob eine Pflanze heilt oder tötet, kann nämlich schon allein von der Jahreszeit abhängen. Weil die Kraft der Pflanzengifte, der sogenannten Phytotoxine, erheblich variieren kann, kommt es vor, dass zwei identische Pflanzen am gleichen Standort ganz unterschiedlich starke Toxine aufweisen.
Dieses System von Trial and Error hat maßgeblich zu unserem heutigen Verständnis des menschlichen Körpers beigetragen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Tollkirsche. Der Giftstoff Atropin, der in der ganzen Pflanze vorhanden ist, stört die Signale ans Gehirn, die den Speichelfluss steuern, und trocknet so den Mund aus. Das kann im Vergiftungsfall sehr unangenehm sein, wird aber in der Chirurgie routinemäßig eingesetzt, um postoperative Komplikationen zu verhindern. Bei bewusstlosen oder intubierten Patienten besteht nämlich die Gefahr, dass Speichel in den hinteren Teil des Rachens und in die Lunge gerät. Das kann das Atmen erschweren und zu Lungenentzündungen führen. Atropin aber hemmt die Speichelproduktion und verhindert so lebensbedrohliche Infektionen.
Was also ist Gift überhaupt? Mehr als nur eine chemische Frage ist es auch eine moralische – und eine politische. Sind Psychedelika Giftpflanzen? Ist Zucker giftig? Oder Alkohol? Der Schweizer Arzt Paracelsus prägte im 16. Jahrhundert das bis heute oft zitierte Bonmot: »Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis machts, dass ein Ding kein Gift sei.« 3 In der Frage, was eine Gesellschaft als giftig klassifiziert, sind Chemie, Politik und Wirtschaft untrennbar miteinander verwoben.
Ich möchte den Einfluss verstehen, den Pflanzen auf unsere Kultur haben. Ich möchte eintauchen in die Folklore und die Märchen – jene Geschichten, in denen Pflanzen die Helden und Bösewichte sind. Vor allem aber möchte ich ihrem Innersten auf den Grund gehen: Was verleiht Pflanzen Heilkräfte? Was gibt ihnen die Macht zu töten? Und: Wie gehen wir Menschen mit diesen Kräften um?
So kommt es, dass ich mir wie die privilegierte Besucherin einer anderen Welt vorkomme, als mich John Knox vor den Eingangstoren zum Poison Garden begrüßt und mir anbietet, mich mit den Gewächsen im Inneren des Gartens bekannt zu machen. Was ich an dem Tag wirklich entdecke, ist eine atemberaubend fremdartige Welt, die nicht etwa hinter magischen Portalen oder nur in der Tiefe exotischer Urwälder liegt, sondern direkt hinter meiner Haustür. Alle Geschichten – das lerne ich an diesem Tag – sind wahr.
Übrigens: Wer nach Verlassen des Gartens nun Sorge hat, an einer versehentlichen Rhabarbervergiftung zu sterben, für den hat John doch noch einen Trost parat. Denn anders als bei Rizin gibt es für Oxalsäure ein Gegengift: »Die Oxalsäure entzieht dem Magen jegliches freie Kalzium und lagert sich in den Nieren in Form von Nierensteinen ab. Aber meistens essen wir Rhabarber sowieso mit milchhaltiger Vanillesauce. Die lässt die Oxalatkristalle weich werden und sie geflissentlich durch den Körper gleiten.«
Zwei: Die Alraune
Zwei
Die Alraune
Mandragora
Vor vielen Jahren, am Anfang dieser Geschichte, saßen zwei Träumer vor einem Kassettenspieler. Das Band ratterte leise über die Wickelrollen, und aus den Lautsprecherboxen drangen Geschichten von Zaubersprüchen, Fabelwesen und magischen Pflanzen. Es waren Geschichten von einer Welt, die direkt neben der unseren existierte und ihr doch unendlich fern schien.
Wie Tausende andere Kinder auch wuchsen mein Bruder und ich mit den Geschichten vom Zauberlehrling Harry Potter auf. Jahr für Jahr warteten wir voll Sehnsucht auf unseren Brief aus Hogwarts, der renommierten Schule für Hexerei und Zauberei, und nachts träumten wir abwechselnd vom Fliegen auf Besenstielen und Schlangenwesen, die ahnungslosen Kindern in dunklen Fluren auflauerten und sie mit ihrem bloßen Blick töten konnten. Angst und Sehnsucht schlossen sich nicht gegenseitig aus, im Gegenteil: Sie ergänzten sich. Dass das Zauberhafte auch etwas unheimlich war, machte es erst faszinierend.
Es ist ein Irrglaube, dass man im Erwachsenenalter den Sinn für Fantasie ablegt. Die schlausten Köpfe der Wissenschaft glaubten im Lauf der Geschichte immer wieder, auf Magie gestoßen zu sein, weil es nach ihrem Wissensstand keine logischen Erklärungen gab. Wenn ich ehrlich bin, dann geht es mir bis heute mit sehr vielen Dingen im Alltag so. Warum fallen Flugzeuge nicht vom Himmel? Magie! Wie funktioniert ein Toaster? Magie!
Mag die Realität auch etwas unromantischer sein als im Märchen, so gefällt es mir doch, dass wir Menschen uns die Welt viele Jahrhunderte lang mit Zauberei, Feen und Flüchen erklärten und es an vielen Orten bis heute tun. Ich mag den Gedanken, dass sich manche Dinge nicht anders erklären lassen, als dass ihnen ein kleiner Zauber innewohnt.
Von der Alraune, die John Knox mir im Poison Garden zeigt, ist nur ein unscheinbares Büschel dicker grüner Blätter zu sehen. Die Wurzel ist tief im Boden. »Sie schreit nicht, wenn man sie aus der Erde zieht«, sagt John, bevor ich genau das fragen kann. »Wir haben es getestet.« Er gibt belustigt einen Laut von sich. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie enttäuscht die ganzen anwesenden Harry-Potter-Fans darüber waren!«
Die Alraune oder Mandragora officinarum spielt in Harry Potter eine bedeutende Rolle. Aus ihren Wurzeln kann nämlich ein Trank gebraut werden, der Menschen aus einer rätselhaften Versteinerung erlöst. Tatsächlich werden der Alraune schon seit Menschengedenken magische Kräfte zugeschrieben. Weil die unter dem Laub gegabelte Wurzel menschlichen Beinen nicht unähnlich sieht, glaubte man, die Alraune sei das lebende Bindeglied zwischen Pflanzen und Tieren. Ihre vermeintlich menschenähnliche Form brachte ihr Spitznamen wie »Wurzel des Lebens« oder »göttliche Wurzel« ein. Viele Menschen glaubten, dass Alraunen ihnen außerdem ihre verlorene Jugend zurückgäben und als Liebestrank wirkten.
»Die Alraune ist voller Gift«, räumt John mit den Mythen auf. »Sie enthält Atropin, Scopolamin und Hyoscyamin. Im Mittelalter wurde sie als Betäubungsmittel eingesetzt.« Er zählt auf: »Ein bisschen Alraune, ein bisschen Schlafmohn, etwas Bilsenkraut, eine Prise Stechapfel, alles zusammenmischen und die Säfte mit einem Schwamm auffangen. So.« John ahmt mit seiner Hand nach, wie er alle diese giftigen Substanzen mischt und einen unsichtbaren Schwamm eintunkt. Richtige Schwämme mit ebendieser Giftmischung wurden in mittelalterlichen Operationssälen Patienten vor Mund und Nase gehalten, um sie zu betäuben. »Das kann dich gut und gern drei Tage außer Gefecht setzen«, fährt er fort, »sofern die Mischung gelungen ist, versteht sich. Hat der Arzt etwas falsch gemacht, dann wachst du vielleicht nie wieder auf.«
Die Alraune oder Mandragora ist eine Pflanzengattung in der Familie der Nachtschattengewächse. Der Name setzt sich aus dem altgriechischen mandra, »Stall«, und agora, »Sammelplatz«, zusammen. Daraus lässt sich schließen, dass Alraunen früher in der Nähe von Stallungen wuchsen. Ursprünglich in Norditalien und Griechenland beheimatet, waren ihre getrockneten Wurzeln im Mittelalter in Apotheken in ganz Europa zu finden. Das erklärt auch ihren deutschen Namen: »Alraune« stammt aus dem Germanischen. Runa bedeutet »Geheimnis«, der Name könnte also entsprechend ihrer Form für »Kobold« oder »mythisches Wesen« stehen. Heute erstreckt sich die Verbreitung der Alraune von Südeuropa über Nordafrika bis nach Westasien und in die Himalaya-Region.
Mittelalterliche Kräuterbücher schrieben ihr heilende Kräfte zu, besonders bei Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen, Gicht und Wahnsinn. Zweifellos zeigten die in der Alraune enthaltenen Wirkstoffe eine gewisse Effektivität. Allerdings wurden nur die Rohextrakte der Pflanze verwendet, was den Anwendern wenig Kontrolle über die Kraft und die Nebenwirkungen dieser Medizin ließ. Dass jemand bei der Behandlung von lästigen Kopfschmerzen starb, ist darum nicht auszuschließen. Vor allem aber wurden Alraunen als Aphrodisiakum verkauft. Bereits im alten Ägypten waren sie eine wichtige Zutat in Liebestränken, und in der Antike setzten Hebammen die Pflanze ein, um Fruchtbarkeit und Empfängnis zu fördern. Zugleich erleichterten Alraunen die Geburt, dienten als Betäubungsmittel bei Kaiserschnitten und hatten außerdem die Kraft, Föten ab- und Totgeburten auszutreiben.
Ihre gewaltige Wirkung machte die Alraune sehr wertvoll, und über zweihundert Jahre war sie ihr Gewicht in Gold wert. Es ist also nicht verwunderlich, dass Leute, die Alraunen bei sich im Garten wachsen hatten, diese auch schützen wollten. »Die Pflanze mochte Gold wert sein«, meint John, »aber jeder wusste: Wenn man sie aus der Erde zieht, fängt sie an zu schreien. Und dieser Schrei tötet jeden, der ihn hört. Es hilft natürlich«, fügt er nach einer kurzen Sprechpause hinzu, »dass damals alle abergläubisch waren.«
Um dem furchtbaren Alraunenschrei vorzubeugen, legen Harry Potter und seine Klassenkameraden Gehörschutz an. Eine clevere Methode, aber die Menschen im Mittelalter zogen oft magische Rituale vor. Um nicht von dem Schrei getötet oder anderweitig außer Gefecht gesetzt zu werden, schlichen sie um Mitternacht in den Garten, banden ein Stück Schnur an den Teil der Pflanze, der aus der Erde ragte, und knüpften das andere Ende an den Schwanz eines schwarzen Hundes. »Es funktioniert nur, wenn es ein schwarzer Hund ist«, betont John Knox. »Sie bliesen danach in ein Horn, das den Hund anlockte und gleichzeitig den Schrei der Alraune übertönte. Der Hund riss die Pflanze aus, und schon war man im Besitz einer Pflanze, die ihr Gewicht in Gold wert war! Aber …« John seufzt. »In keiner der Geschichten steht, was mit dem armen Hund passiert.«
Alraunen enthalten mehrere giftige Verbindungen, sogenannte Tropanalkaloide. Sie kommen in allen Pflanzenteilen außer den Früchten vor. Bei diesen Verbindungen handelt es sich um starke Anticholinergika, Wirkstoffe, die den körpereigenen Botenstoff Acetylcholin behindern. Acetylcholin hat die Aufgabe, Nervenimpulse im Nervensystem weiterzuleiten. Von außen nimmt man trockene und gerötete Haut, erweiterte Pupillen und trockene Schleimhäute wahr. Darüber hinaus erhöhen sie den Blutdruck und hemmen die Nervensignale, die den Herzrhythmus regulieren, sodass das Herz schneller zu schlagen beginnt und sich unter Umständen komplett überarbeitet.
Kein Wunder also, dass auch Harry Potter findet, Alraunen gehörten zu den »viel interessanteren und gefährlicheren Pflanzen«. 1 Was seine Kräuterkundelehrerin, Professor Sprout, jedoch nicht erwähnt, sind die halluzinogenen Eigenschaften der Alraune. Im Mittelalter und sogar darüber hinaus wurden die Alraunwurzeln zu Salben verarbeitet. Die Tinktur wurde beispielsweise auf so empfindliche Stellen wie die Schleimhäute der Vagina getropft und mit einem Besenstiel verteilt. Das versetzte die Frauen in eine Trance, die ihnen das Gefühl gab, sie könnten fliegen. Diese Praxis bereitete außerdem den Boden für das Gerücht, Alraunen verliehen Frauen Hexenkräfte und verzauberten ihre Besen, sodass sie darauf zum Hexensabbat fliegen konnten.
So zauberhaft Alnwick mit seiner Schlosskulisse auch erscheint, der Nordosten Englands, zu dem auch die Grafschaft Northumberland gehört, hat die höchste Zahl von Drogentoten pro Kopf im ganzen Land. Vor diesem Hintergrund rief Jane Percy, Herzogin von Northumberland, auch Poison Garden ins Leben. Der Poison Garden verfügt über eine Sondergenehmigung für den Anbau von Koka- und Marihuanapflanzen, anhand derer Menschen wie John Kinder und Jugendliche über die Gefahren von Pflanzen aufklären.
Die Art, wie Gifte wirken, verrät eine Menge darüber, wie der menschliche Körper funktioniert. Viele Giftverbindungen greifen das Nervensystem an und stören die elektromagnetischen Signale, mit denen die normalen Funktionen des Körpers gesteuert werden. So können Gifte die Kommunikation zwischen Teilen des Herzens unterbrechen und einen Herzstillstand verursachen. Oder sie können die Regulierung des Zwerchfells stören und dafür sorgen, dass wir ersticken. Andere Gifte dringen in die Körperzellen ein und werden in den Zellstoffwechsel aufgenommen, wodurch die gesamte Zellchemie ins Stocken gerät und Zellen im Extremfall absterben. Und sind erst genügend Zellen abgestorben, ist bald auch der Rest des Körpers dran.
Während sich Vergiftungen sehr verschieden auswirken können, sind die Methoden, jemanden zu vergiften, relativ beschränkt. Heruntergebrochen gibt es nämlich nur vier Möglichkeiten, einer Person Gift einzuflößen: durch den Verdauungstrakt, über die Atemwege, über die Haut oder indem der Stoff direkt in die Muskeln oder den Blutkreislauf gespritzt wird.
Je nachdem, wie ein Giftstoff aufgenommen wird, verändert sich auch seine Wirkung. Die Atropa belladonna kann ich berühren, ohne mir dabei Schaden zuzuziehen. Proteintoxine wiederum, die etwa im Rizinusbaum oder im Fingerhut vorkommen, können von Magen und Darm abgebaut und ausgeschieden werden. Sie entfalten ihre tödliche Wirkung vor allem, wenn sie injiziert werden.
Drei: Die Engelstrompete
Drei
Die Engelstrompete
Brugmansia
Es scheint kein Zufall zu sein, dass der Poison Garden ausgerechnet in der Schlossparkanlage von Alnwick Castle liegt – jenem Schloss, das als Hogwarts-Kulisse in den Harry Potter-Filmen verwendet wurde. Das Castle wurde im Jahr 1096 erbaut und ist heute im Besitz des Herzogs von Northumberland, mit vollem Namen Ralph Percy, 12th Duke of Northumberland. Es ist ein Schloss wie aus dem Bilderbuch. Mit Türmen und Zinnen und dicken Mauern und mächtigen Eingangstoren, neben denen sich die Schießscharten befinden, aus denen die Bogenschützen ihre Pfeile auf den Feind richten konnten, ohne selbst getroffen zu werden. Eigentlich diente Alnwick Castle nämlich als Festung zur Abwehr gegen schottische Angreifer. Heute finden auf seinen Ländereien vor allem Mittelalterfeste mit Drachen und Rittern statt, und wer will, kann an Besenflugstunden teilnehmen.
Jane Percy wurde 1995 eher unerwartet zur Herzogin Northumberlands, nachdem der ältere Bruder ihres Mannes Ralph plötzlich verstarb. Mit dem Titel erbten Jane und Ralph auch den Adelssitz. Die Schlossgärten waren zu der Zeit eine stillgelegte Forstwirtschaft, in der reihenweise Weihnachtsbäume standen, und Jane beschloss, sich der Gärten anzunehmen. Sie hatte zunächst vor, einen Apothekergarten anzulegen, wie es bei Schlossgärten oft der Brauch ist, aber sie änderte bald schon den Kurs und begann stattdessen, giftige Pflanzen zu sammeln. Die Pflanzen mussten für Jane nur ein einziges wichtiges Kriterium erfüllen: Sie mussten gute Geschichten erzählen. So kommt es, dass auf den knapp zweihundert Quadratmetern, über die sich der Poison Garden seit seiner Eröffnung 2005 erstreckt, heute exotische Gewächse wie die Brugmansia aus Südamerika neben so unscheinbaren Pflanzen wie der Lorbeerhecke stehen.
An genau diesen Hecken vorbei führt mich John zu einem Baum am hinteren Ende des Gartens. Große trompetenförmige Blüten hängen von den Ästen. Sie leuchten gelborange, und ein betörend süßer Duft geht von ihnen aus. Bevor ich allerdings zu nahe treten kann, hält John mich zurück. »Das ist die Brugmansia«, erklärt er warnend. »Die Engelstrompete. Sie ist eine der gefährlichsten Pflanzen hier im Garten.«
Die Engelstrompete ist in Südamerika heimisch, allerdings kommt sie als Gartenzierpflanze mittlerweile in ganz Europa vor. Sie wird bis zu fünf Meter hoch, und ihre trompetenförmigen Blüten können dreißig Zentimeter lang werden. Die Engelstrompete gehört zur Familie der Nachtschattengewächse, die in unterschiedlichen Dosen die Alkaloide Solanin, Atropin und Hyoscin (auch Scopolamin genannt) enthalten. Letzteres kommt in der Pflanze in besonderer Konzentration vor und kann ganz unterschiedliche Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben. In kleinen Mengen, meint John, seien die Extrakte als Mittel gegen Seekrankheit verwendet worden. In größeren Mengen als Wahrheitsserum.
»Hyoscin blockiert das Gedächtnis«, fasst er zusammen. »Es macht dich ganz entspannt und schläfrig und versetzt dich in eine Trance, die lebensgefährlich sein kann.« Das machte das Gift vor allem bei professionellen Mördern sehr beliebt, da sie wussten, dass ihre Opfer auf diese Weise nicht gewalttätig werden würden.
Lange Zeit wurde Hyoscin Müttern zur Entbindung verabreicht, um ihre Schmerzen zu lindern. Tatsächlich verwischt die Droge aber vielmehr die Erinnerung an die Schmerzerfahrung, als dass sie den eigentlichen Schmerz dämpft. Hyoscin versetzte die Frauen in einen »Dämmerschlaf«, einen Zustand, in dem die Patientinnen keine Schmerzen mehr wahrnahmen, aber noch immer bei Bewusstsein waren. Dazu wurden ihnen standardmäßig 0,432 Milligramm Hyoscin und 32,4 Milligramm Morphin intramuskulär gespritzt. Eine Dreiviertelstunde später folgte eine zweite Hyoscinspritze mit der gleichen Dosierung. Um die Wirkung des Dämmerschlafs zu verstärken, wurden die Frauen zum Gebären in einen abgedunkelten Raum gebracht, wo man ihnen die Augen verband und die Ohren mit ölgetränkter Baumwolle verstopfte. Diese Sinnesunterdrückungen sollten auch einem möglichen Delirium vorbeugen – einer unerwünschten Nebenwirkung von Hyoscin.
Die Dämmerschlafmethode wurde vor allem in Deutschland so beliebt, dass ab 1907 wohlhabende Frauen aus der ganzen Welt zur Entbindung nach Freiburg im Breisgau reisten, wo die Methode von dem renommierten Mediziner Carl Gauß angewandt wurde. Tatsächlich hatte die Frauenklinik der Badischen Landesuniversität, an der er als Arzt tätig war, die niedrigsten Mütter- und Neugeborenensterblichkeitsraten in Freiburg.
Anfang der 1920er-Jahre nutzte der texanische Arzt Robert Ernest House den Dämmerschlafzustand der Frauen, um bei ihnen einen sogenannten »Gedächtnistest« durchzuführen. Er kalibrierte die richtige Dosis für den Dämmerschlaf, indem er den Frauen vor der Verabreichung des Hyoscin einen Gegenstand zeigte, den sie benennen mussten. Nach jeder darauffolgenden Dosis zeigte er ihnen den Gegenstand erneut, bis es ihnen nicht mehr gelang, ihn zu identifizieren. House berechnete die betäubende Wirkung von Hyoscin also zunächst, indem er das geschwächte Erinnerungsvermögen seiner Patientinnen erhob. Aber bald nahmen seine Erkenntnisse eine überraschende Wendung: House kam zu dem Schluss, dass er die Frauen mit Hyoscin dazu bringen konnte, sehr intakte Erinnerungen mit großer Offenheit wiederzugeben. Die Frauen im Wochenbett antworteten selbst im Dämmerschlaf mit erstaunlicher Genauigkeit auf fast alle Fragen. House war sich sicher: Mit der Hilfe von Hyoscin konnte er »jeden dazu bringen, bei jeder Frage die Wahrheit zu sagen«. 1
Wie viel wissenschaftliche Erkenntnis tatsächlich in House’ Thesen steckte, darüber waren sich schon seine Zeitgenossen uneins. Ihn schien vor allem die Tatsache zu faszinieren, dass die Frauen in ihrem beeinträchtigten Zustand überhaupt kommunizieren konnten. Einen wirklichen Grund, den Arzt anzulügen, hatten sie eh nicht. Aber House machte seine Entdeckung in einer Zeit, in der zahlreiche Nachrichten über Jugendkriminalität und Verbrecherbanden kursierten. Dazu dominierten Schlagzeilen über Korruption bei der Polizei und in den Behörden. Vor diesem Hintergrund fühlten sich viele Bürger verpflichtet, sich am Kampf gegen das Verbrechen zu beteiligen. Dieses Pflichtgefühl wurde noch verstärkt, als ein Leitartikel 1922 die Leserinnen dazu aufrief, sich selbst die Frage zu stellen: »Was habe ich getan, um zu helfen?« 2
Vor diesem Hintergrund fand am 13. Februar 1922 der erste öffentliche Prozess gegen zwei Gefangene in Dallas statt, die beide ihre Unschuld beteuerten. W. S. Scrivenor hatte angeblich einen Raubüberfall verübt, und Ed Smith wurde des Mordes beschuldigt. House schlug erfolgreich vor, beim Verhör Hyoscin einzusetzen. Beiden Häftlingen wurde eine Dosis verabreicht – und beide leugneten weiter ihre Schuld. »Die Antworten auf die Fragen rutschten mir aus dem Kopf«, beschrieb Scrivenor die Erfahrung später. »Ich hatte das Gefühl, dass ich keine phantasievollen Ergänzungen dazu formulieren konnte.« Er habe gar nichts anderes tun können, als die Wahrheit zu sagen, »weil ich wusste, dass ich die Wahrheit sagte und dass es unmöglich war, etwas anderes zu tun«. 3 Scrivenors Aussage trug zur Glaubwürdigkeit von Hyoscin als Wahrheitsserum bei, was wiederum Ed Smith half, der 1921 wegen eines Mordes von 1916 verhaftet worden war. Die Zeugen des Vorfalls weigerten sich, einen Hyoscin-Test zu machen, was Smith nur noch mehr Glaubhaftigkeit verlieh. Sowohl er als auch Scrivenor wurden daraufhin freigesprochen.
»Das Problem ist nur«, gibt John Knox zu bedenken, »dass zu viel Hyoscin das Herz stark schädigen kann. Es in einem Verhör einzusetzen, ist also fast wie eine doppelte Drohung: ›Sag mir, wo die Bombe ist – das Wahrheitsserum zwingt dich nicht nur, mir alles zu erzählen, sondern in drei, vier Tagen bist du auch tot!‹«
Das Wahrheitsserum erregte nationales Aufsehen, wurde aber in den Jahren danach von Gerichten regelmäßig als unzureichendes Beweismittel abgelehnt. Polizei, Strafvollzugsbeamte, Seelsorger und sogar ein paar Anwälte indes waren von der Idee eines Mittels sehr angetan, das Menschen dazu brachte, die Wahrheit zu sagen. Die Tatsache, dass angesehene Juristen und ausgebildete Psychologen den Einsatz von Hyoscin äußerst kritisch hinterfragten, hatte kaum Einfluss auf ihre Begeisterung. House selber reiste quer durch die USA, um »Hyoscin-Befragungen« von Verdächtigen und Verurteilten durchzuführen. In der Hoffnung, das Potenzial seiner Droge demonstrieren zu können, besuchte er Gefängnisse in Kalifornien, Los Angeles und New Orleans. Bis 1925 führte House sechsundachtzig solcher »Hyoscin-Befragungen« durch. Zwar sollte Hyoscin nie als Beweismittel vor Gericht zugelassen werden, aber immerhin führten die Experimente in sechsundzwanzig Fällen dazu, dass Angeklagte wieder freigelassen wurden.
House sah das Wahrheitsserum als wichtiges Mittel, um korrupte Institutionen und verbrecherische Einzelpersonen zu Ehrlichkeit und Transparenz zu zwingen. Der Einsatz von Hyoscin, glaubte er, würde nicht nur echte Geständnisse garantieren, sondern auch falsche verhindern. Angesichts der von US-amerikanischen Behörden oft angewandten Verhörmethoden war das Wahrheitsserum vielleicht tatsächlich nur eine »milde Form der Folter«, 4 wie George W. Kirchway, Dekan der Columbia Law School, es 1923 nannte. Dennoch wurde das Wahrheitsserum schon zu seiner Zeit mit unfreiwilligen Geständnissen gleichgesetzt, die unwilligen Personen abgerungen wurden. Und als House 1929 einen schweren Schlaganfall erlitt und im Jahr darauf starb, verlor Hyoscin seinen energischsten Verfechter.
Nach dem Tod des Arztes wurde das Wahrheitsserum denn auch vermehrt dafür eingesetzt, um Geständnisse von widerspenstigen Angeklagten zu erhalten. Es war nicht länger Mittel, das Polizei und Justiz reformierte, sondern verhalf dazu, deren Autorität zu stärken. Im Laufe seiner späteren Geschichte erfuhr das Wahrheitsserum weder eine zunehmende Legitimität noch einen stetigen Niedergang. In den 1960er- und 1970er-Jahren wurden hypnotische Drogen in der forensischen Psychiatrie als Hilfsmittel zur Auffrischung von Zeugenerinnerungen genutzt. In den 1980er-Jahren setzte man Hyoscin ein, um Opfer von sexuellem Missbrauch dabei zu unterstützen, sich wieder an Details zu erinnern
Fast zur gleichen Zeit, als House die Funktion von Hyoscin als Wahrheitsserum erforschte und testete, fand auf der anderen Seite des Ozeans ein Mordfall statt, der zahlreiche Krimiromane des 20. Jahrhunderts inspirierte und dessen Aufklärung bis heute kontrovers diskutiert wird. Eine buchstäbliche Leiche im Keller, ein untreuer Ehemann und ein Detektiv, der Jack the Ripper auf den Fersen war: Die Geschichte von Dr. Crippen hat alles, um Krimiliebhaber in ihren Bann zu ziehen.
Am 30. Juni 1910 wurde Kriminalhauptkommissar Walter Dew in das Büro seines Chefs gerufen. Dew war siebenundvierzig Jahre alt und mit dem Ermitteln von Mordfällen gut vertraut. In den 1880er-Jahren, der Zeit, in der Jack the Ripper sein Unwesen in London trieb, war Dew in Whitechapel im Osten Londons stationiert. Sein Traum war es gewesen, »eines Tages im Zeugenstand zu stehen und gegen Jack the Ripper auszusagen«, wie er später in seiner Autobiografie schrieb. Dazu kam es jedoch nie, die Morde sind bis heute nicht aufgeklärt.
Sein Chef stellte Dew den Theatermanager John Nash und dessen Frau, die amerikanische Varietésängerin Lil Hawthorne, vor. Die beiden hatten Scotland Yard aufgesucht, weil sie sich um Hawthornes Freundin aus der Music Hall Ladies’ Guild, Cora Crippen, sorgten. Cora, auch bekannt unter ihrem Bühnenpseudonym Belle Elmore, hatte England angeblich am 2. Februar 1910 in Richtung Amerika verlassen und war dort am 23. März gestorben. Nur: Nash und Hawthorne trauten der Sache nicht so richtig.
Coras Mann, ein amerikanischer Homöopath und Zahnarzt namens Dr. Hawley Harvey Crippen, konnte – oder wollte – ihnen nicht eindeutig sagen, wie oder wo Cora gestorben war. Ihre Leiche sollte, entgegen dem katholischen Brauch, eingeäschert werden. Nach ihrer Abreise waren mehrere Schecks mit Coras Unterschrift in London eingelöst worden, ihr Name aber stand nicht auf der Passagierliste des Schiffs, das zuletzt in Richtung Amerika abgelegt hatte.
Walter Dew stimmte zu, dass »die ganzen Umstände rätselhaft waren«, war aber überzeugt, dass es für Coras Verschwinden irgendeine profane Erklärung gab. In Gesprächen mit ihren Freundinnen und anderen Mitgliedern der Gilde musste er jedoch bald feststellen, dass er es nicht mit einem herkömmlichen Vermisstenfall zu tun hatte. Dr. Crippen hatte allen erzählt, Cora sei nach Amerika gereist, um einige rechtliche Angelegenheiten für ihn zu regeln und seine Familie zu besuchen. Crippens Sohn Otto aus einer früheren Ehe berichtete Dew jedoch in einem Telegramm, er habe weder von Coras Besuch noch von ihrem Tod gewusst. Erst als sein Vater ihm schrieb, seine Frau sei in Los Angeles gestorben, habe er davon erfahren. Den US-Behörden jedoch lagen keine Dokumente zu Coras Todesfall vor.
Als Dew am 8. Juli Dr. Crippen in dessen Haus in Camden Town in Nordlondon aufsuchte, um ihn zu befragen, machte ihm Ethel Le Neve die Tür auf: Crippens Sekretärin und Geliebte. Sie war längst in das Haus eingezogen und trug, zur großen Irritation von Coras Freundinnen, regelmäßig deren Kleidung und Schmuck. Le Neve führte Dew in die New Oxford Street, wo Crippen sein Büro hatte.