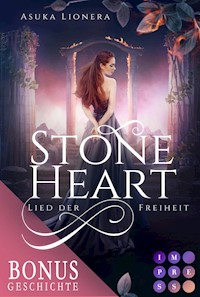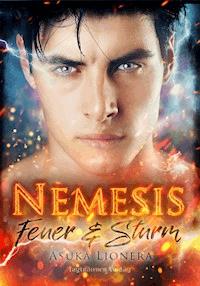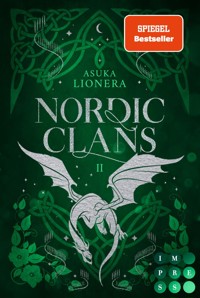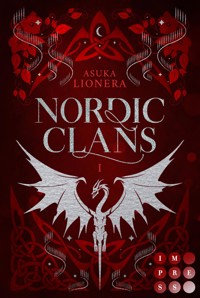7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
**Wenn deine Gefühle zur größten Gefahr für dich werden** Als Frau hat Scarlet nach dem Tod ihres Vaters, dem Clanführer der Roten, nicht viele Möglichkeiten. Die Welt, in der sie lebt, ist ein gefährlicher Ort, an dem hungrige Bestien in den Wäldern lauern – starke und unzähmbare Kreaturen. Einzig die hohen Mauern der Städte, in denen die Frauen leben müssen, versprechen ein Minimum an Sicherheit. Aber Scarlets rebellisches Herz sehnt sich nicht nach Schutz, sondern danach zu kämpfen. Und nach ihrem besten Freund: Tristan, dem Sohn des neuen Clan-Führers. Für ihn ist sie bereit alles zu riskieren: ihre Zukunft, ihr Leben und ihre Liebe. //Dies ist ein Roman aus dem Carlsen-Imprint Dark Diamonds. Jeder Roman ein Juwel.// //Alle Bände der dramatisch-düsteren Reihe »Feral Moon«: -- Band 1: Feral Moon. Die rote Kriegerin -- Band 2: Feral Moon. Der schwarze Prinz -- Band 3: Feral Moon. Die brennende Krone//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Dark Diamonds
Jeder Roman ein Juwel.
Das digitale Imprint »Dark Diamonds« ist ein E-Book-Label des Carlsen Verlags und publiziert New Adult Fantasy.
Wer nach einer hochwertig geschliffenen Geschichte voller dunkler Romantik sucht, ist bei uns genau richtig. Im Mittelpunkt unserer Romane stehen starke weibliche Heldinnen, die ihre Teenagerjahre bereits hinter sich gelassen haben, aber noch nicht ganz in ihrer Zukunft angekommen sind. Mit viel Gefühl, einer Prise Gefahr und einem Hauch von Sinnlichkeit entführen sie uns in die grenzenlosen Weiten fantastischer Welten – genau dorthin, wo man die Realität vollkommen vergisst und sich selbst wiederfindet.
Das Dark-Diamonds-Programm wurde vom Lektorat des erfolgreichen Carlsen-Labels Impress handverlesen und enthält nur wahre Juwelen der romantischen Fantasyliteratur für junge Erwachsene.
Asuka Lionera
Feral Moon 1: Die rote Kriegerin
**Wenn deine Gefühle zur größten Gefahr für dich werden** Als Frau hat Scarlet nach dem Tod ihres Vaters, dem Clanführer der Roten, nicht viele Möglichkeiten. Die Welt, in der sie lebt, ist ein gefährlicher Ort, an dem hungrige Bestien in den Wäldern lauern – starke und unzähmbare Kreaturen. Einzig die hohen Mauern der Städte, in denen die Frauen leben müssen, versprechen ein Minimum an Sicherheit. Aber Scarlets rebellisches Herz sehnt sich nicht nach Schutz, sondern danach zu kämpfen. Und nach ihrem besten Freund: Tristan, dem Sohn des neuen Clan-Führers. Für ihn ist sie bereit alles zu riskieren: ihre Zukunft, ihr Leben und ihre Liebe.
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Playlist
Das könnte dir auch gefallen
© rini
Asuka Lionera wurde 1987 in einer thüringischen Kleinstadt geboren und begann als Jugendliche nicht nur Fan-Fiction zu ihren Lieblingsserien zu schreiben, sondern entwickelte auch kleine RPG-Spiele für den PC. Ihre Leidenschaft machte sie nach ein paar Umwegen zu ihrem Beruf und ist heute eine erfolgreiche Autorin, die mit ihrem Mann und ihren vierbeinigen Kindern in einem kleinen Dorf in Hessen wohnt, das mehr Kühe als Einwohner hat.
Der Narben lacht,wer Wunden nie gefühlt.
William Shakespeare(Romeo und Julia)
SCARLET
KAPITEL 1
Die letzten Meter sind die schlimmsten, aber ich gebe noch einmal alles. Obwohl die Muskeln schmerzen, befehle ich meinen Beinen, schneller zu laufen. Schneller und immer schneller. Die Umgebung huscht an mir vorbei, verschwimmt zu einem undeutlichen Schleier, während ich nur Augen für den Baum direkt vor mir habe. Noch fünf Meter, vier, drei …
Ich strecke die Hand aus und schlage gegen den Stamm.
»Erster!«, keuche ich und drehe mich um.
Tristan ist bereits hinter mir und hat seine Hand ebenfalls gehoben, um den Baumstamm, der seit jeher die Zielmarkierung unserer Wettrennen ist, zu berühren.
Ich lehne mich mit dem Rücken gegen die Rinde und schaue zu dem jungen Mann vor mir auf, während er die Hand neben meinem Gesicht abstützt. Mit einem schelmischen Grinsen erwidert er meinen Blick und ein aufgeregtes Flattern breitet sich in meinem Bauch aus.
Das passiert mir in letzter Zeit häufiger in Tristans Gegenwart. Anfangs fand ich es seltsam, aber mittlerweile freue ich mich auf dieses unbekannte Gefühl.
Wir japsen beide nach Luft; Schweiß rinnt unsere Schläfen hinab. Meine Muskeln brennen und pulsieren nach der Anstrengung, aber trotzdem fühle ich mich glücklich.
»Du hast mich schon wieder besiegt, Prinzessin«, brummelt Tristan, lächelt dabei aber.
Ich liebe diesen Spitznamen. Seit wir als Kinder den Geschichten meiner Großmutter über verlorene Welten, tapfere Ritter und geraubte Jungfrauen gelauscht haben, bin ich seine Prinzessin und er ist mein Prinz. Koseworte, ausgesucht von Kindern, die ihre wahre Bedeutung nie erfasst haben. Und jetzt, da wir sie begreifen, sind sie so fest in uns verankert, dass wir sie nicht mehr loslassen wollen.
»Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass du mal Erster warst«, necke ich ihn. »Das muss Jahre her sein.«
Er greift mit der Linken nach dem Ende meines geflochtenen Zopfes und zieht spielerisch daran. »Werd bloß nicht frech! Ich bin mir ziemlich sicher, dass es erst vor ein paar Wochen war, als ich dich zuletzt überholt habe.«
»Du solltest dich weniger auf dein Waffentraining konzentrieren«, sage ich. »Letztendlich wird dir deine Schnelligkeit das Leben retten, wenn du da draußen auf einen von denen triffst.«
Mit einem Stirnrunzeln schüttelt er den Kopf. »Es wird noch eine Weile dauern, bis sie mir erlauben, auf Streifzüge zu gehen. Bis dahin habe ich genug Zeit, um weiter mit dir zu üben. Aber es ist eine Verschwendung, dass sie dir nicht erlauben, ebenfalls eine Waffe zu führen.«
Ich schlage die Augen nieder. Das ist ein Thema, mit dem ich schon fast mein ganzes Leben hadere. Ich bin schneller und wendiger als die Jungen in meinem Alter und auch im Nahkampf könnte ich die meisten von ihnen mühelos besiegen. Trotzdem werde ich nie eine Rüstung oder Waffe bekommen, werde nie den roten Mantel anlegen dürfen, um die Stadt und unsere Siedlung vor den Stadtmauern verteidigen zu dürfen.
»Du weißt, warum ich nicht kämpfen darf«, sage ich, ohne aufzublicken. »Ich bin ein Mädchen.«
Tristan schweigt einige Herzschläge lang, bevor er murmelt: »Ja, das ist nicht zu übersehen.«
Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn falsch verstanden habe, und schaue nach oben. Sein Blick hat einen seltsamen Ausdruck angenommen, der ein wohliges Kribbeln meinen Rücken hinunterschickt.
Tristan ist ein Jahr älter als ich, aber ich kenne ihn schon, seit ich denken kann. Da mein älterer Bruder gestorben ist, als ich noch klein war, bin ich als Dreikäsehoch immer Tristan hinterhergetapst, und weil er selbst keine Geschwister hat, nahm er mich unter seine Fittiche. Man sah uns nur gemeinsam – Tristan und Scarlet. Wo der eine war, konnte der andere nicht weit sein. Wir wuchsen zusammen auf, heckten gemeinsam Streiche aus und lernten zur selben Zeit die Gebräuche unseres Volkes kennen. Er war mein Bruder und ich war seine Schwester.
Zumindest war das bis vor Kurzem noch der Fall.
Wenn ich ihn heute anschaue, sehe ich so vieles, was mir eigentlich vertraut sein sollte, aber gleichzeitig neu ist. Die Farbe seiner Augen zum Beispiel: ein helles Violett, das mich an blühenden Flieder erinnert. Vor einem Jahr wäre ich nie auf solche Vergleiche gekommen, doch jetzt ertappe ich mich immer häufiger dabei, wie ich alltägliche Dinge sehe und an Tristan denken muss.
Als ich gestern in der Hütte meiner Großmutter, der Ältesten unseres Clans, war, habe ich sie dabei beobachtet, wie sie etwas mit einem ihrer seltenen Kohlestifte auf ein Pergament geschrieben hat. Die Zeichen, die der Stift auf dem Untergrund malte, ließen mich hingegen an meine Haarfarbe denken: Auf den ersten Blick erscheinen sie schwarz, doch wenn die Sonne daraufscheint, erkennt man dunkelbraune Strähnen.
Heute Morgen, als ich in den Himmel schaute, erinnerte mich die Farbe der Wolken, die gerade von der aufgehenden Sonne berührt wurden, an das goldene Schimmern von Tristans Haaren.
Jetzt hängen ihm einzelne feuchte Strähnen bis in die Augen und meine Fingerspitzen kribbeln vor Verlangen, sie ihm aus der Stirn zu streichen. Auch dieses Gefühl ist völlig neu. Tristan ist mir so nah, dass ich seinen unregelmäßigen, aber warmen Atem auf dem Gesicht spüren kann. Sein vertrauter Geruch nach Leder und Holz wird von Schweiß und etwas anderem, was ich nicht zuordnen kann, überdeckt. Ich atme tief ein und wünsche mir, dass er immer so riechen würde.
»Wir sollten zurückgehen«, sage ich, um mich selbst von dem Chaos in meinem Inneren abzulenken. »Sie haben mittlerweile bestimmt bemerkt, dass wir verschwunden sind.«
Statt meiner Aufforderung nachzukommen, stemmt Tristan die andere Hand ebenfalls gegen den Baumstamm. Ich bin zwischen seinen Armen gefangen. Mit wild klopfendem Herzen schaue ich wieder zu ihm auf und das Funkeln in seinen Augen lässt mich nach Luft schnappen.
»Der Clan weiß, wo wir sind«, sagt er. Seine Stimme klingt kratzig und ungewohnt, aber es gefällt mir. Keine Ahnung, wieso. »Scarlet, ich muss etwas mit dir besprechen.«
Mir wird ganz mulmig zumute, doch ich nicke, trotz des warnenden Kribbelns in meinem Bauch.
»Ich habe nur keine Ahnung, wie ich es sagen soll«, murmelt er und stößt den Atem aus.
Ohne mich auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen, bewegt er sich mit dem Oberkörper auf mich zu und lehnt die Stirn gegen meine. Ich bin so überrascht darüber, dass ich vergesse zu atmen. Sein Blick hält meinen gefangen, während seine Nasenspitze an meiner entlangstreicht.
»Sag mir, dass ich aufhören soll«, wispert er so nah an meinen Lippen, dass ich glaube, die Bewegung seines Mundes spüren zu können. »Sag mir, dass das eine blöde Idee ist.«
»Es ist eine blöde Idee, Prinz«, antworte ich ebenso leise. Er zögert, will sich wieder zurückziehen, doch ich erwidere schnell: »Das heißt aber nicht, dass du aufhören sollst.«
Er löst eine Hand vom Baumstamm und legt sie an meine Wange. Seine Handfläche ist warm und die Berührung lässt einen wohligen Schauer durch meinen Körper rauschen.
»Wann hast du aufgehört, meine kleine Prinzessin zu sein?«, fragt er, bevor er mit den Lippen über meine streift. Zögerlich, unsicher, fragend. Und doch stark genug, um die Haut, die er berührt hat, kribbeln zu lassen.
Ich will ihm antworten, dass ich mich nicht verändert habe. Dass ich noch immer die Scarlet bin, die er schon sein Leben lang kennt. Aber kein Wort kommt aus meinem Mund. Viel zu gespannt warte ich darauf, seine Lippen erneut zu spüren.
Ein Rascheln im Gebüsch neben uns lässt uns jedoch auseinanderschrecken. Schnell mache ich einen Schritt zur Seite, um eine Armlänge Abstand zwischen uns zu bringen, wie es von den Gesetzen unseres Clans gefordert wird.
Es ist Cedric, ein Junge in Tristans Alter, der plötzlich vor uns steht. Mein Herz schlägt bis zum Hals, als er uns mit hochgezogenen Augenbrauen mustert. Es macht mir Angst. Wie viel hat er gesehen? Kurz schiele ich zur Seite, wo Tristan scheinbar ungerührt mit verschränkten Armen an den Baumstamm gelehnt steht und Cedrics Blick mit einer Mischung aus Geringschätzung und Missmut begegnet.
»Ich habe mir gedacht, dass ich dich hier finde, Tristan«, sagt Cedric, bevor er wieder zu mir schaut. »Spielst wohl wieder mit den kleinen Mädchen, was?«
Ich schlucke den Ärger über seine Bemerkung hinunter und senke den Blick, wie es von mir erwartet wird. Obwohl ich gegen den pummeligen Cedric während der Trainingseinheiten immer gewonnen habe, gibt es nichts, was ich ihm jetzt entgegensetzen dürfte. Dass ich überhaupt mit ihnen trainieren und zumindest das Grundtraining absolvieren darf, grenzt an ein Wunder und ist nur meiner Großmutter zu verdanken, die nach dem Tod meines Bruders darauf bestanden hat, dass ein Nachkomme aus ihrer Blutlinie im Kampf gegen die Gefahren dieser Welt unterwiesen wird. Ich gehöre zu den Besten. Das bedeutet aber nicht, dass mir die Gleichaltrigen mit Respekt begegnen. Eher ist das Gegenteil der Fall.
Trotz meines Könnens darf ich nur am Verteidigungs- und Ausdauertraining teilnehmen. Es ist mir unter Strafe verboten, eine größere Waffe als einen Dolch in die Hand zu nehmen, obwohl ich mir sicher bin, dass ich besser damit umgehen könnte als die meisten Gleichaltrigen.
Cedric ist seit jeher ein Idiot, sein Spott trifft mich dennoch. Ich bin kein kleines Mädchen, sondern eine junge Frau, wie mir jeden Tag mehr und mehr bewusst wird. Ich versuche die Veränderungen zu verstecken und die neuen Gedanken, die mir vor allem in Tristans Gegenwart in den Sinn kommen, zu verdrängen, aber es gelingt mir nicht immer.
»Wir haben trainiert, Cedric«, stellt Tristan in einem Tonfall klar, der keinen Widerspruch duldet. »Etwas, worauf du dich auch öfter konzentrieren solltest, wenn du nicht während deines ersten Einsatzes krepieren willst.«
Cedric verzieht angewidert den Mund, wagt aber nicht zu widersprechen. Wahrscheinlich, weil Tristan der Sohn unseres neuen Häuptlings und dessen Nachfolger ist, und Cedric war immer schon darum bemüht, sich möglichst viele Vorteile zu sichern. Eine Unart, die er sich von seinem Vater abgeschaut haben muss.
»Ich verstehe einfach nicht, warum du deine Zeit mit ihr verschwendest.« Mit der Hand macht er eine abwertende Geste in meine Richtung. »In zwei Jahren ist sie eh verschwunden.«
Tristans rechte Hand, die auf seinem Arm liegt, ballt sich zur Faust. »Das hat dich nicht zu interessieren. Warum bist du überhaupt hier?«
»Dein Vater schickt mich«, antwortet Cedric. »Er will, dass du sofort zu ihm kommst.«
Einen Moment lang zögert Tristan und wirft mir einen kurzen Blick zu. Dann stößt er sich vom Baumstamm ab und gibt Cedric mit einem Kopfnicken zu verstehen, dass er vorausgehen soll.
Ich bleibe, wo ich bin, schaue Cedric hinterher, als er im Unterholz verschwindet, und stelle mir vor, wie ich ihm den Dolch, den ich an der Hüfte trage, hinterherwerfe. Der Kerl ist ein aufgeblasener Wichtigtuer, der heiße Luft versprüht, wenn er nur den Mund aufmacht. Niemand würde ihn vermissen, da bin ich mir sicher. Und nachdem er uns unterbrochen hat, spüre ich den unbändigen Drang, ihn dafür büßen zu lassen.
Ehe ich mein Vorhaben in die Tat umsetzen kann, streift Tristan meine Hand im Vorbeigehen mit den Fingern und schenkt mir ein kleines Lächeln. Augenblicklich verpufft meine Wut und ich lächle zurück.
Ich lasse ihm und Cedric ein wenig Vorsprung, bevor ich mich auch auf den Rückweg zur Siedlung mache. Bei jedem Schritt meine ich Tristans Lippen auf meinen spüren zu können – und das hebt meine Laune merklich. Ob er mich noch einmal geküsst hätte, wenn Cedric nicht aufgetaucht wäre?
Gleichzeitig beschwingt und verwirrt laufe ich durch das Tor und nicke den beiden Wachen zu. Der Wall aus hölzernen, etwa drei Meter hohen Palisaden, der unsere komplette Siedlung umgibt, ist unsere einzige Schutzvorrichtung vor den Gefahren, die draußen im Wald auf uns lauern. Doch bis hierher trauen sie sich so gut wie nie. Die Siedlung unseres Clans liegt zu nah an einer der letzten befestigten Städte und wird dementsprechend gut bewacht. Niemand kommt ungesehen an uns vorbei.
Wir sind eines der letzten Bollwerke im Kampf gegen die Bedrohung, die jenseits unserer Grenzen in den dichten Wäldern lauert.
Seit über einhundert Jahren machen wir unsere Sache gut und beschützen die Bewohner der Stadt. Man erzählt sich, dass es außer unserer nur noch zwei weitere befestigte Städte da draußen geben soll, in denen Menschen leben und der Gefahr trotzen. Als mein Vater noch der Clan-Führer war, erhielt er in unregelmäßigen Abständen Briefe aus weit entfernten Orten und machte sich einmal im Jahr zu einem Treffen mit anderen Clan-Führern auf.
Ich hingegen war nie weiter als eine Stunde von unserer Siedlung entfernt und kenne die Welt hinter den dichten Wäldern, die unser Dorf umgeben, nur aus den Märchen meiner Großmutter.
Ich schlendere über die ausgetretenen Wege und lasse den Blick zu den niedrigen Hütten schweifen, die unser Zuhause sind. Es ist ruhig, wie immer, und ich begegne kaum einer Menschenseele auf meinem Weg durchs Dorf. Die Wächter sind draußen und patrouillieren an unseren Grenzen. Andere Frauen oder gar Kinder gibt es nicht. Neben Großmutter bin ich das einzige weibliche Wesen, das hier lebt.
Unsere Hütte steht im hinteren Bereich der Siedlung, nah an den Palisaden. Dunkler Rauch steigt aus dem Schornstein auf. Seufzend öffne ich die Holztür, die mit einem lauten Knarren aufschwingt, und wappne mich gegen den beißenden Geruch, den Großmutters Tinkturen versprühen und der mir in den Augen brennt.
»Ach, da bist du ja endlich«, begrüßt sie mich murrend, ohne von dem Kessel aufzublicken, in dem eine undefinierbare Brühe köchelt. Hoffentlich ist das nicht unser heutiges Abendessen. An ihrer gebeugten Gestalt sind die Lebensjahre nicht spurlos vorübergegangen, dennoch liegt in ihrer Haltung und der Erscheinung eine Würde, die nahezu jeden im Dorf vor Ehrfurcht den Blick senken lässt. »Ich dachte schon, du willst deine heutige Lektion schwänzen.«
»Nie im Leben«, sage ich schnell, auch wenn es eine Lüge ist.
Ich würde fast alles dafür tun, um nicht Großmutters sterbenslangweiligen Vorträgen über heimische Pflanzen und deren Heilwirkung lauschen zu müssen. Doch das ist mein Schicksal, wenn ich hier in der Siedlung bleiben will. Ansonsten blüht mir das, was Cedric vorhin angesprochen hat: Ich muss weg, in die Stadt, um einem noch schlimmeren Schicksal ins Auge zu sehen.
»Bring mir ein paar Blätter des Nachtkrauts«, weist Großmutter mich an und deutet mit dem knorrigen Zeigefinger in Richtung ihrer Regale.
Ich gehorche und finde das gewünschte Kraut auf Anhieb. Seine dunkelblaue Farbe und die gezackten Blätter sind unverkennbar.
Als ich ihr die Blätter reiche, fragt sie: »Wofür wird Nachtkraut verwendet?«
»Es hilft, Fieber zu senken, wenn es nicht zu hoch ist, und kann bei ausreichender Dosierung einen Patienten in Schlaf versetzen, damit er die Behandlung oder seine Verletzungen nicht spüren muss«, leiere ich monoton herunter. »Außerdem stoppt es Blutungen und hilft, offene Wunden zu reinigen.«
»Aber?«, hakt Großmutter nach.
»Aber die Dosierung ist nicht einfach«, antworte ich gehorsam. »Wird es als Tinktur verabreicht, können ein paar Tropfen zu viel über Leben oder Tod entscheiden.«
»Wie kann es noch verabreicht werden?«
»Zerstoßen als Pulver, dann als Tee aufgebrüht. Oder mit Fett verrieben als eine Paste, die direkt auf die Verletzung aufgetragen werden kann.«
»Sehr gut«, murmelt sie und nimmt die Blätter entgegen, um sie in den Kessel zu werfen. »Wo hast du dich wieder herumgetrieben?«
Ich verdrehe hinter ihrem Rücken die Augen. »Ich treibe mich nirgends herum«, murre ich. »Ich war am Waldrand und habe mit Tristan trainiert.«
Großmutter schnalzt mit der Zunge, ehe sie den Kopf schüttelt. »Hast du dir den Jungen noch immer nicht aus dem Kopf geschlagen? Du bist nicht mehr die Tochter des Clan-Führers. Dein Vater ist tot, ebenso wie dein älterer Bruder. Die Göttin möge ihren Seelen gnädig sein. Du hast keinen Sonderstatus mehr in diesem Dorf.«
»Ich weiß«, presse ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
»Du kannst ihn nicht haben, das weißt du hoffentlich auch«, fährt sie unerbittlich fort. »Du kennst die Wahl, die du hast.«
Ich wende mich ab und gebe mir die größte Mühe, meinen Ärger hinunterzuschlucken, doch es will mir nicht gelingen. Dieses Gespräch führen wir nicht zum ersten Mal. Seit sie mitbekommen hat, dass ich mehr für Tristan empfinde, als ich sollte, liegt sie mir damit in den Ohren. Keiner weiß von meinen Gefühlen für ihn; bis vorhin wusste er es nicht einmal selbst. Wie es Großmutter herausbekommen hat, ist mir ein Rätsel. Sie schaute mir eines Tages, nachdem ich wieder vom Training mit Tristan zurückkam, prüfend ins Gesicht, während sich ihre Augen zu Schlitzen verengten, und sagte, ich solle noch nicht mal daran denken, mehr für ihn zu empfinden als für einen Freund aus Kindheitstagen. Ansonsten würde es mir nur das Herz brechen, denn Tristan ist der Sohn unseres Clan-Führers – und damit unerreichbar für mich. Ich stamme zwar aus dem Dorf, aber ein Nachfolger wird nie mit einem einfachen Mädchen wie mir verheiratet werden. Ich solle mir ihn sofort aus dem Kopf schlagen und ja nicht auf die Idee kommen, meinen Gedanken Taten folgen zu lassen. Was auch immer sie damit meinte. Damals tat ich ihre Worte als übertriebene Fürsorge ab, schließlich war ich mir sicher, dass sich Tristan nicht für mich interessieren würde und in mir nicht mehr sah als seine kleine Schwester.
Der heutige Tag allerdings belehrte mich eines Besseren.
Großmutter hat recht: Ich kenne die Wahl, die ich habe. Und Tristan kommt darin nicht vor.
Ich kann entweder so werden wie sie – eine Unberührbare, die Schamanin unseres Clans, die Heilerin und Seherin, die von jedem geachtet, aber auch gemieden wird, und der es verboten ist, einen Mann oder gar eine eigene Familie zu haben.
Oder ich teile das Schicksal aller anderen Frauen und lebe in der Stadt, wo ich in regelmäßigen Abständen ein Kind nach dem anderen gebären muss, damit die Menschheit überlebt.
Ja, meine Aussichten sind alles andere als rosig und in keiner von ihnen kommt auch nur der Hauch von Liebe oder Romantik vor, von denen ich in den unzähligen Geschichten und Märchen gehört habe.
Ich wende mich wieder zu der alten Frau am Kessel um. Sie ist nicht meine richtige Großmutter, auch wenn wir blutsverwandt sind. Sie ist die Tante meines Vaters und wurde schon von klein auf auf ihr Leben als Unberührbare vorbereitet. Ich habe noch nie gehört, dass sie sich über ihr Schicksal beklagt hätte, aber andererseits macht sie auch keinen glücklichen Eindruck auf mich.
»Es gibt noch einen weiteren Weg für mich«, sage ich, während ich die Hände zu Fäusten balle. »Du hast darauf bestanden, dass einer aus der Blutlinie als Wächter ausgebildet wird. Ich kann kämpfen! Ich bin besser als die Jungen in meinem Alter. Ich kann …«
Großmutter fängt an zu lachen. »Du kannst keine Wächterin werden, Scarlet. Es gibt keine weiblichen Wächter.«
»Aber warum?«, frage ich. »Ich würde da draußen länger überleben und mehr von denen töten als Cedric oder Mortimer. Ich könnte …«
»Und was dann?«, unterbricht sie mich. »Glaubst du wirklich, dass unsere Wächter eine Frau in ihrer Mitte willkommen heißen würden? Es ist unerheblich, für wie gut du dich hältst. Sei lieber froh, dass ich dich vor die Wahl stelle, meine Nachfolgerin zu werden. Andere Mädchen würden für diese Option töten.«
»Ich will aber keine Unberührbare werden«, zische ich.
Großmutter zuckt ungerührt mit den Schultern. »Dann gehst du eben in die Stadt, sobald du achtzehn wirst, und verlässt sie für den Rest deines Lebens nicht mehr.«
Ich kenne die Geschichten, die man sich über die Städte erzählt … Zwar war ich selbst noch nie dort, aber es soll kein Ort sein, an dem man für den Rest seines Lebens bleiben möchte. Ich habe die Männer des Dorfes belauscht, die regelmäßig in der Stadt ihre Frauen und Töchter besuchen oder dort auf Brautschau sind. Sie sprachen von Gebäuden, so hoch wie Bäume, von befestigten Straßen und Lichtern, die nicht aus Feuer bestehen, aber trotzdem die ganze Nacht brennen. Die letzten Städte sind eine Zuflucht, ein unüberwindbarer Schutz vor den Gefahren, die nachts in den Wäldern lauern, aber kein Mädchen und keine Frau betritt die Stadt und kommt von dort zurück.
Bis auf Großmutter. Sie besucht die Stadt regelmäßig, um die Bewohner medizinisch zu versorgen. Es gibt zwar auch in den Städten Heiler und Unberührbare, dennoch genießt Großmutter einen gewissen Ruf, vor allem unter den Frauen der Männer unseres Clans. Sie bezahlen viel dafür, dass Großmutter nach ihnen sieht. Um was es sich bei ihren Krankheiten handelt, weiß ich jedoch nicht.
Und ich will es auch nicht herausfinden … Das Leben in der Stadt ist nichts, was ich mir für mich vorstellen kann. Eingesperrt hinter Mauern …
»Warum hast du mich ausbilden lassen?«, frage ich so ruhig wie möglich. »Du hast darauf bestanden, dass ich am Wächter-Training teilnehmen darf, was sonst nur den männlichen Nachkommen vorbehalten ist.«
»Es war nicht einfach, diese verbohrten Knacker davon zu überzeugen«, murmelt Großmutter. »Damals dachte ich, dass der Respekt, den sie deinem Vater entgegengebracht haben, stark genug gewesen wäre, um dich zu verschonen.«
»Verschonen?«, wiederhole ich. »Verschonen wovor?«
Der Blick aus ihren durchdringenden blauen Augen schweift an meinem Körper entlang. »Du wirst sie nicht ewig täuschen können. Die weite Kleidung, die du trägst, und die Leinenstreifen, die du dir jeden Morgen um die Brust schnürst, werden nicht mehr lange verbergen können, dass dein Körper sich verändert.«
Das Gespräch mit Tristan kommt mir in den Sinn. Er sagte, es sei nicht zu übersehen, dass ich eine junge Frau sei, und sah mich dabei so seltsam an.
»Frauen gehören in die Städte, das weißt du«, reißt Großmutter mich barsch aus meinen Gedanken.
»Aber es gibt Siedlungen, in denen auch Frauen leben«, halte ich dagegen.
»Ja, weil sie zu weit von der Stadt entfernt liegen und die Männer nicht mehr regelmäßigen …« Sie verstummt abrupt und murmelt etwas, was ich nicht verstehen kann. »Wie dem auch sei, das gilt nicht für unsere Siedlung. Unsere Frauen müssen in die Stadt. Und das betrifft auch dich, jetzt, da dein Vater nicht mehr der Clan-Führer ist. Wäre er noch am Leben, wärst du an einen anderen Clan-Führer verheiratet worden und dem Schicksal, das nun auf dich wartet, vielleicht entgangen.« Sie zuckt mit den Schultern. »Wobei es im Grunde ein und dasselbe ist. Ob du nun in der Stadt oder dem Dorf eines anderen Clans eingesperrt wärst, macht keinen Unterschied.«
»Hast du deshalb durchgesetzt, dass ich am Training teilnehmen darf?«, frage ich. »Was ist so schlimm an den Städten? Ich kenne nur Gerüchte, aber nichts Genaues.«
Erneut huscht ihr Blick zu mir und ihre Augen glänzen kalt. »Die Stadt an sich ist nicht schlimm, sondern das Leben, das du dort führen müsstest. Ich werde dich morgen mit nach Daarth … in die Stadt nehmen. Lobrida, Cedrics Mutter, hat nach mir verlangt.«
»Was will sie von dir?«
»Das, was sie alle wollen: meine Hilfe.«
»Ist sie krank?«
Großmutter schüttelt den Kopf. »Nein, aber ohne meine Hilfe könnte sie sterben. Die Heiler in Daarth sind kopflose Narren, die die Leiden der Frauen nicht richtig kurieren können. Und die Unberührbaren, die dort leben, sind so überlastet, dass sie nicht alle behandeln können.« Sie wendet sich wieder dem Kessel zu und rührt weiter darin herum. »Wir brechen morgen sehr früh auf. Du solltest zeitig zu Bett gehen.«
Ich wage nicht zu widersprechen. Einerseits graut es mir davor, in die Stadt zu gehen, doch andererseits will ich wissen, was dort vor sich geht. Woher stammen die Gerüchte? Und warum kommen die Frauen, die da leben, nie zurück?
Ich murmele: »Gute Nacht«, und steige die Leiter nach oben in den ersten Stock, in dem sich mein Zimmer befindet.
KAPITEL 2
Unruhig wälze ich mich in meinem Bett aus Stroh hin und her, finde aber keinen Schlaf. Das Gespräch mit Großmutter hat mir Grund zum Nachdenken gegeben. Vieles, was ich nicht weiß und mir auch nicht zusammenreimen kann, und vieles, wovon ich lieber nichts wüsste. Dennoch freue ich mich ein Stück weit darauf, mit ihr morgen in die Stadt zu reisen. Ich war noch nie weiter als zweihundert Meter von unserer Siedlung entfernt und ich bin schon ganz gespannt, was mich alles erwarten wird.
Aber ich habe auch Angst.
Was, wenn sie mich gleich in der Stadt lässt, nachdem ich ihr unumwunden gesagt habe, dass ich keine Unberührbare werden will? Wird sie sich ein anderes Mädchen suchen, das ihre Nachfolge antreten wird? Werde ich einfach ersetzt werden?
Ein Geräusch von draußen lässt mich zusammenzucken. Geduckt schleiche ich zu meinem Fenster und spähe hinunter. Mein Herz macht einen Satz, als ich Tristan dort unten im fahlen Mondlicht erkennen kann. Er wirft kleine Steinchen gegen die Hauswand neben dem Fenster, wartet dann ein paar Sekunden, ehe er die Prozedur wiederholt.
Nachdem wieder ein Steinchen mit einem »Plopp!« gegen die Hauswand geknallt ist, strecke ich schnell den Kopf nach draußen.
»Was ist los?«, frage ich flüsternd.
Tristan war nach Einbruch der Dunkelheit noch nie hier. Wir sehen uns tagsüber, aber sobald die ausgebildeten Wächter nachts zu ihren Missionen aufbrechen, verlässt kein anderer Dorfbewohner seine Hütte. Es gleicht einem ohnmächtigen Luftanhalten, während jeder darauf hofft, dass alle gesund und in einem Stück zurückkehren. Deshalb bin ich verwundert darüber, plötzlich Tristan dort unten stehen zu sehen.
»Können wir reden?«, wispert er zurück.
Ich blinzele ein paarmal. »Jetzt?!«
Er zuckt mit den Schultern. »Ja, jetzt.«
Ich zögere, nicke ihm dann aber zu und husche zurück in mein Zimmer. Im Laufen streife ich mir das weiße Nachthemd über den Kopf und schlüpfe in meine lederne Hose und die weite Tunika. Meine Haare fasse ich zu einem unordentlichen Zopf zusammen, während ich so leise wie möglich die Leiter nach unten steige. Ich meide die Dielen, von denen ich weiß, dass sie knarren, und werfe immer wieder einen Blick über die Schulter in den hinteren Bereich des Erdgeschosses, in dem Großmutter schläft. Sie liegt mit dem Rücken zu mir, trotzdem habe ich das Gefühl, als würde sie mich beobachten.
Die Asche im Kamin glimmt noch immer und verbreitet eine trockene Wärme, die zusammen mit dem allgegenwärtigen Geruch nach Kräutern und Gebräuen sofort in meinem Hals kratzt. So schnell wie möglich schleiche ich zur Tür und drücke die Klinke nach unten. Die Tür öffne ich nur einen Spaltbreit, da sie ab der Hälfte quietscht, und schiebe mich nach draußen in die kühle Nacht.
Erst als ich sie leise hinter mir geschlossen habe, erlaube ich mir tief durchzuatmen. Das Kratzen in meinem Hals, das mich beinahe husten ließ, verschwindet nach wenigen Sekunden.
Als ich Tristans Hand auf meiner Schulter spüre, drehe ich mich zu ihm um. Er steht verborgen im Schatten unserer Hütte und mustert mich mit zusammengezogenen Augenbrauen. Sein Blick gleitet an mir hinab und verweilt einen Moment zu lange auf meinen Brüsten. Siedend heiß fällt mir ein, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, sie zu bandagieren. Schnell verschränke ich die Arme davor. Seine Blicke machen mich nervös, auch wenn sie nicht unangenehm sind.
»Du wolltest reden?«, flüstere ich und sichere mir dadurch seine Aufmerksamkeit.
Tristan macht einen Schritt nach hinten, tiefer in den Schatten hinein, und winkt mich zu sich. Ohne zu zögern, folge ich ihm.
»Warum verstecken wir uns?«, frage ich, mehr aus Neugier denn Sorge.
»Um diese Zeit sollte ich nicht bei dir sein«, gibt er mit einem schiefen Grinsen zu. »Das würden die anderen, allen voran mein Vater, nicht gutheißen.«
Ich schnaube und schüttele den Kopf. Boldur, Tristans Vater, hat die Führung unseres Clans nach dem Tod meines Vaters übernommen. Vielleicht bin ich voreingenommen, aber er macht seine Sache nicht halb so gut wie mein Vater. Boldur mag zwar ein ausgezeichneter Wächter sein, aber er ist kein Anführer. Seine Meinung ändert er sprunghaft und seine Entscheidungen scheinen oft willkürlich getroffen zu sein. Wann immer ich ihm zufällig begegne, ziehe ich den Kopf zwischen die Schultern und bete, dass er mich nicht bemerkt.
Als wäre er plötzlich verlegen, reibt sich Tristan mit der Hand über den Nacken und weicht meinem Blick aus. »Eigentlich wollte ich mich nur für heute im Wald entschuldigen.«
»Entschuldigen?«, wiederhole ich, weil ich hoffe, mich verhört zu haben. Meine Stimme zittert und klingt seltsam hoch.
»Ja, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist.«
Noch immer glaube ich, etwas mit den Ohren zu haben, und ich schaffe es nicht, meinen offen stehenden Mund zu schließen, geschweige denn etwas darauf zu entgegnen. Es gibt nichts, wofür er sich entschuldigen müsste. Das ist doch lächerlich! Hat er nicht bemerkt, dass ich seinen Kuss erwidert habe, bis uns dieser Blödmann Cedric unterbrochen hat?
Tristan nun davon sprechen zu hören, dass er sich dafür entschuldigt und vielleicht auch schämt, verursacht einen dumpfen Schmerz in meiner Brust, den ich noch nie zuvor verspürt habe. Er unterscheidet sich völlig von den Schmerzen, die ich durch Prellungen beim Training davontrage oder wenn ich mich an den scharfkantigen Blättern eines Heilkrauts schneide, und ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll.
»Jedenfalls wird es nicht wieder vorkommen«, murmelt Tristan, nachdem ich noch immer keinen Laut von mir gegeben habe.
»Was?«, krächze ich und erkenne meine eigene Stimme nun gar nicht mehr wieder.
Tristan mustert weiterhin das Gras unter seinen Füßen, als wäre es das Spannendste auf der Welt. »Du bist meine Prinzessin«, antwortet er. »Meine kleine Schwester. Ich hätte nicht …«
Stolpernd mache ich einen Schritt auf ihn zu, lege die Hände um sein Gesicht und ziehe seinen Kopf zu mir herunter. Seinen verdutzten Ausdruck und die weit aufgerissenen Augen ignoriere ich und streife seine Lippen mit meinen. Sie sind warm und weich, genau wie heute im Wald.
»Du bist mein Prinz, Tristan«, wispere ich. »Das heißt aber nicht, dass ich dich als meinen Bruder sehen muss. Denn das bist du nicht.«
Zögerlich hebt er die Arme und für einen Moment befürchte ich, dass er mich von sich stoßen wird. Stattdessen schlingt er sie um mich und zieht mich so nah an sich heran, dass kein Lufthauch mehr zwischen uns hindurchpassen würde. Das Gefühl seines harten, durch das Training gestählten Körpers an meinem weckt völlig neue Empfindungen in mir, die über mich hereinbrechen und mein Denkvermögen ausschalten. Ich beginne zu zittern und meine Knie werden weich, ohne dass ich weiß warum, daher bin ich dankbar für den zusätzlichen Halt, den mir seine Arme gewähren. Das Kribbeln im Bauch lässt meinen Atem stoßweise gehen, während mein Herz in einem zu schnellen Takt gegen den Brustkorb hämmert.
Er küsst mich erneut, nicht so sanft wie zuvor, sondern fester und fordernder, und ich stöhne auf. Erschrocken über diesen Laut, der mir noch nie über die Lippen gekommen ist, will ich zurückweichen, doch Tristan legt schnell eine Hand an meinen Hinterkopf, um mich daran zu hindern.
Ich weiß nicht, wie lange wir uns verborgen im Schatten küssen. Es mag eine Ewigkeit sein, aber genauso gut auch nur die Dauer eines flüchtigen Augenblicks. Irgendwann lösen wir uns schwer atmend voneinander und schauen uns tief in die Augen, als könnten wir beim anderen die Antworten finden, nach denen wir so dringend suchen. Antworten darauf, wohin das mit uns führen soll – was auch immer das ist – oder warum wir uns verstecken müssen. Und ob wir das in absehbarer Zeit wiederholen können.
»Mein Vater sagt, dass ich in dir nie mehr als die kleine Schwester sehen darf«, murmelt Tristan, während er die Stirn gegen meine lehnt. »Dass du nichts weiter bist als ein Mädchen, das bald verschwunden sein wird.«
Sein Geständnis lässt ein schales Gefühl in meiner Brust aufflammen. »Großmutter meint, dass ich mir dich aus dem Kopf schlagen soll«, antworte ich leise. »Dass ich dich sowieso nicht haben kann, egal wie sehr ich es mir wünsche.«
»Ist es nicht furchtbar, dass die beiden alten Menschen einfach über unsere Köpfe hinweg entscheiden, was das Beste für uns ist?«
Ich schmunzele. »Das dürfen wir nicht zulassen.«
Tristan seufzt bei meinen Worten. »Wenn ich könnte, würde ich mit dir von hier verschwinden«, sagt er und haucht mir einen Kuss auf die Nasenspitze. »Wenn die Welt, in der wir leben, sicher wäre, würde ich dich einfach entführen und mit dir bis ans Ende der Welt gehen, wo uns niemand kennt.«
»Das klingt mehr als verlockend.«
Die Vorstellung, einfach mit ihm von hier zu verschwinden, hat durchaus ihren Reiz für mich. Weg von den Verpflichtungen, weg von der Last meiner ungewissen Zukunft, weg von Großmutter, die in mir nichts lieber sieht als ihre Nachfolgerin.
Doch ich weiß, dass wir nicht gehen können. Tristan ist der einzige Sohn des Clan-Führers und sein zukünftiger Nachfolger. Er wird seine Familie nicht einfach hinter sich lassen können. Ich hingegen habe außer Großmutter keine nahen Verwandten mehr, die mich vermissen würden. Seit dem Tod meines Vaters fühle ich mich in unserer Siedlung wie eine Ausgestoßene. Ich werde geduldet, aber mir entgehen nicht das Getuschel und die Blicke, die mir unweigerlich folgen, sobald ich unsere Hütte verlasse. Ich weiß, dass unsere Trainer mich besonders hart rannehmen, um mich dazu zu bringen, dass ich freiwillig das Wächter-Training aufgebe. Sie sind an das Versprechen, das Großmutter ihnen abgepresst hat, gebunden und können erst aufhören mich zu unterrichten, wenn ich es bin, die es von sich aus abbricht.
Bis auf Tristan gibt es nichts, was mich in dieser vermaledeiten Siedlung hält. Wenn es nach mir ginge, würde ich lieber heute als morgen verschwinden. Aber Tristan hat noch etwas angesprochen, was eine Flucht unmöglich macht: Unsere Welt ist nicht sicher. Wir könnten da draußen keine drei Nächte überleben, ohne von den Wesen, die in den Wäldern lauern, getötet zu werden. Kein anderer Clan nähme uns auf, denn sie sind fremden Menschen gegenüber nicht gerade gastfreundlich – und auch in der Stadt wären wir vielleicht nicht willkommen. Wir kennen dort niemanden. Wir wüssten gar nicht, wohin wir uns wenden sollten. Bis zu einer der weit entfernten Städte, in der man nichts von uns wüsste, könnten wir uns unmöglich durchschlagen.
»Ich hatte Angst davor, heute Nacht hierherzukommen«, sagt Tristan nach einer Weile, während er mir weiterhin über den Rücken streicht.
»Warum?«
Er zuckt hilflos mit den Schultern. »Nach dem, was heute im Wald geschehen ist, wusste ich nicht, was ich tun soll. Und es gab noch immer die Möglichkeit, dass du deine Meinung geändert haben könntest. Dass ich dich überrumpelt habe und du nicht …«
Schnell verschließe ich seinen Mund mit einem Kuss. »Du bist ein Dummkopf, Tristan«, murmele ich, nachdem ich mich wieder von ihm gelöst habe. »Deine Angst war völlig unbegründet.«
Er schließt mich fester in die Arme und flüstert an meinem Ohr: »Ich werde mir etwas einfallen lassen. Ich finde einen Weg, wie wir zusammen sein können.«
Ein wohliger Schauer rieselt bei seinen Worten meinen Rücken hinunter und ich schöpfe Hoffnung. Gibt es vielleicht doch noch einen anderen Weg für mich? Schließlich ist Tristan alles, was ich immer wollte, selbst bevor ich wusste, was ich überhaupt für ihn empfinde. Er war mein ganzes Leben lang an meiner Seite und eine wichtige Stütze, vor allem als mein Vater und mein Bruder starben und ich plötzlich meine vertraute Stellung im Dorf verlor.
Ein Leben ohne Tristan kann ich mir nicht vorstellen.
»Ich warte auf dich«, flüstere ich zurück. »Egal wie lange es dauern wird.«
Lächelnd umschließt er erneut mein Gesicht mit den Händen und küsst mich. Das sachte Flattern im Bauch breitet sich über meinen ganzen Körper aus und lässt mich nichts anderes als pures Glück spüren. Wie könnte ich auch nicht glücklich sein? Tristans Arme um meine Mitte, seine Lippen auf meinen, sein vertrauter Duft und das Wissen, dass ich es bin, die er will, ist alles, wonach ich mich je gesehnt habe.
»Können wir uns morgen Nacht wieder hier treffen?«, fragt er, nachdem er mich freigegeben hat.
»Ich weiß nicht«, murmele ich. Als ich seinen niedergeschlagenen Gesichtsausdruck sehe, sage ich schnell: »Großmutter nimmt mich morgen früh mit in die Stadt. Ich weiß nicht, wann wir zurück sein werden oder ob wir da über Nacht bleiben.«
Tristan nickt. »Ich verstehe. Mir wäre es lieber, wenn ihr dortbliebet. Der Weg zur Stadt ist weit und beschwerlich, vor allem, wenn ihr am selben Tag zurückreisen wollt.«
»Ich passe auf Großmutter auf«, verspreche ich. »Ich weiß, dass du an ihr hängst.«
Tristans Lippen verziehen sich zu einem schwachen Lächeln. »Sie war für mich wie eine Mutter, ebenso wie für dich. Natürlich hänge ich an ihr. Außerdem ist sie wichtig für den Clan. Die Lücke, die sie und das Wissen, über das sie verfügt, hinterlassen würden, wäre fatal.«
»Da spricht der zukünftige Anführer«, necke ich ihn. »Schon jetzt hast du nur das Wohl des Clans im Sinn.«
»Irgendwer muss sich um den Clan sorgen …«
Er dreht den Kopf weg, doch ich lege die Hand an seine Wange und zwinge ihn so, mich wieder anzusehen. »Du wirst ein besserer Clan-Führer als dein Vater werden.«
»Ich habe nicht darum gebeten, diese Bürde zu tragen«, sagt er niedergeschlagen.
»Ich weiß«, antworte ich. »Ich habe auch nicht darum gebeten, dass Vater und Kito sterben. Und dennoch sind sie tot.«
»Ein Gutes hat es jedoch«, murmelt er, während er eine Haarsträhne von mir um den Zeigefinger wickelt. »Als Tochter des amtierenden Clan-Führers wärst du an den Sohn eines anderen Anführers verheiratet worden. Wahrscheinlich wärst du schon gar nicht mehr hier in unserer Siedlung.«
Ich kenne diesen Brauch, auch wenn ich den Sinn dahinter nie verstanden habe. Mein Bruder Kito war bereits mit der Tochter des Anführers der Blauen verlobt, deren Siedlung etwa vier Tagesreisen von unserer entfernt liegt. Er hat sie nie zu Gesicht bekommen, wusste aber immer, dass dies seine Bestimmung war. Mein Bruder war anders als ich; er hätte sich nie gegen Vaters Willen oder unsere Bräuche aufgelehnt. Ich hingegen hätte mich mit Händen, Füßen und notfalls auch mit Waffen gegen jeden anderen Mann außer Tristan gewehrt. Der arme Tropf, der mich zur Frau hätte nehmen müssen, wäre nicht glücklich – und wahrscheinlich auch nicht alt – geworden.
»Du solltest wieder hineingehen«, sagt Tristan. »Schlaf dich aus. Du wirst deine Kraft für den Weg in die Stadt brauchen. Versprich mir, dass du deinen Dolch mitnehmen wirst.«
Ich nicke. Der Dolch mit dem verzierten Griff war Tristans Geschenk an mich, kurz nachdem ich meinen ersten Trainingstag mit den Wächter-Anwärtern hatte. Da unsere Trainer sich weigerten, mir eine Waffe in die Hand zu geben, hat mir Tristan einen seiner Dolche zugesteckt. Seitdem bewahre ich ihn wie einen Schatz auf und übe heimlich ihn zu führen. Sonderlich gut bin ich jedoch nicht. Zwar schaue ich den anderen bei ihrem Waffentraining zu, aber wenn ich ohne Hilfe versuche ihre Bewegungen auszuführen, kann ich mich oft nicht an die genaue Abfolge erinnern. Ich habe niemanden, der meinen Stand korrigiert oder mir sagt, in welchem Winkel ich auf mein imaginäres Opfer einstechen soll.
»Denkst du, wir werden einem von denen begegnen?«, frage ich.
»Einem Feral?« Zu meiner Erleichterung schüttelt Tristan den Kopf. »Sie sind nur nachts unterwegs, deshalb würde ich mich wohlerfühlen, wenn ihr erst übermorgen zurückkämt. Aber es gibt da draußen noch andere Raubtiere als die Ferals. Zwar keine so gefährlichen, aber du solltest sie dennoch nicht unterschätzen.«
»Das werde ich nicht«, verspreche ich.
Er zieht mich erneut an sich und haucht mir einen Kuss auf die Stirn. »Schlaf gut, Prinzessin. Spätestens übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin ist mir vielleicht schon etwas eingefallen.«
»Ich hoffe es«, sage ich lächelnd und löse mich widerstrebend von ihm.
Am liebsten hätte ich die restliche Nacht in seinen Armen verbracht, aber ich weiß, dass ich für die morgige Reise ausgeruht sein muss. Der Weg ist weit und ich habe noch keine Ahnung, was mich in der Stadt erwarten wird. Als ich in die Hütte gehe, werfe ich mehrmals einen Blick zurück. Tristan bleibt im Schatten stehen, bis ich verschwunden bin.
KAPITEL 3
Überwältigt von dem, was geschehen ist, bin ich so aufgedreht, dass an Schlaf kaum zu denken ist. Ich fühle ein seliges Lächeln auf meinem Gesicht und wälze ich mich auf meinem Lager herum, während ich das Gefühl von Tristans Lippen noch immer auf meinen spüren kann. Ich fasse es kaum, dass er das Gleiche für mich empfindet wie ich für ihn. Und dass er mich will. Es ist das größte Wunder für mich. Als Sohn des Clan-Führers hätte er die freie Wahl sowohl in der Stadt als auch in den anderen Siedlungen – und die Frauen und Mädchen würden um seine Aufmerksamkeit buhlen.
Für mich stellte sich diese Frage nie, selbst als mein Leben noch in geordneten Bahnen verlief. Ich wusste immer, dass Tristan der einzige Mann wäre, den ich an meiner Seite dulden könnte, auch als ich nicht mal eine Ahnung von Liebe hatte. Und ich bin mir sicher, dass er einen Weg finden wird, wie wir es schaffen, zusammen zu sein.
Irgendwann schlafe ich doch ein und schrecke nach gefühlten fünf Minuten wieder hoch, als Großmutter die Leiter nach oben steigt, die in mein Zimmer führt.
»Bist du immer noch nicht wach?«, poltert sie, während sie die Fensterläden aufreißt.
Als die Sonne direkt in mein Gesicht scheint, kneife ich schnell die Augen wieder zu.
»Es ist schon spät«, redet Großmutter weiter und reißt mir die Decke weg. »Zieh dir das gute Kleid und feste Stiefel an. Keine Bandagen heute! Komm dann nach unten, ich mache dir die Haare.«
»Warum?«, nuschele ich undeutlich, während ich mir mit einer Hand übers Gesicht reibe.
»Weil du bei deinem ersten Besuch in der Stadt nicht aussehen sollst wie eine Wilde«, ist ihre knappe Antwort, ehe sie wieder verschwindet.
Grummelnd lehne ich den Kopf nach hinten ins Kissen, bevor ich die Beine aus dem Bett schwinge. Als ob ich aussehen würde wie eine Wilde …! In der Truhe neben dem Bett krame ich nach dem Kleid, von dem Großmutter gesprochen hat. Ich finde es ganz unten vergraben unter Trainingskleidung und einfachen Klamotten.
Nur widerwillig ziehe ich das Kleid hervor. Das letzte Mal, als ich es getragen habe, war zu Vaters Beerdigung. Mein Blick gleitet über das eigentlich wunderschöne Stück, mit dem ich jedoch nur schreckliche Erinnerungen verbinde. Zum Großteil besteht das Kleid aus weichem, fast weißem Leder, das sich kühl in den Händen anfühlt. Wenn ich Glück habe, passt es mir gar nicht mehr.
Doch ich habe kein Glück. Die Schnürungen an den Seiten lassen sich so weit lockern, dass es zwar etwas über der Brust spannt, aber immer noch tragbar ist. Ich hatte es nur länger in Erinnerung … Der mit bunten Stickereien verzierte Saum reicht mir lediglich bis zur Mitte der Oberschenkel. Ohne weiter darüber nachzudenken, schlüpfe ich in eine der engen dunklen Trainingshosen, die ebenfalls aus Leder gefertigt ist, um die Beine zu bedecken und mich weniger nackt zu fühlen. Anschließend schnappe ich mir die fast schwarzen Stiefel, die mir beinahe bis zu den Knien reichen, und binde mir einen ebenso dunklen Gürtel um die Taille. Tristans Dolch ziehe ich unter der Strohmatratze hervor und verstecke ihn im rechten Stiefelschaft.
Als ich an mir hinabblicke, muss ich dem Drang, mir doch schnell die Bandagen umzulegen, widerstehen. Ich fühle mich unwohl in diesem Aufzug, obwohl mein Körper, bis auf die Unterarme, nahezu völlig bedeckt ist. Nachdem ich die letzten Jahre nur weite, bequeme Kleidung getragen habe, die jede Rundung meines Körpers verborgen hat, kommt mir diese Zurschaustellung falsch vor und am liebsten würde ich mir die Klamotten sofort vom Leib reißen.
»Bist du immer noch nicht fertig?«, schallt Großmutters Stimme aus dem Erdgeschoss zu mir herauf.
Seufzend steige ich die Leiter nach unten und versuche mich mit dem Gedanken, dass es nur für heute ist, zu beruhigen. Danach werde ich dieses Kleid verbrennen, egal was Großmutter davon halten wird. Tristan wird mich nicht dazu zwingen, so etwas zu tragen, wenn ich es nicht will. Irgendwie werde ich den heutigen und morgigen Tag schon hinter mich bringen. In der Stadt kennt mich niemand; dort sind mir die Blicke der anderen auch egal. Bleibt zu hoffen, dass um diese Zeit noch nicht viele Dorfbewohner unterwegs sind und ich niemand Wichtigem begegne, bis wir die Siedlung verlassen haben.
Großmutter erwartet mich bereits am Küchentisch und bedeutet mir, mich auf den Stuhl zu setzen. Sie lässt sich viel Zeit dabei, mein hüftlanges Haar, das fast dieselbe Farbe wie meine Stiefel hat, zu entwirren und zu kämmen. Zwischendurch schnalzt sie ein paarmal mit der Zunge, während sie mit einigen hartnäckigen Knoten kämpft. Anschließend flicht sie einzelne Strähnen an meinen Schläfen nach hinten, lässt den Rest aber offen.
Ich trage die Haare nie so, weil sie mich stören. Die kürzeren Strähnen hängen mir beim Training ins Gesicht, nehmen mir die Sicht oder kitzeln in der Nase.
Ich greife nach der Schleife, die auf dem Tisch vor mir liegt, um das Haar zumindest im Nacken zusammenzubinden, doch Großmutter schlägt meine Hand weg.
»Sie bleiben so, wie sie sind«, beschließt sie, ohne mich nach meiner Meinung zu fragen.
»Aber ich …«
»Nein! Sei froh, dass ich dir gestatte, die Hose anzubehalten.« Ihr Blick gleitet an meinen Beinen entlang. »In der Stadt werde ich dir ein neues Kleid kaufen. Die Schneider dort haben mehr Ahnung von Frauenkleidung als der alte Lambert hier im Dorf.«
»Ich brauche kein neues Kleid«, zische ich. »Ich würde es sowieso nicht tragen.«
»Ach nein?«, fragt Großmutter und zieht eine Augenbraue nach oben. »Was soll ich dir denn stattdessen kaufen? Einen Bogen vielleicht? Oder ein Schwert?«
Ich halte ihrem durchdringenden Blick stand, auch wenn es mich meine gesamte Willensstärke kostet, antworte aber nicht auf ihre Frage. Ich starre sie an, kämpfe mit ihr auf einer Ebene, die keiner Worte bedarf. Sie weiß, wie ich bin und was ich will. Und so, wie ich gerade aussehe, diese Verkleidung, die ich tragen muss, ist so ziemlich alles, was ich nicht bin und will.
»Du tätest gut daran, in Daarth zu tun, was ich dir sage«, murrt Großmutter, ohne den Blick zu senken. »Die Männer dort sind weitaus weniger tolerant als die, die du kennst.«
»Sie würden uns Leid zufügen?«, frage ich.
»Mir nicht.« Großmutters Lippen verziehen sich zu einem Grinsen, das mich hart schlucken lässt. »Sie würden es nicht wagen, auch nur einen Finger an mich zu legen. Aber du …« Sie schüttelt den Kopf. »Da du keine Unberührbare bist, würden sie vor dir nicht zurückschrecken. Bleib also dicht bei mir und mach, was ich dir sage. Keine Widerworte, kein Ungehorsam!«
Ich schlage den Blick nieder und nicke einmal. Die Eindringlichkeit, mit der sie zu mir gesprochen hat, lässt mich unruhig werden und der Funke Vorfreude, den ich noch bis eben verspürte, ist wie weggeblasen.
»Nimm den Rucksack dort drüben, wir brechen gleich auf«, weist mich Großmutter an und deutet mit einer Handbewegung neben den Kamin, wo ein prall gefüllter Rucksack an der Wand lehnt.
Ich gehorche und schultere das Packstück. Auch ohne zu fragen, weiß ich, was sich darin befindet. Der scharfe Geruch nach Kräutern steigt mir in die Nase und lässt mich schnauben. Fläschchen klirren im Inneren bei jeder Bewegung gegeneinander. Der Rucksack ist so vollgepackt und schwer, dass sich die dünnen Träger in die Schultern schneiden.
Großmutter wartet bereits an der Tür auf mich. Gemeinsam treten wir hinaus. Obwohl die Sonne gerade erst aufgegangen ist, herrscht im Dorf bereits ein geschäftiges Treiben. Ein Stimmengewirr schallt vom Versammlungsplatz zu uns herüber.
»Sie bereiten das diesjährige Bannhain vor«, erklärt Großmutter, deren Blick meinem gefolgt ist.
»Ich habe völlig vergessen, dass es schon wieder so weit ist«, murmele ich mehr zu mir selbst.
Bannhain, auch die jährliche Jagd genannt, gehört zu den wichtigsten Ereignissen im Alltagstrott unserer Siedlung. Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger und kälter werden, schicken die Ältesten die Wächter-Anwärter hinaus in die Wälder. Dort müssen sie drei Tage und Nächte überleben. Wenn sie zurückkehren, werden sie als vollwertige Wächter angesehen. Denjenigen, die während des Bannhains sogar einen der gefürchteten Ferals getötet haben, wird eine besondere Ehre zuteil. Doch das halte ich für eine Legende. Bisher hat es noch nie jemand geschafft, einen Feral während seines Initiationsrituals zu töten.
Im Geiste gehe ich die Gesichter der jungen Männer durch, die zwei Jahre älter sind als ich und begierig darauf warten, endlich hinausgeschickt zu werden. Sie sind wild entschlossen, in die Fußstapfen ihrer Väter zu treten, und schließen bereits Wetten darüber ab, wer von ihnen zuerst einem Feral begegnen wird.
Wie viele von ihnen werden die Nächte des Bannhains wohl nicht überleben?
In den letzten Jahren kamen immer weniger junge Männer zurück. Meistens nicht einmal die Hälfte. In ihren Augen lag ein Schrecken, der mich jedes Mal verstörte und den ich nicht begreifen konnte. Auch mein Bruder war einst unter denen, die nicht zurückkehrten. Man fand seinen Leichnam – oder das, was davon übrig war – im Wald, nur wenige Kilometer von unserer Siedlung entfernt. Seitdem gehört Bannhain für mich zu den schlimmsten Tagen im Jahr. Als mein Bruder starb, mein großer, starker, immer lächelnder Bruder, wurde mir klar, dass auch meine Familie alles andere als unverwundbar ist.
Wie viele Familien werden dieses Jahr einen aus ihrer Mitte verlieren?
»Komm, wir müssen los«, brummt Großmutter und reißt mich damit aus meinen Grübeleien.
Mit gesenktem Kopf trotte ich hinter ihr her durchs Dorf. Nächstes Jahr … Nächstes Jahr wird Tristan achtzehn. Nächstes Jahr gehört er auch zu den Anwärtern, die zu Bannhain in den Wald geschickt werden. Allein beim Gedanken daran schnürt sich mir die Kehle zu und ich bekomme keine Luft mehr.
»Den Kopf hoch«, zischt Großmutter leise vor mir und ich schaue auf.
Wie versteinert bleibe ich stehen. Meine Hände zittern, als ich sie um die Träger des Rucksacks kralle. Mehrere Dorfbewohner säumen den Weg. Während sie Großmutter eilig Platz machen und ehrerbietig den Kopf neigen, als sie an ihnen vorbeigeht, starren sie mich an, als ob sie mich noch nie zuvor gesehen hätten. Ihre Blicke bohren sich förmlich in mich hinein, gleiten an mir hinab. Beinahe wäre ich auf dem Absatz herumgewirbelt und zurück zu unserer Hütte geflüchtet. Doch der Blick eines der Umstehenden hält mich davon ab.
Tristans blonder Haarschopf sticht zwischen den anderen hervor. Er steht zwar weiter hinten, aber es gelingt mir trotzdem, seinen Blick aufzufangen. Und als ich das Funkeln in den violetten Augen sehe, straffe ich automatisch den Rücken und komme endlich Großmutters Aufforderung nach. Die Blicke der anderen, die mich bis eben noch verstört haben, blende ich komplett aus und schaue nur auf Tristan. Aus ihm schöpfe ich die Kraft, einen Fuß vor den anderen zu setzen, um wieder zu Großmutter aufzuschließen.
Rechts von mir vernehme ich Cedrics Stimme. »Ohne Dreck im Gesicht und ohne die abgelegten Klamotten deines Bruders hätte ich dich fast nicht erkannt, Scarlet. Ich hätte nicht gedacht, dass darunter eine Frau stecken könnte.«
Ich bleibe stehen und starre ihn an, ohne eine Miene zu verziehen, selbst als ich sein anzügliches Grinsen bemerke. Betont langsam lasse ich den Blick über ihn gleiten. »Zu schade, dass ein bisschen Wasser und frische Kleidung bei dir nichts helfen werden«, erwidere ich dann. »Du wirst auch dann noch hässlich und ein Kotzbrocken sein.«
Ohne ihm die Möglichkeit zum Kontern zu geben, wende ich mich ab, werfe mir ein paar Strähnen meines dunklen Haares über die Schulter und gehe mit langen Schritten auf Großmutter zu. Hinter mir glaube ich, Tristans unterdrücktes Lachen zu hören, und kann mir ein Schmunzeln nicht verkneifen. Cedric vor allen anderen bloßzustellen gehört definitiv nicht zu meinen klügsten Entscheidungen und ich weiß, dass er mich früher oder später dafür büßen lassen wird. Doch im Moment verspüre ich nichts anderes als das Hochgefühl des Sieges und das bewundernde Staunen, das ich in Tristans Blick aufblitzen sehen konnte. Noch immer fühle ich das Kribbeln, das er in mir ausgelöst hat. Noch nie hat mich ein junger Mann auf diese Weise angesehen – und bisher hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass es mir gefallen könnte. Doch jetzt wünschte ich, Tristan würde mich immer mit diesem Blick betrachten.
»Hör auf, so dämlich zu grinsen«, murrt Großmutter, als ich mit ihr durch die Tore gehe.
»Tue ich doch gar nicht«, widerspreche ich halbherzig, schaffe es aber dennoch nicht, meine Lippen davon abzuhalten, sich zu heben.
Großmutter schüttelt seufzend den Kopf, sagt aber nichts weiter. Ich folge ihr den festgetretenen Pfad entlang, der zur Stadt führt.
***
Der Weg ist lang; viel länger, als ich erwartet habe. Wir machen nur zwei Pausen, um eine Kleinigkeit zu essen und uns auszuruhen. Zum Glück ist es recht kühl, sodass ich kaum schwitze. Dennoch brennen meine Füße. Ich bin es nicht gewohnt, so weit zu laufen. Zwar bin ich auch während des Trainings und meinen sonstigen Arbeiten die meiste Zeit des Tages auf den Beinen, aber ich muss nicht solche Strecken zurücklegen. Großmutter sehe ich die Anstrengung nicht an. Ohne Mühe erhebt sie sich nach den kurzen Pausen und treibt mich weiter.
Nachdem wir laut Stand der Sonne einen halben Tag unterwegs waren, ändert sich unsere Umgebung. Die Wege, die bisher aus festgetretener Erde bestanden haben, werden breiter und … grau.
»Was ist das?«, frage ich, während ich vorsichtig einen Fuß auf den ungewohnten Untergrund setze. Es fühlt sich härter und unnachgiebiger unter den Sohlen an als die Erde.
»Das ist Asphalt«, antwortet Großmutter, die – ohne zu zögern – über diesen … Asphalt läuft, als sei es das Normalste der Welt. »Damit haben die Menschen früher ihre Straßen gebaut.«
Ich husche hinter ihr her, habe aber immer noch die Angst, dass sich der Boden jederzeit unter den Füßen auftun könnte. Als mein Blick auf etwas Glänzendes seitlich von mir fällt, bleibe ich erneut stehen.
»Und … was ist das?«, frage ich und deute mit dem Finger auf das Ding.
»Das ist ein Auto«, sagt Großmutter. »Oder vielmehr: Es war mal ein Auto. Jetzt ist es nur noch Schrott.« Sie mustert das in der Sonne glänzende Gebilde, das teilweise mit Flechten und Ranken überwuchert ist, bevor sie sich abwendet. »Davon wirst du auf unserem restlichen Weg noch eine Menge sehen. Vor vielen Jahren haben sich die Menschen in den Autos auf den Straßen fortbewegt.«
Ich reiße den Blick von dem Ding los und stolpere hinter ihr her. »Konnten die Autos schneller laufen als wir?«
Großmutter nickt. »Sehr, sehr viel schneller. Die Menschen saßen einfach darin und mussten nicht viel tun. Sie gelangten so von einem Ort zum anderen, auch wenn er weit entfernt lag.«
»Und warum nutzen wir diese Autos nicht mehr?«
»Weil sie nicht ohne einen besonderen Kraftstoff laufen«, erklärt sie. »Ohne den konnten die Menschen die Autos nicht mehr benutzen. Als die Ferals kamen …« Sie zuckt mit den Schultern. »Nun, du kennst die Geschichte. Die Ferals löschten fast alle Menschen aus und die wenigen, die überlebten, vergaßen im Laufe der Zeit, wie die Dinge, die sie vorher täglich genutzt haben, funktionierten. Alles brach zusammen, wodurch noch mehr Menschen starben, weil sie so sehr an die Technik und das dadurch einfache Leben gewöhnt waren, dass sie mit dem, was nun vor ihnen lag, nicht mehr zurechtkamen.«
Schon von klein auf wird uns die Geschichte unserer Feinde, der Ferals, erzählt. Seltsame und grausame Wesen, weder Tier noch Mensch, die die Wälder durchstreifen. Immer hungrig, immer auf der Suche nach Nahrung und süchtig nach Menschenfleisch. Woher sie ursprünglich kamen, weiß niemand so genau. Durch die getöteten Ferals, die unsere Wächter hin und wieder in die Siedlung bringen, wissen wir jedoch, dass es verschiedene Arten von ihnen zu geben scheint. Unsere Siedlung, der Clan der Roten, verteidigt die Stadt gegen Ferals, die vom Boden aus Jagd auf uns machen. Es soll aber auch Ferals geben, die im Wasser leben oder sogar fliegen können. Allerdings kenne ich niemanden, der einem solchen Feral bereits begegnet ist. Allgemein gibt es nur sehr wenige Menschen, die von einem Zusammentreffen mit einem Feral hinterher noch berichten können.
»In der Stadt und auf dem Weg dorthin wirst du weitere Relikte längst vergangener Zeiten sehen«, sagt Großmutter, während wir weiter über den Asphalt laufen. »Viele von ihnen sind in Vergessenheit geraten und auch ich weiß nichts darüber. Unsere Aufzeichnungen über die alte Zeit sind lückenhaft, ebenso wie es unser Wissen über ihre Verwendung ist.«
Die Straße, über die wir laufen, wird breiter und breiter. An den Seiten stehen weitere Autos, dicht hintereinander und so alt und beschädigt, dass sie mir vorkommen wie Skelette, die man hier zurückgelassen hat. Hüfthohe Mauern säumen beide Enden der Straße, die sich bis zum Horizont zu erstrecken scheint. Baukunst, die unzählige Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte überdauert hat.
Nach Stunden taucht in der Ferne endlich die Stadt auf. Schon von Weitem sehe ich den Rauch, der wie dunkle Regenwolken am Himmel hängt, und ein beißender Gestank sticht in meiner Nase. Ich verziehe angewidert das Gesicht. Großmutter brummt etwas, was ich nicht verstehe, aber ich sehe ihr an, dass auch sie den Gestank bemerkt hat.
Je näher wir der Stadt kommen, desto schlimmer wird es. Hohe Mauern, größer als jedes Haus in unserer Siedlung, gefertigt aus dunklem Stein, ragen vor uns auf und ich muss den Kopf in den Nacken legen, um überhaupt das Ende der Mauer erahnen zu können. Ein unüberwindbares Bollwerk für die am Boden lebenden Ferals.
Vier Wachen stehen am Tor, das in die Stadt hineinführt, und mustern uns. Sie scheinen meine Großmutter zu erkennen und machen ihr Platz, um sie durchzulassen, während ihre Blicke sofort auf mich fallen. Ich zucke unter zu viel Aufmerksamkeit zusammen.
»Sie gehört zu mir«, sagt Großmutter mit einem barschen Unterton, der die beiden jüngeren Wachen sofort dazu veranlasst, den Blick von mir zu nehmen. Ich beeile mich schnell wieder zu ihr aufzuschließen.
Sobald wir das Tor passiert haben, schließt es sich hinter uns. Das dumpfe Geräusch hallt in meinen Eingeweiden wider und ich werde das Gefühl nicht los, eingesperrt zu sein. Großmutter stapft währenddessen unbeeindruckt weiter. Ich folge ihr dicht und nehme die Eindrücke um mich herum in mich auf.
Eigentlich habe ich damit gerechnet, direkt in einem Wohnviertel zu stehen und dicht an dicht gedrängte Häuser und Hütten zu sehen, doch das Gegenteil ist der Fall. Rechts und links von uns erstrecken sich Felder, auf denen Menschen arbeiten und den Boden bestellen, und Wiesen, auf denen Tiere grasen, die den Kopf heben, um uns zu beäugen, bevor sie sich fressend wieder dem Gras zuwenden. Korn und Mais schillern in der Nachmittagssonne und Ähren wiegen sich im leichten Wind.
Ebenfalls am Rande der Stadt erspähe ich den Grund für den Gestank. Als wir näher an den Gebäuden mit den großen Bottichen davor vorbeikommen, halte ich mir die Nase zu.
»Was machen sie da?«, frage ich.
»Sie gerben Leder. Vor allem für Kleidung wie die, die du am Leib trägst«, antwortet Großmutter. »Und dort drüben werden die Tiere geschlachtet. Beides sind wichtige Handwerke, aber der Geruch, den sie verbreiten, ist so schlimm, dass man sie so weit wie möglich außerhalb angesiedelt hat.«
»Kann ich gut verstehen«, murmele ich und beeile mich mit Großmutter Schritt zu halten.