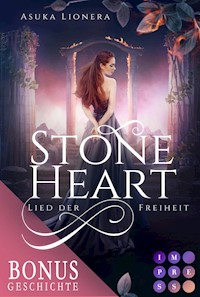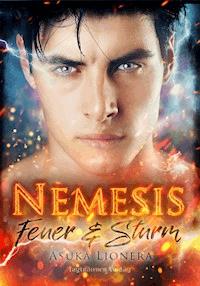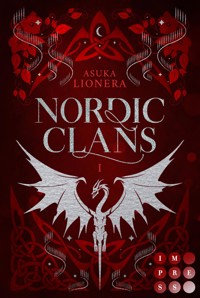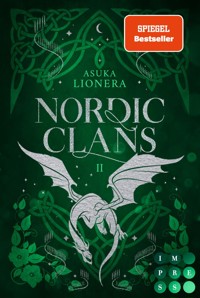
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Mache ich dich auf eine gute oder schlechte Art nervös?« »Ich weiß es nicht.« »Willst du es herausfinden?« Um die letzte Prüfung zu bestehen und Anführer aller Clans zu werden, muss sich Yrsa mit ihrem Rivalen Kier auf ein Schiff begeben und eine Reise ins Unbekannte antreten. Dass dort, wo Schätze liegen, auch tödliche Gefahren lauern, weiß sie. Darauf, sich die Dunkle Herrin der Unterwelt zum Feind zu machen, ist allerdings keiner von ihnen vorbereitet ... Derweil wird die Anziehung zwischen Kier und Yrsa immer stärker. Eine Anziehung, die nicht sein darf und doch unvermeidbar scheint. Bis Yrsa von Kiers Geheimnis erfährt – und von dem Fluch, der sein Leben fordern soll. Begeisterte Stimmen zu Band 1: »Asuka ist wirklich eine Queen of Romantasy. Romantisch, spannend und eine Prise Humor. Ich liebe dieses Buch!« SPIEGEL-Bestseller-Autorin Stella Tack »Ein beeindruckendes Worldbuilding, starke Charaktere, ungeahnte Gefahren und überraschende Wendungen haben mein Leserherz höherschlagen lassen. Magisch, fesselnd, prickelnd, bildgewaltig und von der ersten bis zur letzten Seite episch!« Yvonne von @book_lovely29 »Nordic Clans - der bildgewaltige Auftakt einer mitreißenden Story rund um nordische Traditionen, mystische Wesen und zwei Clanführer, auf der Suche nach ihrer eigenen Legende.« Sophie von @so_leviosa Die wunderschön veredelte Ausgabe mit umliegender Klappe gibt es nur in der 1. Auflage, solange der Vorrat reicht. //Dies ist der zweite Band der romantischen Slow-Burn Fantasy-Dilogie »Nordic Clans«. Alle Romane der fesselnden Romantasy: -- Band 1: Mein Herz, so verloren und stolz -- Band 2: Dein Kuss, so wild und verflucht Diese Reihe ist abgeschlossen.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
ImpressDie Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Asuka Lionera
Nordic Clans. Dein Kuss, so wild und verflucht
Um die letzte Prüfung zu bestehen und Anführer aller Clans zu werden, muss sich Yrsa mit ihrem Rivalen Kier auf ein Schiff begeben und eine Reise ins Unbekannte antreten. Dass dort, wo Schätze liegen, auch tödliche Gefahren lauern, weiß sie. Darauf, sich die Dunkle Herrin der Unterwelt zum Feind zu machen, ist allerdings keiner von ihnen vorbereitet ... Derweil wird die Anziehung zwischen Kier und Yrsa immer stärker. Eine Anziehung, die nicht sein darf und doch unvermeidbar scheint. Bis Yrsa von Kiers Vergangenheit erfährt – und von dem Fluch, der sein Leben fordern soll.
Heiße Forbidden Love Romantasy von Bestseller-Autorin Asuka Lionera!
Wohin soll es gehen?
Glossar
Hinweis des Verlags
Widmung
Buch lesen
Danksagung
Content Note
Vita
© privat
Asuka Lionera wurde 1987 in einer thüringischen Kleinstadt geboren und begann als Jugendliche nicht nur Fan-Fiction zu ihren Lieblingsserien zu schreiben, sondern entwickelte auch kleine RPG-Spiele für den PC. Ihre Leidenschaft machte sie nach ein paar Umwegen zu ihrem Beruf und ist heute eine erfolgreiche Autorin, die mit ihrem Mann und ihrem Fellnasenkind in einem kleinen Dorf in Hessen wohnt, das mehr Kühe als Einwohner hat.
VORBEMERKUNG FÜR DIE LESER*INNEN
Liebe*r Leser*in,
dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Aus diesem Grund befindet sich hier eine Triggerwarnung. Am Romanende findest du eine Themenübersicht, die demzufolge Spoiler für den Roman enthält.
Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest. Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du während des Lesens auf Probleme stößt und / oder betroffen bist, bleib damit nicht allein. Wende dich an deine Familie, Freunde oder auch professionelle Hilfestellen.
Wir wünschen dir alles Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.
Asuka Lionera und das Carlsen-Team
GLOSSAR
ÁRORA – Göttin des Himmels, Jüngste der Schicksalsgöttinnen
MERTHING – Die heiligen Prüfungen, bei denen der oberste Anführer gewählt wird. Sie werden alle fünfzehn Jahre ausgetragen.
MERWA – Die oberste Göttin, Gemahlin des Noren. Göttin des Neuanfangs und der Fruchtbarkeit.
MERWAFEST – Feierlichkeiten, die zweimal im Jahr (Frühjahr und Herbst) zu Ehren der obersten Göttin abgehalten werden.
NOREN – Der oberste Gott. Gott des Krieges, der Eroberung und der Seefahrt.
OBERSTER ANFÜHRER – Ein Anführer, der während einer Prüfung unter allen Anführern gewählt wird und als einziger Befehlshaber im Verteidigungsfall fungiert.
THAN – Der Anführer eines Clans
THAN DER THANE – siehe »oberster Anführer«.
VALKRA – Die spirituelle Führung eines Clans. In Visionen vernimmt sie die Worte der Götter.
Für all jene, die die Stimme ihres Herzens gefunden haben. Haltet sie fest!
Ich starre meine Begleiterin Astrid an, als sähe ich sie zum ersten Mal. Wieder und wieder hallen ihre Worte durch meinen Kopf, ohne dass sie einen Sinn ergeben.
Kier hat seine Valkra getötet. Mit seinen eigenen Händen.
»Das ist unmöglich«, presse ich hervor.
Eine Valkra, die das Sprachrohr der Götter in unserer Welt ist, zu töten steht fast auf einer Stufe damit, einen Gott umzubringen. Nicht, dass ich je von jemandem gehört hätte, der so dumm war, es zu versuchen. Allein der Gedanke ist Ketzerei. Wenn tatsächlich jemand so dumm wäre, eine Valkra zu töten, würde ihn die schlimmste aller Strafen erwarten: das Ausweiden bei lebendigem Leib – der Blutadler. Ich habe dieser Strafe zum Glück nie beiwohnen, geschweige denn sie befehlen müssen, aber in Elvis alten Schriften darüber gelesen. Bei den Ausführungen, wann welche Rippe zerschmettert werden muss, um Lunge und Herz möglichst unbeschadet entnehmen zu können, hat sich mir der Magen umgedreht.
Mit einem katzenhaften Grinsen lehnt sich Astrid gegen die Reling des Schiffes, mit dem wir seit Wochen, vielleicht auch Monaten unterwegs sind. Um sie herum erstreckt sich nichts als eine undurchdringliche Nebelwand, weshalb mir nichts anderes übrig bleibt, als sie weiterhin anzustarren. Ich wünschte, es gäbe etwas, worauf ich mich konzentrieren könnte. Etwas, was mich von den quälenden Worten ablenkt, die sie gesagt hat. Aber da ist nichts. Schwankend zwischen dem Wunsch, mir die Ohren zuzuhalten, und der mich schier auffressenden Neugier warte ich, dass sie den Mund öffnet.
»Das ist es, was man sich auf dem Schiff erzählt.«
Ich verdrehe die Augen und überspiele damit hoffentlich all meine Regungen. Seit der Schemen nicht mehr in mir haust, bin ich besser darin geworden, meine Gefühle zu kontrollieren, allerdings längst nicht so gut, wie ich gern wäre. »Der allgegenwärtige Nebel veranlasst die Besatzung offenbar dazu, Lügen zu spinnen.«
Astrids Blick hält mich fest. »Bist du dir da sicher?«
Ich brauche eine Weile, bis ich nicke. »Es muss einen anderen Grund geben, warum die Götter Kiers Clan keine neue Valkra senden.«
Die Schildmaid zuckt desinteressiert mit den Schultern. »Wenn du meinst. Ich an deiner Stelle würde ihm kein einziges Wort mehr glauben. Und ich würde ihm auf gar keinen Fall meine Schwester anvertrauen – also wenn ich eine hätte, meine ich.« Sie stößt sich von der Reling ab und schlendert zu mir herüber, um mit dem Finger über die Stelle an meinem Hals zu streichen, an der Kiers Lippen zuvor gesaugt haben, ehe ich Hals über Kopf aus seiner Kajüte geflüchtet bin, und wo sich offenbar ein kleiner, aber verräterischer Bluterguss gebildet hat. »Du solltest dich so weit wie möglich von ihm fernhalten, wenn du nicht willst, dass Gerüchte über dich die Runde machen.«
Ich schlage ihre Hand weg und lege sie schützend über die Stelle, nur um sie Sekunden später sinken zu lassen.
Ich weiß nicht, was ich denken oder fühlen soll. Es gibt keinen Grund, warum Astrid sich so etwas ausdenken sollte; also muss es die Wahrheit sein – oder zumindest ein Gerücht. Aber wie kann Kier dann noch am Leben und noch dazu ein Anführer sein? Kein Clan würde so jemandem auch nur für eine Sekunde die Treue halten.
»Das ergibt keinen Sinn«, flüstere ich, um mich selbst davon zu überzeugen.
Doch Astrid hat es ebenfalls gehört. »Siehst du es nicht?«, fragt sie, ehe sie schnaubt. »Bist du tatsächlich derart geblendet von ihm, dass du es nicht begreifst?«
»Was meinst du?«
»Er will nicht dich, sondern deine Schwester. Das wollte er von Anfang an. Es ging ihm nie um dich, sondern bloß um die Valkra. Du hättest den Tauschhandel jederzeit ablehnen können, also musste er sichergehen, dass du ihm vertraust. Und wie er das geschafft hat, ist nicht schwer zu erraten.«
Es fühlt sich an, als würde sie mir mit jedem Wort ein Stück meines Herzens aus der Brust reißen. Es bäumt sich auf, schreit mir zu, dass ihre Worte gelogen sind. Doch wieso klingen sie dann so logisch? All die Briefe, die Kier mir geschrieben hat, dienten lediglich dazu, dass ich meine Meinung in der Zwischenzeit nicht ändere. Er hat mich mit Nahrung bestochen, die ich meinem Clan in einem harten Winter nicht vorenthalten durfte. Auch vorhin in seiner Kajüte … Alles, was er gesagt und getan hat … Es diente nur dazu, dass ich unseren Handel nicht vergesse. Dass ich mich besser dabei fühle, wenn ich ihm meine Schwester für ein Jahr überlassen muss.
Und ich habe es nicht bemerkt.
Mein Herz schlägt langsamer, beinahe träge, als hätte es diese unumstößliche Wahrheit endlich ebenfalls erkannt.
Oder als hätte es aufgegeben.
Mir ist beides recht, solange ich diesen stechenden Schmerz nicht mehr ertragen muss.
Trotzdem sträubt sich etwas in mir gegen Astrids Erklärungen. Als Anführerin ist es wichtig, mir beide Seiten anzuhören. Ich gebe nichts auf Erzählungen aus dritter Hand. Zwar ist mir klar, dass sich in Gerüchten zumindest ein Körnchen Wahrheit verbirgt, aber um das große Ganze zu erfassen und Entscheidungen zu treffen, die nicht selten um Leben oder Tod gehen, muss ich alle Einzelheiten kennen.
Ich schiebe mich an Astrid vorbei, doch sie packt mich am Arm.
»Wo willst du hin?«, fragt sie.
»Ich muss mit Kier reden.«
Sie starrt mich an, als hätte ich völlig den Verstand verloren. »Damit er dir noch mehr Lügen erzählen kann?«
Ich will mich losreißen, doch sie verstärkt ihren Griff, bis ich das Gesicht vor Schmerz verziehe.
»Die Besatzung redet schon über dich«, wispert sie eindringlich. »Was, glaubst du, werden sie sagen, wenn sie dich mitten in der Nacht in der Kajüte ihres Anführers ein und aus gehen sehen?«
»Das ist mir egal.«
Sie reckt das Kinn. »Und was ist mit Vangars und meiner Meinung?«
Ich schlucke angestrengt, denn ich begreife sofort, worauf sie hinauswill.
»Wir sind deine Begleiterinnen«, fährt sie fort, ohne ihren Griff zu lockern. »Es ist unsere Pflicht, unserem Clan alles zu berichten, was sich auf der Reise zugetragen hat. Muss ich dir wirklich erklären, was geschieht, wenn sie erfahren, dass du dich auf einen fremden Anführer eingelassen hast?«
Ich atme zitternd aus. So weit habe ich nicht gedacht. Ich nahm an, dass es niemand erfahren würde, wenn Kier und ich zusammen sind, und dass wir einfach unserer Wege gehen könnten, sobald wir wieder an meiner Küste angelegt haben. Doch diese Annahme ist aus vielen Gründen ein Irrtum.
Astrid und Vangar müssen ihre Pflicht erfüllen und unserem Clan detailgetreu berichten, wie ich mich auf dieser Reise geschlagen habe. Selbst wenn ich sie darum bäte, dürften sie nichts unter den Tisch fallen lassen.
Jeder wird es erfahren. Jeder von ihnen wird hören, dass ich eines der obersten Gesetze unseres Volkes gebrochen habe. Dass ich mich mit dem Feind eingelassen habe. Sie werden sich von mir abwenden, mich verstoßen – wenn ich Glück habe. Ich werde meinen Namen ablegen und meine Familie verleugnen müssen und allein und schutzlos umherwandern, bis ich irgendwann sterbe.
Und das nur, weil mein verdammtes Herz der Meinung ist, es müsse etwas für den Anführer des Schwingenclans empfinden!
Ich wünschte, mein Schemen hätte mich nicht verlassen. Dann müsste ich mir darum keine Sorgen machen, da er alle Gefühle einfach auffressen und jeden törichten Gedanken damit im Keim ersticken würde. All meine Probleme wären dann gelöst.
Doch der Schemen ist weg und ich muss zusehen, wie ich allein zurechtkomme. In meinem bisherigen Leben ist mir das gut gelungen, doch nun habe ich den Weg, der sonst klar vor mir lag, aus den Augen verloren. Ich bin gefangen in einem dunklen Geflecht aus Irrwegen, ohne dass ich weiß, wohin ich gehen soll und welcher Pfad der richtige für mich ist.
In meiner Not wende ich mich an die Frau, die ich mittlerweile als eine Freundin ansehe. »Was muss ich tun?«, murmele ich.
»Halte dich von ihm fern«, beschwört mich Astrid. »Rede bloß mit ihm, wenn andere dabei sind. Es dürfen keine weiteren Gerüchte aufkommen.«
»Was ist mit Vangar und dir? Was werdet ihr berichten?«
Sie lässt endlich von mir ab und zuckt mit den Schultern. »Das, was wir sehen.«
Ich hebe fragend eine Augenbraue.
Sie tippt sich gegen die Lippen. Meine brennen noch leicht von Kiers Küssen. »Du sagst, dass du irgendwo angestoßen bist, und ich glaube dir, weil ich weder das eine noch das andere gesehen habe.«
Ich stoße lang gezogen den Atem aus. »Danke.«
Ich bin ihr wirklich dankbar, doch nicht einmal die Dankbarkeit vertreibt die Leere in mir. Zwar habe ich nun wieder einen Weg, auf dem ich einen Fuß vor den anderen setzen kann, das ändert aber nichts an meinem Gefühl, verloren zu sein.
Ich starre auf die Tür, durch die Yrsa vor einigen Minuten verschwunden ist, als könnte ich sie mit bloßer Willenskraft wieder hier erscheinen lassen. Mein Kiefer tut weh, weil ich die Zähne ganz fest zusammenpresse, um nicht zu schreien. Dabei will ich schreien und auf etwas einprügeln, um den Schmerz in mir zu überlagern, der sich in Windeseile durch mich hindurchfrisst. Ich kenne seinen Ursprung und auch die passende Heilung nur allzu gut, doch ich bin zu stolz und wütend, um meiner Heilung nachzulaufen.
Mit der Faust schlage ich mir gegen die Brust. Es soll aufhören wehzutun, verdammt!
Als das nichts bringt, schnappe ich mir den Hocker hinter dem Tisch und werfe ihn quer durch die Kajüte. Er zerbirst an der Wand hinter meinem Bett. Dem Bett, in dem Yrsa mehrere Tage lag und das noch immer nach ihr riecht, weil ich mich geweigert habe, ein frisches Laken aufzuziehen. Nun bereue ich es.
Ich bereue so vieles. Ihr gesagt zu haben, dass ich sie mag, zum Beispiel. Es überhaupt versucht zu haben.
Als der Schemen wie durch eine göttliche Fügung verschwunden war, hatte ich Hoffnung. Dieses schreckliche Gefühl wuchs mit jedem Blick, den sie mir schenken konnte, ohne schmerzerfüllt das Gesicht zu verziehen, mit jedem Wort, jeder Berührung. Es vereinnahmte mich, redete mir ein, dass nun alles möglich wäre. Dass Yrsa tatsächlich diejenige ist, für die ich sie halte. Dass sie meine Erlösung ist.
Ich hörte auf die Worte, die die verdammte Hoffnung mir einflüsterte. Ich glaubte ihnen.
Doch die Hoffnung hat sich geirrt. Ich habe mich geirrt.
Natürlich ist mir klar, dass Yrsa und ich nicht einfach zusammen sein können wie ein normales Paar. Aber es wäre auch nicht unmöglich gewesen; erst recht nicht, nachdem einer von uns der nächste oberste Anführer geworden wäre. Dann hätten andere Regeln für uns gegolten. Zumindest hätte ich es in Betracht gezogen, unsere uralten Traditionen mit Füßen zu treten, um mit ihr zusammen sein zu können.
Aber Yrsa offenbar nicht. Ich muss zu viel in ihre Blicke und Worte hineininterpretiert haben. Ich habe mich zu sehr von der dummen Hoffnung leiten lassen und stehe nun ohne etwas da; beseelt von einem verzehrenden Schmerz, der wie eine Krankheit in mir wütet.
»So schlimm, ja?«
Ich habe nicht gehört, dass Halvar hereingekommen ist, doch ich bin nicht verwundert darüber. Wahrscheinlich habe ich mit meinem Schemelwurf das halbe Schiff aufgeweckt.
»Verschwinde«, murmele ich, ohne in seine Richtung zu blicken, während ich mich kraftlos gegen den Tisch sinken lasse.
»Damit du deine spärliche Einrichtung weiter demolieren kannst?« Er schließt die Tür hinter sich. »Du kannst froh sein, dass unser Clan nicht an deinen Geschichten interessiert ist, sonst müsste ich berichten, wie erbärmlich du gerade aussiehst. Ich habe mir schon gedacht, dass es nicht ganz so gut gelaufen ist, wie du dir erhofft hast, als ich die Kleine mit blasser Nasenspitze zu ihrem Bären habe rennen sehen. Aber du gibst ein noch größeres Bild des Jammers ab.«
»Wenn du mir jetzt sagst, dass ich mich zusammenreißen soll, dann vergesse ich mich.«
»Das hatte ich nicht vor.«
Er kommt auf mich zu. Seine Schritte klingen schwer auf den Holzdielen. Als er vor mir steht, legt er mir eine Hand auf die Schulter.
»Ich sehe, dass du leidest. Ich trete nicht nach, wenn jemand am Boden liegt. Willst du reden?«
Seine Frage entlockt mir tatsächlich ein Schmunzeln. »Mit dir? Da kann mir Drakkar bessere Tipps geben als du.«
»Ich wollte wenigstens gefragt haben. Wie schlimm war es?«
Ich stoße den Atem aus. »Es hat gut angefangen, ging dann aber den Bach runter, als sie mir klarmachte, dass ich sie zwar gern vögeln könnte, aber nicht auf mehr hoffen sollte.«
Halvar gibt ein Schnauben von sich. »Du weißt schon, dass sich eine Menge Männer auf diese Art von Beziehung einlassen würden und damit zufrieden wären, oder?«
»Ich bin aber nicht eine Menge Männer und sie ist nicht irgendeine Frau für mich.«
Halvar nickt. »Das ist nicht der einzige Grund, warum dich ihre Aussage so verletzt hat, nicht wahr? Es ist wegen …«
Ruckartig bewege ich die Schulter und schüttele seine Hand ab. »Wehe, du sagst ihren Namen!«
Entschuldigend hebt Halvar die Hände. »Hatte ich nicht vor.«
»Ich will nicht über sie reden.«
»Auch nicht mit der Kleinen?«
»Erst recht nicht mit Yrsa.«
»Aber vielleicht könnte sie dich dann besser verstehen.«
Ich verdrehe die Augen. »Ja, sicher versteht sie mich dann besser. Vor allem, weil sie mir fast dasselbe Angebot gemacht hat wie die Frau, die mein ganzes Leben zerstört hat.«
»Spar dir deinen Spott. Ich meine es ernst.«
»Ich auch.«
Ich stoße mich vom Tisch ab und laufe in der Kajüte auf und ab. Mehr als zwei Schritte kann ich nicht in eine Richtung machen, ohne gegen die Wand oder Halvar zu prallen, doch ich halte es nicht aus, weiter stillzustehen.
»Wahrscheinlich ist es besser, so wie es ist«, murmele ich.
Halvar gibt einen abschätzigen Laut von sich. »Jetzt komm mir nicht wieder mit deinem Gerede über den Fluch.«
»Das ist kein Gerede, sondern die Wahrheit. Ich bringe jedem Unglück, der mir wichtig ist. Yrsa wäre es über kurz oder lang auch nicht anders ergangen.«
Halvar stellt sich mir in den Weg. Als ich ihm ausweichen will, packt er mich an den Schultern. »Hör auf damit, du machst mich nervös. Und hör auch auf mit diesem Unglücksunsinn. Du bist nicht verflucht. Du hattest … einfach Pech.«
Ich schnaube. »Du bezeichnest es als Pech, dass ich für den Tod meiner Eltern und den unserer letzten Valkra verantwortlich bin?«
»Ja, das tue ich. Schon seit Jahren, wie du weißt. Und es ist Pech, dass du dich ausgerechnet in eine Kleine aus einem anderen Clan verguckt hast.«
Erneut rolle ich mit den Augen, verkneife mir aber eine Erwiderung. Als jemand, der noch nie verliebt war, wird Halvar den Unterschied zwischen vergucken und dem Finden seines Gegenstückes nicht einmal verstehen, wenn ich es ihm aufzeichne.
Er mag es als Pech bezeichnen, aber für mich ist es eindeutig ein Fluch. Ein grausamer Scherz der Götter, die es bereits vor meiner Geburt auf mich abgesehen hatten und nicht müde werden, mir einen Schicksalsschlag nach dem nächsten vor die Füße zu werfen. Auch die anderen Valkras, mit denen ich gesprochen habe, waren sich darin einig, ebenso wie mein Clan. Bloß Halvar klammert sich an die Möglichkeit, dass ich lediglich vom Pech verfolgt bin.
Es gab Zeiten, dunkle Zeiten in meinem Leben, in denen ich ihm liebend gern geglaubt hätte. In denen ich selbst hoffte, er hätte recht. Aber ich weiß, dass dem nicht so ist. Ich spüre den Schatten des Fluches, der mich auf Schritt und Tritt verfolgt. Ich sehe die Auswirkungen, die mein Dasein auf mein Umfeld hat. Um zu glauben, dass dies nichts als Pech sei, müsste ich ein Narr sein.
Vor einigen Monaten hatte ich mich nicht als Narr bezeichnet. Nun bin ich mir nicht mehr so sicher. Anders kann ich mir nicht erklären, warum ich mir Yrsa nicht einfach aus dem Kopf schlage. Es gibt so viele Dinge, die wichtiger sind, als einer Frau nachzulaufen, die nicht dasselbe für mich empfindet und bloß an meinem Körper interessiert ist – nicht an meinem Herzen.
Und doch kriege ich sie nicht aus dem Kopf. Würde mein Stolz mich nicht davon abhalten, wäre ich ihr schon längst nachgerannt.
Halvar scheint zu bemerken, was in mir vorgeht. »Wie wichtig ist dir die Kleine?«
Für einen Moment erwidere ich seinen Blick, komme aber zu dem Schluss, dass ich ihm gegenüber nicht lügen muss. »Verdammt wichtig.«
»Ihr seid beide Anführer. Eine Beziehung zwischen euch ist … schwierig.«
Ich nicke, ehe ich resigniert die Augen schließe. »Das hat Yrsa auch gemeint. Und ich verstehe sie. Ihr Clan bedeutet ihr alles. Unsere Traditionen sind ihr nicht nur heilig, sie kennt und ehrt jede einzelne. Ich begreife und respektiere das. Aber trotzdem …«, mein Blick huscht unstet im Raum umher, »… hätte ich gehofft, dass sie wenigstens die Möglichkeit in Betracht zieht … Dass sie … uns nicht von vornherein aufgibt. Ich habe gehofft, dass ich ihr wichtig genug bin, dass sie um mich – um uns – kämpft. Oder dass wir darüber reden und uns einen Plan zurechtlegen können. Denn ja, es ist schwierig, aber vielleicht nicht unmöglich.« Ich schüttele den Kopf. »Aber das hat sie nicht getan. Sie hat mich von Anfang an abgelehnt. Und wenn ich ehrlich bin, schmerzt mich das am meisten. Dass sie uns gar nicht erst eine Chance gibt.«
Halvar mustert mich eine Weile mit gerunzelter Stirn. »Bist du bereit, wegen ihr die Götter gegen dich aufzubringen?«
Ich zucke mit den Schultern. »Ich habe sie bereits vor meinem ersten Atemzug gegen mich aufgebracht.«
»Das warst nicht du, sondern dein Vater.«
Ich nicke. »Und ich muss mit den Konsequenzen leben, also macht es nicht wirklich einen Unterschied.«
»Also, was ist jetzt? Wirst du sie aufgeben?«
Ich lasse den Kopf sinken. »Ich sollte es tun. Ich würde sie nie zu etwas zwingen.«
»So, wie ich es verstanden habe, musst du sie zu gar nichts zwingen, weil sie fast alles will, was du ihr anzubieten hast.«
»Fast«, entgegne ich. »Mein Herz will sie nicht.«
»Dann biete es ihr erneut an.«
»Damit sie es wieder mit Füßen tritt?«
Halvar verzieht den Mund. »Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.«
Ich ziehe die Augenbrauen zusammen. »Was meinst du damit?«
Er gibt mich frei, doch ich bleibe an Ort und Stelle stehen. »Die Kleine ist wegen ihres Schemens keine gewöhnliche Frau, und sie ähnelt derjenigen, deren Namen wir nicht nennen, in keiner Weise. Aber dennoch ist sie eine Frau mit Bedürfnissen, die offenbar nur du stillen kannst. Angeblich hat sie ja nichts gespürt, als sie mich geküsst hat.«
Langsam dämmert mir, worauf er hinauswill. »Du meinst, ich soll sie verführen?«
Er hebt die Schultern. »Warum nicht?«
»Weil es mir um ihre Gefühle geht, nicht bloß um ihren Körper.«
Halvar grinst mich an. »Du hättest dich öfter auf den Merwafesten herumtreiben sollen. Dann wüsstest du, dass aus dieser Nacht die meisten glücklichen Ehen hervorgehen. Liebe und Lust sind grundverschieden, aber sie können sich verbinden und zusammenwachsen – wenn man es richtig anstellt.«
»Ich soll also ihren Körper nutzen, um an ihre Gefühle zu kommen?«, frage ich.
»So wie du das sagst, klingt es fast verwerflich. Aber das wäre es nur, wenn einer von euch das nicht will.«
Ich verschränke die Arme. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich es will.«
Halvar seufzt mitleidig. »Als ob ich dir glauben würde, wenn du mir erzählst, dass du nicht ausschließlich an sie denkst, wenn du es dir selbst machst. Keine falsche Zurückhaltung!«
Ich zögere, während ich mir seinen Vorschlag durch den Kopf gehen lasse. Ich habe noch nie eine Frau verführt. Das wäre auch jetzt nicht nötig, denn Yrsa hat ihr Interesse deutlich gemacht.
»Und was, wenn es nicht ausreicht?«, frage ich. »Wenn es nicht genug ist, damit sie mehr für mich empfindet? Wenn sie dann immer noch der Meinung ist, dass wir nie mehr sein können?«
»Ich habe keine Zweifel daran, dass dein Zauberschwanz die Sache regeln wird. Aber falls nicht, wirst du einen anderen Weg finden. Wenn sie dir so wichtig ist, wie du sagst, solltest du nicht aufgeben.«
»Es geht nicht bloß um mich. Ich muss ihr auch wichtig sein.«
»Das bist du.« Halvar schiebt sich an mir vorbei Richtung Tür, nicht ohne mir im Vorbeigehen eine Spur zu fest auf die Schulter zu hauen. »Eine Frau, der du egal wärst, hätte nicht derart aufgelöst ausgesehen wie die Kleine vorhin.«
Ich erlaube mir nicht, bei seinen Worten Hoffnung zu empfinden. »Sicherlich war Yrsa bloß verwirrt. Sie kann Empfindungen nicht immer richtig einordnen.«
»Nein, sie war nicht nur verwirrt. Sie sah aus, als wärst du derjenige gewesen, der ihr das Herz gebrochen hat.«
Beinahe hätte ich aufgelacht. Es war ihr Mund, aus dem die Worte kamen. Sie ist diejenige, die uns keine Chance gibt. Der ich nicht wichtig genug bin, um eine Lösung zu suchen.
Tief in mir verstehe ich Yrsa. Würde ich meinem Clan so große Bedeutung zugestehen wie sie, wäre ich auch zögerlicher. Für sie gibt es nichts Wichtigeres als ihre Leute und die Traditionen, die sie zu ehren geschworen hat. Sie müsste entweder ihre Position aufgeben oder ihren Clan in Gefahr bringen, wenn sie sich für mich entscheidet. Nichts davon wird sie tun; einerseits finde ich es bewundernswert, wie stark und stolz sie an unseren Werten festhält.
Andererseits wünschte ich, es wäre anders. Ich wünschte, dass ich einem anderen Menschen wichtig genug wäre, um für ihn an erster Stelle zu stehen. Oder dass zumindest die Möglichkeit bestünde. Ich wollte mir ihr reden, ihr meine Vorschläge unterbreiten.
Und nicht zuletzt hatte ich gehofft, dass sie mich rettet.
Die nächsten Tage verschanze ich mich in meiner Kajüte und grübele über das nach, was geschehen ist und was Halvar gesagt hat. Ich verlasse diesen Raum nur, um nach Drakkar zu sehen. Sie würde ich nicht einmal vernachlässigen, wenn Yrsa mir das schlagende Herz bei lebendigem Leib herausgerissen hätte.
Abgesehen davon spreche ich mit der Besatzung bloß das Nötigste. Yrsa sehe ich lediglich aus der Ferne, dennoch gerät mein Herzschlag jedes Mal aus dem Takt, wenn sich unsere Blicke treffen. Und das tun sie immer, wenn ich meine Kajüte verlasse, als wüsste sie, dass ich genau dort erscheinen muss. Und es ist, als ob ich wüsste, wohin ich schauen muss, um sie zu sehen, ohne dass ich ihre Anwesenheit bewusst wahrgenommen habe.
Nach drei Tagen halte ich es nicht mehr aus und schreibe ihr einen Zettel. Genauer gesagt schreibe ich gefühlte dreißig Varianten, die ich alle verwerfe, bis bloß noch ein »Triff mich in meiner Kajüte, wenn alle schlafen« übrig bleibt. Ehe ich es mir anders überlegen kann, befestige ich den Zettel an Brans Hals, während Yrsa und die anderen beim Essen sind. Ihr Tierwesen straft mich mit einem mahnenden Blick, als ich mich ihm nähere, und ich frage mich, wie viel es weiß. Drakkar spürt alles, was in mir vorgeht; sie verhielt sich die letzten Tage weit umgänglicher als gewöhnlich, um mir keinen zusätzlichen Kummer zu bereiten. Doch Bran scheint bloß Yrsas Version zu kennen, in der ich – seinem durchdringenden Blick und dem Gebrumme nach – offenbar der Böse bin.
»Ich würde deiner Gefährtin nie schaden«, versichere ich ihm leise. »Aber ich werde es mir bis an mein Lebensende vorwerfen, wenn ich einfach nur danebenstehe und zusehe, wie sie geht, ohne dass ich etwas unternehme. Halvar hat recht: Ich habe nichts zu verlieren.«
Ich weiß nicht, ob er versteht, was ich sage; da wir keine Verbindung haben, ist es unwahrscheinlich. Trotzdem rede ich mir ein, dass er es begriffen hat.
Doch Yrsa hat keine Gelegenheit, den Zettel zu finden.
Als ich mich umdrehe, stürzt Drakkar aus dem Nebel herab und landet auf dem hinteren Teil des Schiffes. Ich spüre ihre Aufregung und haste zu ihr. Eigentlich sollte sie das Schiff noch eine Weile ziehen, damit wir endlich irgendwo ankommen. Hat sie sich etwa verletzt?
Meine Gedanken überschlagen sich, während ich versuche, eine Verbindung zu ihr aufzubauen. Normalerweise gelingt uns das spielend, doch sie ist derart außer sich, dass ich mehrere Anläufe brauche, um die Nachricht zu verstehen, die sie mir übermitteln will.
»Was ist los, mein Mädchen?«, frage ich, als ich sie endlich erreicht habe und beruhigend über ihren langen schuppigen Hals streiche.
Und dann sehe ich es in meinem Kopf glasklar vor mir, als hätte ich es selbst erblickt: Land.
Eine Küste, direkt vor uns, in der Ferne von Fackeln beleuchtet und damit eindeutig bewohnt.
»Gut gemacht«, lobe ich meinen Wyvern, ehe ich unter Deck haste, um es der Mannschaft mitzuteilen.
Land. Kier muss es mehrmals wiederholen, damit es alle begreifen. Es klingt fast wie ein Wort aus einer fremden Sprache, auf das wir uns keinen Reim machen können.
Als ich es endlich verstehe, muss ich mich davon abhalten, Kier um den Hals zu fallen.
»Macht euch bereit«, sagt er an die Besatzung gewandt. »Die letzten Meter müssen wir rudern, aber der Schutz der Nacht ist uns sicher.«
Ich tausche einen Blick mit Vangar und Astrid, die bereits aufgesprungen sind, um zu ihren Kojen zu eilen, und mir bedeuten, ihnen zu folgen. Als ich an Kier vorbeigehe, ist es, als würden meine Füße ein Eigenleben entwickeln, denn sie bleiben direkt neben ihm stehen. Sanft, beinahe zögerlich berührt er meine Hand und schickt damit ein wohliges Kribbeln meinen Arm hinauf. Ich erschauere und frage mich, wie ich die letzten Tage ohne dieses Gefühl überstehen konnte. Es fehlt nicht viel und ich hätte mich an ihn gelehnt, um seinen festen Körper an meinem zu spüren und seinen Duft einatmen zu können.
Irgendwo im hinteren Teil meines Bewusstseins warnt mich eine Stimme, dass ich mich unter keinen Umständen auf ihn einlassen darf. Doch mit jedem Atemzug, der erfüllt ist von seinem Duft, mit jeder Sekunde in seiner Nähe wird die Stimme leiser und leiser, bis ich vergesse, warum ich mich von ihm fernhalten muss.
Nein, ich vergesse es nicht. Die letzten Tage habe ich mehr über dieses Gerücht aufgeschnappt, das in der Mannschaft kursiert. Details vermischten sich mit Hörensagen, aber in einer Sache waren sie sich einig: Es stimmt. Kier hat seine Valkra eigenhändig getötet.
Ich entziehe ihm meine Hand und mache einen Schritt von ihm weg. Weiter wollen sich meine Füße aber nicht bewegen. Ein vorsichtiger Blick verrät mir, dass ein Anflug von Schmerz über Kiers Gesicht huscht, und am liebsten hätte ich sofort wieder die Finger nach ihm ausgestreckt. Schnell balle ich die Hände zu Fäusten, um sie von dieser Torheit abzuhalten.
»Was auch immer da draußen auf uns wartet«, murmelt Kier so leise, dass ich ihn über den entstandenen Tumult in der Mannschaft kaum verstehen kann, »versprich mir, dass du auf dich aufpasst.«
Ich schlucke angestrengt. Obwohl ich ihn in den letzten Tagen gemieden habe und auch nun deutlich mache, dass ich seine Nähe nicht will, sorgt er sich um mich. Und ich sorge mich auch um ihn. Der Gedanke, dass dies vielleicht unser letztes Gespräch ist, versetzt mir einen Stich.
Ich öffne den Mund und sage das einzig Richtige. »Nur, wenn du mir das Gleiche versprichst.«
Aus den Augenwinkeln sehe ich ihn lächeln – zurückhaltend, aber seine Mundwinkel heben sich ein Stück. Das Stechen in meiner Brust verschlimmert sich, als mir aufgeht, dass ich der Grund für seine Vorsicht bin. Die letzten Tage kreisten meine Gedanken einzig und allein um ihn. Ich bin unser Gespräch wieder und wieder durchgegangen und habe mich selbst damit gequält.
Mehrmals habe ich den Weg zu seiner Kajüte eingeschlagen, um mit ihm über die Gerüchte zu reden, die die Mannschaft teilweise bestätigte. Ich hörte so viel, dass ich nicht mehr wusste, was stimmte und was hinzugedichtet war, wie es bei unseren Erzählungen der Brauch ist. Ich musste die Wahrheit aus seinem Mund hören. Oder würde er mich mit weiteren Lügen bezirzen, wie Astrid vermutet? Jedes Mal, wenn ich mit ihm reden wollte, spürte ich von überall Astrids und Vangars achtsame Blicke, die jeden meiner Schritte beobachten. Also blieb ich, wo ich war, und versuchte, mich an das Stechen in meiner Brust und die darin schwelende Unsicherheit zu gewöhnen.
Als der Schemen noch darin lebte, empfand ich ein Druckgefühl, als wäre meine Brust nicht groß genug, um einem derart gut genährten Wesen wie ihm genug Raum zu geben. Ich habe dieses Gefühl gehasst, nachdem ich endlich verstanden hatte, woher es rührte. Doch das Stechen, das nun mein ständiger Begleiter ist, wenn meine Gedanken zu Kier wandern, hasse ich noch mehr.
Jetzt gibt es kein dunkles Wesen mehr, dem ich die Schuld dafür geben könnte.
»Wenn wir zurück sind, wartet ein Zettel auf dich«, sagt Kier und reißt mich damit aus meinen wirren Gedanken. »Bran bewacht ihn. Lies ihn aber bitte erst, wenn wir wohlbehalten auf der Rückfahrt sind.«
Meine Mundwinkel zucken und meine Lippen bewegen sich so schnell, dass die Worte heraus sind, ehe ich sie zusammenpressen kann. »Zu Hause unter meinem Kopfkissen liegt auch noch ein Brief von dir, den ich noch nicht lesen durfte. Du spannst mich ganz schön auf die Folter.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob du diesen Brief je lesen solltest.«
»Deine anderen Briefe habe ich alle mehrmals gelesen«, verrate ich ihm, ehe ich die Worte zurückhalten kann. »Wenn du derart geheimnisvoll tust, muss der Brief unter meinem Kopfkissen etwas ganz Besonderes sein. So besonders, dass ich ihn so oft lese, bis ich ihn auswendig kenne?«
Er schenkt mir ein weiteres Lächeln, diesmal ein trauriges. »Wir können wohl besser in Briefen miteinander umgehen. Trotzdem würde ich gern mit dir reden, wenn … das hier vorbei ist. Bis dahin bitte ich dich: Sei vorsichtig.«
Mein verdammtes Herz sollte bei der bloßen Vorstellung, Zeit mit ihm allein zu verbringen, nicht so verflucht schnell schlagen. Doch das tut es.
»Sei du bitte auch vorsichtig«, murmele ich.
Er nickt. »Versprochen.«
Kier wendet sich ab und hastet an Deck.
Mehrmals klatsche ich mir mit den flachen Händen gegen die Wangen, um mich davon abzuhalten, ihm zu folgen. Ich bin schließlich nicht seinetwegen hier, sondern um die nächste oberste Anführerin zu werden. Dafür muss ich in der fremden Welt etwas finden, was den amtierenden Than der Thane derart beeindruckt, dass er keine andere Wahl hat, als mich zu seiner Nachfolgerin zu ernennen.
Und das werde ich. Denn das ist der einzige Grund, warum ich hier bin.
Die gesamte Mannschaft hat sich bereits an Deck versammelt, als ich endlich fertig bin. Nachdem sie mir beim Ankleiden geholfen haben, stritten Astrid und Vangar darüber, ob sie mein Haar lieber offen lassen oder flechten sollen. Schlussendlich haben sie sich für einen Mittelweg entschieden.
Kier beobachtet mich, als ich die Stufen an Deck steige. Ich spüre es immer, wenn er mich ansieht, als wäre sein Blick eine Berührung auf meiner Haut.
Auch er hat sich herausgeputzt und wirkt nun wahrlich wie der Anführer seines Clans. Das schulterlange rabenschwarze Haar hat er ähnlich wie ich an den Schläfen zurückgeflochten. Die rituelle, ebenfalls dunkle Kampfkluft betont seinen muskulösen Körper. Sein Anblick macht so großen Eindruck auf mich, dass ich mich zwingen muss, woanders hinzusehen. Über dieses viel zu schnelle und zu laute Klopfen meines Herzens hinweg vergesse ich manchmal, warum ich ihm nicht vertrauen sollte.
Langsam schält sich die Landzunge aus dem Nebel. Einige Besatzungsmitglieder gehen unter Deck, um die letzten Meter zu rudern, während Kier sich auf Drakkars Rücken schwingt, die bereits ungeduldig mit den Flügeln schlägt.
»Denkt daran«, sagt er laut genug, dass jeder ihn verstehen kann. »Wer auch immer dieses Land bewohnt, ist uns zahlenmäßig überlegen. Wir sind nicht vorrangig hier, um zu erobern, sondern um zu plündern. Geht Kämpfen, wenn möglich, aus dem Weg und reißt euch alles unter den Nagel, was fremd und wertvoll aussieht. Kehrt so schnell wie möglich zum Schiff zurück. Wir greifen im Schutz der Nacht an und brechen bei Sonnenaufgang auf. Wer bis dahin nicht wieder da ist, wird zurückgelassen. Hat das jeder verstanden?«
Obwohl die Mannschaft vergleichsweise klein für eine solche Reise ist – bloß zehn Krieger, zwei Schiffsbauer, Kier, unsere Tierwesen, meine Begleiterinnen und ich –, dröhnt ihr einstimmiger Kriegsschrei so voll und tief, dass sich mir die Härchen im Nacken aufstellen.
Kiers Blick verweilt auf mir, bis ich nicke. Wortlos formt mein Mund: Pass auf dich auf.
Zufrieden bedeutet er Drakkar, dass sie losfliegen soll. Beinahe geräuschlos schwingt der Wyvern sich in die Lüfte und wird kurz darauf von den letzten Ausläufern des Nebels verschluckt.
Ich schwinge mich auf Brans Rücken, der ebenso ungeduldig wie Drakkar darauf wartet, dass es losgeht. Auch ich kann meine Aufregung kaum mehr unterdrücken.
Es ist Äonen her, seit jemand aus meinem Volk den Nebel durchquert hat. Nur halb vergessene Legenden sind von der Welt jenseits unserer Insel übrig. Uns ist es gelungen. Unsere Geschichte wird in den Sagas erzählt werden.
Und ich werde meinem Clan zu neuer Stärke verhelfen.
Ganz gleich, was uns jenseits der Küste erwartet – ich bin bereit, es mit allem aufzunehmen.
Die Besatzung bringt unser Schiff so nah wie möglich an die Küste heran, ohne auf Grund zu laufen. Hier hat sich der Nebel verzogen und ich habe freie Sicht auf das Land, das sich vor uns erstreckt. Während einige Beiboote zu Wasser gelassen werden, entdecke ich Kier und Drakkar, die bereits ihre Kreise an der Küste ziehen.
Wir haben Glück: Nicht weit entfernt vom Strand kann ich einige Lichter ausmachen. Ein Dorf, vielleicht sogar etwas Größeres. Welche Schätze uns wohl an diesen fremden Gestaden erwarten?
Als der Wind ohne Vorwarnung dreht, schlägt uns der Gestank von Asche und verbranntem Fleisch entgegen. Ich wechsele einen Blick mit Astrid und Vangar, die ebenfalls das Gesicht verziehen. In der Nähe einer Siedlung sind solche Gerüche nicht ungewöhnlich, dennoch nistet sich ein ungutes Gefühl in meinen Eingeweiden ein.
Bran, meine Begleiterinnen und ich sind die Letzten, die das Schiff in einem Beiboot verlassen können. Durch das Gewicht meines Bärtierwesens sinkt es beinahe. Die fast schwarzen Wellen schwappen über den Rand herein und sind so kalt, dass sie mir bis in die Knochen zu kriechen scheinen.
Mehrmals muss ich Bran ermahnen, dass er stillsitzen soll, während Astrid und Vangar rudern. Vom Schiff aus kam mir der Weg bis zum Strand nicht so lang vor, und doch sind wir eine halbe Ewigkeit unterwegs. Immer wenn Wasser über den Bootsrand schwappt, will Bran ausweichen und das Boot schlingert. Stumm bete ich zu allen Göttern, die mir einfallen, dass wir den Strand halbwegs trocken und nicht völlig unterkühlt erreichen.
Kiers Begleiter haben sich bereits formiert und eilen auf die Siedlung zu, deren Fackelschein sich deutlich in einiger Entfernung abzeichnet, ehe unser Beiboot endlich im Sand liegen bleibt.
Astrid und Vangar springen sogleich heraus, während ich Bran erst nach gutem Zureden dazu bringen kann, das Boot zu verlassen und sich die Tatzen in den kalten Wellen nass zu machen.
»Ich schwöre«, grummele ich, »wenn das hier vorbei ist, werde ich dich jeden Tag an unserer Küste schwimmen lassen, bis du keine Angst mehr vor Wasser hast.«
Nicht einmal ich, die beinahe im eiskalten Meer ertrunken wäre, fürchte mich davor.
Nachdem Bran endlich festen und trockenen Sand unter den Tatzen hat, beruhigt er sich wieder. Selbst im Dunkel der Nacht fällt mir auf, dass der Strand hier nicht nahezu schwarz ist wie an unserer Küste, sondern hell.
»Wir müssen los, wenn wir noch irgendwas finden wollen«, beschwört mich Vangar.
Astrid nickt bekräftigend. »Bevor Kier und seine Krieger uns alles direkt vor der Nase wegschnappen.«
Ich würde gern argumentieren, dass dieses Land sicherlich groß genug ist, damit wir alle etwas finden, womit wir den obersten Anführer beeindrucken können, doch ich stimme ihnen zu. Wir dürfen nicht weiter zurückfallen. Jedes weitere Zögern könnte mich den Sieg kosten.
Der Vorsprung von Kiers Truppe ist größer als gedacht; keinen einzigen seiner zehn Krieger kann ich noch ausmachen, obwohl das Land flach und einsehbar ist.
Ich muss mich zügeln, um Bran nicht zu einem schnelleren Tempo anzutreiben, bei dem Astrid und Vangar zu Fuß nicht mithalten könnten, so dringend will ich ihnen nachsetzen, um nicht noch weiter zurückzufallen.
Stattdessen konzentriere ich mich auf meine beiden Begleiterinnen. »Denkt daran«, sage ich zu ihnen, als die Mauern der Siedlung in Sichtweite sind. »Wir sind hier, um zu plündern. Überschätzt euch nicht!«
Kier hatte mit seiner Ansprache recht. Zwar sind wir mit dem Ziel aufgebrochen, zu entdecken und zu plündern, aber zunächst sollten wir auskundschaften. Nun, da wir wissen, dass es jenseits der Nebel bewohntes Land gibt, können wir jederzeit zum Erobern mit mehr Kriegern zurückkommen.
Zumindest Kier kann das, denn sein Schiff ist das einzige, dem es seit Generationen gelungen ist, den Nebel zu durchsegeln. Ich werde höchstwahrscheinlich nie wieder einen Fuß an fremde Gestade setzen.
»Als hätten wir uns je überschätzt«, säuselt Astrid.
Je näher wir den Mauern kommen, die die Siedlung umgeben, desto mehr wird mir klar, dass es sich hier nicht um ein einfaches Dorf handelt, wie ich es aus meinem Gebiet kenne. Die steinerne Mauer ist so hoch, dass ich den Kopf in den Nacken legen muss und sich ihr Ende in der Nacht dennoch nicht abzeichnet. Sie erstreckt sich weiter, als mein Blick reicht. Sicherlich wäre sie ein hervorragender Schutz vor Eindringlingen, wären da nicht die vielen Löcher, durch die sogar Bran bequem hindurchpasst.
»Kommt euch das auch seltsam vor?«, fragt Vangar, als sie eines dieser Löcher inspiziert.
»Sieht mir nicht so aus, als hätten sie die Löcher absichtlich dort eingelassen«, sagt Astrid.
»Du meinst, jemand war vor uns da und hat die Mauer zerstört«, murmele ich, ehe ich den Mund verziehe. »Na toll. Kiers Leute können das aber unmöglich gewesen sein. Das hätten wir gehört. Eine solche Mauer durchbrichst du nicht einfach mit einem Fingerschnipsen.«
Astrid wirft mir einen vernichtenden Blick zu, den ich möglichst ungerührt erwidere. Sie muss den Mund nicht öffnen, damit ich weiß, was sie sagen will: Ich darf mich nicht auf Kiers Seite stellen, obwohl ich mit meiner Aussage recht habe.
Irgendetwas stimmt hier nicht. Das wird mir bereits klar, nachdem sich der Nebel gelichtet hat und ich von Drakkars Rücken aus freie Sicht auf das Land habe.
Zwar waren uns die Schicksalsgöttinnen hold und haben uns an bewohnte Gestade geführt, doch der Gestank nach verbranntem Fleisch und Asche raubt mir selbst hier oben schier den Atem.
Schnell erkenne ich auch, woher dieser Gestank rührt: Dicke Rauchschwaden steigen aus der Siedlung auf, die sich direkt vor uns hinter einer großen Mauer erstreckt.
Ich treibe Drakkar an, damit ich die Umgebung ausspähen kann, bevor die Besatzung von Bord gegangen ist. In sicherem Abstand lasse ich meinen Wyvern über die Siedlung gleiten. Je näher ich komme, desto größer wird das Ausmaß der Zerstörung, das sich mir bietet. Die meisten Häuser sind bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die hohe Mauer, von der sich die Einwohner wohl ausreichend Schutz versprochen haben, ist an vielen Stellen zerstört, deshalb gehe ich nicht von einem verheerenden und außer Kontrolle geratenen Feuer aus.
Nein, jemand ist uns zuvorgekommen.
Jemand, dem es nicht bloß darum ging, ein paar Schätze an sich zu bringen.
Hier ging es um Zerstörung und Vernichtung.
Kämpfe und Fehden sind meinem Volk nicht fremd; manche Fehden schwelen derart lang und schlimm, dass sie ganze Familien und Siedlungen auslöschen.
Aber eine solche Zerstörung habe ich noch nie gesehen.
Besonders die Totenstille setzt mir zu. Müssten nicht Einwohner schreien oder um Hilfe rufen? Doch egal, wie tief ich Drakkar über die verfallenen Dächer gleiten lasse, ich höre nichts.
»Zurück zum Strand«, befehle ich ihr. Zügig kommt sie meiner Anweisung nach, als spürte auch sie, dass etwas nicht stimmt.
Zurück am Strand warten meine zehn Krieger bereits auf ihren Einsatz; die beiden Schiffsbauer sind an Bord geblieben. Nachdem Drakkar auf einer nahe gelegenen Ebene gelandet ist, begebe ich mich zu ihnen. Nur wenige Fackeln erhellen ihre Gesichter, doch ich sehe den unendlichen Tatendrang und die Freude darüber, dass sie endlich wieder festen Boden unter den Füßen haben.
Eine solche Freude kenne ich nicht; wenn es nach mir ginge, würde ich für immer auf Drakkars Rücken durch die Lüfte segeln.
Knapp berichte ich ihnen, was ich gesehen habe. Ihre Mienen verdüstern sich bei jedem Wort.
»Es gibt hier nichts mehr zu holen?«, fragt einer von ihnen.
»Das weiß ich nicht«, gebe ich zu. »Ich habe keine Menschen in der Stadt gesehen oder gehört. Gut möglich, dass sie sich in Sicherheit gebracht und ihre Habe in der Eile zurückgelassen haben.«
Das meiste davon müsste verbrannt sein, doch das verschweige ich ihnen. Wir waren wochenlang unterwegs, um dieses Land zu finden. Wenn ich meinen Leuten jetzt sage, dass alles umsonst war … Jeder von ihnen hatte seine eigenen Gründe, mich zu begleiten; die meisten haben sich große Beute versprochen sowie Geschichten, die die Zeit überdauern und die noch in Generationen erzählt werden, sodass sie unsterblich werden.
Wenn ich ihnen sage, dass sie nichts davon erhalten, werde ich ihren sowieso wackeligen Rückhalt endgültig verlieren. Also schenke ich ihnen das Gefühl, das ich zuvor noch verdammt habe: Hoffnung.
»Vor uns liegt eine ganze Stadt«, berichte ich, »die nur darauf wartet, dass wir ihre Schätze finden. Niemand wird sich uns in den Weg stellen.«
Ihre Mienen hellen sich auf, und es gelingt mir wieder ruhig zu atmen.
»Bleibt weitestgehend zusammen«, weise ich sie an. »Wenn ihr eines der Häuser betretet, nehmt mindestens einen anderen mit.«
Halvar nickt, ehe er sich zur restlichen Besatzung wendet. »Ihr habt euren Anführer gehört! Keine Alleingänge! Wir haben nicht die Zeit, euch in den Trümmern zu suchen, wenn niemand weiß, wo ihr hingegangen seid.«
Die anderen antworten mit einem vollen Kriegsschrei, ehe sie auf die Mauern zueilen.
»Und ich komme mit dir«, sagt Halvar.
»Ich bin nicht allein«, entgegne ich, während ich mich erneut auf Drakkars Rücken schwinge.
»Dein Wyvern kann dich nicht vor jeder Dummheit bewahren. Das ist meine Aufgabe.«
Ich will ihm widersprechen, stattdessen heben sich meine Mundwinkel zu einem Lächeln. »Was würde ich nur ohne dich tun?«
Ich erwarte keine Antwort von ihm, denn ich kenne sie – die bittere, dunkle Antwort, was mit mir geschehen wäre, wenn Halvar nicht unumstößlich zu mir gehalten hätte. Wenn er mir nicht jeden Fehltritt, jede törichte Entscheidung vergeben und mich vor neuen bewahrt hätte.
Ich hätte den leichten Weg gewählt und aufgegeben, ungeachtet der Tatsache, was dann mit meiner Seele geschehen wäre.
Auch jetzt würde ein Teil von mir am liebsten zum Schiff zurückfliegen, um sich dort zu verkriechen, bis wir die Heimreise antreten. Ich fürchte mich nicht vor dem, was mich in der zerstörten Stadt erwarten könnte, aber ich habe gelernt, dass die Götter nie etwas Gutes für mich bereithalten. Fast jedes vermeintliche Geschenk hat sich als Fluch entpuppt.
Diese Stadt, dieses Land wird keine Ausnahme bilden.
Doch wenn ich jetzt umdrehe, hätte ich mich auch gleich nach Vaters Tod irgendwo einrollen und sterben können. Es wäre einfacher gewesen.
Aber ich bin noch hier, und ich werde für die wenigen Geschenke, die die Götter mir machten, dankbar sein und sie beschützen. Ich werde meinen einzigen Freund und mein Tierwesen nicht allein in diese unbekannte Stadt ziehen lassen.
Nachdem wir die Mauer hinter uns gelassen haben, rechne ich bei jedem Schritt mit einem Angriff. Meine Äxte halte ich fest umklammert, während ich nach links und rechts spähe.
Um uns herum ragen halb zerfallene und vom Feuer gezeichnete Häuser auf. Jeder Atemzug ist erfüllt von Rauch und Asche.
Mit einem Handzeichen bedeute ich Astrid und Vangar, dass sie das Haus zu unserer Rechten betreten sollen, während ich ihnen mit Bran Deckung gebe.
»Nichts«, sagt Vangar, nachdem sie wieder zu mir getreten ist.
Das habe ich befürchtet. »Die Randgebiete sind völlig niedergebrannt. Wir müssen weiter ins Innere der Siedlung.«
Einige Meter über uns zieht Drakkar ihre Kreise. Meine Begleiterinnen mustern den Wyvern mit finsterem Blick.
»Und wir müssen uns beeilen«, grummelt Astrid.
Nach einer Weile erreichen wir einen mit Steinen gepflasterten Platz, der um ein hohes Gebäude angelegt ist. Einst muss das Gebäude bis in den Himmel hinaufgeragt haben; nun ist es kaum größer als unser Langhaus. Dennoch zeugen die aufwendigen Verzierungen im Stein, die nicht dem Feuer zum Opfer gefallen sind, von Reichtum und Wohlstand.
Wenn wir etwas von Wert finden, dann in diesem Haus.
Ich bedeute Bran, dass er hier warten soll. Er will mit einem Brummen gegen meinen Befehl aufbegehren, doch ich bleibe hart. In diesem engen Gebäude wäre er uns nur im Weg.
»Findet ihr es nicht auch seltsam, dass wir nirgends auf Leichen stoßen?«, fragt Astrid, nachdem ich zu ihr und Vangar getreten bin.
Ihre Partnerin nickt. »Was auch immer mit dieser Siedlung geschehen ist, bei dem Ausmaß der Zerstörung muss es Tote gegeben haben.«
»Das braucht uns nicht zu kümmern«, sage ich, obwohl mir ein eisiger Schauer den Rücken hinabrinnt.
Denn sie haben recht: Selbst wenn sich Aasfresser über die Leichen hergemacht haben, müssten wir noch Überreste finden.
Ich schiebe den Gedanken schnell beiseite und betrete das Gebäude. Einst muss es einer wichtigen Familie gehört haben, denn einige Malereien an den Wänden und feine Stoffe auf dem Boden sind nicht den Flammen anheimgefallen. Steinstufen führen sowohl in einen oberen als auch in einen unteren Stock.
»Ihr seht euch hier oben um«, sage ich zu meinen Begleiterinnen. »Ich gehe nach unten.«
»Wir sollten uns nicht aufteilen«, sagt Vangar.
Doch Astrid zuckt mit den Schultern. »Hier ist niemand. Was soll schon passieren?«
Das Untergeschoss ist erwartungsgemäß finster. Zum Glück haben mir Astrid und Vangar eine Fackel überlassen. Dennoch muss ich mich Stück für Stück über den Schutt vorantasten.
Oben konnte ich das ungute Gefühl, das in meinem Nacken lauerte, beinahe völlig abschütteln; hier unten fällt es hinterrücks über mich her. Mehrmals erstarre ich vom Geräusch meiner eigenen Schritte oder meines unregelmäßigen Atems.
Reiß dich zusammen!, schimpfe ich stumm mit mir, während ich mich weiter vorwage.
Doch ich beruhige mich nicht. Vielmehr habe ich das Gefühl, dass die Wände auf mich zurücken und mich zwischen sich zerquetschen, wenn ich nicht augenblicklich umdrehe und zurück nach oben haste, wo ich den Nachthimmel über mir habe.
Ich halte mir vor Augen, dass es mir bloß ungewohnt vorkommt, weil unsere Gebäude nicht mehr als eine Etage haben. Lediglich Elvis Haus verfügt für ihre Kräuter und Tinkturen über einen Keller, den ich jedoch meide. Zu viele Valkra-Rituale hat sie dort unten vorbereitet. Zu viele magische Formeln gesprochen. Zu viele Götter angerufen, die ich kaum vom Namen her kenne. Die Luft dort unten muss geschwängert sein von Kräutern, Magie, Heilung und Tod.
Nein, Elvis Keller würde ich nicht einmal betreten, wenn mein Leben davon abhinge.
Ich lenke mich von diesem Gedanken und meiner Angst ab, indem ich meine Umgebung näher betrachte. Nichts deutet darauf hin, dass hier bis vor Kurzem noch Menschen gelebt haben. Ich entdecke nirgends Vorräte, die in aller Eile zurückgelassen wurden. Auf den größtenteils zerstörten Möbeln hat sich eine dicke Staub- und Ascheschicht gebildet.
Doch woher stammt der Gestank nach verbranntem Fleisch, wenn nicht von Vorräten?
Ich wünschte, ich hätte diese Frage niemals gestellt.
Denn ich erhalte die Antwort, als ich einen Raum betrete, der so riesig ist, dass mein ganzer Clan problemlos darin unterkommen würde. Wahrscheinlich sogar zusammen mit Kiers Clan. Nur flüchtig frage ich mich, welche Menschen dazu fähig waren, so riesige Bauten zu errichten. Dann wird meine Aufmerksamkeit von einem glimmenden Scheiterhaufen in der Mitte des Raumes gefesselt. Verkohlte Überreste, die bloß mit viel Fantasie als menschlich zu erkennen sind, sind an einen Pfahl gebunden, der aus dem Scheiterhaufen herausragt.
»Was ist mit dir, Vlengan?«
Ich zucke zusammen, als plötzlich eine tiefe, gnadenlose Stimme in dem leeren Gemäuer widerhallt. So schnell ich kann, presse ich mich mit dem Rücken gegen die nächstbeste Wand. Mein Herz schlägt so panisch, dass ich mir sicher bin, dass man es bis hinaus in die zerstörte Stadt hören kann.
»Hast du etwas gefunden?«, fährt die Stimme in einem Tonfall fort, bei dem sich mir die Nackenhaare aufstellen.
Ich habe besonders Kier, aber auch den obersten Anführer dafür bewundert, wie sie mithilfe ihrer Stimmen und der Aura, die sie verströmen, alle um sich herum beeinflussen können – mich ebenfalls.
Der Besitzer dieser Stimme kann das auch, doch er ruft in mir keine Bewunderung hervor, sondern Angst. Eine solche Angst, wie ich sie noch nie zuvor verspürt habe.
Jeder klare Gedanke in mir schreit, dass ich sofort verschwinden soll, aber ich bleibe wie angewurzelt stehen. Bisher habe ich nichts als Trümmer und Schutt gefunden. Wenn es jedoch Überlebende gibt, müssen sie etwas besitzen, was ich mitnehmen kann. Irgendetwas von Wert. Vielleicht sind dieser Mann und derjenige, mit dem er redet, die letzten Einwohner dieser Siedlung.
Und somit meine letzte Chance, als Siegerin aus dem Wettstreit hervorzugehen.
Mit der rechten Hand ziehe ich eine meiner Äxte aus dem Gürtel und schiebe mich wieder ein Stück näher zum Eingang des Raumes.
»Ich warte auf eine Antwort, Vlengan«, grollt die Stimme. Meine Füße wollen lieber die entgegengesetzte Richtung einschlagen, doch ich zwinge sie, sich weiter nach vorn zu bewegen. »Oder soll ich dich auf ähnliche Weise zum Reden bringen wie Locren?«
Ich spähe in den Raum. Im hinteren Bereich steht ein steinernes Ungetüm von einem Thron auf einem Podest, zu dem mehrere Stufen hinaufführen. Und davor kniet jemand. Im ersten Moment halte ich es für Kleidung, doch als sich die Gestalt aufrichtet, wird mir klar, dass ihre Haut diesen gräulichen Ton besitzt.
»Ich habe nichts gefunden, mein Fürst«, sagt die Gestalt zu einer weiteren, die auf dem Thron lümmelt. Aus der Entfernung kann ich weder ihr Gesicht noch klare Umrisse erkennen, aber ich bin mir sicher, dass etwas nicht stimmt. »Wir haben alle Bewohner dieses Reichs unterworfen. Es gibt niemanden mehr, den wir …«
Die Gestalt auf dem Thron schlägt mit der Faust auf die Armlehne. Wenn Haut auf Stein trifft, sollte es kaum ein Geräusch verursachen, und doch scheint der riesige Raum zu erzittern. Ich ebenfalls.
»Und warum ist ihre Armee dann noch nicht vollständig?«
Die Gestalt vor dem Thron sackt zurück auf die Knie. »Das weiß ich nicht. Vielleicht sind noch nicht alle Seelen bei ihr angekommen und …«
»Das kannst du sie gleich selbst fragen.«
Im nächsten Moment steht der Kniende lichterloh in bläulich schimmernden Flammen. So schrecklich seine Schreie auch sind, kann ich den Blick nicht abwenden. Als hinge mein eigenes Leben davon ab, sehe ich mit aufgerissenen Augen dabei zu, wie er sich im verzweifelten Versuch, die seltsamen Flammen zu löschen, auf dem Steinboden hin und her wirft. Doch vergeblich; zwar fühlt es sich an wie eine kleine Ewigkeit, aber vermutlich vergehen bloß Sekunden, bis er endlich verstummt. Nachdem sich die Flammen in Luft aufgelöst haben, ist kaum mehr als ein Häufchen Asche von ihm übrig.
Was auch immer das für Wesen sind, menschlich sind sie auf keinen Fall.
Ich mache einen Schritt zurück, weg von dem riesigen Raum. Sosehr ich auch gewinnen und die nächste oberste Anführerin werden will, habe ich doch keine Todessehnsucht.
Obwohl ich mir sicher bin, kein Geräusch verursacht zu haben, ruckt der Kopf des verbliebenen Wesens in meine Richtung.
»Ich weiß, dass du da bist. Ich kann dich riechen.«
So schnell ich kann, wirbele ich herum und suche mein Heil in der Flucht. Ich denke nicht nach, aus welcher Richtung ich vorhin gekommen bin, sondern renne nur, so schnell mich meine Füße tragen.
Ich habe es beinahe durch den Korridor geschafft, als aus dem Nichts vor mir eine blaue Feuerwand erscheint. Hektisch mache ich einen Satz zurück, um nicht ebenso verbrannt zu werden wie das Wesen eben.
Die Feuerwand rückt auf mich zu. Langsam zwar, aber doch so, dass ich einen weiteren Schritt nach hinten in Richtung des hohen Raumes machen muss. Das Herz schlägt mir bis zum Hals, während ich mich umsehe. Der verdammte Korridor nimmt nirgends eine Abzweigung! Und andere Zimmer kann ich ebenfalls nicht entdecken.
Ich stehe also vor der Wahl jämmerlich zu verbrennen oder zurück zu dem Furcht einflößenden Wesen zu gehen.
Während ich einen Fluch ausstoße, drehe ich mich um und schreite erhobenen Hauptes in den hohen Raum. Jeder Muskel in meinem Körper zittert; ob vor Angst oder Anspannung, vermag ich nicht zu sagen.
Als ich den Raum betrete, lege ich beide Hände demonstrativ an die Äxte, die in meinem Gürtel stecken. Ich verlangsame meine Schritte so weit, dass es wirkt, als würde ich mich langweilen. Tatsächlich nutze ich die Zeit, um mich möglichst unauffällig umzusehen. In der Mitte des Raumes steht der Scheiterhaufen. Vor dem Podest liegt die Asche des Wesens. Ich gebe mir Mühe, beides auszublenden, und konzentriere mich auf die wichtigen Dinge. Abgesehen von dem Korridor, aus dem ich eben kam, führen noch zwei weitere Gänge von dem Raum weg. Ich habe keine Ahnung, wohin sie führen, doch alles ist besser, als hierzubleiben.
Doch das Wesen, dem ich kaum Beachtung geschenkt habe, scheint meine Gedanken zu lesen, denn im nächsten Moment erscheinen auch an den anderen Ausgängen bläulich flackernde Feuerwände.
»Du willst schon gehen?«, raunt das Wesen. »Das wäre aber schade.«
Nun drehe ich den Kopf in seine Richtung und wünsche im nächsten Moment, ich hätte es nicht getan.
Seine Körperform mutet menschlich an: zwei Beine, zwei Arme, ein Torso und ein Kopf. Er ist auch in etwa so groß wie ein Mensch; ein Stück größer als Kier vielleicht.
Damit enden die Gemeinsamkeiten jedoch. Das, was seine Haut sein müsste, wirkt eher wie ein dunkelgrauer, zerknitterter Überzug. Bei diesen tiefen Furchen von Falten zu reden wäre eine Untertreibung. Es ist, als hätte sich die Haut nach innen gestülpt, nur um kurz darauf wieder hervorzukommen.
Darunter scheinen sich keine Muskeln zu befinden; das Wesen wirkt knöchern und abgemagert, und doch zweifle ich nicht eine Sekunde an seiner Kraft.
Bis auf einen zerfetzten schwarzen Lendenschurz trägt es weder Kleidung noch Waffen.
Ich muss mich dazu zwingen, den Blick zu heben und in sein Gesicht zu schauen. Beinahe erinnert es mich an das Antlitz des Schemens. Ein lippenloser Mund, der bei einem trägen Lächeln spitze Zähne entblößt. Ein mit grauer Haut überspannter Schädel voller Furchen und scharfer Kanten. Unheimliche gelb leuchtende Augen, die so tief in den Höhlen liegen, dass das Weiße um die Iriden schwarz wirkt. Lichtes hellgraues Haar, das in verfilzten Strähnen bis zu seinen schmalen Schultern fällt.
Das Wesen nimmt einen tiefen Atemzug. Wie es mit dieser Nase, die ähnlich wie bei einer Schlange bloß aus zwei Löchern besteht, etwas riechen will, ist mir schleierhaft, dennoch weiche ich ein winziges Stück zurück. Mit einem zufriedenen Lächeln betrachtet es mich.
»Ich wusste doch, dass ich dich rieche.«
Es mag sein, dass ich in den letzten Wochen auf dem Schiff nicht sehr stark auf Körperhygiene geachtet habe – mein unfreiwilliges Bad im Meer ausgenommen –, aber ich bezweifle, dass es mich über mehrere Meter hinweg wittern konnte.
»Was bist du?«, frage ich und bin stolz, dass meine Stimme kaum zittert.
Das Wesen macht einen Schritt auf mich zu. Obwohl sein Körper nur aus Haut und Knochen zu bestehen scheint, wohnt seinen Bewegungen etwas Kraftvolles inne. Ich gebe mir die größte Mühe, es nicht zu tun, aber mein Körper verweigert den Befehl und weicht vor dem Wesen zurück. Auch das Zittern, das von mir Besitz ergriffen hat, kann ich kaum noch unterdrücken. Alles an diesem scheußlichen, fremdartigen Wesen schreit Gefahr.
»Warum so schüchtern?«, fragt es. »Wir sind uns nicht unähnlich, du und ich.«
Ich halte eine Axt vor mich. »Dass ich nicht lache!«
»Du riechst nach Schatten.« Erneut schnuppert es. »Du bist das Gefäß eines Schemens.«
Ich schlucke angestrengt. Zu viele Fragen wirbeln wild durch meinen Kopf, doch ich kann mir nicht vorstellen, dass das Wesen eine davon beantworten wird.
Ich setze einen weiteren Fuß zurück, ohne das Wesen aus den Augen zu lassen. »Ich werde jetzt gehen.«
Erneut entblößt es seine spitzen Zähne. »Das glaube ich nicht. Ich habe lange auf dich gewartet.« Mit einem Fingerzeig beschwört es hinter mir eine erneute Feuerwand und schneidet mir damit den Rückzugsweg ab. »Wir werden uns prächtig amüsieren.«
Als es einen weiteren Schritt auf mich zu macht, zögere ich nicht länger, hole mit meiner Axt aus und will sie ihm direkt in den Brustkorb rammen. Doch kurz bevor meine Schneide ihr Ziel trifft, wird der Griff meiner Waffe so heiß, dass ich keine andere Wahl habe, als ihn mit einem Aufschrei loszulassen. Klirrend fällt die Axt zu Boden, blaue Flammen züngeln am Ärmel meines Hemdes, und ich schlage sie hastig mit der anderen Hand aus. Sofort bilden sich auf meiner Handfläche und dort, wo eben die Flammen waren, kleine schmerzende Bläschen.
»Warum so feindselig?«, höhnt das Wesen. »Ich wollte mich gerade mit dir anfreunden.«
Ich presse eine Hand auf die Stelle, an der sich die Flammen in meine Haut gefressen haben und von wo aus nun ein pochender Schmerz meinen Arm hinaufschießt. Mit zusammengebissenen Zähnen starre ich dem Wesen entgegen, während ich fieberhaft nach einem Ausweg suche.
»Was willst du?«, frage ich.
Es streckt die Hand aus und deutet mit einem knochigen Finger auf mich. »Deine mit Schatten befleckte Seele. Und die Seelen all jener, die du kennst.«
Nichts. Hier ist, verdammt noch mal, nichts. Keine einzige Goldmünze. Kein Schmuck. Nicht einmal ein verfluchter Wandteppich!
Ich werfe Halvar, der sich einige Meter von mir entfernt durch einen Haufen Schutt wühlt, einen Blick zu. In seiner Miene entdecke ich die Frustration, die zweifelsohne auch in meiner zu finden ist.
Ich habe diese Reise nicht unternommen, um möglichst viele Reichtümer zu finden. Sogar ohne den Befehl des obersten Anführers wäre ich eines Tages losgesegelt, um zu entdecken und mir damit einen Namen zu machen, der würdig ist, in unseren Sagas genannt zu werden. Aber dieses zerstörte Land ist es nicht einmal wert, als Entdeckung bezeichnet zu werden.