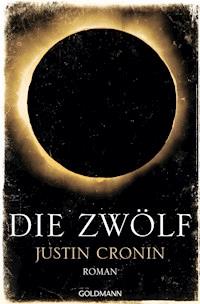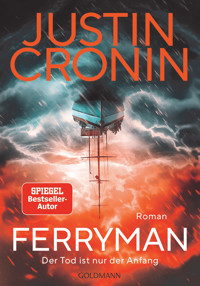
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Es ist fast unmöglich, dieses Buch aus der Hand zu legen. Spannend, geheimnisvoll und absolut fesselnd. Ein Buch, in dem man sich verlieren kann.« Stephen King
Ein mitreißender Roman, der unsere Realität genial infrage stellt - für Fans von Westworld, Inception und Snowpiercer.
Die Inseln von Prospera liegen in einem riesigen Ozean, idyllisch abgeschieden vom Rest der Menschheit. Die Bewohner genießen ein unbeschwertes Leben voller Privilegien, umsorgt von dienendem Hilfspersonal. Neigt sich die Lebenszeit der Prosperaner dem Ende zu, werden sie auf eine geheimnisvolle Nachbarinsel geschickt, um dort neu gebootet zu werden und ein weiteres Leben zu beginnen. Proctor Bennett ist der Fährmann, der die Prosperaner dorthin geleitet. Er hat seine Arbeit nie in Frage gestellt, bis er eines Tages eine kryptische Nachricht erhält. Sie bestätigt, was er insgeheim immer befürchtet hat – denn sie birgt eine Wahrheit, die das Schicksal der Menschheit auf ewig verändern wird ...
»Ein gewichtiges Buch! Justin Cronins Fantasie ist grenzenlos, sein schriftstellerisches Können beneidenswert.« Kirkus Reviews
»Besser kann ein Roman nicht sein, so spannend erzählt, dass man den Rest des Lebens auf Eis legt, bis man die letzte Seite gelesen hat.« Blake Crouch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 832
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Die Inseln von Prospera liegen in einem riesigen Ozean, idyllisch abgeschieden vom Rest der Menschheit. Die Bewohner genießen ein unbeschwertes Leben voller Privilegien, umsorgt von dienendem Hilfspersonal. Neigt sich die Lebenszeit der Prosperaner dem Ende zu, werden sie auf eine geheimnisvolle Nachbarinsel geschickt, um dort neu gebootet zu werden und ein weiteres Leben zu beginnen. Proctor Bennett ist der Fährmann, der die Prosperaner dorthin geleitet. Er hat seine Arbeit nie infrage gestellt, bis er eines Tages eine kryptische Nachricht erhält. Sie bestätigt, was er insgeheim immer befürchtet hat – denn sie birgt eine Wahrheit, die das Schicksal der Menschheit auf ewig verändern wird …
Weitere Informationen zu Justin Cronin finden Sie am Ende des Buches.
Justin Cronin
Ferryman
Der Tod ist nur der Anfang
Roman
Aus dem Amerikanischen von Rainer Schmidt
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »The Ferryman« bei Ballantine Books, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2024
Copyright © der Originalausgabe 2023 by Justin Cronin
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Claudia Jürgens
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © FinePic®, München
KN · Herstellung: ast
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-23812-4V003
www.goldmann-verlag.de
Für die Familien
Er zog vorbei am Feuerrand von Ort und Zeit:
Den lebenden Thron, den saphirhellen blauen,
Wo Engel zittern, wenn sie ihn nur schauen,
Den sah er, doch, bestrahlt von Licht in grenzenloser Pracht,
Schloss er die Augen in endloser Nacht.
Thomas Gray, »The Progress of Poesy«
Inhalt
Prolog
I Der letzte schöne Tag
II Das Unwetter
III Das verlorene Mädchen
IV Die Nursery
V Der Annex
VI Das Vestibül
VII Der Mann, der den Himmel zerbrach
VIII Die Verschwundenen
Epilog
Danksagung
Prolog
Der Tag bricht an, als sie sich aus dem Haus schleicht. Die Luft ist kühl und frisch, und die Vögel singen in den Bäumen. Überall das Rauschen des Meeres, das große Metronom der Welt, das seinen Takt schlägt unter einem samtenen Himmel und schwindenden Sternen. In ihrem blassen Nachthemd streift sie durch den Garten. Ihr Schritt ist nicht zögernd, nur ohne Hast und beinahe liebevoll. Wie sehr muss sie einem Geist gleichen, diese einsame Gestalt, die dort zwischen den Blumenbeeten schwebt, den plätschernden Sprungbrunnen und Hecken, die so exakt getrimmt sind, dass die scharfen Kanten blutige Verletzungen hervorrufen könnten. Das Haus hinter ihr ist dunkel wie ein Monolith, aber bald werden die dem Meer zugewandten Fenster von Licht schwellen.
Es ist nicht leicht, ein Leben zu verlassen, ein Zuhause. Die Einzelheiten hinterlassen Gräben in dir – Gerüche, Geräusche, Assoziationen, Rhythmen. Das Knarren der Bodendiele auf dem Korridor im ersten Stock. Der Geruch, der dich am Ende eines Tages im Eingangsflur begrüßt. Der Lichtschalter in einem dunklen Zimmer, den die Hand automatisch findet. Sie hätte den Weg zwischen den Möbeln mit verbundenen Augen gefunden. Zwanzig Jahre. Sie würde noch zwanzig nehmen, wenn sie könnte.
Nach dem Essen hatte sie Malcolm die Neuigkeit mitgeteilt. Ein gutes Essen, wie er es liebte: gegrillte Lammkoteletts, Risotto mit Käse, in etwas Öl gebratener Spargel, ein feiner Wein. Kaffee und Petits Fours zum Nachtisch. Sie hatten beschlossen, draußen zu essen; der Abend war so schön. Eine Blumenorgie auf dem Tisch, das Tick-Tack der See, glänzender Kerzenschein auf ihren Gesichtern. Du wirst es nicht vorher wissen, wann es so weit ist, sagte sie zu ihm. Ich werde einfach nicht mehr da sein. Machtlos sah sie zu, wie er den Schlag einsteckte und das Gesicht in die Hände legte. So bald? Muss es jetzt sein? »Komm ins Bett mit mir«, forderte sie ihn auf – ihr Körper würde ihm sagen, was Worte nicht sagen konnten –, und nachher hielt sie ihn fest, als er weinte. Die dunklen Stunden vergingen. Endlich umfing ihn die Mattigkeit der Trauer. In ihren Armen schlief er ein.
Leb wohl, Garten, denkt sie. Leb wohl, Haus. Lebt wohl, Vögel und Bäume und lange, gemächliche Tage, und wenn ich schon dabei bin, lebt wohl, all ihr Lügen, die ich erzählen musste.
Sie wird älter. Alles, was eine Frau tun kann, hat sie getan. Die Cremes und Extrakte. Das stundenlange Fitnesstraining und die gewissenhaft eingehaltene Diät. Die kleinen, diskreten Eingriffe, von denen nicht einmal Malcolm etwas weiß. Jedes Mittel hat sie angewandt, um das Fortschreiten der Jahre zu verlangsamen, aber damit ist es vorbei. Sie hatte beschlossen zu warten, bis jemand eine Bemerkung darüber machte, und dann, aus heiterem Himmel, passierte es.
»Gibst du denn auch acht auf dich, Cynthia?«
Sie hatten eben Tennis gespielt, die übliche Dienstagsgruppe, ein Dutzend Frauen, allesamt gute Spielerinnen, und danach Gläser mit Eistee und Salate, an denen sie nur herumpickten, auch wenn sie noch so hungrig waren. Sie hatte nicht gut gespielt. Tatsächlich hatte sie sogar ziemlich schlecht gespielt. Ihre Knie waren schmerzhaft schwerfällig, die Sonne war zu intensiv und zehrte an ihren Kräften. Es war die Zeit, die sie in den Gliedern spürte, ihr unerbittliches Vorrücken, während alles um sie herum, die Körper und Gesichter ihrer Freundinnen, sich nur sanft schleichend voranbewegte.
Ach ja, die Frage. Ihre Freundin wartete auf eine Antwort. Ihr Name war Lauralai Swan. Sie war fast sechzig, sah aber aus wie dreißig: straffe Haut, schlanke Glieder mit vom Yoga modellierten Muskeln, üppiges Haar. Selbst ihre Hände sahen gut aus. War die Frage ein Ausdruck aufrechter Sorge, oder war da etwas Dunkleres? Cynthia hatte gewusst, dass dieser Tag kommen würde, und dennoch war sie überrascht und hatte keine Antwort parat. Ihr Verstand sortierte eilig die Möglichkeiten, und gerade noch rechtzeitig fiel ihr etwas ein. Was sie brauchte, war ein Scherz.
»Glaub mir«, sagte sie, »wenn du mit Malcolm verheiratet wärst, würdest du auch müde aussehen. Der Mann akzeptiert kein Nein als Antwort.«
Sie lachte und hoffte, Lauralai werde mitlachen, und nach einer angespannten Pause tat sie es auch; alle taten es, und dann redeten alle von ihren Ehemännern und erhöhten den Einsatz mit jeder Geschichte, die am Tisch die Runde machte, indem sie ihre Männer sogar mit ehemaligen Liebhabern und Ex-Gatten verglichen. Wer war besser, aufmerksamer im Bett? Wer ließ seine feuchten Joggingshorts im Bad auf dem Boden liegen? Wer quetschte die Zahnpastatube in der Mitte zusammen?
Es war alles in allem ein angenehmer, sonniger Nachmittag, an dem sie alle redeten, wie Frauen es gern taten. Aber innerlich spürte Cynthia, wie sich ein tiefes Loch auftat. Gibst du denn auch acht auf dich? Was sich da auftat, war die Grube unter dem Henkersstrick.
Lebt wohl, all das und ihr alle, die ihr mir gegeben habt, was als Leben gelten konnte.
Und doch: Nicht die Partys und Konzerte werden ihr fehlen, nicht das gute Leder ihrer Taschen und Schuhe, nicht die langen Mahlzeiten mit gutem Essen und feinem Wein und spritziger Unterhaltung bis tief in die Nacht hinein – nichts davon. Was ihr fehlen wird, ist der Junge. Sie denkt an zwei Tage zurück, einer am Anfang, einer am Ende. Der erste war der Tag, an dem er zu ihr kam. Sie hatte erwartet, nichts zu empfinden. Ein Mündel zu adoptieren war eins der Dinge, die eine Person in ihrer Position nun einmal tat. In diesem Sinne war der Junge eine Art Dekor wie das Sofa in ihrem Wohnzimmer oder die Bilder an ihren Wänden. Oh, du hast ein Kind adoptiert!, würden die Leute sagen. Das muss ja so aufregend sein! Sie hatten natürlich ein Bild von ihm gesehen. Man wählte ja nicht blind. Aber als Cynthia ihn da erblickte, wie er an der Reling der Fähre stand, veränderte sich etwas. Er war größer, als sie erwartet hatte, mindestens eins achtzig, was noch betont wurde durch seine neutrale, schlecht sitzende Kleidung, die an einen Pyjama oder an den OP-Anzug eines Arztes denken ließ. Die anderen Mündel starrten mit unscharfem, ausdruckslosem Blick über die Reling, er als Einziger sah sich um und betrachtete die Menschenmenge und die Gebäude der Stadt und sogar den Himmel, und er legte den Kopf in den Nacken, um die Sonne im Gesicht zu spüren. Sein Haarschnitt, das bemerkte sie sofort, war grässlich, als hätte ein Blinder ihn zu verantworten. Das war etwas, worum sie sich sofort würde kümmern müssen: dass der Junge eine anständige Frisur bekam.
»Glaubst du, das ist er?«, fragte ihr Mann, und als sie nicht antwortete, wandte er sich an die Adoptionsagentin, die sie zur Fähre begleitet hatte: »Ist das unser Sohn?«
Aber Cynthia nahm dieses Gespräch nur nebelhaft wahr. Die Stimme ihres Mannes, das Gemurmel der Menge, Sonne und Himmel und Meer: Alles schien zu verblassen angesichts der lebhaften Realität des Jungen. Fragen erwachten in ihrem Kopf: Was würde er wohl gern essen? Was würde er gern anziehen? Welche Musik hören, was für Bücher lesen? Und woher kam dieser plötzliche Impuls, sich über diese Dinge Gedanken zu machen? Seine Existenz beruhte ausschließlich auf Papieren. Warum also verspürte sie diese plötzliche Woge von Zärtlichkeit für dieses beliebige Wesen? Die Fähre vollendete ihre letzten Manöver, die Mündel versammelten sich oben an der Gangway. Zurückgehalten durch ein Absperrseil, durfte keiner der Vormünder sich nähern. Der Junge – ihr Junge – war der Erste in der Reihe. (»Ihr« Junge? War es so schnell gegangen?) Er hielt den Blick geradeaus gerichtet, als er mit gemessenen Schritten und der Hand auf dem Geländer zum Kai herunterkam. Ebenso gut hätte er aus einem Raumschiff auf eine fremde Welt heruntersteigen können, so methodisch war jede Bewegung seines Körpers. Am Fuß der Gangway erwarteten ihn ein Mann in einem dunklen Anzug und mit einem Clipboard und eine Frau in einem Laborkittel und mit einem Lesegerät in der Hand. Der Mann im Anzug sprach nicht mit dem Jungen; stattdessen entblößte er dessen Arm und streckte ihn, und seine Begleiterin, vermutlich eine Ärztin, schob die Kabel in die Ports am Monitor. Dann folgte eine Pause, in der die Ärztin die Daten studierte. Ein erwartungsvolles Schweigen hatte sich auf die Menge gesenkt. Endlich blickte sie auf und wandte sich an die Wartenden.
»Würden die Vormünder bitte vortreten?«
Die Agentin hakte das Seil los, und Cynthia und Malcolm traten vor. Der Junge tat das Gleiche. Die drei trafen sich in der Lücke zwischen der Menschenmenge und der Gangway. Der Junge sprach als Erster.
»Guten Tag«, sagte er freundlich. »Ich bin Proctor, euer Mündel.«
Er streckte die Hand aus. Es war eine Geste, für die er offensichtlich gecoacht worden war.
»Na, da bist du ja, Sohn«, sagte ihr Mann. Er strahlte und schüttelte dem Jungen eifrig die Hand. »Es ist schön, dich endlich kennenzulernen.«
»Hallo, Vater«, antwortete der Junge. Er wandte sich Cynthia zu und streckte wieder die Hand aus. »Und du musst meine Mutter sein. Es freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen.«
Deine Bekanntschaft! Sie wollte lachen und hätte es beinahe getan. Kein spöttisches Lachen, sondern ein Lachen reinster Heiterkeit. Wie höflich er war! Wie eifrig bestrebt, brav zu sein, ihnen zu gefallen, eine Familie aus ihnen zu machen! Und sein Name. Proctor, vom lateinischen procurator (das sollte sie später erfahren; ihr Mann wusste solche Dinge): der Verwalter, der Manager, einer, der sich um die Angelegenheiten anderer kümmerte. So perfekt! Sie schüttelte die Hand des Jungen nicht, sondern umschloss sie mit ihren beiden Händen und hielt sie fest, fühlte ihre Wärme und ihren lebendigen Puls. Sie sah ihm in die Augen. Ja, da war etwas, etwas anderes. Etwas … Seelenvolles. Sie fragte sich, was für ein Mann er vorher gewesen war. Wovon hatte er gelebt? Wer waren seine Freunde gewesen? Hatte er viele Frauen gehabt?
War er glücklich gewesen?
»Cynthia, du kannst den Jungen jetzt loslassen.«
Da lachte sie und ließ ihn los. Du musst meine Mutter sein. Er war noch ein Junge, eben wiedergeboren in die Welt – ein Meter achtzig groß, aber ein Junge nichtsdestoweniger –, und das würde sie sein. Sie würde seine Mutter sein.
Es ist wahr, denkt sie jetzt, als sie den abschüssigen Rasen zum Weg hinuntergeht. Der Himmel wird sanfter, die Sterne sind fortgeschwemmt, und am Horizont ist ein leuchtender Lichtstreif erschienen. Das war der Tag, an dem sie den Jungen in ihr Herz geschlossen hat. Und nicht nur den Jungen, sondern auch Malcolm. Dieses strenge, moralische Wesen, diesen Liebhaber der Codes und Protokolle – es war, als hätte man einen Stab über sein Leben geschwenkt, als wäre er ein Pinocchio im Erwachsenenformat, der durch plötzliche Liebe in einen Menschen verwandelt worden war. Das virile Grinsen in seinem Gesicht, als er dem Jungen die Hand geschüttelt hatte; das Leuchten der Freude in seinem Blick, als er dem Jungen sein Zimmer gezeigt hatte, das Zimmer mit dem Bett und dem Schreibtisch aus Teakholz und den Bildern von Schiffen an den Wänden und dem alten, auf das Meer gerichteten Teleskop auf seinem Stativ; und die Art, wie er beim Abendessen mit allem viel Aufhebens gemacht hatte, weil er wollte, dass der Junge sich willkommen fühlte, wie er ihn geduldig in den Gebrauch von Messer und Gabel und Serviette eingewiesen hatte; und schließlich am Ende des Tages, als Malcolm die Zimmertür des Jungen mit einem gedämpften Klicken geschlossen hatte, da hatte er sie im Gang stehen sehen und einen Finger an die Lippen gelegt: Sschhhh. Wie könnte sie für einen solchen Mann nichts empfinden?
Und der zweite Tag, Jahre später. Sie hatte irgendwann früher einmal etwas über Liebe und Loslassen gehört. An die genauen Worte erinnerte sie sich nicht, nur an die Idee dahinter: dass Verlust die Buchhaltung der Liebe sei, ihre Maßeinheit, ganz wie man einen Fuß in Zoll berechnete, einen Yard in Fuß. Es war das erste Jahr des Jungen an der Universität, ein Jahr des Triumphs, als eine spezielle Begabung ans Licht kam. Er hatte ihr an diesem Tag gesagt, sie solle nicht kommen – es würde ihn nervös machen, hatte er erklärt, zu wissen, dass sie da sei –, aber sie war trotzdem da gewesen und hatte sich einen Platz hoch oben auf der Tribüne des Natatoriums gesucht, wo sie unbemerkt bleiben konnte. Die Luft war warm und feucht, die Akustik verwirrend. Tief unter ihr bildete das Schwimmbecken ein präzises Rechteck von unwirklichem Blau. Mit unbestimmtem Interesse und einer langsam zunehmenden Anspannung in der Brust verfolgte sie, wie die verschiedenen Wettkämpfe kamen und gingen, bis die Jungen an der Reihe waren. Hundert-Meter-Freistil. Er sah aus wie alle anderen Teilnehmer – in ihren eng anliegenden Anzügen mit den Schwimmbrillen und den silbernen Kappen waren sie buchstäblich nicht zu unterscheiden –, aber nur er gehörte ihr, und seine Präsenz war so einzigartig wie an dem Tag, als sie ihn an der Reling auf der Fähre erblickt hatte. Er stand am Beckenrand, schüttelte die Arme aus und dehnte den Hals. Als sie ihn anschaute, fühlte sie sich vergrößert, als wäre er eine Erweiterung ihrer selbst – eine Kolonie oder ein Vorposten. Er machte eine kleine, hüpfende Bewegung und pustete mit aufgeblasenen Wangen nervös die Luft aus der Lunge. Er ging in sich, begriff sie, wie einer, der sich in Trance versetzt.
Das Signal wurde gegeben, die Schwimmer stiegen auf die Startblöcke. Im Gleichtakt beugten sie sich in den Hüften nach vorn, bis ihre Fingerspitzen die Zehen berührten. Die Zuschauer strafften sich. Für eine endlose Sekunde erstarrten sie, und dann ertönte die Sirene, ein schimmerndes Geräusch, und zehn gesunde junge Körper schnellten durch die Luft und wurden vom Wasser geschluckt.
Ihr Herz machte einen Satz.
Ihr Junge war in der dritten Bahn. Ein langes Gleiten unter Wasser, dann tauchte er auf. Sie war aufgesprungen und schrie wie eine Verrückte. »Los, los!« Seine Schwimmzüge, unfassbar lang, trieben ihn durch das Wasser, als wäre es nichts. Alles ging so schnell, dauerte Sekunden nur, aber in diesen Sekunden fühlte sie etwas Grenzenloses. Er machte seine Rollwende, stieß sich ab und tauchte als Zweiter wieder auf. Zwei Züge, und er hatte die Führung inne. Was unmöglich erschienen war, würde jetzt passieren. Sie schrie, und das Adrenalin brachte ihr Herz zum Fliegen. Vor ihren Augen entfaltete sich der größte Augenblick seines Lebens.
Der Wettkampf war vorbei, ehe sie sichs versah. Gerade streckte er noch die Hand zum Beckenrand aus, und im nächsten Moment rotierte er im Wasser, um zur Uhr hinaufzuspähen, wo sein Name neben der Siegerzeit leuchtete. Er reckte triumphierend die Faust in die Höhe, und sein Gesicht strahlte von unfassbarer Freude. Da wusste sie es noch nicht, aber er hatte nicht nur das Wettschwimmen gewonnen, sondern auch den Rekord um zwei Zehntelsekunden übertroffen. Der Junge in der nächsten Bahn schlug klatschend gegen seine erhobene Handfläche.
Er wandte sich ab und ließ den Blick über die Zuschauer wandern. Plötzlich begriff Cynthia. Seine Proteste waren eine List gewesen. Er hatte die ganze Zeit gewusst, dass sie da sein würde. Es war, als sei sein Sieg ein Geschenk, das er ihr machte. Aber als sie ihn rufen wollte, stürmte ein Mädchen von der Tribüne zum Becken hinunter. Der Junge sprang auf den Beckenrand und streifte Brille und Kappe ab, als das Mädchen auf ihn zuflog, und dann war sie in seinen Armen. Ihre Füße hoben sich tatsächlich vom Boden, so beschwingt umarmten sie sich. Ohne jede Verlegenheit drückte er seinen Mund auf ihren zu einem langen, tiefen Kuss. Das Publikum jubelte ausgelassen, und auf den Tribünen erhoben sich Pfiffe.
Natürlich hatte es Mädchen gegeben. Er war schließlich ein Junge, breitschultrig und groß und mit einem entspannten Lächeln, und wenn du mit ihm sprachst, sagte sein Blick, dass er dich ernst nahm, dass er wirklich zuhörte und nicht nur darauf wartete, dass er an die Reihe kam zu reden, wie es die meisten Jungen taten. Mit anderen Worten, er war alles, was Mädchen liebten.
Aber dieses Mädchen war anders. Der Kuss verriet es ihr. Warum hatte er sie nie erwähnt? Die Antwort lag auf der Hand. Er hatte sie nie erwähnt, weil er nie auf den Gedanken gekommen war.
Eilig verließ sie das Natatorium. Sie war erschüttert, fühlte sich verbannt und ausgelöscht. Ihr Junge war kein Junge mehr. Er hatte seinen Platz am Tisch des Lebens eingenommen. Als sie aus dem Gebäude kam, traf die Nachmittagssonne sie wie ein Scheinwerferspot – nichts als gleißender Schmerz. Sie wühlte ihre Sonnenbrille aus der Tasche und setzte sie auf. Ein Teil ihrer selbst hatte sich immer abseits gehalten – das Ende war im Anfang bestimmt, der letzte Akkord war in die ersten Takte einer Symphonie eingebaut –, aber nichts hatte sie auf das vorbereitet, was sie jetzt erlebte. Wie die Liebe eine Lügnerin aus ihr gemacht hatte! Dies war der Gedanke, der ihr schließlich die Tränen in die Augen trieb, und sie lief die Eingangstreppe hinunter, über den Parkplatz und immer weiter in den verkehrsreichen Nachmittag, allein.
Jetzt ist alles fort, alles verloren.
Am Ende des Piers wartet das Dinghi. Sie steigt hinunter, legt die Ruder in die Dollen und stößt ab. Die Sonne ist aufgegangen und schießt rosarote Ranken in den Himmel über der ruhigen See. Es ist völlig windstill. Sie gestattet sich einen Augenblick der Ruhe und lässt das Boot einfach treiben. Dann packt sie die Ruder mit den Fäusten und rudert vom Ufer weg.
Der Pier, der Strand, die Dünen, das Haus, in dem sie zwei Jahrzehnte gelebt hat: Alles wird kleiner. Einzelheiten verschwimmen im großen Ganzen, dann verschwinden sie. Hinter dem Vorgebirge verändert sich das Meer und wird dunkel und wild. Die Sonne scheint ihr jetzt warm in den Nacken. Wellen rennen gegen sie an, und das Boot hebt und senkt sich in die Täler dazwischen.
Sie wartet auf eine Zeugin.
Sie hört sie, bevor sie sie sieht – ein leises, verhauchtes Summen wie ein anhaltendes »w« zwischen beinahe geschlossenen Lippen. Die Drohne kommt auf ihren Libellenflügeln tief über dem Wasser heran, wird langsamer und geht über ihr in Position. In der Bauweise ähnelt sie einem Insekt, aber sie ist unbestreitbar eine technische Konstruktion, und so sieht sie sowohl natürlich als auch menschengemacht aus und zugleich weder noch. Sie hebt das Gesicht, um das Gerät anzuschauen. An einem Bauch aus glänzendem Chrom wölbt sich eine Glaskuppel mit der Kamera.
Wer beobachtet sie? Sie stellt sich einen Mann vor, der in einem Keller des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit vor einer Wand aus Monitoren sitzt. Er ist die ganze Nacht auf gewesen; seine Augen sind müde und trocken, sein Kinn ist von Stoppeln bedeckt, der Atem sauer in seinem Mund. Er hat die Stiefel auf den Tisch gelegt und löst ein Kreuzworträtsel in einem Heft. Etwas lässt ihn aufblicken. Was haben wir denn da? Eine Frau, allein in einem Ruderboot. Merkwürdig, um diese Zeit jemanden draußen zu sehen, und ist das ein Nachthemd, das sie da anhat? Er drückt auf ein paar Tasten. Auf einem zweiten Monitor, der die Umrisse der Küste zeigt, leuchtet ein roter Punkt, der anscheinend die Position der Drohne angibt. Die Frau im Nachthemd ist drei Meilen weit vom Ufer entfernt.
Noch ein paar Klicks. Das Gesichtserkennungssystem des Computers liefert dem Mann weitere Daten: ihren Namen, den Namen ihres Mannes, ihre Adresse und ihr Alter. (Nicht schlecht, denkt er, für einundfünfzig.) Außerdem erfährt er, dass sie Angestellte des Aufsichtsrats der Abteilung für Rechtsangelegenheiten war. Sie ist ein angesehenes Mitglied des Harbor Club, der Union League und des Opera Circle, und sie hat in den letzten zwei Jahren sechs Strafzettel wegen Falschparkens bekommen und bezahlt. Er erfährt die Namen der Wohltätigkeitsorganisationen, für die sie gespendet hat, und der Presseorgane, die sie liest, den Stand ihres Bankkontos, ihre Kleider- und Schuhgröße (36 und 8½) und den Namen ihres Lieblingsrestaurants (Il Forno an der Prosperity Plaza – laut ihrer Kreditkartenabrechnung isst sie dort einmal die Woche). Mit anderen Worten, er erfährt eine ganze Menge über sie, aber nichts, was ihm verraten würde, warum sie (er sieht auf die Uhr) um 6:42 Uhr an einem Dienstagmorgen im Juli mit einem Ruderboot drei Meilen weit vor der Küste unterwegs ist. Im Nachthemd. Allein.
Und was macht sie jetzt?
Er reibt sich die Augen und beugt sich weiter nach vorn zum Monitor. Unter der Ruderbank hat die Frau eine kleine Tasche hervorgezogen. Mit den Fingerspitzen zieht sie den Verschlussriemen auf und nimmt den Inhalt heraus, drei Gegenstände, die sie neben sich auf die Bank legt. Einen Stock oder Pflock, ungefähr dreißig Zentimeter lang. Eine Drahtzange. Und ein Messer in einer alten Lederscheide.
Der Mann am Monitor greift zum Telefon.
Tatsächlich kann Cynthia nur, indem sie die Ereignisse mit den Augen dieses imaginären Mannes beobachtet, tun, was als Nächstes kommt. Während er mit wachsender Besorgnis zusieht und darauf wartet, dass sein Vorgesetzter sich meldet, schiebt sie sich den Pflock in den Mund und zieht den Ärmel ihres Nachthemds hoch, um den Monitorport freizulegen, ein kleines Rechteck, das in der Mitte zwischen linkem Ellenbogen und Handgelenk implantiert ist. Sie nimmt das Messer in die Hand. Die Klinge ist achtzehn Zentimeter lang und hat eine gebogene Spitze, ein Messer, wie man es zum Schuppen und Ausnehmen von Fischen benutzt. Sie atmet dreimal tief durch und umklammert das Messer fester. Sie legt die Spitze des Messers in die kleine Hautkerbe am Rand des Ports, wartet, bis das Boot stillliegt, und als es so weit ist, schiebt sie die Klinge in den Arm.
Der Schmerz ist so erstaunlich wie die Menge Blut, die hervorschießt. Der Monitor des Mannes hat keinen Ton; sonst würde er eine Reihe von erstickten Schreien hören, als sie um den Port herumschneidet. Für ihn ist die Stille ein Segen, und Cynthia empfindet schmerzliches Mitleid mit dieser unbekannten Person, die durch Zufall auserkoren wurde, diese schreckliche Szene mitanzusehen. Als sie fertig ist, ist alles voller Blut, ihr Nachthemd, die Ruderbank, der Boden des Bootes – alles. Ihr Kopf ist von Qualen durchtränkt, und sie vermutet, sie hat sich einen Zahn zerbissen. Mit einem letzten Stoß rammt sie die Messerspitze unter den Port. Ein reißendes Geräusch und ein feuchtes, hohles Ploppen, und endlich ist das Gerät heraus.
Nimm ab, haucht der Mann in sein Telefon. Nimm ab, nimm ab, nimm ab.
Zweimal schnipp mit der Drahtschere, und sie wirft den Monitor über Bord. Sie nimmt den Pflock aus dem Mund und wirft ihn hinterher. Glühwürmchen tanzen vor ihren Augen, und sie hat angefangen zu keuchen. Sie braucht einen Moment, um ihre letzten Kräfte zu sammeln, und dann beugt Cynthia sich in den Bug, um den Anker aus seiner Halterung zu lösen.
Sie fängt an, das Ankertau um ihre Fußknöchel zu schlingen.
Und in diesem Augenblick meldet der Vorgesetzte des Mannes sich endlich am Telefon. »Ja?«, sagt er knapp. »Was zum Teufel gibt’s? Warum rufen Sie um diese Zeit an?«
Aber der Mann am Monitor antwortet nicht. Er kann nicht antworten. Er bringt kein Wort heraus.
Cynthia steht auf. Das blutgetränkte Nachthemd klebt an ihrer Haut. Das Boot unter ihr kippelt, und beinahe fällt sie hinaus. Ihre Gliedmaßen fühlen sich losgelöst an, und ihr Kopf ist aus Luft, unfassbar leicht. Trotzdem findet sie die Kraft, den Anker hochzuheben und an die Brust zu drücken.
Sie hebt das Gesicht. Über ihr im blauen Morgenhimmel schwebt die Drohne.
Was mag sie denken? Aber das kann der Mann am Monitor nicht wissen. Er kann es sich nicht einmal vorstellen. Sie denkt an den Jungen und den Mann und ihr unwahrscheinliches Leben miteinander – zu kurz. Lebt wohl, flüstert sie, lebt wohl, meine Liebsten, ich hätte euch niemals lieben dürfen, aber ich habe es getan, ich habe es getan. Und sie drückt den Anker an die Brust, wie eine Mutter ihr Kind an sich drückt, sie schließt die Augen, lehnt sich zurück und versinkt im Wasser.
I Der letzte schöne Tag
1
Der Traum war immer der gleiche.
Ich schwimme im Meer. Unter Wasser, mit angehaltenem Atem, schiebe ich mich vorwärts durch eine flüssige, blau-grüne Welt. Meine Glieder sind sauber und stark, meine Schwimmzüge mühelos kraftvoll, Sonnenlicht schimmert auf der Oberfläche hoch über mir.
Ausgeatmete Blasen bilden einen Pfad, auf dem ich aufsteige. Die untergehende Sonne malt farbige Bänder in die purpurne Himmelskuppel. Von etwas Unbekanntem angezogen – meine Handlungen sind weder freiwillig noch unfreiwillig, sie sind einfach –, schwimme ich weg vom Ufer. Die Nacht sinkt langsam und dann plötzlich herab, und daraufhin habe ich das schreckliche Gefühl, einen Fehler begangen zu haben. Das alles ist ein großer Irrtum. Ich wende mich zurück zum Ufer und sehe nirgendwo Lichter. Das Land ist verschwunden. In meiner Panik drehe ich mich im Wasser hin und her, und jeder Orientierungssinn ist verschwunden. Ich bin allein im endlosen Meer.
»Du brauchst keine Angst zu haben, Proctor.«
Eine Frau schwimmt neben mir in geschmeidigem Bruststil. Sie hält den Kopf aufrecht über Wasser wie ein Seehund. Ihr Gesicht kann ich nicht sehen, und ihre Stimme kenne ich nicht. Aber etwas an ihrer Anwesenheit erfüllt mich mit großer Ruhe. Es ist, als hätte ich auf sie gewartet, und jetzt ist sie hier.
»Es dauert nicht mehr lange«, sagt sie sanft. »Ich zeige dir den Weg.«
»Wo wollen wir hin?«
Aber sie antwortet nicht. Sie gleitet davon, und ich folge ihr. Ich spüre keinen Wind, keine Strömung. Der Meeresspiegel ist bewegungslos wie Stein, und das einzige Geräusch ist das sanfte Zischeln des Wassers, das durch unsere gewölbten Hände strömt.
Sie deutet zum Himmel. »Kannst du ihn sehen?«
Ein einzelner, strahlender Stern ist erschienen. Er ist anders als die anderen – heller, klarer, mit einem bläulichen Schimmer.
»Erinnerst du dich an den Stern, Proctor?«
Sollte ich? Meine Gedanken sind diffus und treiben dahin wie Strohhalme in der Strömung. Sie hüpfen von einem Punkt zum anderen. Das Meer, seine unpersönliche, tintenschwarze Weite. Der Stern, der den Himmel durchbohrt wie ein Leuchtfeuer. Alles ist bekannt und unbekannt, alles vertraut und fremd.
»Du frierst«, sagt sie.
Das stimmt. Meine Glieder zittern, meine Zähne klappern. Sie kommt an meine Seite.
»Nimm meine Hand.«
Das habe ich anscheinend schon getan. Ihre Haut ist warm und scheint vor lauter Leben zu pulsieren. Es ist ein starkes Gefühl, machtvoll wie eine Flutwelle. Es fließt durch meinen Körper wie eine weiche Welle. Wie das Gefühl, heimzukehren. Zu Hause zu sein.
»Bist du bereit?«
Sie dreht sich zu mir um. Für einen Augenblick ist ihr Gesicht zu sehen, aber das Bild verschwindet zu schnell wieder und lässt sich nicht bewahren, und dann drückt sie ihren Mund auf meinen und küsst mich. Ein Strom von Gefühlen durchrauscht mich. Es ist, als wären mein Geist und mein Körper plötzlich mit grenzenlosen Kräften verbunden. Ich denke: So fühlt es sich an zu lieben. Wie haben wir nur vergessen, wie man liebt? Die Arme der Frau haben sich um mich geschlungen und drücken meine Hände an meine Brust. Gleichzeitig wird mir bewusst, dass das Wasser seinen Charakter verändert. Es wird weniger dicht.
»Zeit aufzuwachen, Proctor.«
Ich strample wie wild, um mich an der Oberfläche zu halten. Aber es nützt nichts. Es ist, als strampelte ich in der Luft. Ich hänge fest und kann mich kaum bewegen. Das Meer löst sich auf und klafft wie ein weit geöffneter Schlund. Die Angst schnürt mir die Kehle zu, ich kann nicht schreien …
Ihre Stimme ist ein Flüstern dicht an meinem Ohr: »Schau nach unten.«
Ich tue es, und damit stürze ich ab. Wir stürzen, in einen endlos schwarzen Abgrund, und das Letzte, was ich denken kann, ist dies:
Das Meer ist voller Sterne.
Mein Name ist Proctor Bennett. Dies ist, was ich mein Leben genannt habe.
Ich bin ein Bürger eines Inselstaats namens Prospera. Weit entfernt von jeder Landmasse, existiert Prospera in wunderbarer Isolation, verborgen vor der Welt. Sein Klima ist wie alles andere absolut wohltuend: warmer Sonnenschein, kühlende Meeresbrise und häufige, sanfte Regenfälle. Insel eins, bekannt als das eigentliche Prospera, ist fast kreisrund und erstreckt sich über 482 Quadratmeilen. Hier leben alle Prosperaner. Mit seinen von kristallinem weißem Sand bedeckten Stränden, den von zahllosen Wildtieren bevölkerten Wäldern und den Tälern mit äußerst fruchtbarem Boden im Inland könnte man es irrtümlich für ein mythologisches Paradies halten. Insel zwei, bekannt als Annex, ist der Wohnsitz des Hilfspersonals – das sind Männer und Frauen von geringerer biologischer und sozialer Ausstattung, deren Gesellschaft nach meiner Erfahrung gleichwohl durchaus angenehm sein kann. Mit einem Viertel der Größe Prosperas ist sie mit der Hauptinsel durch eine Pontonbrücke verbunden, auf der ihre hilfreichen Bürger täglich herüberkommen, um ihren diversen Aufgaben nachzugehen.
Die letzte der drei Inseln unterscheidet sich insofern von den anderen, als wir kaum wissen, was dort vor sich geht, nur dass dort etwas ist. Man nennt sie die Nursery. Geschützt durch gefährliche Untiefen und turmhohe Klippen, könnte man sie mit einer schwimmenden Festung vergleichen. Es gibt nur eine Möglichkeit, dort zu landen, eine Öffnung an der Ostflanke der Insel, wo die Fähre hindurchfährt – eine Reise, die jeder Prosperaner zweimal pro Iteration unternimmt, einmal am Anfang, einmal am Ende. Ich kann nicht sagen, wer auf der Nursery lebt, aber zweifellos muss jemand dort sein. Manche sagen, dass der Designer selbst dort residiert und den regenerativen Prozess beaufsichtigt, der als Fundament unserer außergewöhnlichen Lebensweise dient.
In diesem opulenten Land, frei von Not und Ablenkung, widmen sich die Prosperaner den höchsten Zielen. Kreativer Ausdruck und das Streben nach persönlicher Höchstleistung – das sind die Eckpfeiler unserer Zivilisation. Wir sind eine Gesellschaft von Musikern und Malern, von Dichtern und Gelehrten, von Handwerkern jeder Art. Die Kleider, die wir tragen, die Speisen, die wir essen, die gesellschaftlichen Versammlungen, an denen wir teilnehmen, die Räume, in denen wir arbeiten und ruhen und uns erholen – jede Facette des Alltags unterliegt einem kuratorischen Blick von höchster Gewissenhaftigkeit. Man könnte sagen, Prospera selbst ist ein Kunstwerk, eine Leinwand, auf der jeder unserer Bürger einen auf das Kunstfertigste ausgeführten Pinselstrich zur Geltung bringt.
Was ist unsere Geschichte? Wie sind wir entstanden? Auf diese Fragen habe ich kaum eine Antwort; selbst das Jahr ist mittlerweile schwer zu bestimmen. Und was wir über den derzeitigen Zustand der restlichen Welt wissen, ist in einem Wort: nichts. Geschützt durch den Schleier – eine elektromagnetische Barriere, die uns vor der Welt verbirgt und die Welt vor uns –, bleiben wir von dieser trübseligen Geschichte verschont. Aber man kann es sich leicht vorstellen. Kriege, Seuchen, Hungersnöte, der Zusammenbruch der Umwelt, gewaltige Migrationsbewegungen und Fanatismen jeglicher Couleur, eine Welt, so dezivilisiert wie die Völker der Erde, die sich konkurrierenden Göttern verschrieben haben und sich gegeneinander wenden – das waren die Schrecknisse, die den Designer in vergangenen Zeiten dazu inspirierten, unsere verborgene Zuflucht zu errichten. Selten, wenn überhaupt, sprechen wir von diesen Dingen, allgemein als »Die Schrecknisse« bekannt, denn das bringt keinen Gewinn. Das ist, könnte man sagen, das Herz des designerischen Genies und auch Prosperas ganzer Sinn: das Beste der Menschheit vor dem Schlimmsten zu beschützen.
Prospera zu verlassen ist natürlich verboten. Wenn sich unsere Existenz herumspräche, würde alles in Gefahr geraten. Aber wer könnte schon den Wunsch hegen, einen solchen Ort zu verlassen? Von Zeit zu Zeit hört man von jemandem – ausnahmslos Angehörige des Hilfspersonals –, der törichterweise versucht hat, auf die andere Seite des Schleiers zu reisen. Aber da niemand von denen je zurückgekehrt ist und da unsere Existenz ein Geheimnis geblieben ist, kann man mit Sicherheit annehmen, dass diese Unruhestifter gescheitert sind. Vielleicht hat das Meer sie verschlungen. Vielleicht haben sie keine Welt gefunden, die sie aufnehmen wollte, weil jegliche Zivilisation sich am Ende restlos selbst verzehrt hat. Vielleicht, so behauptet eine allerorten erzählte Sage, sind sie auch einfach über den Rand der Welt ins Nichts gesegelt.
Was mich selbst betrifft: In meiner derzeitigen Iteration bin ich zweiundvierzig Jahre alt. (Prosperaner starten die Uhr mit sechzehn, etwa dem biologischen Alter neuer Iteranten, frisch von der Fähre.) Mein aktuelles soziales Arrangement, mein erstes, ist ein Vertrag über fünfzehn Jahre einer heterosexuellen Ehe. Verlängerbar. Nach acht gemeinsamen Jahren würde ich sagen, dass Elise und ich im Allgemeinen glücklich sind. Wir sind nicht mehr das glühende Liebespaar, das wir waren, als wir die Hände praktisch nicht voneinander lassen konnten. Aber diese Dinge nehmen im Laufe der Zeit ab und münden im besten Fall in einer entspannteren, behaglicheren Partnerschaft, in der auch wir uns jetzt befinden. Unser Haus, das Elise’ Vormünder bezahlt haben – angesichts meines relativ bescheidenen Gehalts im Staatsdienst könnte ich mir so etwas niemals selbst leisten –, steht auf einer felsigen Halbinsel an der Südküste Prosperas. Nie habe ich Elise so selig und in ihrem Element gesehen wie in den zwei Jahren der Bauzeit. Jeden Tag steckten sie und eine Armee von Architekten, Handwerkern und Arbeitern stundenlang die Köpfe zusammen, und so sorgte sie dafür, dass jedes noch so kleine Detail ihren Fingerabdruck trug. Ich gebe zu, dass mein eigenes Interesse eher lau war. Ich habe nicht Elise’ Blick für diese Dinge und wäre auch zufrieden gewesen, eine Wohnung näher bei der Stadt zu beziehen. Außerdem war ich besorgt wegen des Einflusses, den ihre Vormünder auf unser neu verbundenes Leben ausüben könnten, ihre Mutter vor allem. Aber das Haus macht sie glücklich, und deshalb macht es mich auch glücklich. Dort also führen Elise und ich unser Leben, begleitet vom Rauschen des Windes in den Palmen und dem Knirschen weißzahniger Wellen unten auf dem Strand.
Meinen Job als Leitender Direktor für Distrikt sechs der Abteilung für soziale Verträge, Bereich Vollzug, empfinden manche Leute als beunruhigend, vielleicht sogar ein wenig makaber. Aber die Bezeichnung »Fährmann« trage ich mit Stolz. Manchmal muss das Getriebe der Emotionen geschmiert werden, damit es reibungslos läuft, und meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen – wenn zum Beispiel ein älterer Bürger mit den geistigen Beeinträchtigungen, die in den letzten Jahren der Iteration oftmals auftreten, es nicht über sich bringt, den nächsten Schritt zu tun. Das kann zu heiklen Situationen führen. Aber selbst wenn ihnen der Gedanke an eine Veränderung widerstrebt, lassen sich die meisten Leute überzeugen und sehen darin eine weise Entscheidung. Eine Reise in eine völlig neue Existenz anzutreten, die gesammelte Last des Lebens abzulegen, die Tafel der Erinnerungen sauber abzuwischen und wiedergeboren zu werden als kerngesunder Teenager mit frischem Gesicht und leuchtenden Augen – wer würde sich all das nicht wünschen?
Und dennoch …
Es gibt Zeiten, da muss der Geist sich einfach Fragen stellen und einen misstrauischen Blick auf das Leben werfen. Man denke an das Hilfspersonal. Wie anders muss ihm das Leben erscheinen, auf die altmodische Art geboren und als nasses, quäkendes Klümpchen ins Dasein geschossen zu werden, gebadet in vollkommener Unschuld. Ein Leben und wirklich nur eines zu leben, eingeklemmt in den schnellen Lauf der Zeit. Seine Tage der ernsthaften Arbeit mit messbaren Ergebnissen zu widmen (der Frische eines gemähten Rasens, der klinischen Makellosigkeit einer gründlich geputzten Küche, dem Acker, besät, abgeerntet und wieder besät). Selbst Kinder zu gebären und zu beobachten, wie sie stehen lernen, gehen und in ihr Leben hineinwachsen. Fünfzig, sechzig, siebzig Jahre auf der Erde zu verbringen und dann in die gedankenfreie Vergessenheit hinauszusegeln.
An einen Gott zu glauben, wenn es doch keinen Gott gibt.
Abstrakt gesehen, kann ihr Leben das unsere vergleichsweise öde erscheinen lassen. Unwillkürlich verspüre ich einen stechenden Anflug von Neid. Aber dann denke ich an die Lasten und Leiden solcher dauerhaften Verstrickungen. Liebe kann scheitern. Kinder können ihren Eltern ins Grab vorausgehen. Der Körper kollabiert in einer rauschenden Kaskade von biologischen Demütigungen, einer Parade der Schmerzen. Für die Helfer, der Segnungen der Iteration beraubt, gibt es keinen zweiten Versuch, kein Entkommen von den Erschütterungen und dem tiefen Bedauern des Lebens. Und so vergeht der Neid.
Was bleibt? Vollkommene Tage in endloser Zahl und ein Traum, in dem ich, umschlossen von den Armen der Liebe, in die Sterne stürze.
Ein Mittwoch vor nicht allzu langer Zeit. Ein Mittwoch im Juni – nicht weil das Datum wichtig wäre, sondern weil es nun einmal ein Mittwoch war. Die zerwühlten, schweißfeuchten Laken, die eingebildeten Schrecken der Nacht (Meer, Sterne), die langsam verwehen, das Meereslicht des Morgens, das das Schlafzimmer erfüllt wie ein goldenes Gas. Ich, Proctor Bennett – Prosperaner, Ehemann, Fährmann –, öffne die Augen und weiß sofort, dass das Haus leer ist. Ich stehe auf, strecke mich, ziehe Hausmantel und Pantoffeln an. In der Küche hat Elise eine Kanne Kaffee hingestellt. Frische Meeresluft weht durch die offenen Terrassentüren ins Haus. Ich gieße mir eine Tasse Kaffee ein, gebe einen Schuss Milch dazu und trete ins Freie.
Eine Zeit lang stehe ich einfach da und schaue aufs Meer hinaus. Es ist schon lange meine Gewohnheit, den Tag so anzufangen und abzuwarten, bis ich von selbst einen klaren Kopf bekomme. Manchmal verschwindet mein Traum sofort wie eine platzende Seifenblase. An solchen Tagen frage ich mich oft, ob ich tatsächlich geträumt habe oder ob ich mich einfach an andere Träume aus anderen Nächten erinnere. Dann wieder kommt es vor, dass der Traum in mir nachklingt wie eine Art zweite, überlagernde Realität, und dann weiß ich, dass seine Bilder meine Empfindungen noch weit in den Tag hinein färben werden.
Dies ist ein solcher Morgen.
Ich bin immer ein Träumer gewesen – das heißt, jemand, der Träume hat. In aller Regel träumen die Bürger unserer Welt nicht. Dies hält man gemeinhin für ein Nebenprodukt der industriellen Gifte, die einst den Planeten bedeckten, wenn auch für ein nicht völlig unwillkommenes. Wenn unser Leben im Wachzustand so zufriedenstellend ist, warum sollten wir dann solche qualvollen Ausflüge ins Geschichtenerzählen für nötig halten? Ich sage, Prosperaner träumen nicht, aber das stimmt nicht ganz. Die Ältesten unter uns tun es doch. Bei meiner Arbeit habe ich die Konsequenzen oft gesehen. Die rastlosen Nächte und seltsamen Visionen, die allmählich sich ausbreitende Unordnung des Denkens, der abschließende Sturz in den Irrsinn, der so schmerzlich mitanzusehen ist. Ich spreche für meinen Beruf, wenn ich sage, wir bemühen uns, es nicht so weit kommen zu lassen, aber das bedeutet nicht, dass es nie passiert.
Es ist mir gelungen, diesen Teil meines Lebens großenteils herunterzuspielen – aber das war nicht immer so. Als junges Mündel plagten mich nächtliche Besuche von solcher Kraft, dass sie mich oft aus dem Bett trieben und in einem Zustand benommener Besinnungslosigkeit im Haus umherwandern und die unverständlichsten Handlungen vollziehen ließen. Dann drehte ich alle Wasserhähne auf. Ich zerschlug eine Lampe. Ich machte ein Brot mit Butter und Gelee und schleuderte es zur allgemeinen Verblüffung aus dem Fenster. (Dies hat mein Vater mit eigenen Augen beobachtet; zu jener Zeit hatten meine Vormünder sich angewöhnt, mich in Ruhe zu lassen, solange nicht die Gefahr bestand, dass ich mich selbst verletzte.)
Diese Vorstellung mag amüsant erscheinen, aber damals war sie es nicht. Irgendwann verunsicherte die Situation meine Vormünder so sehr, dass meine Mutter mit mir zu einer Ärztin ging. Ich war erst ein oder zwei Jahre zuvor von der Fähre gekommen. Damals war die Welt noch neu für mich, und abgesehen von meinen täglichen Fahrten zur Akademie des frühen Lernens hatte ich noch nicht viel von der Insel gesehen. Der Shuttle brachte uns ins Landesinnere und folgte dabei einer gewundenen Landstraße durch Felder und Obstgärten, bevor man uns bei einem unauffälligen Bürogebäude mitten im Nirgendwo absetzte, als außer uns schon keine Fahrgäste mehr an Bord waren. Das Gebäude war kaum mehr als ein Betonwürfel, aber in einer hübsch gestalteten Umgebung mit blühenden Büschen und einem sanftgrünen Rasen, der immer noch nass vom nächtlichen Regen war. In einem Büro nahm eine Frau unsere Namen auf und befahl uns, zu warten, obwohl außer uns niemand da war. Tickend vergingen die Minuten, und meine schwindende Aufregung ließ zu, dass das ganze Ausmaß meiner Bangigkeit zutage trat. Mir war bewusst, dass meine Träumerei ein Problem war. Tatsächlich träumte ich ja nicht einmal gern. Die zerbrochenen Bilder und machtvollen Gefühle beunruhigten mich zutiefst. Aber noch besorgniserregender war, dass ich meine Vormünder enttäuscht haben könnte, was ich keinesfalls wollte. Als ich dort im Wartezimmer saß und meine Ängste wie eine kalte Suppe gerannen, kam mir ein schrecklicher Gedanke. Ich war eine Belastung. Wenn meine Träume nicht aufhörten, würden meine Vormünder mich in die Nursery zurückschicken. Weil ich ihren Erwartungen nicht entsprochen hatte, würden sie mich gegen einen anderen, würdigeren Jungen eintauschen, wie man ein schlecht ausgewähltes Geschenk im Geschäft gegen etwas Passenderes umtauschte.
Endlich öffnete sich die Tür zum inneren Büro. Die Ärztin, eine junge Frau im weißen Kittel mit strahlend blauen Augen und braunem Haar, das mit einer silbernen Spange zusammengehalten wurde, stellte sich als Dr. Patty vor und bat uns herein. Das Büro war entmutigend funktional: Fensterlos und ohne jeden Schmuck, enthielt es nur eine gepolsterte Liege, einen gläsernen Instrumentenschrank und einen Stuhl für meine Mutter. Dr. Patty bat mich, mein Hemd auszuziehen und mich auf die Liege zu setzen, wo sie mich untersuchte. Sie kontrollierte meine Monitordaten, hörte Herz und Lunge ab, spähte mir in Augen, Nase und Mund und wandte sich dann der aktuellen Frage zu. »So«, sagte sie, »träumen, ja?« (Ich nickte.) Wie oft, würde ich schätzen, kam das vor? (Das wusste ich nicht genau. Oft.) Und was, falls ich das sagen konnte, blieb mir von diesen Träumen in Erinnerung? (Sie machten mir Angst?) Sie notierte meine Antworten und kritzelte sie auf meine Karte, auch den Bericht meiner Mutter über das Geleebrot. Inzwischen war ich ein nervöses Wrack und den Tränen nahe. Sicher hatte ich mich so gründlich selbst belastet, dass man mich von ihrem Büro geradewegs auf die Fähre bringen würde. Damit wäre mein jetziges Leben, das doch gerade erst angefangen hatte, schon vorbei.
Aber das geschah nicht. Stattdessen legte Dr. Patty meine Karteikarte zur Seite und sah mich mit einem zutiefst beruhigenden Blick an. »Tja«, erklärte sie, »ich glaube nicht, dass es Anlass zur Sorge gibt.« In meinem Alter seien Träume vielleicht ungewöhnlich, aber nicht gänzlich unbekannt. In den ersten Jahren einer Reiteration könne es vorkommen, dass Splitter und Fetzen einer früheren Iteration an die Oberfläche drangen. Sie könnten die Form nächtlicher Störungen annehmen, wie ich sie beschrieben hatte. »Betrachte sie«, sagte Dr. Patty, »nicht als Träume, sondern als Echos.« Die Quelle sei nicht mehr da, aber der Ton halle noch im Kopf nach, bis er ebenfalls verklang.
Und es war ihr zugutezuhalten, dass die Situation sich mehr oder weniger so entwickelte. Im Laufe einiger Monate wurden diese Episoden immer seltener und hörten dann ganz auf, und als ich auf die Universität kam, dachte ich schon nicht mehr daran. Die ganze Sache war eine von vielen verrückten Episoden, wie sie in den Anfängen der Reiteration vorkamen, etwas, worüber man beim zweiten Cocktail oder beim dritten Glas Wein seine Scherze machte. Proctor, erzähl doch mal die Geschichte von dem Geleesandwich! Deine Vormünder müssen ja gedacht haben, du hättest den Verstand verloren!
Das glaubte ich damals wenigstens.
Aber meine Erinnerung an jenen Morgen ist damit noch nicht erschöpft. Meine Mutter und ich kehrten zur Bushaltestelle zurück. Auch wenn Dr. Pattys Erklärung mir nur teilweise einleuchtete (Echos in meinem Kopf?), war ich doch ungeheuer erleichtert. Ich war normal; es gab keinen Grund, mich in die Nursery zurückzuschicken. Dies versetzte mich in schwindelnde Begeisterung, aber meine Mutter blieb stumm und war anscheinend außerstande, an meiner guten Laune teilzuhaben. Ich saß neben ihr auf der Bank und versuchte, sie mit einer Reihe von optimistischen Bemerkungen aus der Reserve zu locken, aber ohne Erfolg. Schließlich wandte sie mir ihr Gesicht zu und sah mich lange und forschend an.
Meine Mutter war eine hübsche Frau, viel jünger als mein Vater. Nur hauchzarte Fältchen breiteten sich fächerförmig von ihren Augen- und Mundwinkeln aus, und ihr Haar, ein sattes Kakaobraun, glänzte in der Sonne. Es stimmt, ich wusste nur sehr wenig Persönliches über sie. Zum Beispiel wusste ich nicht, ob mein Vater ihr erster Mann war. (Mein Vater hatte drei Verträge hinter sich, bevor sie sich kennenlernten.) Ich hatte nie ein Wort über ihre eigenen Vormünder gehört, und sie hatte nie von den frühen Jahren ihrer eigenen Iteration gesprochen. Alles in allem war sie umgeben von einer wehmütigen, geheimnisvollen Aura – sie war eine Frau, bei der man sich danach sehnte, mehr über sie zu erfahren –, und fast alle, die sie kannten, behaupteten, ihr Glück sei von einer ganz besonderen Art: nicht, dass sie selbst glücklich gewesen wäre, was ich inzwischen entschieden bezweifle, sondern dass ihre Anwesenheit die Macht habe, bei anderen positive Gefühle zu wecken. Das war ihre spezielle Begabung, und das kann ich bezeugen.
Aber das war es nicht, was an jenem Morgen auf der Bank geschah. Ihr Blick machte mir Angst.
»Du weißt, dass ich dich liebe«, sagte sie. »Oder?«
An einem Tag voll seltsamer Ereignisse waren diese Worte für mich das Seltsamste überhaupt. Keiner meiner Vormünder hatte mir je gesagt, dass er oder sie mich liebe; elterliche Liebe von der Art, wie sie die Helfer gegenüber ihrem biologischen Nachwuchs praktizierten, war weder vorgesehen noch erforderlich. Vielleicht würde sich mit der Zeit, wenn wir drei uns besser kennenlernten, eine festere Bindung zwischen uns bilden. Aber ich sah keinen Grund für sie, mich zu lieben.
»Schon gut«, sagte sie, als ich nicht antwortete. (Ich hatte keine Ahnung, was ich sagen sollte.) »Ich will dich nicht verlegen machen. Ich wollte es nur sagen.«
Ich war zutiefst verblüfft. Warum sprach sie so mit mir, auf diese intime Weise – als wäre ich erwachsen? Ja, ich war einen Meter achtzig groß, aber was wusste ich denn schon?
»Weißt du, Proctor, es ist mir egal, was die Leute sagen, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass du Träume hast.«
»Nicht?«
»Tatsächlich finde ich es wundervoll.« Sie lehnte sich zu mir herüber. »Ich verrate dir ein Geheimnis. Du bist nicht der Einzige.«
Ich war verdutzt. »Nicht?«
»Keineswegs. Wenn du mich fragst, träumen viele Leute. Sie wissen es nur nicht.«
Über diese wunderliche Idee musste ich nachdenken. »Was ist mir dir?«, fragte ich sie. »Träumst du?«
Sie spähte mit schmalen Augen in die Ferne, als läge die Antwort auf meine Frage dort verborgen. »Manchmal«, sagte sie. »Zumindest glaube ich es. Dann wache ich mit diesem … Gefühl auf. Als wäre ich woanders gewesen.«
Ich verstand, was sie meinte: das Gefühl des Reisens. Diese Welt verlassen zu haben und auf einer anderen gewesen zu sein. »Glaubst du, das sind gute Träume?«, fragte ich.
Sie zuckte kurz die Achseln. »Das kann ich wirklich nicht sagen.« Sie sah mich wieder an. »Das Wichtigste ist, Proctor, dass du hörst, was sie dir sagen.«
»Aber ich erinnere mich nicht daran.«
»Vielleicht. Vielleicht wirst du es nie tun, nicht so, wie du es meinst. Aber selbst wenn nicht, sie sind noch in dir. Etwas, das dein Geist geschaffen hat. Sie sind ein Teil dessen, was du bist.«
»So habe ich es nie gesehen.«
Ihr Gesicht wurde noch ernster. »Ich habe gemeint, was ich vorhin gesagt habe. Ich hoffe, Liebe ist etwas, das in deinem Leben vorkommt. Dass du jemanden so liebst, wie ich dich liebe. Denke immer daran, okay?«
Sie meinte: Eines Tages werde ich dich verlassen. Aber das konnte ich da noch nicht wissen.
Geräusche hinter mir: Elise, die aus ihrem Atelier über der Garage zurückkommt. Meine Kaffeetasse, fast noch voll, ist in meiner Hand kalt geworden. Ich gehe ins Haus, gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie sie ihre Mappe auf den Esstisch legt, mit zügigem Schritt in die Küche kommt und den Kühlschrank öffnet.
»Da bist du«, sagt sie.
Klare Haut, helle Augen, energische Bewegungen – es war ein produktiver Morgen für sie. Sie ist für den Tag gekleidet: Stretchhose und eine weite Leinenbluse, ein sehr zarter Hauch von Make-up – nicht, dass sie es brauchen würde. Kolonnen von silbernen Armbändern – ihr einziger Schmuck – klingeln auf und ab an ihren Handgelenken. Sie fängt an, Frühstückssachen aus dem Kühlschrank zu holen: Möhren, Sellerie, Blattsalat, Vitamin-B-Komplex, eine Zitrone.
»Du solltest etwas zu dir nehmen«, sagt sie und wirft mir einen Blick zu.
Selbst nach den hohen Maßstäben von Prospera ist meine Frau hinreißend schön. Bevor sie Designerin für Damenbekleidung wurde, hatte sie eine höchst erfolgreiche Karriere als Model, insbesondere im Rahmen der »Lebe-außergewöhnlich«-Kampagne des Lifestyle-Ministeriums, als ihr Gesicht die Seiten der Illustrierten geziert und von Plakatwänden überall auf der Insel die Vorübergehenden angestrahlt hatte. Noch heute erkennen die Leute sie – Kundinnen, Partygäste, sogar unser Klempner – und bekommen leuchtende Augen, wenn sie den Zusammenhang herstellen. Und es gibt Momente – wie jetzt –, da verschlägt sie mir immer noch den Atem.
»Proctor, hörst du mir zu?«
Ich reiße mich aus meinen Gedanken. »Entschuldige.« Ich halte meine Tasse hoch. »Der Kaffee genügt. Ich hole mir etwas im Büro.«
Sie wirft ihre Zutaten in den Mixer. »Was hast du letzte Nacht hier draußen gemacht?«
»Gemacht?«
Der Mixer brüllt und hört dann unvermittelt auf, wodurch die Stille noch tiefer wird. Elise gießt ihre Mixtur in ein hohes Glas.
»Ich habe gehört, wie du hier herumgeklappert hast.« Sie trinkt einen Schluck und macht eine kreisförmige Gebärde mit dem Glas. »Das muss gegen drei Uhr morgens gewesen sein.«
Das ist natürlich beunruhigend. Gibt es eine plausible Erklärung? Habe ich ein Geräusch gehört und bin nachsehen gegangen? Habe ich die Küche geplündert, weil ich Hunger hatte? Bin ich vom Regen aufgewacht und aufgestanden, um die Fenster zu schließen? Soweit ich weiß, habe ich die Nacht durchgeschlafen, und zwar wie ein Stein.
»Das muss der Wein gewesen sein. Der viele Zucker. Da konnte ich nicht schlafen.«
»Na, du hast jedenfalls eine Menge getrunken.« Sie leert ihr Glas und stellt es in die Spüle. »Komm, ich muss dir etwas zeigen.«
Am Esstisch schlägt sie ihre Mappe auf und nimmt vier großformatige Pastellskizzen heraus, die sie auf dem Tisch ausbreitet. Jede zeigt eine Frauengestalt in einem hochtaillierten Cocktailkleid mit halblangen Ärmeln, Faltenrock und einem samtenen Schmetterlingskragen.
»Für die neue Saison.« Elise tritt zurück und verschränkt die Arme. »Was meinst du?«
Um ehrlich zu sein, ich habe keine wirkliche Meinung zu diesem Kleid. Ich kann mir solche Dinge nicht gut abstrakt vorstellen. Wie würde das an einer lebenden Frau aussehen? Sehr schwer zu sagen.
»Ich finde sie toll.« Ich lächle nach besten Kräften wie ein guter Ehemann. »Vielleicht deine besten Skizzen bisher.«
»Welches?«
»Welches was?«
»Sie sind alle unterschiedlich, Proctor.«
Ich begreife, dass ich nicht so leicht davonkomme. Ich betrachte die Bilder und suche nach Unterschieden, die anscheinend so gering sind, dass sie mir bedeutungslos erscheinen. Ich nehme eine Skizze und zeige darauf, aber meine Auswahl ist beliebig. »Das hier.«
Elise blinzelt zweifelnd. »Warum?«
Ich betrachte das Bild noch einmal. »Ich glaube, wegen des Kragens. Er kommt mir zurückhaltender vor.«
»Die Kragen sind alle gleich, Proctor. Nur die Kragen; alles andere ist unterschiedlich.«
Ein angespannter Augenblick verstreicht. Elise fängt an, die Skizzen nachlässig zusammenzuschieben.
»Vielleicht irre ich mich ja«, sage ich. »Lass mich noch mal sehen.«
Sie schüttelt den Kopf, ohne mich anzublicken, und schiebt die Entwürfe wieder in die Mappe. »Nein, wo du recht hast, hast du recht. Es ist totaler Mist.«
»Elise, das habe ich nicht gesagt.«
»Das brauchtest du auch nicht. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Den ganzen Morgen habe ich verschwendet.«
Es hat keinen Sinn, weiter beruhigend auf sie einzuwirken. Nach beinahe zehn Jahren mit ihr habe ich gelernt, dass manche Versionen dieses Gesprächs einfach Bestandteil des Lebens mit einer kreativen Persönlichkeit sind und nicht persönlich genommen werden dürfen. Elise’ Stimmung wird sich bessern, und sie wird vergnügt an etwas anderem arbeiten. Der andauernde Kampf gegen den Selbstzweifel ist einfach ein Teil des Prozesses und verstärkt ihre Begeisterung, wenn sich am Ende alles fügt (was es sicher tun wird, und dann finden sich ihre Entwürfe zu Höchstpreisen in den besten Geschäften).
»Tja.« Sie seufzt, und es klingt ziemlich hoffnungslos. »Ich glaube, ich sollte mich anziehen. Ich habe mein Training in einer Stunde und heute Mittag ein Treffen mit einem Einkäufer. Nicht dass ich da etwas vorzuweisen hätte.« Sie wirft mir einen wachsamen Blick zu. »Weißt du, manchmal mache ich mir Sorgen um dich, Proctor.«
»Um mich? Warum solltest du dir um mich Sorgen machen?«
»Du scheinst dich in letzter Zeit einfach nicht – ich weiß es nicht … nicht für besonders viel zu interessieren. Du bist die halbe Nacht auf, du isst kaum, du achtest nicht auf dich.«
»Aber mir geht’s gut, wirklich. Ich habe nur gerade viel zu tun im Büro.«
»Dann ist vielleicht die Arbeit das Problem. Vielleicht wird es Zeit, über etwas anderes nachzudenken.«
Auch das ist ein altes Gespräch. »Ich habe doch schon gesagt, mir gefällt, was ich tue. Die Leute brauchen mich.«
»Und darum bist du bei siebenundsiebzig Prozent. Und versuch nicht, es abzustreiten. Ich habe gestern Abend das Lesegerät gecheckt, als du geschlafen hast. Du hattest es im Bad vergessen.«
Sie spricht von meinem Monitor. Jeder Prosperaner hat einen; es ist ein kleiner Port, in die Mitte des Unterarms zwischen Ellenbeuge und Handgelenk eingebettet. Er ist durch ein Netzwerk von Drähten, die ein Zehntel der Dicke eines menschlichen Haars messen und an den Knochen entlang verlaufen, mit einem Sensorarray an der Basis der Großhirnrinde verbunden, das Tool, das an vorderster Front den ständigen Wechsel von Ebbe und Flut des Lebens zu messen hat – nicht nur unsere körperliche Gesundheit, sondern auch die reichhaltigere, komplexere Matrix, aus der unser allgemeines Wohlbefinden besteht. Wir sind gehalten, jeden Abend unseren Wert, gemessen in Prozent, zu kontrollieren, aber die meisten Gesundheitsbegeisterten unter uns sind dafür bekannt, dass sie ihre Lesegeräte bei sich tragen, wohin sie auch gehen. Im Allgemeinen liegt mein Wert, seit ich Anfang dreißig war, immer bei Mitte achtzig, aber in letzter Zeit habe ich gesehen, dass er sinkt, dass er hin und wieder um einen oder zwei Punkte fällt und sich nie wieder vollständig erholt.
»Wenn du es so herumliegen lässt«, sagt Elise, »ist es, als wolltest du, dass ich es sehe.«
»Er wird auch wieder steigen. Ich bin nur müde.«
»Das sage ich ja. Deine Arbeit strapaziert dich. Es tut mir weh, dich so zu sehen.«
»Was sollte ich denn sonst tun?«
Ein Lächeln erstrahlt auf ihrem Gesicht, es soll aufmunternd wirken. »Wie ist es mit Malen? Ich glaube, das könntest du gut. Oder Schreiben. Du hast davon gesprochen, ein Buch zu schreiben.«
»Elise, ich habe noch nie davon gesprochen, ein Buch zu schreiben.«
Sie seufzt schnaubend. Ich bin kein kooperativer Ehepartner. »Na, dann irgendetwas. All diese alten Leute. Ehrlich, Schatz, ich weiß nicht, wie du das den ganzen Tag aushältst.«
»Aber so ist es nicht. Es ist wichtig, was ich tue. Es gibt mir das Gefühl, nützlich zu sein.«
Sie sieht mich vielsagend an. »Versprich mir, dass du zu Warren gehst, okay? Lass dich einfach durchchecken. Nur um sicherzugehen, dass sonst alles in Ordnung ist.«
Warren ist ein alter Freund, ich kenne ihn seit Jahren. Er ist leitender Beamter im Ministerium für Wohlergehen, er ist also Arzt in dem Sinne, wie ich Verkehrspolizist bin – verwandte Berufe, aber nicht ganz das Gleiche.
»Es ist alles in Ordnung, Elise.«
»Dann wird er das auch feststellen. Mir liegt etwas an dir, Proctor. Es gefällt mir nicht, dich so erschöpft zu sehen. Tu mir den Gefallen, okay?«
Ein Attest über meinen ausgezeichneten Gesundheitszustand könnte zumindest dieses Gespräch beenden. »Es kann wohl nichts schaden, nehme ich an.«
»Also gehst du hin?«
Ich nicke. »Okay, ich gehe hin.«
»Gut.« Sie lächelt triumphierend – als hätte es je irgendeinen Zweifel daran gegeben, dass sie ihren Kopf am Ende durchsetzt. Sie tritt an mich heran und küsst mich kurz auf den Mund. »Und um Himmels willen, Proctor, iss etwas zum Frühstück.«
Sie verschwindet ins Schlafzimmer und verlässt dann das Haus, ehe ich michs versehe. Eigentlich gibt es auch nichts mehr zu sagen. Es ist eine Situation, von der wir beide wissen, dass sie sich wahrscheinlich nicht mehr ändern wird. Nicht dass Elise es tatsächlich notwendig fände. Das alles ist eine Art Spiel, in dem Elise ihre Besorgnis über mich zum Ausdruck bringt. Nachdem sie diesem Gedanken Luft gemacht hat, steht es ihr frei, mit etwas anderem weiterzumachen. Nach meiner Erfahrung läuft ein großer Teil der menschlichen Interaktion über Wortwechsel dieser Art. Sie sind weniger ein wirkliches Gespräch als vielmehr eine Form der parallelen Beichte: Die beiden Beteiligten tragen ihre inneren Monologe vor, abwechselnd und ohne einander wirklich zuzuhören. Das meine ich nicht zynisch oder als Beschreibung meiner persönlichen Überlegenheit. Ich bin da genauso schuldig wie jeder andere.
Aber unter diesem Gespräch verbirgt sich ein zweites, unausgesprochenes Problem, das unsere Verbindung allmählich belastet: die Frage der Adoption eines Mündels. Anders als das Hilfspersonal können Prosperaner keine eigenen Kinder produzieren. Sterilität ist eine Nebenwirkung des Iterationsprozesses. Das ist eine Sache mathematischer Notwendigkeit (wir leben schließlich auf einer Insel), aber auch eine allgemein begrüßte Eigenschaft unseres Lebens, denn es gestattet folgenlose sexuelle Experimente und erspart den Frauen die gefährlichen und entstellenden Strapazen der Schwangerschaft. Aber die Adoption eines Mündels wird gern gesehen, und nachdem sie acht Jahre miteinander verbracht haben, sind die meisten Paare weit fortgeschritten auf dem Weg zur Elternschaft.
Und doch, irgendwie bringen Elise und ich es nicht zustande. Gemeinhin sind die Frauen die treibende Kraft, und die Männer machen mehr oder minder bereitwillig mit. Aber bei uns ist das Gegenteil der Fall. Ich bin derjenige, der adoptieren will. Die Kraft dieses Impulses hat mich überrascht; es war etwas, das ich nicht wahrgenommen habe, bis ich es fühlte. Und ich erinnere mich an den Augenblick, als es mich überkam – nicht weil es einen naheliegenden Auslöser gegeben hätte, sondern weil es keinen gab. Ich war an einem nicht weiter bemerkenswert angenehmen Samstagnachmittag auf der Terrasse, um mich zu entspannen, und Elise war irgendwo unterwegs, als mich aus heiterem Himmel ein Gefühl der Unvollständigkeit überkam, das so sonderbar konkret war, dass ich sofort erkannte, was es war: Jemand fehlte. Ich war so begeistert von dieser Erkenntnis über mich, dass ich bereit war, geradewegs zur Adoptionsagentur zu fahren und die Papiere auszufüllen. Aber als Elise nach Hause kam und ich ihr in der sicheren Erwartung, sie werde meine Begeisterung teilen, erzählte, was passiert war, konnte ich sie kaum dazu bringen, sich auf das Thema zu konzentrieren. Ich konnte sie gar nicht dazu bringen, sich überhaupt zu konzentrieren. »Interessant«, sagte sie, ohne auf dem Weg von der Terrasse in die Küche ins Wohnzimmer innezuhalten (ich musste ihr tatsächlich nachlaufen, um mich verständlich zu machen). Und: »Darüber habe ich eigentlich noch nie nachgedacht.« Und: »Ehrlich, Proctor, wann hätten wir denn dafür Zeit?« Und anderes in dem Sinne. Ich brachte das Thema einen Tag später noch einmal zur Sprache und danach an mehreren Tagen, und ich kassierte jedes Mal die gleiche unbestimmte Absage. Schließlich ließ ich es bleiben und hoffte, sie werde selbst darauf zurückkommen. Aber das ist nicht passiert, und allmählich glaube ich, es wird auch nie passieren.