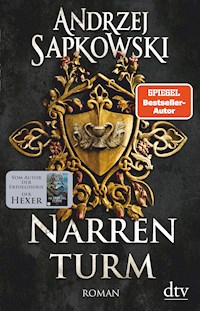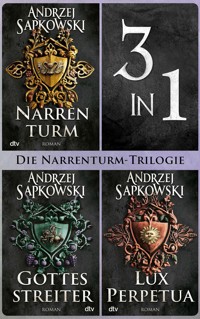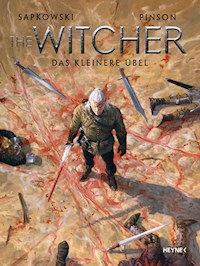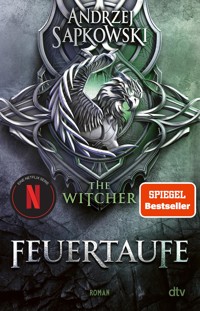
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Hexer - mit Gutscheinpunkten lesen!
- Sprache: Deutsch
Die Bücher zur NETFLIX-Serie – Die Witcher-Saga 3 in der opulenten Fan-Edition Andrzej Sapkowski ist der Großmeister der Fantasy In Nilfgaard wird die Verlobung des Kaisers mit Cirilla, der Thronerbin von Cintra, proklamiert. Aber handelt es sich wirklich um die echte Cirilla? Geralt, kaum von seinen schweren Verletzungen genesen, macht sich auf den Weg nach Nilfgaard, begleitet von Rittersporn und der Bogenschützin Milva sowie dem geheimnisvollen Regis, der über seltsame Kräfte verfügt. Der Witcher kämpft ums Überleben Doch auch eine gerade erst gegründete Geheimloge von Zauberinnen will Cirilla um jeden Preis zu finden und zur Königin zu machen, um so die Macht der Zauberer zu sichern ... Lesen Sie auch »Kreuzweg der Raben«, das neue, große Prequel zur Witcher-Saga.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Über das Buch
»Vor ihr ist Feuer, hinter ihr ist der Tod. Ich muss mich beeilen.«
In Nilfgaard wird die Verlobung des Kaisers mit Cirilla, der Thronerbin von Cintra, proklamiert. Aber handelt es sich wirklich um die echte Cirilla? Geralt, noch kaum von seinen schweren Verletzungen genesen, macht sich auf den Weg nach Nilfgaard, begleitet von Rittersporn und der Bogenschützin Milva sowie dem geheimnisvollen Regis, der über seltsame Kräfte verfügt. Doch auch eine gerade erst gegründete Geheimloge von Zauberinnen will Cirilla um jeden Preis finden und zur Königin machen, um so die Macht der Zauberer zu sichern ...
Von Andrzej Sapkowski sind bei dtv erschienen:
Die Abenteuer des jungen Witchers
Der letzte Wunsch
Zeit des Sturms
Das Schwert der Vorsehung
Die Witcher-Saga
Das Erbe der Elfen
Zeit der Verachtung
Feuertaufe
Der Schwalbenturm
Die Dame vom See
Kreuzweg der Raben
Geschichten aus der Welt des Witchers
Etwas endet, etwas beginnt
Das Universum des Andrzej Sapkowski
Alain T. Puysségur: The Witcher. Der Codex
Die Narrenturm-Trilogie
Narrenturm
Gottesstreiter
Lux perpetua
Andrzej Sapkowski
Feuertaufe
Die Witcher-Saga 3
Roman
Aus dem Polnischen von Erik Simon
Through these fields of destruction
Baptisms of fire
I’ve watched all your suffering
As the battles raged higher
And though they did hurt me so bad
In the fear and alarm
You did not desert me
My brothers in arms …
Dire Straits
Da sprach die Fee zu dem Hexer: »Solchen Rat gebe ich dir: Zieh eiserne Stiefel an, nimm einen eisernen Wanderstab. Geh in den eisernen Stiefeln bis ans Ende der Welt, den Weg vor dir aber sollst du mit dem Stab ertasten und mit deinen Tränen netzen. Geh durch Feuer und Wasser, halte nicht inne, schau nicht zurück. Wenn aber die Sohlen durchgelaufen sind, wenn der eiserne Stab verschlissen ist, wenn deine Augen von Wind und Hitze so trocken geworden sind, daß keine Träne mehr hervorquillt, dann wirst du am Ende der Welt das finden, was du suchst, und das, was du liebst. Vielleicht.«
Und der Hexer ging durch Feuer und Wasser, schaute niemals zurück. Doch er nahm weder eiserne Stiefel mit noch einen Wanderstab. Nur sein Hexerschwert nahm er mit. Er hörte nicht auf die Worte der Fee. Und er tat gut daran, denn es war eine böse Fee.
Flourens Delannoy,
Märchen und Volkssagen
DASERSTEKAPITEL
Im Gebüsch rumorten Vögel.
Die Hänge der Schlucht waren mit dichtem Gestrüpp von Brombeeren und Berberitzen überwuchert, ein traumhafter Ort zum Brüten und zum Fressen; es war also kein Wunder, dass es dort von Vögeln wimmelte. Hingebungsvoll trillerten Grünfinken, zwitscherten Hänflinge und Grasmücken, alle paar Augenblicke ertönte auch das kräftige »pink-pink« eines Buchfinks. Der Fink kündigt Regen an, dachte Milva und schaute instinktiv zum Himmel. Es waren keine Wolken zu sehen. Aber Finken kündigen immer Regen an. Ein wenig Regen würde nicht schaden.
Die Stelle gegenüber vom Ausgang aus dem Talkessel war ein guter Standort und versprach eine gute Jagd, insbesondere hier im Brokilon mit seiner überreichen Tierwelt. Die Dryaden, die über das ausgedehnte Waldgebiet herrschten, jagten ungemein selten, und ein Mensch wagte sich noch seltener hierher. Ein Jäger, den es nach Fleisch oder Pelzen gelüstete, wurde hier selbst zur Jagdbeute. Die Dryaden vom Brokilon hatten mit Eindringlingen kein Erbarmen. Milva hatte das einst am eigenen Leibe erfahren.
An Tieren mangelte es im Brokilon jedenfalls nicht. Milva saß nun aber schon seit über zwei Stunden im Hinterhalt und war immer noch nicht zum Schuss gekommen. Aus der Bewegung jagen konnte sie nicht – die seit Monaten herrschende Trockenheit hatte den Boden mit dürren Zweigen und Blättern bedeckt, die bei jedem Schritt knackten. Unter solchen Bedingungen versprach nur regloses Verharren im Hinterhalt Erfolg und Beute.
Auf einem Bogenhorn ließ sich ein Admiral-Schmetterling nieder. Milva zerquetschte ihn nicht. Während sie zusah, wie er die Flügelchen auf- und zuklappte, betrachtete sie zugleich den Bogen, eine Neuerwerbung, über die sie sich immer noch freute. Sie war eine passionierte Bogenschützin und liebte eine gute Waffe. Und die, die sie in der Hand hielt, war die allerbeste.
Milva hatte in ihrem Leben viele Bögen besessen. Schießen gelernt hatte sie mit gewöhnlichen aus Eschen- und Eibenholz, sie aber bald zugunsten der Kompositbögen aufgegeben, wie die Dryaden und Elfen sie benutzten. Die Elfenbögen waren kürzer, leichter und handlicher und dank der Zusammensetzung aus Schichten von Holz und Tiersehnen auch viel »schneller« als Eibenbögen – ein damit abgeschossener Pfeil erreichte das Ziel in viel kürzerer Zeit und auf einer viel flacheren Flugbahn, was die Gefahr einer Ablenkung durch den Wind erheblich verringerte. Die besten Exemplare solch einer Waffe mit vierfacher Krümmung hießen bei den Elfen zefhar, weil die Bogenhörner und die Wurfarme die Form der gleichnamigen Rune bildeten. Milva hatte eine ganze Reihe von Jahren lang Sefars benutzt und nicht geglaubt, dass es einen Bogen geben könnte, der sie übertraf.
Doch schließlich war ihr solch ein Bogen untergekommen. Natürlich war das auf dem Seebasar in Cidaris geschehen, der für sein reiches Angebot an wundersamen und seltenen Waren berühmt war, die Seeleute aus den fernsten Weltgegenden mitbrachten, von überall, woher Koggen und Galeonen eintrafen. Wann immer sie konnte, besuchte Milva den Basar und schaute sich die überseeischen Bögen an. Dort hatte sie auch den Bogen erworben, von dem sie glaubte, er würde ihr viele Jahre lang dienen – einen Sefar aus Serrikanien, verstärkt durch geschliffenes Antilopenhorn. Diesen Bogen hielt sie für vollkommen. Ein Jahr lang. Denn im Jahr darauf erblickte sie an demselben Stand, bei demselben Händler ein wahres Wunder.
Der Bogen kam aus dem fernen Norden. Er hatte eine Länge von zweiundsechzig Zoll, ein perfekt ausgewogenes Griffstück aus Mahagoni und flache, laminierte Arme, zusammengeleimt aus miteinander verschlungenen Schichten von Edelholz, gekochten Sehnen und Walbein. Von den anderen, neben ihm liegenden Bögen unterschied er sich nicht nur in der Konstruktion, sondern auch im Preis – und gerade der Preis hatte Milvas Aufmerksamkeit erregt. Als sie jedoch den Bogen in die Hand genommen und erprobt hatte, bezahlte sie ohne zu zögern und zu feilschen so viel, wie der Händler verlangte. Vierhundert Nowigrader Kronen. Natürlich hatte sie eine derart schwindelerregende Summe nicht bei sich – sie opferte für das Geschäft ihren serrikanischen Sefar, ein Bündel Zobelpelze und ein wunderschön gearbeitetes kleines Elfenmedaillon, eine Kamee aus Koralle mit einem Kranz von Flussperlen.
Doch sie hatte es nicht bereut. Niemals. Der Bogen war unglaublich leicht und geradezu ideal zielsicher. Obwohl er nicht allzu lang war, steckte in den Kompositarmen eine tüchtige Wucht. Mit einer aus Seide und Hanf gedrehten Sehne versehen, die in den exakt gekrümmten Hörnern eingehängt war, brachte er es bei einer Spannung um vierundzwanzig Zoll auf fünfundfünfzig Pfund Schusskraft. Es gab freilich Bögen, die sogar achtzig lieferten, aber das hielt Milva für übertrieben. Ein mit ihrem Fünfundfünfziger aus Walbein verschossener Pfeil legte eine Entfernung von zweihundert Schritt in der Zeit zwischen zwei Herzschlägen zurück, und auf hundert Schritt reichte die Durchschlagskraft, um einen Hirsch zu erlegen; durch einen Menschen indes, der keine Rüstung trug, ging der Pfeil glatt hindurch. Auf Tiere, die größer waren als ein Hirsch, oder auf Menschen in schwerer Rüstung machte Milva selten Jagd.
Der Schmetterling flog fort. Die Finken rumorten noch immer im Gebüsch. Und noch immer war ihr nichts vor den Bogen gekommen. Milva lehnte sich mit der Hüfte gegen einen Fichtenstamm und gab sich Erinnerungen hin. Einfach so, um die Zeit totzuschlagen.
Ihre erste Begegnung mit dem Hexer hatte im Juli stattgefunden, zwei Wochen nach den Ereignissen auf der Insel Thanedd und dem Ausbruch des Krieges in Dol Angra. Milva war nach gut einem Dutzend Tagen Abwesenheit in den Brokilon zurückgekehrt, hatte die Reste eines Kommandos der Scioa’tael mitgebracht, das in Temerien zerschlagen worden war, als es versucht hatte, aufs Gebiet des vom Kriege erfassten Aedirn zu gelangen. Die Eichhörnchen wollten sich dem Aufstand der Elfen im Dol Blathanna anschließen. Es war ihnen nicht gelungen, und ohne Milva wären sie verloren gewesen. Doch sie hatten Milva und Asyl im Brokilon gefunden.
Sofort nach ihrer Ankunft hatte man Milva wissen lassen, dass Aglaïs sie in Col Serrai erwartete. Milva wunderte sich ein wenig. Aglaïs stand den Heilerinnen des Brokilon vor, und der tiefe Talkessel Col Serrai mit seinen heißen Quellen und Höhlen war der Ort der Heilung.
Sie folgte jedoch dem Ruf, überzeugt, es handele sich um einen Elf, der dort geheilt wurde und durch ihre Vermittlung Kontakt zu seinem Kommando aufnehmen wollte. Als sie aber den verwundeten Hexer erblickte und erfuhr, worum es ging, geriet sie in Raserei. Sie lief mit wehenden Haaren aus der Grotte, und ihre ganze Wut entlud sich auf Aglaïs.
»Er hat mich gesehen! Er hat mein Gesicht gesehen! Ist dir klar, was das für mich bedeutet?«
»Nein, es ist mir nicht klar«, erwiderte die Heilerin kalt. »Das ist Gwynbleidd, der Hexer. Ein Freund des Brokilon. Er ist seit vierzehn Tagen hier, seit Neumond. Und es wird noch einige Zeit verstreichen, ehe er aufstehen und normal gehen kann. Er verlangt nach Nachrichten aus der Welt, von den Menschen, die ihm nahestehen. Nur du kannst sie ihm beschaffen.«
»Nachrichten aus der Welt? Du hast wohl den Verstand verloren, Scheuweib! Weißt du, was jetzt in der Welt los ist, jenseits der Grenzen deines ruhigen Waldes? In Aedirn ist Krieg! In Brugge, in Temerien und in Redanien ist Aufruhr, die Hölle, Menschenjagd! Hinter denen, die die Rebellion auf Thanedd angezettelt haben, sind alle her! Überall wimmelt es von Spitzeln und Aan’brengar, mitunter braucht man nur ein Wort zu verlieren oder an der falschen Stelle den Mund zu verziehen, und schon leuchtet einem im dunklen Verlies der Henker mit einem glühenden Eisen heim! Und ich soll auf Kundschaft gehen, Fragen stellen, Nachrichten sammeln? Meinen Kopf hinhalten? Und für wen? Für irgend ’nen halbtoten Hexer? Was ist mir der schon? Du hast wirklich den Verstand verloren, Aglaïs!«
»Wenn du vorhast zu brüllen«, fiel ihr die Dryade ruhig ins Wort, »dann lass uns weiter in den Wald gehen. Er braucht Ruhe.«
Milva drehte sich unwillkürlich zum Eingang der Höhle um, in der sie eben erst den Verwundeten gesehen hatte. Ein ansehnliches Mannsbild, dachte sie automatisch, wenn auch mager, nichts als Sehnen … Weiße Haare, aber der Bauch flach wie bei einem jungen, man sieht, dass er es mit der Arbeit hält, nicht mit Speck und Bier …
»Er war auf Thanedd« – eine Feststellung, keine Frage. »Ein Aufständischer.«
»Ich weiß nicht.« Aglaïs zuckte mit den Achseln. »Er ist verwundet. Braucht Hilfe. Der Rest geht mich nichts an.«
Milva winkte ab. Die Heilerin war dafür bekannt, dass sie nicht gern redete. Aber Milva hatte schon die aufgeregten Berichte der Dryaden vom Ostrand des Brokilon gehört, wusste schon alles über die zwei Wochen zurückliegenden Ereignisse. Von der brünetten Zauberin, die inmitten magischer Blitze im Brokilon aufgetaucht war, von dem Krüppel mit den zerschmetterten Armen und Beinen, den sie mitgebracht hatte. Von dem Krüppel, der sich als der Hexer erwies, den die Dryaden unter dem Namen Gwynbleidd kannten, der Weiße Wolf.
Anfangs, hatten die Dryaden erzählt, wussten sie nicht, was sie machen sollten. Der blutüberströmte Hexer schrie abwechselnd und fiel in Ohnmacht, Aglaïs legte provisorische Verbände an, die Zauberin fluchte. Und weinte. Letzteres wollte Milva partout nicht glauben – wer hätte jemals eine Zauberin weinen sehen? Später war dann der Befehl aus Duén Canell gekommen, von der Silberäugigen Eithné, der Herrin des Brokilon. Die Zauberin wegschicken, lautete der Befehl der Herrscherin des Dryadenwaldes. Den Hexer heilen.
Er wurde geheilt. Milva wusste es. Er lag in der Höhle, in einer Mulde voll Wasser von den magischen Quellen des Brokilon, seine mit Schienen und Streckvorrichtungen fixierten Extremitäten waren dicht mit den heilkräftigen Schlingpflanzen Conynhael und mit Büscheln von purpurrotem Beinwurz umwickelt. Seine Haare waren weiß wie Milch. Er war bei Bewusstsein, obwohl jemand, der mit Conynhael behandelt wurde, für gewöhnlich besinnungslos dalag, fantasierte und die Magie aus ihm sprach …
»Und?« Die ausdruckslose Stimme der Heilerin riss sie aus ihren Gedanken. »Was ist nun? Was soll ich ihm sagen?«
»Dass er sich zum Teufel scheren soll«, blaffte Milva und zog den vom Quersack und vom Jagdmesser herabgezogenen Gürtel zurecht. »Und du geh auch zum Teufel, Aglaïs.«
»Wie du willst. Ich zwinge dich nicht.«
»Daran tust du gut. Zwing mich nicht.«
Sie ging in den Wald, zwischen die locker stehenden Kiefern. Sie war wütend.
Von den Ereignissen, die sich in der ersten Neumondnacht des Juli auf der Insel Thanedd zugetragen hatten, wusste Milva; die Scioa’tael redeten pausenlos davon. Während der Zusammenkunft der Zauberer auf der Insel war es zu einem Aufstand gekommen, es war Blut geflossen, es waren Köpfe gerollt. Und wie auf ein Zeichen schlugen die Armeen Nilfgaards gegen Aedirn und Lyrien los, der Krieg begann. In Temerien, Redanien und Kaedwen aber stürzte sich alles auf die Eichhörnchen. Zum einen, weil den aufständischen Zauberern auf Thanedd ein Kommando der Scioa’tael zu Hilfe gekommen sein sollte. Zweitens, weil irgendein Elf oder Halbelf mit dem Stilett Wisimir ermordet haben sollte, den redanischen König. Also nahmen sich die aufgebrachten Menschen die Eichhörnchen gründlich vor. Überall kochte es, es flossen Ströme von Elfenblut …
Ha, dachte Milva, vielleicht haben die Priester ja recht, die davon faseln, dass das Ende der Welt und der Tag des Gerichts nah sind? Die Welt in Flammen, der Mensch nicht nur des Elfs, sondern auch des Menschen Wolf, Bruder zückt gegen Bruder das Messer … Und ein Hexer mischt sich in die Politik ein und schließt sich einem Aufstand an. Ein Hexer, der doch zu nichts anderem da ist, als die Welt zu durchwandern und Ungeheuer zu töten, die den Menschen schaden! Seit die Welt steht, hat sich nie ein Hexer in die Politik oder in Kriege hineinziehen lassen. Es gibt sogar so ein Märchen von einem dummen König, der in einem Sieb Wasser trug, einen Hasen zum Boten und einen Hexer zum Heerführer machen wollte. Und jetzt ein Hexer, der sich gegen die Könige empört und dabei etwas abgekriegt hat, sich im Brokilon vor der Strafe verstecken muss. Fürwahr, das Ende der Welt!
»Guten Tag, Maria.«
Sie zuckte zusammen. Die an den Stamm einer Kiefer gelehnte, nicht besonders große Dryade hatte Augen und Haare von silberner Farbe. Die untergehende Sonne umgab ihren Kopf vor dem gefleckten Hintergrund des Waldes mit einem Glorienschein. Milva ließ sich auf ein Knie sinken, neigte tief den Kopf: »Sei gegrüßt, Frau Eithné.«
Die Herrin des Brokilon steckte ein kleines, sichelförmiges goldenes Messer hinter ihren Bastgürtel. »Steh auf«, sagte sie. »Lass uns ein Stück gehen. Ich will mit dir reden.«
Lange gingen sie zusammen durch den von Schatten erfüllten Wald, die kleine silberäugige Dryade und die große flachsblonde junge Frau. Lange brach keine das Schweigen.
»Du hast lange nicht in Duén Canell vorbeigeschaut, Maria.«
»Es war keine Zeit dazu, Frau Eithné. Nach Duén Canell ist es ein weiter Weg vom Bandwasser, und ich … Du weißt doch.«
»Ich weiß. Bist du müde?«
»Die Elfen brauchen Hilfe. Es ist ja auf deinen Befehl, dass ich ihnen helfe.«
»Auf meine Bitte.«
»In der Tat. Auf deine Bitte.«
»Ich habe noch eine.«
»Das dacht ich mir. Der Hexer?«
»Hilf ihm.«
Milva blieb stehen und drehte sich um, brach mit einer heftigen Bewegung einen Geißblattzweig ab, der sich in ihrer Kleidung verhakt hatte, drehte ihn zwischen den Fingern, warf ihn zu Boden.
»Seit einem halben Jahr«, sagte sie leise und schaute der Dryade in die silbernen Augen, »riskier ich meinen Kopf, führ Elfen aus zerschlagenen Kommandos in den Brokilon … Wenn sie sich ausgeruht und ihre Wunden kuriert haben, führ ich sie wieder hinaus … Reicht das nicht? Hab ich nicht genug getan? Bei jedem Neumond mach ich mich in finsterster Nacht auf den Weg … Ich fürcht schon die Sonne wie eine Fledermaus oder irgendein Uhu …«
»Niemand kennt die Waldwege besser als du.«
»Im Dickicht werd ich nichts erfahren. Der Hexer will ja, dass ich Nachrichten sammle, unter Menschen geh. Er ist ein Aufständischer, die Aan’brengar horchen auf, wenn sie seinen Namen hören. Ich selber sollt mich auch nicht in Städten blicken lassen. Wenn mich nun jemand erkennt? Die Erinnerung an jene Sache ist noch lebendig, das Blut von damals ist noch nicht getrocknet … Denn es war viel Blut, Frau Eithné.«
»Nicht wenig.« Die silbernen Augen der alten Dryade waren fremd, kalt, undurchdringlich. »Nicht wenig, fürwahr.«
»Wenn sie mich erkennen, setzen sie mich auf den Pfahl.«
»Du bist vernünftig. Du bist vorsichtig und wachsam.«
»Um die Nachrichten, um die der Hexer bittet, zu sammeln, muss ich die Vorsicht außer Acht lassen. Ich muss fragen. Und heutzutage ist es gefährlich, Neugier zu zeigen. Wenn sie mich fassen …«
»Du hast Beziehungen.«
»… foltern sie mich zu Tode. Sie richten mich hin. Oder lassen mich in Drakenborg verfaulen …«
»Aber mir schuldest du etwas.«
Milva wandte sich um, biss sich auf die Lippen. »Ja«, sagte sie bitter. »Ich werd es nicht vergessen.«
Sie schloss die Augen, ihr Gesicht verzerrte sich plötzlich, die Lippen zitterten, die Zähne pressten sich fest aufeinander. Unter den Lidern glomm blass die Erinnerung auf, im gespenstischen Mondlicht jener Nacht. Plötzlich kehrte der Schmerz in dem Fußknöchel zurück, den die Riemenschlinge der Falle erfasst hatte, der Schmerz im von dem Ruck ausgerenkten Gelenk. In den Ohren rauschte das Laub des plötzlich hochschnellenden Baumes … Ein Schrei, ein Stöhnen, wildes, wahnsinniges, entsetztes Zappeln und das abscheuliche Gefühl der Angst, die sie überschwemmte, als ihr klar wurde, dass sie nicht mehr freikommen würde … Der Schrei und die Angst, das Knirschen des Seils, die wogenden Schatten, der schwankende, unnatürlich umgekehrte Erdboden, die Bäume mit den umgekehrten Wipfeln, das in den Schläfen hämmernde Blut … Und im Morgengrauen die Dryaden, ringsumher, im Kreis … Das ferne silbrige Lachen … Ein Püppchen an der Schnur! Zapple nur, zapple, Püppchen, mit dem Köpfchen nach unten … Und ihr eigener, doch fremder, durchdringender Schrei. Und dann Dunkelheit.
»Fürwahr, ich schulde dir was«, presste sie abermals zwischen den Zähnen hervor. »Fürwahr, denn ich bin ja eine Gehängte, die man vom Galgen geschnitten hat. Solang ich leb, seh ich, werd ich diese Schuld nicht begleichen können.«
»Jeder hat irgendeine Schuld abzutragen«, sagte Eithné. »So ist das Leben, Maria Barring. Schulden und Forderungen, Verpflichtungen, Dankbarkeit, Vergeltung … Etwas für jemanden tun. Oder vielleicht für sich selbst? Denn so ist es in Wahrheit, dass wir immer uns selbst zahlen, nicht irgendwem. Jede aufgenommene Schuld zahlen wir bei uns selbst ab. In jedem von uns stecken Gläubiger und Schuldner zugleich. Es geht darum, dass diese Rechnung in uns aufgeht. Wir kommen zur Welt als ein kleiner Teil von dem uns gegebenen Leben, dann machen und zahlen wir immerzu Schulden. An uns. Für uns. Damit am Ende die Rechnung aufgeht.«
»Steht dir dieser Mensch nahe, Frau Eithné? Dieser … Hexer?«
»Ja. Obwohl er es selbst nicht weiß. Geh zurück nach Col Serrai, Maria Barring. Geh zu ihm. Und tu, worum er dich bitten wird.«
In dem Talkessel raschelte das Reisig auf dem Boden, ein Zweig knackte. Es ertönte das laute und zornige »tschök-tschök« einer Elster, die Finken flogen auf, dass die weißen Steuerfedern blitzten. Milva hielt den Atem an. Endlich.
Tschök-tschök, rief die Elster. Tschök-tschök-tschök. Wieder knackte ein Zweig.
Milva rückte den langgedienten, bis zum Glanz abgescheuerten ledernen Armschutz am linken Unterarm zurecht, legte die Hand in die am Griff befestigte Schlinge. Automatisch, gewohnheitsmäßig überprüfte sie die Schärfe der Pfeilspitze und die Fiederung. Die Schäfte hatte sie auf dem Jahrmarkt gekauft – wobei sie im Schnitt einen von zehn ausgewählt hatte, die man ihr anbot –, die Federn aber stets selbst angebracht. Die meisten im Handel erhältlichen fertigen Pfeile hatten Federn, die zu kurz und gerade am Schaft entlang angebracht waren, Milva aber verwendete ausschließlich Pfeile, deren Federn spiralförmig angesetzt und mindestens fünf Zoll lang waren.
Sie legte den Pfeil auf die Sehne und schaute zur Talöffnung hin, auf den zwischen Baumstämmen grünenden Fleck von Berberitzen, an dem in schweren Trauben rote Beeren hingen.
Die Finken waren nicht weit fortgeflogen, sie begannen wieder zu schlagen. Komm, Ricklein, dachte Milva, während sie den Bogen hob und spannte. Komm. Ich bin bereit.
Aber die Rehe gingen durch den Hohlweg, auf den Sumpftümpel und die Quellen zu, die die ins Bandwasser fließenden Rinnsale speisten. Aus dem Talkessel kam ein Rehbock. Hübsch, dem Anschein nach über vierzig Pfund. Er hob den Kopf, spitzte die Lauscher, dann wandte er sich zu den Büschen ab, knabberte an Blättern.
Ein günstiger Schuss – von hinten. Wäre da nicht ein Baumstamm gewesen, der das Ziel verdeckte, hätte Milva ohne zu zögern geschossen. Sogar wenn sie in den Bauch traf, würde der Pfeil ihn durchschlagen und Herz, Eingeweide oder Lunge erreichen. Traf er in eine Keule, würde er eine Arterie zerreißen, auch dann müsste das Tier nach kurzer Zeit fallen. Sie wartete, ohne die Sehne loszulassen.
Abermals hob der Bock den Kopf, machte einen Schritt, kam hinter dem Stamm hervor – und wandte sich plötzlich um, so dass er ihr die Vorderseite zukehrte. Milva, die den Bogen vollends gespannt hatte, hielt den Pfeil zurück und fluchte in Gedanken. Ein Schuss von vorn war unsicher – statt in die Lunge konnte der Pfeil in den Bauch treffen. Sie wartete, hielt die Luft an, spürte im Mundwinkel den salzigen Geschmack der Sehne. Das war noch ein großer, geradezu unschätzbarer Vorzug ihres Bogens – wenn sie eine schwerere oder weniger sorgfältig gearbeitete Waffe benutzt hätte, dann hätte sie ihn nicht so lange gespannt halten können, ohne zu riskieren, dass ihr die Hand ermüdete und der Schuss ungenau wurde.
Zum Glück senkte der Bock den Kopf, zupfte aus dem Mulm ragende Grashalme ab und wandte sich zur Seite. Milva atmete ruhig aus, zielte auf den Brustkasten und ließ sacht die Sehne los.
Sie vernahm jedoch nicht das erwartete Knacken einer vom Pfeil zerbrochenen Rippe. Stattdessen sprang der Bock hoch, schlug hinten aus und verschwand, vom Knistern trockener Zweige und dem Rascheln gestreifter Blätter begleitet.
Ein paar Herzschläge lang blieb Milva reglos stehen, versteinert wie die Marmorstatue einer kleinen Waldgöttin. Erst als alle Geräusche verklungen waren, nahm sie die rechte Hand von der Wange und ließ den Bogen sinken. Nachdem sie sich die Fluchtrichtung des Tieres eingeprägt hatte, setzte sie sich ruhig hin, den Rücken gegen einen Baumstamm gelehnt. Sie war eine erfahrene Jägerin, wilderte von Kindesbeinen an in den herrschaftlichen Wäldern; das erste Reh hatte sie mit elf Jahren erlegt, den ersten Vierzehnender – als unglaublich glückliches Jagd-Omen – an ihrem vierzehnten Geburtstag. Und die Erfahrung hatte sie gelehrt, dass man sich bei der Verfolgung eines angeschweißten Tiers niemals beeilen soll. Wenn sie gut getroffen hatte, musste der Bock höchstens zweihundert Schritt vom Ausgang des Talkessels gefallen sein. Hatte sie schlechter getroffen – was sie im Prinzip nicht für möglich hielt –, dann konnte Eile die Sache nur schlimmer machen. Ein schlecht getroffenes verwundetes Tier, das man nicht beunruhigt, wird nach der panischen Flucht langsamer und geht im Schritt weiter. Ein Tier, das man verfolgt und schreckt, rennt Hals über Kopf weiter und macht auch hinter sieben Bergen noch nicht halt.
Ihr blieb also mindestens noch eine halbe Stunde Zeit. Sie nahm einen abgerissenen Grashalm zwischen die Zähne und gab sich wieder ihren Gedanken hin. Sie erinnerte sich.
Als sie nach zwölf Tagen in den Brokilon zurückgekehrt war, konnte der Hexer schon gehen. Er humpelte leicht und zog die Hüfte ein wenig nach, doch er ging. Milva wunderte sich nicht – sie wusste um die wundersamen Heilkräfte des Waldwassers und des Conynhael genannten Krautes. Sie wusste auch, wie geschickt Aglaïs war, mehr als einmal hatte sie miterlebt, wie verwundete Dryaden geradezu blitzschnell genasen. Und die Gerüchte von der beispiellosen Widerstandskraft und Zähigkeit der Hexer waren offensichtlich auch keine Ammenmärchen.
Sie ging nicht gleich nach ihrer Ankunft nach Col Serrai, obwohl die Dryaden sie wissen ließen, Gwynbleidd warte ungeduldig auf ihre Rückkehr. Sie ließ sich vorsätzlich Zeit, sie war noch immer unzufrieden mit der ihr übertragenen Mission und wollte das auch zeigen. Sie begleitete die Elfen aus dem Eichhörnchen-Kommando, das sie hergeführt hatte, ins Lager. Ausführlich gab sie Bericht über die Geschehnisse unterwegs, warnte die Dryaden vor der von den Menschen eingerichteten Grenzsperre am Bandwasser. Erst als man sie zum dritten Mal daran erinnerte, badete sich Milva, zog sich um und ging zu dem Hexer.
Er erwartete sie am Rande einer Lichtung, dort, wo Zedern wuchsen. Er ging auf und ab, hockte sich von Zeit zu Zeit hin, richtete sich federnd auf. Offensichtlich hatte Aglaïs ihm Übungen aufgegeben.
»Was gibt es Neues?«, fragte er sofort nach der Begrüßung. Die Kälte in seiner Stimme konnte Milva nicht täuschen.
»Der Krieg scheint zu Ende zu gehen«, erwiderte sie und zuckte mit den Schultern. »Nilfgaard, heißt es, hat schließlich Lyrien und Aedirn vernichtend geschlagen. Verden hat sich unterworfen, und der König von Temerien hat sich mit dem Kaiser von Nilfgaard arrangiert. Und die Elfen im Blumental haben ein eigenes Königreich gegründet. Die Scioa’tael aus Temerien und Redanien sind allerdings nicht dorthin ausgewandert. Sie schlagen sich noch immer …«
»Das wollte ich nicht wissen.«
»Nein?« Sie tat verwundert. »Ach ja. Nun, ich hab in Dorian vorbeigeschaut, wie du mich gebeten hast, obwohl es ein ziemlich großer Umweg war. Und die Straßen sind heutzutage unsicher …«
Sie brach ab, streckte sich. Diesmal drängte er sie nicht.
»Dieser Codringher«, fragte sie schließlich, »den ich für dich aufsuchen sollte, war dein Freund?«
Das Gesicht des Hexers zuckte nicht, doch Milva sah, dass er sofort verstanden hatte. »Nein. War er nicht.«
»Das ist gut«, fuhr sie ungezwungen fort. »Denn er hat das Zeitliche gesegnet. Ist mitsamt seinem Anwesen verbrannt, nur der Schornstein und die halbe Vorderfront sind übrig. Ganz Dorian ist voll von Gerüchten. Die einen sagen, dieser Codringher hat Schwarzkunst betrieben und Gifte gemischt, ist mit dem Teufel im Bunde gewesen, also hat ihn das Höllenfeuer verschlungen. Andre sagen, er hat Nase und Finger in fremde Angelegenheiten gesteckt, wie es so seine Art war. Und jemandem hat das nicht gepasst, also hat der ihn einfach erledigt und Feuer gelegt, um die Spuren zu vernichten. Und was denkst du?«
Sie erhielt weder eine Antwort, noch sah sie eine Regung auf dem grau gewordenen Gesicht. Also fuhr sie fort, ohne den boshaften und überheblichen Ton aufzugeben.
»Merkwürdig ist, dass sich dieses Feuer und das Verschwinden Codringhers in der ersten Neumondnacht im Juli ereignet haben, genau wie der Tumult auf der Insel Thanedd. Just wie wenn jemand auf den Gedanken gekommen ist, dass Codringher etwas über den Aufstand weiß und man ihn nach Einzelheiten fragen wird. Wie wenn ihm jemand für immer den Mund stopfen wollte. Was sagst du dazu? Ha, ich seh, nichts sagst du. Bist ziemlich wortkarg! Dann sag ich dir: Diese deine Angelegenheiten sind gefährlich, deine Nachforschungen und Erkundigungen. Vielleicht will jemand außer bei Codringher auch noch andre Münder und Ohren stopfen. So denk ich mir das.«
»Verzeih mir«, sagte er nach einer Weile. »Du hast recht. Ich habe dich der Gefahr ausgesetzt. Dieser Auftrag war zu riskant für …«
»Für ein Weib, was?« Mit einer heftigen Kopfbewegung schüttelte sie die immer noch nassen Haare von der Schulter. »Wolltest du das sagen? So was von einem Kavalier! Schreib dir hinter die Ohren: Obwohl ich mich zum Pinkeln hinhocken muss, ist mein Oberrock mit Wolfspelz besetzt, nicht mit Kaninchen! Mach keinen Feigling aus mir, denn du kennst mich nicht!«
»Ich kenne dich«, sagte er leise und ruhig, ohne auf ihre Wut und die erhobene Stimme zu reagieren. »Du bist Milva. Du führst Eichhörnchen in den Brokilon, schlägst dich zwischen den Suchtrupps durch. Ich kenne deinen Mut. Aber ich habe dich leichtfertig und egoistisch der Gefahr ausgesetzt …«
»Du bist dumm!«, unterbrach sie ihn scharf. »Sorg dich um dich selber, nicht um mich. Um das Mädchen sorg dich!«
Sie lächelte spöttisch. Denn diesmal veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Sie schwieg absichtlich, wartete auf weitere Fragen.
»Was weißt du?«, fragte er schließlich. »Und von wem?«
»Du hattest deinen Codringher«, fauchte sie mit stolz erhobenem Kopf, »ich hab meine Bekannten. Solche, die schnelle Augen und Ohren haben.«
»Rede. Bitte, Milva.«
»Nach der Revolte auf Thanedd«, begann sie, nachdem sie einen Augenblick gewartet hatte, »fing es überall an zu brodeln. Sie fingen an, Jagd auf Verräter zu machen. Vor allem auf jene Zauberer, die auf Seiten Nilfgaards standen, und auch auf andere, die sich verkauft hatten. Manche wurden ergriffen. Andere verschwanden spurlos. Man braucht nicht besonders schlau zu sein, um zu erraten, wohin sie gegangen sind, unter wessen Fittichen sie sich verborgen haben. Doch nicht nur auf Zauberer und Verräter wurde Jagd gemacht. Bei der Rebellion auf Thanedd war den aufständischen Zauberern ein Eichhörnchen-Kommando zu Hilfe gekommen, angeführt von dem berühmten Faoiltiarna. Nach ihm wird gesucht. Es ist befohlen, jeden gefangenen Elfen unter der Folter nach dem Kommando Faoiltiarnas zu befragen.«
»Wer ist dieser Faoiltiarna?«
»Ein Elf, ein Scioa’tael. Er hat den Menschen wie kaum ein andrer zugesetzt. Es steht ein hoher Preis auf seinen Kopf. Aber nicht nur ihn suchen sie. Auch einen Nilfgaarder Ritter, der auf Thanedd war. Und dann noch …«
»Sprich.«
»Die Aan’brengar fragen nach einem Hexer namens Geralt von Riva. Und nach einem Mädchen namens Cirilla. Es ist befohlen, diese beiden lebendig zu ergreifen. Es ist bei Todesstrafe verboten, beiden auch nur ein Haar zu krümmen, kein Knopf darf ihnen vom Rock gerissen werden. Ha! Du musst ihnen sehr am Herzen liegen, wenn sie sich so um deine Gesundheit sorgen …«
Sie hielt inne, als sie seinen Gesichtsausdruck sah, aus dem die unmenschliche Ruhe auf einen Schlag verschwunden war. Ihr wurde klar, dass es ihr bei aller Mühe nicht gelungen war, ihm Angst einzujagen. Zumindest nicht um die eigene Haut. Unerwartet verspürte sie Scham.
»Nun ja, was diese Verfolgung angeht, so ist das jedenfalls vertane Müh«, sagte sie freundlicher, aber immer noch mit einem leicht spöttischen Lächeln. »Im Brokilon bist du in Sicherheit. Und das Mädchen werden sie auch nicht lebendig kriegen. Als sie die Steinbrocken auf Thanedd durchgewühlt haben, die Trümmer von diesem magischen Turm … He, was ist mit dir?«
Der Hexer wankte, lehnte sich an eine Zeder, ließ sich schwer am Stamm herabsinken. Milva sprang zurück, über die Blässe erschrocken, die plötzlich sein Gesicht überzog.
»Aglaïs! Sirssa! Fauve! Zu mir, schnell! Verdammt, der will anscheinend die Mücke machen! He, du!«
»Ruf sie nicht … Es ist nichts … Sprich. Ich will es wissen …«
Auf einmal begriff Milva.
»Nichts haben sie in dem Trümmerhaufen gefunden!«, schrie sie und fühlte, wie sie ebenfalls erbleichte. »Nichts! Obwohl sie jeden Stein umgedreht und Zaubersprüche gewirkt haben, haben sie nichts gefunden …«
Sie wischte sich den Schweiß von den Brauen, hielt mit einer Handbewegung die herbeieilenden Dryaden zurück. Sie packte den sitzenden Hexer bei den Schultern, beugte sich so über ihn, dass ihre langen hellen Haare auf sein erbleichtes Gesicht fielen.
»Du hast mich nicht richtig verstanden«, wiederholte sie schnell, stockend, fand mit Mühe die Worte unter all denen, die aus ihr herausdrängten. »Ich wollte nur sagen, dass … Du hast mich falsch verstanden. Weil ich … Woher sollte ich denn wissen, dass du so sehr … Das hab ich nicht gewollt. Ich meinte nur, dass dieses Mädchen … dass sie nicht gefunden worden ist, weil sie spurlos verschwunden ist, wie diese Zauberer … Verzeih mir.«
Er gab keine Antwort. Blickte zur Seite. Milva biss sich auf die Lippen, ballte die Fäuste. »In drei Tagen verlass ich den Brokilon«, sagte sie freundlich nach langem, sehr langem Schweigen. »Der Mond soll noch ein bisschen abnehmen, die Nacht ein bisschen dunkler werden. Bis zum zehnten Tag komm ich zurück, vielleicht früher. Gleich nach Lammas, Anfang August. Mach dir keine Sorgen. Ich werd Himmel und Hölle in Bewegung setzen, alles herausfinden. Wenn jemand etwas von diesem Fräulein weiß, wirst du es erfahren.«
»Danke, Milva.«
»Bis in zehn Tagen … Gwynbleidd.«
»Ich bin Geralt.« Er streckte die Hand aus. Sie drückte sie, ohne zu zögern. Sehr kräftig.
»Ich bin Maria Barring.«
Mit einem Kopfnicken und der Andeutung eines Lächelns dankte er ihr für die Offenheit; sie wusste, dass er sie schätzte.
»Sei bitte vorsichtig. Wenn du Fragen stellst, dann achte darauf, wem.«
»Mach dir um mich keine Sorgen.«
»Deine Gewährsleute … Vertraust du ihnen?«
»Ich traue niemandem.«
»Der Hexer ist im Brokilon. Bei den Dryaden.«
»Das dachte ich mir.« Dijkstra verschränkte die Arme vor der Brust. »Aber es ist gut, dass ich die Bestätigung habe.«
Er schwieg eine Weile. Lennep leckte sich die Lippen. Er wartete.
»Gut, dass ich die Bestätigung habe«, wiederholte der Geheimdienstchef von Redanien nachdenklich, als spreche er mit sich selbst. »Gewissheit ist immer besser. Ach, und wenn sich noch erweisen würde, dass Yennefer bei ihm ist … Ist keine Zauberin bei ihm, Lennep?«
»Wie bitte?« Der Kundschafter zuckte zusammen. »Nein, edler Herr. Keine. Was befehlt Ihr? Wenn Ihr ihn lebendig haben wollt, locke ich ihn aus dem Brokilon. Wenn er Euch aber tot lieber ist …«
»Lennep.« Dijkstra hob den Blick seiner kalten blassblauen Augen zu dem Agenten. »Sei nicht übereifrig. In unserer Branche macht sich Übereifer niemals bezahlt. Und er ist immer verdächtig.«
»Herr …« Lennep wurde etwas blass. »Ich wollte nur …«
»Ich weiß. Du wolltest nur wissen, was ich befehle. Ich befehle, den Hexer in Ruhe zu lassen.«
»Zu Befehl. Und was ist mit Milva?«
»Die lässt du auch in Ruhe. Vorläufig.«
»Zu Befehl. Kann ich gehen?«
»Du kannst.«
Der Agent verließ das Zimmer, schloss vorsichtig und fein leise die Eichentür hinter sich. Dijkstra schwieg lange, den Blick auf die Karten, Briefe, Berichte, Verhörprotokolle und Todesurteile geheftet, die sich auf dem Tisch türmten.
»Ori.«
Der Sekretär hob den Kopf, räusperte sich. Er schwieg.
»Der Hexer ist im Brokilon.«
Ori Reuven räusperte sich abermals, schaute instinktiv unter den Tisch, zu den Beinen des Chefs hin.
Dijkstra bemerkte den Blick. »Stimmt. Das werde ich ihm nicht vergessen«, knurrte er. »Zwei Wochen lang konnte ich seinetwegen nicht gehen. Ich habe vor Philippa das Gesicht verloren, musste wie ein Hund winseln und sie um ihre verdammten Zaubereien bitten, sonst würde ich heute noch hinken. Na ja, ich bin selber schuld, habe ihn unterschätzt. Am schlimmsten ist, dass ich jetzt nicht an seinen Hexerarsch herankommen und mich bei ihm revanchieren kann! Ich selbst habe keine Zeit, und für Privatangelegenheiten kann ich schließlich nicht meine Leute benutzen! Nicht wahr, Ori, das kann ich nicht?«
»Ä-häm …«
»Krächze nicht. Ich weiß. Ach, zum Teufel, wie verlockend diese Macht ist! Wie es einen juckt, sie zu gebrauchen! Wie leicht man sich vergisst, wenn man sie hat! Aber wenn man sich einmal vergisst, hat es kein Ende … Sitzt Philippa Eilhart immer noch in Montecalvo?«
»Ja.«
»Nimm Feder und Tinte. Ich werde dir einen Brief an sie diktieren. Schreib … Verdammt, ich kann mich nicht konzentrieren. Was ist das für ein verdammtes Geschrei, Ori? Was geht da auf dem Platz vor sich?«
»Straßenjungen werfen Steine auf die Residenz des Nilfgaarder Gesandten. Wir haben sie dafür bezahlt, ä-häm, wie mir scheint.«
»Aha. Gut. Mach das Fenster zu. Morgen sollen die Jungen die Bankfiliale des Zwergs Giancardi bewerfen gehen. Er hat sich geweigert, mir die Konten offenzulegen.«
»Giancardi, ä-häm, hat eine erhebliche Summe in den Militärfonds eingezahlt.«
»Ha. Dann sollen sie die Banken bewerfen, die nicht gezahlt haben.«
»Alle haben gezahlt.«
»Ach, du bist fad, Ori. Schreib, sag ich. Geliebte Phil, Sonne meiner … Verdammt, andauernd vergesse ich mich. Nimm einen neuen Bogen. Bereit?«
»Jawohl, ä-häm.«
»Liebe Philippa. Frau Triss Merigold macht sich sicherlich Sorgen um den Hexer, den sie von Thanedd in den Brokilon teleportiert hat, wobei sie daraus ein großes Geheimnis gemacht hat, sogar vor mir, was mich schrecklich schmerzte. Beruhige sie. Dem Hexer geht es gut. Er hat sogar schon begonnen, aus dem Brokilon Emissärinnen auszusenden, damit sie nach Spuren der Fürstentochter Cirilla Ausschau halten, des Persönchens, das dich doch so lebhaft interessiert. Unser Freund Geralt weiß offensichtlich nicht, dass sich Cirilla in Nilfgaard befindet, wo man sie auf die Heirat mit Kaiser Emhyr vorbereitet. Mir ist daran gelegen, dass der Hexer ruhig im Brokilon sitzt, daher werde ich auch dafür sorgen, dass diese Nachricht zu ihm dringt. Hast du das?«
»Ä-häm, zu ihm dringt.«
»Absatz. Ich frage mich … Ori, wisch die Feder ab, zum Kuckuck! Wir schreiben an Philippa, nicht an den königlichen Rat, der Brief muss ästhetisch aussehen! Absatz. Ich frage mich, warum der Hexer keinen Kontakt zu Yennefer sucht. Ich will nicht glauben, dass dieser an Besessenheit grenzende Affekt so plötzlich erloschen ist, unabhängig von den politischen Optionen seines Ideals. Andererseits, wenn es Yennefer wäre, die Cirilla an Emhyr ausgeliefert hat, und wenn es dafür Beweise gäbe, dann würde ich liebend gern dafür sorgen, dass der Hexer sie in die Finger bekommt. Das Problem würde sich von selbst lösen, dessen bin ich mir sicher, und die verräterische schwarzhaarige Schönheit wäre keinen Tag und keine Stunde mehr sicher. Der Hexer mag es nicht, wenn jemand sein Mädchen antastet, Artaud Terranova hat sich davon auf Thanedd nachhaltig überzeugt. Ich möchte glauben, Phil, dass Du keine Beweise für einen Verrat Yennefers hast und nicht weißt, wo sie sich verborgen hält. Es würde mich sehr schmerzen, wenn sich herausstellte, dass das wieder ein Geheimnis ist, das Du vor mir verbirgst. Ich habe vor Dir keine Geheimnisse … Was gibt es da zu lachen, Ori?«
»Nichts, ä-häm.«
»Schreib! Ich habe vor Dir keine Geheimnisse, Phil, und rechne auf Gegenseitigkeit. Ich verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung, et cetera, et cetera. Gib her, ich unterschreibe.«
Ori Reuven streute Sand auf den Brief.
Dijkstra setzte sich zurecht, drehte die Daumen der vor der Brust verschränkten Hände. »Diese Milva, die der Hexer zum Spionieren ausschickt«, begann er. »Was kannst du mir über sie sagen?«
»Sie befasst sich, ä-häm«, krächzte der Sekretär, »damit, Gruppen von Scioa’tael in den Brokilon zu bringen, die von den temerischen Truppen zerschlagen worden sind. Sie führt die Elfen aus Razzien und Umzingelungen heraus, ermöglicht es ihnen, sich zu erholen und sich wieder zu Kampfkommandos zu formieren …«
»Lass mich mit Informationen in Frieden, die allgemein zugänglich sind«, fiel ihm Dijkstra ins Wort. »Milvas Tätigkeit ist mir bekannt, ich habe übrigens vor, sie für meine Zwecke zu nutzen. Andernfalls hätte ich sie den Temeriern längst zum Fraß vorgeworfen. Was kannst du mir über sie selbst sagen? Über Milva als solche?«
»Sie stammt, glaube ich, aus irgendeinem Kuhdorf in Obersodden. In Wahrheit heißt sie Maria Barring. Milva ist ein Spitzname, den ihr die Dryaden gegeben haben. In der Älteren Rede bedeutet er …«
»Weihe«, unterbrach ihn Dijkstra. »Der Vogel. Ich weiß.«
»Ihre Leute sind von alters her Jäger. Waldvolk, auf du und du mit dem Jagdrevier. Als den Sohn des alten Barring ein Elch niedergestampft hatte, hat der Alte seiner Tochter das Waidwerk beigebracht. Als er starb, hat die Mutter wieder geheiratet. Ä-häm … Maria vertrug sich nicht mit dem Stiefvater und lief von zu Hause weg. Damals war sie, glaube ich, sechzehn. Sie wanderte nach Norden, lebte von der Jagd, aber die Förster der Barone machten ihr das Leben schwer, jagten sie selber wie ein Tier. Also begann sie im Brokilon zu wildern, und dort, ä-häm, erwischten sie die Dryaden.«
»Und statt sie kaltzumachen, haben sie sie bei sich aufgenommen«, murmelte Dijkstra. »Haben sie als ihresgleichen anerkannt … Und sie zeigte sich erkenntlich. Sie schloss einen Pakt mit der Hexe vom Brokilon, mit der alten Silberäugigen Eithné. Maria Barring ist tot, es lebe Milva … Wie viele Expeditionstruppen hat sie erledigt, ehe die in Verden und Kerack etwas merkten? Drei?«
»Ä-häm … Vier, glaube ich …« Immerzu glaubte Ori Reuven etwas, obwohl sein Gedächtnis unfehlbar war. »Alles in allem waren es an die hundert Leute, diejenigen, die besonders scharf auf Scheuweib-Skalpe waren. Aber es dauerte lange, bis sie es merkten, denn Milva trug gelegentlich einen von den Verwundeten auf dem eigenen Rücken aus dem Gemetzel, und der Gerettete lobte ihren Mut in den höchsten Tönen. Erst nach dem vierten Mal, in Verden, glaube ich, schlug sich jemand an die Stirn. Wie kommt es denn, fragte man sich plötzlich, ä-häm, dass die Pfadfinderin, die die Leute gegen die Scheuweiber führt, jedes Mal mit dem Leben davonkommt? Und da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen, dass die Pfadfinderin sie führt, aber ins Verderben, geradewegs vor die Pfeile der im Hinterhalt wartenden Dryaden …«
Dijkstra schob ein Verhörprotokoll an den Rand des Schreibtischs, denn es kam ihm so vor, als röche das Pergament noch immer nach der Folterkammer.
»Und da«, erriet er, »verschwand Milva im Brokilon wie fortgeblasen. Aber bis heute ist es in Verden schwer, Freiwillige für Expeditionen gegen die Dryaden zu finden. Die alte Eithné und die junge Weihe haben eine tüchtige Auslese getroffen. Und da wagen sie zu behaupten, wir, die Menschen, hätten die Provokation erfunden. Es sei denn …«
»Ä-häm?«, begann Ori Reuven zu krächzen, verwundert über den abgebrochenen Satz und das lange Schweigen seines Chefs.
»Es sei denn, sie haben schließlich begonnen, von uns zu lernen«, schloss der Spion kalt und schaute auf die Denunziationen, Verhörprotokolle und Todesurteile.
Als sie nirgends Schweiß sah, wurde Milva allmählich unruhig. Plötzlich fiel ihr ein, dass der Bock im Augenblick des Schusses einen Schritt gemacht hatte. Oder machen wollte, das kam auf dasselbe heraus. Er hatte sich bewegt, und der Pfeil konnte in den Bauch gegangen sein. Milva fluchte. Ein Schuss in den Bauch, Schimpf und Schande für den Jäger! Pech! Toi-toi-toi!
Rasch lief sie zum Hang des Talkessels, schaute sich aufmerksam zwischen den Brombeeren, Moosen und Farnen um. Sie suchte den Pfeil. Mit einer Spitze versehen, deren vier Schneiden derart scharf geschliffen waren, dass man die Haare am Unterarm damit abrasieren konnte, musste der Pfeil bei einem Schuss aus fünfzig Schritt Entfernung den Bock glatt durchschlagen haben.
Schließlich sah sie ihn, hob ihn auf und atmete erleichtert auf, spuckte dreimal aus. Sie hatte sich umsonst Sorgen gemacht, es war sogar besser als angenommen. An dem Pfeil klebte kein schmieriger und übel riechender Mageninhalt. Es gab auch keine Spuren von hellem, schaumigem rosa Lungenblut. Der Schaft war zur Gänze mit einem dunklen, kräftigen Rot überzogen. Die Pfeilspitze hatte das Herz durchbohrt. Milva brauchte sich nicht anzuschleichen, es erwartete sie kein langer Fußmarsch auf der Fährte. Der Bock lag zweifellos tot im Unterholz, höchstens hundert Schritt von der Lichtung entfernt, an einer Stelle, die ihr der Schweiß verraten würde. Und ein ins Herz getroffener Bock musste nach ein paar Sprüngen Schweiß verlieren, sie wusste also, dass sie die Fährte leicht finden würde.
Nach zehn Schritten fand sie sie, folgte ihr und gab sich abermals ihren Gedanken und Erinnerungen hin.
Sie hielt das Versprechen, das sie dem Hexer gegeben hatte. In den Brokilon war sie sogar noch früher als versprochen zurückgekehrt, fünf Tage nach dem Erntefest, fünf Tage nach dem Neumond, mit dem bei den Menschen der Monat August beginnt und bei den Elfen Lammas, der siebte, vorletzte savaed des Jahres.
Sie durchquerte das Bandwasser bei Tagesanbruch, zusammen mit fünf Elfen. Das Kommando, das sie führte, hatte anfangs neun Reiter gezählt, doch die Söldner aus Brugge waren ihnen die ganze Zeit auf den Fersen gewesen, drei Tagesmärsche vom Bandwasser entfernt hatten sie sie eingeholt und waren erst am Bandwasser zurückgeblieben, als im morgendlichen Dunst vom rechten Ufer der Brokilon winkte. Das hatte die Elfen gerettet. Sie hatten das andere Ufer erreicht. Entkräftet, verwundet. Und nicht alle.
Sie hatte Nachrichten für den Hexer, doch sie war überzeugt, er befinde sich noch immer in Col Serrai. Sie gedachte erst gegen Mittag zu ihm zu gehen, nachdem sie sich ordentlich ausgeschlafen hatte. Sie staunte, als er plötzlich wie ein Geist aus dem Nebel hervortrat. Wortlos setzte er sich neben sie, schaute zu, wie sie sich ein Lager bereitete, die Decke über den Haufen von Zweigen legte.
»Du hast es vielleicht eilig«, sagte sie vorwurfsvoll. »Hexer, ich kann mich kaum auf den Beinen halten. Tag und Nacht im Sattel, ich spür meinen Hintern nicht mehr, und ich bin durchgeweicht bis auf die Knochen, weil wir uns vor Tagesanbruch wie die Wölfe zwischen den Wasserweiden durchgeschlagen haben …«
»Ich bitte dich. Hast du etwas erfahren?«
»Hab ich«, fauchte sie, während sie die durchnässten, widerspenstigen Stiefel aufschnürte und auszog. »Ohne große Mühe, weil alle Welt davon spricht. Dass dein Fräulein so ein großes Tier ist, hast du mir nicht gesagt! Ich dachte, deine Stieftochter, irgend so ein armes Mädchen, eine Waise, der das Schicksal nicht gnädig war. Und siehe da: eine Prinzessin von Cintra! Ha! Bist du vielleicht auch ein verkleideter Fürst?«
»Sprich bitte.«
»Die Könige werden sie nicht mehr in die Hände kriegen, weil deine Cirilla, wie sich herausstellt, von Thanedd geradewegs nach Nilfgaard geflohen ist, sicherlich zusammen mit diesen Zauberern, die Verrat geübt haben. In Nilfgaard hat Kaiser Emhyr sie mit Pomp empfangen. Und weißt du was? Er ist sogar auf den Gedanken verfallen, sie zu heiraten. Und jetzt will ich mich ausruhen. Wenn du willst, reden wir weiter, wenn ich mich ausgeschlafen hab.«
Der Hexer schwieg. Milva hängte die nassen Fußlappen so an einem gegabelten Zweig auf, dass die aufgehende Sonne darauffallen würde, und löste die Gürtelschnalle.
»Ich will mich ausziehen«, knurrte sie. »Was stehst du hier noch rum? Bessre Neuigkeiten hast du doch wohl nicht erwarten können? Dir droht keine Gefahr mehr, niemand fragt nach dir, die Spitzel werden sich nicht mehr um dich kümmern. Und dein Mädchen ist den Königen entkommen, wird Kaiserin …«
»Ist das eine sichere Nachricht?«
»Nichts ist heutzutage sicher.« Sie gähnte, setzte sich auf das Lager. »Höchstens, dass die liebe Sonne jeden Tag von Osten nach Westen über den Himmel wandert. Aber was sie über den Kaiser von Nilfgaard und die Prinzessin von Cintra reden, muss wahr sein. Alle reden davon.«
»Wieso auf einmal?«
»Das musst du doch wissen! Sie bringt dem Kaiser Emhyr ja als Mitgift einen mächtigen Brocken Land mit! Nicht nur Cintra, auch auf dieser Seite der Jaruga! Ha, das wird ja auch meine Herrin sein, denn ich bin aus Obersodden, und ganz Sodden, wie sich zeigt, ist ihr lehnspflichtig! Pah, wenn ich in ihren Wäldern einen Hirsch erleg und sie mich erwischen, werden sie mich auf ihren Befehl aufhängen … Was für eine elende Welt! Verdammt, mir fallen die Augen zu …«
»Nur noch eine Frage. Von diesen Zauberinnen … das heißt, von diesen Zauberern, die Verrat geübt haben – ist von denen jemand gefasst worden?«
»Nein. Aber eine Magierin soll sich das Leben genommen haben. Kurz nachdem Vengerberg gefallen ist und die Truppen von Kaedwen in Aedirn einmarschiert sind. Gewiss aus Gram oder aus Angst vor der Hinrichtung …«
»Bei dem Kommando, das du hergeführt hast, gab es ledige Pferde. Ob mir die Elfen eins geben werden?«
»Aha, du hast es eilig aufzubrechen«, murmelte sie, während sie sich in die Decke wickelte. »Ich denk mir, ich weiß, wohin …«
Sie verstummte, von seinem Gesichtsausdruck überrascht. Plötzlich begriff sie, dass die Nachricht, die sie gebracht hatte, alles andere als gut war. Plötzlich begriff sie, dass sie nichts, ganz und gar nichts verstand. Plötzlich, unerwartet, aus heiterem Himmel verspürte sie Lust, sich vor ihm hinzusetzen, ihn mit Fragen zu überschütten, ihn auszufragen, etwas zu erfahren, vielleicht ihm einen Rat zu geben … Sie rieb sich heftig mit einem Fingerknöchel den Augenwinkel. Ich bin entkräftet, dachte sie, der Tod ist mir die ganze Nacht auf dem Fuße gefolgt. Ich muss mich ausruhen. Was gehen mich seine Sorgen und Kümmernisse an? Zum Teufel mit ihm und mit ihr! Verdammt, wegen alledem ist mir der Schlaf ganz vergangen …
Der Hexer stand auf. »Werden sie mir ein Pferd geben?«, wiederholte er.
»Nimm, welches du willst«, sagte sie nach einer Weile. »Den Elfen komm lieber nicht unter die Augen. Man hat uns beim Übergang hart zugesetzt, es hat Blut gekostet … Nur den Rappen rühr nicht an, der gehört mir … Was stehst du noch da?«
»Ich danke dir für die Hilfe. Für alles.«
Sie antwortete nicht.
»Ich schulde dir etwas. Wie kann ich mich revanchieren?«
»Wie? Na, indem du endlich deiner Wege gehst!«, schrie sie, stemmte sich auf dem Ellenbogen hoch und riss heftig an der Decke. »Ich … ich muss mich ausschlafen! Nimm ein Pferd … und reit. Nach Nilfgaard, in die Hölle, zum Teufel, mir ist es gleich! Geh weg! Lass mich in Ruhe!«
»Ich werde bezahlen, was ich dir schulde«, sagte er leise. »Ich werde es nicht vergessen. Vielleicht geschieht es einmal, dass du Hilfe brauchst. Einen Halt. Eine Schulter. Dann schrei, schrei in die Nacht. Und ich werde kommen.«
Der Bock lag am Rande eines Hangs, der von sprudelnden Quellen schwammig und dicht mit Farnen überwachsen war; er lag ausgestreckt da, das glasige Auge gen Himmel gerichtet. Milva sah die großen Zecken, die sich an seinem hellbraun-gelblichen Bauch festgesogen hatten.
»Ihr werdet euch anderes Blut suchen müssen, Würmchen«, murmelte sie, während sie die Ärmel hochkrempelte und das Messer hervorholte. »Denn dieses hier gerinnt schon.«
Mit einer geübten, schnellen Bewegung schnitt sie die Decke von der Brust bis zum Waidloch auf, wobei sie die Klinge geschickt um die Geschlechtsorgane herumführte. Vorsichtig teilte sie die Fettschicht, besudelte sich die Arme bis zu den Ellenbogen, als sie den Schlund durchtrennte und den Aufbruch heraushob. Sie schnitt den Magen und die Gallenblase auf, um Bezoarsteine zu suchen. An deren magische Eigenschaften glaubte sie nicht, doch es fehlte nicht an Dummköpfen, die daran glaubten und dafür bezahlten.
Sie nahm den Bock auf und legte ihn auf einen umgestürzten Baumstamm in der Nähe, mit dem aufgetrennten Bauch nach unten, so dass das Blut ablaufen konnte. Sie wischte sich die Hände an der Oberseite des Farnkrautes ab.
Sie setzte sich neben die Beute.
»Besessener, wahnsinniger Hexer«, sagte sie leise, den Blick zu den hundert Schritt über ihr schwebenden Wipfeln der Brokilon-Fichten gerichtet. »Du brichst auf der Suche nach deinem Mädchen nach Nilfgaard auf. Brichst ans Ende der Welt auf, die in Flammen steht, und hast nicht mal daran gedacht, dich mit Wegzehrung zu versorgen. Ich weiß, dass du jemanden hast, für den du lebst. Aber hast du auch was, wovon du leben kannst?«
Die Fichten unterbrachen ihren Monolog natürlich nicht und kommentierten ihn nicht.
»Ich denk mir«, fuhr Milva fort, während sie mit dem Messer Blut unter den Fingernägeln hervorpolkte, »dass du überhaupt keine Chancen hast, dieses Fräulein von dir zu finden. Nicht nur, dass du nicht nach Nilfgaard kommst, du schaffst es nicht mal bis zur Jaruga. Ich denk mir, du kommst nicht mal nach Sodden. Ich denk mir, dass du dem Tode geweiht bist. Auf deinem zusammengepressten Mund steht er geschrieben, aus deinen widerwärtigen Augen schaut er hervor. Der Tod wird dich ereilen, wahnsinniger Hexer, und das schon bald. Aber dank diesem Böcklein wird es wenigstens nicht der Hungertod sein. Und das ist immerhin etwas. Denk ich mir.«
Beim Anblick des in den Audienzsaal tretenden Nilfgaarder Botschafters seufzte Dijkstra insgeheim. Shilard Fitz-Oesterlen, der Gesandte von Kaiser Emhyr var Emreis, hatte die Angewohnheit, Gespräche in der Sprache der Diplomatie zu führen, und flocht in seine Sätze mit Vorliebe pompöse Sprachungetüme ein, die nur Diplomaten und Gelehrten verständlich waren. Dijkstra hatte an der Oxenfurter Universität studiert und zwar keinen Magistergrad erlangt, kannte aber die Grundzüge des akademischen Jargons. Er benutzte ihn jedoch ungern, denn im tiefsten Inneren verabscheute er Pomp und alle Arten von prätentiöser Förmlichkeit.
»Ich grüße Euch, Exzellenz.«
»Herr Graf.« Shilard Fitz-Oesterlen verbeugte sich förmlich. »Ach, geruht bitte zu entschuldigen. Vielleicht sollte ich schon sagen: durchlauchtigster Fürst? Euer Hoheit Reichsregent? Euer Durchlaucht Staatssekretär? Bei meiner Ehre, Euer Hochwohlgeboren, die Würden regnen derart auf Euch herab, dass ich wahrlich nicht weiß, wie ich Euch titulieren soll, ohne das Protokoll zu verletzen.«
»Am besten wäre ›Euer königliche Gnaden‹«, erwiderte Dijkstra bescheiden. »Ihr wisst doch, Exzellenz, dass der Hof den König macht. Und es ist Euch sicherlich nicht unbekannt, dass ich nur zu rufen brauche: ›Springen!‹, und der Hof in Dreiberg fragt: ›Wie hoch?‹«
Der Botschafter wusste, dass Dijkstra übertrieb, aber gar nicht so sehr. Prinz Radowid war minderjährig, Königin Hedwig vom tragischen Tod ihres Gatten niedergedrückt, die Aristokratie verängstigt, kopflos, zerstritten und in Fraktionen gespalten. Die Regierung in Redanien lag de facto in den Händen Dijkstras, und Dijkstra hätte mühelos jede Würde erlangt, die er nur wollte. Doch Dijkstra wollte keine.
»Euer Hochwohlgeboren haben geruht, mich rufen zu lassen«, sagte der Botschafter nach einer Weile. »Unter Übergehung des Ministers für Auswärtige Angelegenheiten. Was verschafft mir diese Ehre?«
»Der Minister« – Dijkstra richtete den Blick zur Decke – »hat aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zur Verfügung gestellt.«
Der Botschafter nickte gewichtig. Er wusste nur zu gut, dass der Außenminister im Kerker saß, und da er ein Feigling und ein Idiot war, hatte er zweifellos schon beim Vorzeigen der Instrumente, das dem Verhör vorausging, alles über seine Konspiration mit dem Nilfgaarder Spionagedienst erzählt. Er wusste, dass das von Vattier de Rideaux, dem Spionagechef des Kaisers, aufgebaute Agentennetz zerschlagen worden war und dass Dijkstra alle Fäden in der Hand hielt. Er wusste auch, dass diese Fäden geraden Weges zu seiner Person führten. Doch seine Person wurde von der diplomatischen Immunität geschützt, und die Pflicht zwang ihn, das Spiel zu Ende zu führen. Insbesondere nach den seltsamen chiffrierten Anweisungen, die ihm Vattier und der Untersuchungsführer Stefan Skellen geschickt hatten, der kaiserliche Agent für Sonderaufgaben.
»Da ein Nachfolger noch nicht ernannt ist«, fuhr Dijkstra fort, »ist es mir eine überaus unangenehme Pflicht, Euch wissen zu lassen, dass Euer Exzellenz im Königreich Redanien zur Persona non grata erklärt worden ist.«
Der Botschafter verneigte sich. »Ich bedaure es«, sagte er, »dass die in der wechselseitigen Abberufung der Botschafter resultierenden Diffidenzen aus Angelegenheiten entspringen, die weder das Königreich Redanien noch das Kaiserreich Nilfgaard unmittelbar betreffen. Das Kaiserreich hat keinerlei feindselige Akte gegen Redanien unternommen.«
»Abgesehen von der Blockade der Jarugamündung und der Skellige-Inseln für unsere Schiffe und Waren. Abgesehen von der Bewaffnung und Unterstützung der Scioa’tael-Banden.«
»Das sind Unterstellungen.«
»Und die Konzentration der kaiserlichen Truppen in Verden und Cintra? Die Überfälle bewaffneter Banden auf Sodden und Brugge? Sodden und Brugge stehen unter dem Schutz von Temerien, wir jedoch sind mit Temerien verbündet, Exzellenz, Angriffe auf Temerien sind Angriffe auf uns. Es bleiben auch Angelegenheiten, die Redanien direkt betreffen: die Rebellion auf der Insel Thanedd und der verbrecherische Anschlag auf König Wisimir. Und die Frage der Rolle, die das Kaiserreich bei diesen Ereignissen gespielt hat.«
»Quod attinet den Zwischenfall auf Thanedd« – der Botschafter breitete die Arme aus –, »bin ich nicht ermächtigt, eine Ansicht zu äußern. Seiner Kaiserlichen Majestät Emhyr var Emreis sind die Hintergründe der privaten Fehden zwischen euren Zauberern fremd. Ich bedaure die Tatsache, dass unsere Proteste gegen eine Propaganda, die etwas anderes suggeriert, keine nennenswerte Wirkung gezeigt haben. Einer Propaganda, die, wie ich anzumerken wage, nicht ohne das Zutun höchster Kreise des Königreiches Redanien verbreitet wird.«
»Eure Proteste kommen überraschend und sind überaus verwunderlich.« Dijkstra deutete ein Lächeln an. »Immerhin verhehlt der Kaiser nicht im Mindesten die Tatsache, dass sich an seinem Hofe eine Herzogin von Cintra aufhält, die just von Thanedd entführt wurde.«
»Cirilla, die Königin von Cintra«, berichtigte ihn Shilard Fitz-Oesterlen nachdrücklich, »ist nicht entführt worden, sondern hat im Kaiserreich um Asyl nachgesucht. Mit dem Zwischenfall auf Thanedd hat das nichts zu tun.«
»Wirklich nicht?«
»Der Zwischenfall auf Thanedd«, fuhr der Botschafter mit steinerner Miene fort, »hat beim Kaiser Missbehagen ausgelöst. Und der heimtückische, von einem Wahnsinnigen ausgeführte Anschlag auf das Leben König Wisimirs hat seine aufrichtige und lebhafte Abscheu erregt. Noch größere Abscheu ruft indes das in der Öffentlichkeit verbreitete widerwärtige Gerücht hervor, das es wagt, die Anstifter dieses Verbrechens im Kaiserreich zu suchen.«
»Die Ergreifung der wahren Anstifter«, sagte Dijkstra langsam, »wird den Gerüchten ein Ende bereiten, wie wir hoffen wollen. Doch ihre Ergreifung und gerechte Aburteilung ist eine Frage der Zeit.«
»Justitia fundamentum regnorum«, pflichtete ihm Shilard Fitz-Oesterlen gewichtig bei. »Und crimen horribilis non potest non esse punibile. Ich versichere, dass Seine Kaiserliche Majestät ebenfalls wünscht, dass es so geschehen möge.«
»Es liegt in der Macht des Kaisers, diesen Wunsch zu erfüllen«, warf Dijkstra wie widerwillig hin und verschränkte die Arme vor der Brust. »Eine der Anführerinnen der Verschwörung, Enid an Gleanna, bis vor Kurzem die Zauberin Francesca Findabair, spielt sich als Königin von des Kaisers Gnaden eines Marionettenstaates der Elfen in Dol Blathanna auf.«
»Seine Kaiserliche Majestät« – der Botschafter verneigte sich steif – »kann sich nicht in die Angelegenheiten von Dol Blathanna einmischen, eines unabhängigen Königreiches, das von allen Nachbarländern anerkannt ist.«
»Aber nicht von Redanien. Für Redanien ist Dol Blathanna weiterhin ein Teil des Königreichs Aedirn. Obwohl ihr Aedirn im Verein mit den Elfen und mit Kaedwen in Teile zerlegt habt, obwohl von Lyrien kein lapis super lapidem geblieben ist, habt ihr diese Königreiche voreilig von der Karte der Welt gestrichen. Voreilig, Euer Exzellenz. Doch dies sind nicht Zeit und Ort, um darüber zu diskutieren. Soll Francesca Findabair vorerst die Königin mimen, die Zeit der Gerechtigkeit wird kommen. Aber was ist mit den anderen Aufständischen und Organisatoren des Anschlags auf König Wisimir? Was ist mit Vilgefortz von Roggeveen, was mit Yennefer von Vengerberg? Es besteht Grund zu der Annahme, dass sie nach dem Scheitern des Putsches beide nach Nilfgaard geflohen sind.«
»Ich versichere« – der Botschafter hob den Kopf –, »dass dem nicht so ist. Und wenn es dazu kommen sollte, so garantiere ich, dass sie der Strafe nicht entgehen werden.«
»Nicht euch gegenüber haben sie sich schuldig gemacht, nicht euch obliegt es also, sie zu bestrafen. Den aufrichtigen Wunsch nach Gerechtigkeit, die ja das fundamentum regnorum ist, würde Kaiser Emhyr unter Beweis stellen, indem er uns die Verbrecher auslieferte.«
»Man kann Eurem Wunsch die Berechtigung nicht absprechen«, gab Shilard Fitz-Oesterlen zu und täuschte ein bekümmertes Lächeln vor. »Die genannten Personen befinden sich jedoch nicht im Kaiserreich, dies primo. Secundo, selbst wenn sie uns unterkämen, besteht ein Impediment. Eine Auslieferung erfolgt aufgrund eines Gerichtsurteils, das in diesem Fall vom kaiserlichen Rat zu fällen wäre. Beachtet, Euer Hochwohlgeboren, dass der Abbruch der diplomatischen Beziehungen durch Redanien ein feindseliger Akt ist, und man kann schwerlich damit rechnen, dass der Rat für die Auslieferung von Asyl suchenden Personen stimmt, wenn die Auslieferung von einem feindseligen Land verlangt wird. Das wäre ein Fall ohne jede Präzedenz … Es sei denn …«
»Es sei denn was?«
»Man schüfe solch einen Präzedenzfall.«
»Ich verstehe nicht.«
»Wenn das Königreich Redanien bereit wäre, dem Kaiser seinen Untertanen auszuliefern, einen hier festgesetzten gemeinen Verbrecher, dann hätten der Kaiser und sein Rat Anlass, diese Geste guten Willens zu erwidern.«
Dijkstra schwieg lange, er machte den Eindruck, er döse vor sich hin oder denke nach. »Um wen handelt es sich?«
»Der Name des Verbrechers …« Der Botschafter tat so, als versuche er sich zu erinnern, schließlich holte er aus einem Mäppchen aus Saffianleder ein Dokument hervor. »Verzeiht, memoria fragilis est … Ich hab’s. Ein gewisser Cahir Mawr Dyffryn aep Ceallach. Gegen ihn liegen schwere Anschuldigungen vor. Er wird wegen Mordes gesucht, Fahnenflucht, raptus puellae, Vergewaltigung, Diebstahl und Urkundenfälschung. Vor dem Zorn des Kaisers ist er ins Ausland geflohen.«
»Nach Redanien? Da hat er sich einen weiten Weg gesucht.«
»Euer Hochwohlgeboren«, sagte Shilard Fitz-Oesterlen mit einem leichten Lächeln, »beschränken Ihre Interessen ja nicht auf Redanien. Ich habe nicht den Schatten eines Zweifels, dass, sollte dieser Verbrecher in irgendeinem der verbündeten Königreiche ergriffen werden, Euer Hochwohlgeboren davon aus den Berichten Eurer zahlreichen … Bekannten erfahren würden.«
»Wie, sagtet Ihr, heißt dieser Verbrecher?«
»Cahir Mawr Dyffryn aep Ceallach.«
Dijkstra schwieg lange und tat so, als suche er in seiner Erinnerung.
»Nein«, sagte er schließlich. »Es wurde niemand dieses Namens verhaftet.«
»Wirklich nicht?«
»Meine memoria pflegt in solchen Dingen nicht fragilis zu sein. Es tut mir leid, Exzellenz.«
»Mir ebenfalls«, erwiderte Shilard Fitz-Oesterlen in eisigem Ton. »Zumal eine wechselseitige Auslieferung von Verbrechern unter diesen Umständen nicht durchzuführen sein dürfte. Ich werde Euer Gnaden nicht länger zur Last fallen. Ich wünsche Gesundheit und Erfolg.«
»Gleichfalls. Lebt wohl, Exzellenz.«
Der Botschafter ging aus dem Zimmer, nachdem er ein paar komplizierte förmliche Verbeugungen ausgeführt hatte.
»Leck mich am sempiternum meam, Schlauberger«, murmelte Dijkstra und kreuzte die Arme vor der Brust. »Ori! Komm raus!«
Rot angelaufen vom lange unterdrückten Krächzen und Husten trat der Sekretär hinter der Portiere hervor.
»Sitzt Philippa immer noch in Montecalvo?«
»Ja, ä-häm. Bei ihr sind die Damen Laux-Antille, Merigold und Metz.«
»In ein, zwei Tagen bricht der Krieg aus, jeden Augenblick kann die Grenze an der Jaruga in Flammen stehen, und die haben sich in irgendeinem Schlösschen in der Wildnis eingesponnen! Nimm die Feder, schreib. Geliebte Phil … Verdammt!«
»Ich habe ›Liebe Philippa‹ geschrieben.«
»Gut. Schreib weiter. Es interessiert Dich vielleicht, dass der dürre Kerl mit dem gefiederten Helm, der von Thanedd ebenso geheimnisvoll verschwunden ist, wie er aufgetaucht war, Cahir Mawr Dyffryn heißt und der Sohn des Seneschalls Ceallach ist. Dieses sonderbare Individuum suchen nicht nur wir, sondern auch der Geheimdienst von Vattier de Rideaux und die Leute dieses Hurensohns …«
»Frau Philippa, ä-häm, mag solche Wörter nicht. Ich habe geschrieben: ›dieser Kanaille‹.«