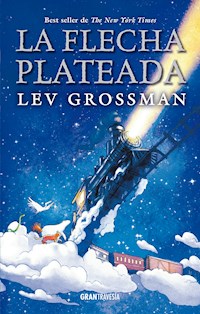9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Fillory
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
In der geheimen Welt des verborgenen Wissens hat die Macht einen schrecklich hohen Preis Quentin Coldwater steht kurz vor dem Abschluss der Highschool. Die Schule langweilt ihn – wie ihn eigentlich alles langweilt außer Fillory, das magische Land aus den phantastischen Büchern, die er liebt. Doch plötzlich findet sich Quentin, der gerade noch durch Brooklyn gelaufen ist, selbst in einer magischen Welt wieder, an einer geheimen Zauberschule: Brakebills College. Und auch Fillory gibt es wirklich. Aber es ist keine heile Welt, sondern ein düsterer Ort, von dem eine schreckliche Bedrohung ausgeht. Quentin und seine Freunde begeben sich auf eine gefährliche Reise – und müssen sich einem alles entscheidenden Kampf stellen… »Fillory verhält sich zu Harry Potter wie ein Glas Whiskey zu einem Becher dünnen Tees. Fest verankert sowohl in der Tradition des Fantasyromans als auch in der der allgemeinen Literatur, spielt er an auf die Welten von Oz und Narnia - auch Harry Potter lässt grüßen. Aber glauben Sie ja nicht, das sei ein Kinderbuch. Grossmans Gefühlswelten sind durch und durch erwachsen, seine Erzählweise düster, gefährlich und voller überraschender Wendungen. Hogwarts war nie so« George R. R. Martin, Das Lied von Eis und Feuer – A Game of Thrones
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 748
Ähnliche
Lev Grossman
Der Zauber von Fillory
Roman
Aus dem Amerikanischen von Stefanie Schäfer
Vignetten: Antje Keil
Fischer e-books
Für Lilly
So will ich meinen Stab zerbrechen,
Ihn etliche Klafter tief in die Erde vergraben,
Und tiefer als jemals ein Senkblei fiel,
Mein Zauberbuch im Meer versenken.
WILLIAM SHAKESPEARE,Der Sturm
Buch I
BROOKLYN
Quentin übte einen Zaubertrick und keiner bemerkte es.
Gemeinsam schlenderten sie den trostlosen, holprigen Bürgersteig entlang: James, Julia und Quentin. James und Julia gingen Hand in Hand. Daran würde er sich wohl gewöhnen müssen. Quentin trödelte hinter ihnen her, trotzig wie ein kleines Kind. Am liebsten wäre er mit Julia allein gewesen, oder für eine Weile sogar ganz allein, aber man konnte eben nicht alles haben. Darauf schien zu diesem Zeitpunkt jedenfalls alles hinzuweisen.
»Okay!«, rief James über die Schulter hinweg. »Q. Wie lautet unsere Strategie?«
James schien einen sechsten Sinn dafür zu haben, wenn Quentin in Selbstmitleid zu versinken drohte. Quentins Vorstellungsgespräch begann in sieben Minuten. James kam gleich nach ihm an die Reihe.
»Freundlicher, fester Händedruck. Häufiger Blickkontakt. Wenn er sich so richtig wohlfühlt, ziehst du ihm einen Stuhl über den Kopf und ich knacke sein Passwort und schreibe unter seiner E-Mail-Adresse nach Princeton.«
»Verhalte dich einfach ganz normal, Q«, riet Julia.
Ihr welliges dunkles Haar hatte sie im Nacken zu einem Knoten geschlungen. Dass sie immer so nett zu ihm war, machte es irgendwie noch schlimmer.
»Etwas anderes habe ich doch gar nicht vor, oder?«
Während er antwortete, übte Quentin erneut den Zaubertrick. Es war ein ganz einfacher Trick, ein einhändiger Grundkniff mit einer kleinen Münze. Er übte in seiner Manteltasche, damit keiner es sehen konnte. Er wiederholte ihn noch einmal, jetzt rückwärts.
»Ich wette, ich errate sein Passwort auf Anhieb«, behauptete James. »HappyTiger69.«
»Oder: BadKitty4U.«
»Denk dran, der Typ ist schon über fünfzig«, wandte Quentin ein. »Da kann sein Passwort nur password lauten, oder?«
Kaum zu glauben, wie lange das jetzt schon so geht, dachte Quentin. Sie waren erst siebzehn, aber er hatte das Gefühl, James und Julia schon seit einer Ewigkeit zu kennen. Es war Schicksal: Das Schulsystem in Brooklyn siebte die Begabten aus und pferchte sie zusammen. Von den einfach nur Begabten trennte es die absurd Brillanten und schloss diese zu einer Elitegruppe zusammen. Infolgedessen waren sie sich seit der Grundschule immer wieder bei den gleichen Rhetorik-Wettbewerben, regionalen Latein-Examen und exklusiven, speziell konzipierten, ultra-schweren Mathematik-Kursen begegnet. Die strebsamsten aller Streber. Die absoluten Nerds. Jetzt, in der Abschlussklasse, kannte Quentin James und Julia besser als irgendjemanden sonst auf der Welt, einschließlich seiner Eltern, und sie kannten wiederum ihn in- und auswendig. Jeder wusste, was der andere sagen wollte, bevor er es aussprach. Jeder hatte längst vorher gewusst, wer mit wem schlafen würde. Julia – die blasse, sommersprossige, verträumte Julia, die Oboe spielte und sogar mehr über Physik wusste als er – würde niemals mit Quentin schlafen.
Quentin war dünn und lang. Er besaß die Angewohnheit, die Schultern einzuziehen, in dem vergeblichen Versuch, sich gegen eine wie auch immer geartete Himmelskatastrophe zu wappnen, die logischerweise die Hochgewachsenen zuerst treffen würde. Sein schulterlanges Haar gefror in der Kälte zu klumpigen Strähnen. Er hätte nach dem Sport die Geduld aufbringen und es trocknen sollen, vor allem in Anbetracht seines heutigen Aufnahmegesprächs. Die tiefhängenden grauen Wolken verhießen Schnee. Quentin hatte den Eindruck, als inszeniere die Welt speziell für ihn kleine Stillleben der Trübsal: Krähen, die auf Stromleitungen hockten, zertretene Hundescheiße, vom Wind zerstreuter Müll und die Leichen unzähliger nasser Eichenblätter, die auf unzählige Arten von unzähligen Autos und Fußgängern geschändet worden waren.
»Gott, bin ich satt«, stöhnte James. »Ich habe zu viel gegessen. Warum muss ich mich immer so vollstopfen?«
»Weil du ein gieriges Ferkel bist?«, schlug Julia vor. »Weil du es satt hast, deine eigenen Füße zu sehen? Weil dein Bauch bis zum Penis runterhängen soll?«
James verschränkte die Hände hinter dem Kopf, die Finger im welligen, kastanienbraunen Haar, den kamelfarbenen Kaschmirmantel trotz der Novemberkälte weit geöffnet, und rülpste lautstark. Kälte schien ihm nie etwas anhaben zu können. Es war, als spüre er sie nicht. Quentin dagegen fror ständig, als sei er in seinem eigenen, persönlichen Winter gefangen.
James sang, zu einer Melodie irgendwo zwischen dem Weihnachtslied »Good King Wenceslas« und dem Kinderlied »Bingo«:
Es war einmal in alter Zeit
Ein Knab voll Stärke und Mut.
Er schwang ein Schwert und ritt ein Pferd
Und trug den Namen Knut.
»Oh nein!«, quietschte Julia. »Hör auf!«
James hatte das Lied vor Jahren für einen Talentwettbewerb in der Schule geschrieben. Er sang es immer noch gerne und mittlerweile konnten alle es längst im Schlaf. Julia schubste den ungerührt weitersingenden James gegen einen Mülleimer, und als das nicht half, zog sie ihm die Wollmütze ab und schlug ihm damit auf den Kopf.
»Meine Frisur! Meine schöne Bewerbungsfrisur!«
König James, dachte Quentin. Le roi s’amuse.
»Ich will euch ja nicht den Spaß verderben«, bemerkte er, »aber wir haben nur noch zwei Minuten.«
»Oh je, oh je!«, zwitscherte Julia. »Die Herzogin! Wir werden uns verspäten!«
Ich sollte glücklich sein, dachte Quentin. Ich bin jung, ich lebe, ich bin gesund. Meine Eltern sind ziemlich in Ordnung. Mein Vater gibt medizinische Fachliteratur heraus, meine Mutter arbeitet als Werbeillustratorin, auch wenn sie viel lieber Malerin geworden wäre. Ich bin ein etabliertes Mitglied der Mittel-Mittel-Klasse. Nur mein IQ ist höher, als es die meisten Leute überhaupt für möglich halten.
Und doch: Als er so in seinem schwarzen Mantel und seinem grauen Bewerbungsanzug die Fifth Avenue in Brooklyn entlangschlenderte, wusste Quentin, dass er nicht glücklich war. Aber warum nicht? Er hatte doch akribisch alle Ingredienzien des Glücks zusammengetragen. Er hatte die nötigen Rituale vollführt, die Kerzen angezündet, die Opfer gebracht. Doch das Glück weigerte sich zu erscheinen, wie ein ungehorsamer Geist. Ihm fiel nichts mehr ein, was er noch hätte unternehmen können.
Er folgte James und Julia vorbei an Kneipen, Waschsalons, hippen Boutiquen, Handygeschäften mit Neonbeleuchtung und einer Bar, in der alte Leute schon am frühen Nachmittag tranken. Sie passierten eine backsteinbraune Gedenkhalle für Kriegsveteranen mit Plastik-Gartenmöbeln auf dem Bürgersteig vor dem Eingang. Das alles untermauerte nur seine Überzeugung, dass sein wahres Leben, das, welches er eigentlich hätte leben sollen, durch eine kosmische Verwaltungspanne fehlgeleitet worden war. Es war woandershin gelenkt worden, hatte eine andere Person erwischt, und er hatte dafür dieses falsche Instantleben erhalten.
Vielleicht würde sein richtiges Leben in Princeton beginnen. Wieder übte er den Trick mit der Münze in der Manteltasche.
»Spielst du mit deinem Schwanz, Quentin?«, fragte James. Quentin errötete.
»Nein, ich spiele nicht mit meinem Schwanz.«
»Du brauchst dich nicht dafür zu schämen«, beschwichtigte ihn James und klopfte ihm auf die Schulter. »Macht den Kopf frei.«
Der Wind pfiff durch den dünnen Stoff von Quentins Bewerbungsanzug; dennoch knöpfte er seinen Mantel nicht zu. Er ließ sich von der Kälte durchdringen. Es machte ihm nichts aus, er war sowieso längst anderswo.
Er war in Fillory.
Fillory und weiter – so hieß eine Reihe von fünf Romanen des Schriftstellers Christopher Plover, die in den 1930er Jahren in England erschienen waren. Sie handelten von den Abenteuern der fünf Chatwin-Kinder in einem Zauberland, das sie entdeckten, während sie Urlaub bei ihren exzentrischen Verwandten auf dem Land machten. Das heißt, eigentlich waren sie gar nicht im Urlaub. Ihr Vater watete bei Passchendaele bis zu dem Hüften in Schlamm und Blut und ihre Mutter war mit einer geheimnisvollen, vermutlich psychisch bedingten Krankheit in ein Sanatorium eingewiesen worden. Deswegen hatte man die Kinder in aller Eile aufs Land geschickt.
Doch all diese traurigen Ereignisse spielten nur ganz am Rande eine Rolle. Im Vordergrund stand, dass die fünf Kinder drei Jahre lang jeden Sommer ihre verschiedenen Internate verließen und in den Norden Englands zu Onkel und Tante zurückkehrten. Und jedes Mal fanden sie ihren geheimen Weg nach Fillory, wo sie Abenteuer erlebten, verzauberte Länder erkundeten und die dort lebenden friedlichen Wesen gegen bedrohliche und mächtige Feinde verteidigten. Der bizarrste und hartnäckigste aller Gegner war eine verschleierte Gestalt, die nur die Wächterin genannt wurde. Sie besaß Macht über die Zeit und drohte, mit ihren Flüchen ausgerechnet an einem besonders trüben, regnerischen Nachmittag Ende September um Punkt fünf Uhr die Zeit stillstehen zu lassen und ganz Fillory für immer in diesem Moment gefangenzuhalten.
Wie fast alle Kinder hatte Quentin die Fillory-Bücher in der Grundschule gelesen. Doch im Gegensatz zu den anderen – darunter James und Julia – hatte er sie nie hinter sich gelassen. Er versetzte sich immer dann nach Fillory, wenn er die wirkliche Welt nicht ertragen konnte. (Die Fillory-Bücher trösteten ihn einerseits darüber hinweg, dass Julia ihn nicht liebte, waren aber andererseits wahrscheinlich einer der Hauptgründe dafür.) Und tatsächlich müffelten sie ein wenig nach alten englischen Kinderzimmern, und so schämte er sich auch insgeheim, wenn er zu dem Kapitel mit dem Kuschelpferd kam, einer riesigen, sanftmütigen pferdartigen Kreatur, die nachts auf Samthufen durch Fillory trabte und deren Rücken so breit war, dass man darauf schlafen konnte.
Fillory verkörperte damit etwas, das verführerisch und zugleich in gewisser Weise gefährlich war und das Quentin einfach nicht aufgeben konnte. Es schien, als handelten die Fillory-Bände – besonders der erste, Die Welt in den Wänden – vom Lesen an sich. Wenn der älteste Chatwin, der melancholische Martin, den Kasten der großen Standuhr öffnete, die am Ende eines dunklen, schmalen, abgelegenen Flures im Haus seines Onkels aufragte und hinüber nach Fillory schlüpfte (Quentin stellte sich jedes Mal vor, wie er ungeschickt das Pendel beiseiteschob wie das Zäpfchen eines riesigen Rachens), war es, als öffne er den Deckel eines Buches. Eines Buches, das erfüllte, was Bücher immer versprachen, aber nie wirklich hielten: ihn zu entführen, wirklich fortzureißen von dort, wo er sich befand, hin zu einem besseren Ort.
Das Land, das Martin in den Wänden des Hauses seines Onkels entdeckte, war eine Welt in magischem Zwielicht, eine kontrastreiche schwarz-weiß-kahle Landschaft wie aus einem Bilderbuch, mit stachligen Stoppelfeldern und Hügeln mit alten Steinmauern. In Fillory ereignete sich jeden Mittag eine Sonnenfinsternis und die Jahreszeiten konnten hundert Jahre andauern. Kahle Bäume ragten in den Himmel und blassgrüne Meere schwappten an schmale weiße Strände aus Muschelsand. In Fillory besaß alles eine tiefere Bedeutung als in der Wirklichkeit. In Fillory empfand man jeweils die Gefühle, die wirklich zu einer Situation passten. Glück war etwas Greifbares, Wahres, Erreichbares, Mögliches. Es kam, wenn man es rief. Oder besser: Es verließ einen erst gar nicht.
Sie hatten das Haus erreicht und hielten inne. Die Gegend hier mit ihren breiten Bürgersteigen und baumbestandenen Vorgärten wirkte gepflegt. Das Backsteingebäude war das einzige freistehende Haus weit und breit in diesem Viertel, das aus Reihenhäusern mit Sandsteinfronten bestand. Aufgrund seiner Rolle in der blutigen Schlacht von Brooklyn hatte es bescheidene Berühmtheit erworben. Ein wenig vorwurfsvoll schien es auf die Autos, Laternen und umliegenden Häuser zu blicken, in Erinnerung an seine glanzvollen niederländischen Zeiten.
Wäre dies ein Fillory-Roman gewesen – dachte Quentin erneut –, hätte das Haus eine Geheimtür zu einer anderen Welt besessen. Der alte Mann, der es bewohnte, wäre freundlich und exzentrisch und würde seltsame Anspielungen fallenlassen. Kaum würde er Quentin den Rücken zukehren, würde dieser über einen geheimnisvollen Schrank oder einen verzauberten Serviertisch oder irgendetwas Ähnliches stolpern, durch das er mit leichter Verwunderung auf die makellosen Hügel einer anderen Welt blicken konnte.
Doch dies war kein Fillory-Roman.
»Na dann«, sagte Julia. »Zeigt’s ihnen!«
Sie trug einen blauen Sergemantel mit einem runden Kragen, in dem sie aussah wie ein französisches Schulmädchen.
»Vielleicht bis nachher in der Bibliothek.«
»Viel Glück!«
Sie stießen mit den Fäusten aneinander. Verlegen senkte Julia den Blick. Sie kannte Quentins Gefühle für sie, und er wusste, dass sie sie kannte. Sie brauchten kein Wort darüber zu verlieren. Er wartete, vorgeblich fasziniert von einem parkenden Auto, während sie James zum Abschied küsste. Sie imitierte voll Ironie die Pose eines altmodischen Starlets, indem sie eine Hand auf seine Brust legte und den Unterschenkel hochwarf. Dann gingen er und James über den Steinfliesenweg zum Eingang.
James legte Quentin unterwegs den Arm um die Schultern.
»Ich weiß, was du denkst, Quentin«, sagte er rau. Quentin war der Größere, aber James war breiter und kräftiger gebaut. Er brachte Quentin aus dem Gleichgewicht. »Du glaubst, niemand versteht dich. Aber ich verstehe dich.« Er drückte Quentins Schulter, fast schon väterlich. »Ich bin der Einzige, der dich versteht.«
Quentin schwieg. Man konnte James beneiden, aber hassen konnte man ihn nicht. Er war nicht nur attraktiv und klug, sondern hatte auch ein weiches, gutes Herz. Mehr als jeder andere, der Quentin je begegnet war, erinnerte ihn James an Martin Chatwin. Aber wenn James ein Chatwin war, was bedeutete das für Quentin? Wer war er? Das wahre Problem im Umgang mit James war, dass er immer als Held aus allem hervorging. Wozu degradierte das seine Mitmenschen? Entweder zu Statisten oder zu Bösewichtern.
Quentin drückte auf den Klingelknopf. Ein leises, blechernes Scheppern ertönte irgendwo in den Tiefen des düsteren Hauses. Ein altmodisches, analoges Klingeln. Quentin listete im Geiste noch einmal seine außerschulischen Leistungen auf, die persönlichen Ziele und so weiter. Er war in jeder Hinsicht hundertprozentig auf dieses Aufnahmegespräch vorbereitet, abgesehen von seiner gefrorenen Frisur vielleicht. Doch jetzt, wo er nur noch die reife Frucht all seiner Vorbereitungen ernten musste, hatte er plötzlich jegliches Interesse daran verloren. Es überraschte ihn nicht. Er war an dieses plötzliche Vakuum gewöhnt, das sich einstellte, wenn man sich abgemüht hatte, um etwas zu erreichen, direkt vor dem Ziel stand – und es dann nicht mehr wollte. Diese Leere erfüllte ihn nur allzu oft. Fast hatte es etwas Beruhigendes, mit welcher Vorhersehbarkeit sie eintrat.
Der Hauseingang wurde von einer bedrückend spießigen Vorstadt-Gittertür versperrt. Orangefarbene und violette Zinnien blühten entgegen jeder gärtnerischen Logik in den schwarzen Beeten rechts und links neben der Eingangstreppe. Merkwürdig, dachte Quentin ohne einen Funken Neugier, dass sie sich bis in den November hinein gerettet haben. Er versteckte seine frierenden Hände in den Mantelärmeln und klemmte die Enden unter die Achseln. Bei dieser Kälte hätte man Schnee erwartet. Stattdessen begann es zu regnen.
Fünf Minuten später regnete es noch immer. Wieder klopfte Quentin an und drückte dann leicht gegen die Tür. Sie öffnete sich einen Spalt und ein warmer Luftzug streifte ihn. Der heimelige, fruchtige Geruch eines fremden Hauses.
»Hallo?«, rief Quentin. Er und James warfen sich einen kurzen Blick zu. Quentin stieß die Tür ganz auf.
»Lass ihm lieber noch eine Minute Zeit.«
»Wie kommt überhaupt einer auf die Idee, seine Freizeit für so etwas zu opfern?«, fragte Quentin. »Der ist garantiert pädophil.«
Die Eingangshalle war dunkel und still. Orientteppiche dämpften jedes Geräusch. James, der draußen stehen geblieben war, lehnte sich noch einmal gegen die Klingel. Nichts rührte sich.
»Ich glaube nicht, dass jemand zu Hause ist«, meinte Quentin, obwohl er sich nicht sicher war, ob James ihn überhaupt hören konnte. Gerade weil James ihm nicht folgte, wuchs sein Verlangen, tiefer in das Haus vorzudringen. Wenn der Leiter der Aufnahmegespräche sich tatsächlich als Wächter zum Zauberland Fillory erwiese, so dachte er, wäre es nur zu schade, dass er keine robusteren Schuhe trug.
Eine Treppe führte nach oben. Links befand sich ein unbenutzt wirkendes Esszimmer für Besucher, rechts ein gemütliches Arbeitszimmer mit lederbezogenen Armsesseln und einem geschnitzten, mannshohen Holzschrank, der separat in einer Ecke stand. Interessant. Eine Wand war zur Hälfte mit einer alten Seekarte bedeckt. Sie war größer als er selbst und wurde von einer kunstvoll gezackten Kompassrose geschmückt. Er fuhr mit einer Hand über die Tapete, auf der Suche nach einem Lichtschalter. In einer Ecke stand ein Korbstuhl, aber er setzte sich nicht.
Vor den Fenstern waren alle Jalousien heruntergelassen, doch das konnte die tiefe Dunkelheit nicht erklären. Diese glich eher einer finsteren Nacht, als sei in dem Moment, als er die Schwelle überschritt, die Sonne untergegangen oder eine Sonnenfinsternis eingetreten. Wie in Zeitlupe betrat Quentin das Zimmer. Gleich würde er hinausgehen und sich durch lautes Rufen bemerkbar machen. Nur noch eine Minute. Er musste wenigstens einmal nachsehen. Die Dunkelheit umgab ihn wie eine prickelnde elektrische Wolke.
Der Schrank war riesig, so groß, dass man hineinklettern konnte. Er legte seine Hand auf den kleinen, angelaufenen Messinggriff. Der Schrank war nicht verschlossen. Ihm zitterten die Finger. Le roi s’amuse. Er konnte sich nicht beherrschen. Ihm schwindelte.
Es war ein Barschrank, gut gefüllt mit einem reichhaltigen Sortiment. Quentin griff über die Reihen der leise klirrenden Flaschen hinweg, bis er das trockene, raue Sperrholz der Rückwand fühlte. Nur zur Sicherheit. Es gab nicht nach, besaß nichts Magisches. Er schloss die Tür, und sein Gesicht brannte vor Scham in der Finsternis. Als er sich umschaute, um sicherzugehen, dass wirklich niemand ihn beobachtet hatte, sah er den Toten auf dem Fußboden.
Eine Viertelstunde später war die Eingangshalle voller Menschen in hektischer Betriebsamkeit. Quentin saß in einer Ecke, in dem Korbstuhl, wie ein Sargträger auf der Beerdigung eines ihm unbekannten Verstorbenen. Er presste den Hinterkopf fest gegen die kühle, harte Wand. James stand neben ihm. Er schien nicht zu wissen, was er mit seinen Händen anfangen sollte. Sie vermieden es, sich anzusehen.
Der alte Mann lag rücklings auf dem Boden. Sein imposanter Bauch ragte rundlich empor, sein Kopf war von wirren grauen Wuschelhaaren umkränzt. Drei Rettungssanitäter hockten neben ihm, zwei Männer und eine Frau. Die Frau war umwerfend, fast unpassend hübsch – ein schriller Kontrast zu der grausigen Szenerie, eine glatte Fehlbesetzung. Die Sanitäter erledigten ihre Arbeit, aber nicht so klinisch-routiniert und blitzschnell wie bei einem lebensrettenden Einsatz. Hier standen sie vor einer anderen Aufgabe, der obligatorischen, aber von vornherein vergeblichen Wiederbelebung. Schließlich murmelten sie leise, packten ihre Utensilien zusammen, rissen Klebestreifen ab, verstauten benutzte Nadeln in einem speziellen Behälter.
Mit einer geübten, kräftigen Bewegung zog einer der Männer den Beatmungsschlauch aus der Leiche. Der Mund des alten Mannes stand offen und Quentin konnte seine leblose graue Zunge sehen. Er roch etwas, von dem er sich zunächst nicht eingestehen wollte, dass es der schwache, bittere Geruch von Kot war.
»Schrecklich«, sagte James, nicht zum ersten Mal.
»Ja«, krächzte Quentin. »wirklich schrecklich.« Seine Lippen und Zähne fühlten sich taub an.
Solange er sich nicht bewegte, konnte ihn niemand weiter in diese Sache hineinziehen. Er versuchte, ruhig zu atmen und sich still zu verhalten. Er blickte starr geradeaus und weigerte sich, die Vorgänge im Arbeitszimmer genauer zu beobachten. Er wusste, er bräuchte nur James anzuschauen, und er würde seinen eigenen seelischen Zustand in ihm widergespiegelt sehen. Ein unendlicher Korridor der Angst, der nirgendwohin führte. Wann sie wohl gehen durften? Er schämte sich, weil er uneingeladen in das Haus eingedrungen war, als habe dies in irgendeiner Weise den Tod des Mannes verursacht.
»Ich hätte ihn nicht als pädophil verdächtigen dürfen«, sagte Quentin reumütig. »Das war nicht richtig.«
»Nein, ganz und gar nicht richtig«, bekräftigte James. Sie redeten langsam, als müssten sie das Sprechen neu erlernen.
Die Sanitäterin erhob sich. Quentin beobachtete sie dabei, wie sie sich reckte, die Handballen in den unteren Rücken stützte und ihren Kopf erst zur einen, dann zur anderen Seite drehte. Sie kam auf sie zu und streifte unterwegs die Gummihandschuhe ab.
»Also«, verkündete sie in lockerem Tonfall, »er ist tot!« Ihrem Akzent nach war sie Engländerin.
Quentin räusperte sich. Er hatte einen Kloß im Hals. Die Frau warf die Handschuhe quer durch das Zimmer und traf genau den Mülleimer.
»Was ist denn mit ihm passiert?«, fragte Quentin.
»Er scheint eine Hirnblutung gehabt zu haben. Ein schöner Tod, wenn man schon sterben muss. Und er musste wohl. Vermutlich war er Alkoholiker.«
Sie deutete eine Trinkbewegung an.
Ihre Wangen waren gerötet, weil sie so lange über der Leiche gekauert hatte. Sie konnte höchstens fünfundzwanzig sein und trug eine dunkelblaue, ordentlich gebügelte Hemdbluse, bei der einer der Knöpfe nicht passte: eine Stewardess auf dem Anschlussflug zur Hölle. Quentin wünschte, sie wäre nicht so begehrenswert gewesen. Irgendwie war es so viel leichter, mit unattraktiven Frauen umzugehen – man ersparte sich den Schmerz ihrer eventuellen Unerreichbarkeit. Aber sie war nicht unattraktiv. Sie war blass und dünn und irritierend schön, mit einem breiten, überaus sinnlichen Mund.
»Hm.« Quentin wusste nicht, was er sagen sollte. »Das tut mir leid.«
»Was tut Ihnen leid?«, fragte sie. »Haben Sie ihn umgebracht?«
»Nein, ich bin wegen eines Aufnahmegesprächs hier. Er hat die Vorstellungsrunden für Princeton geleitet.«
»Also, worüber regen Sie sich auf?«
Quentin zögerte. Er musste falsch verstanden haben, worum es in ihrem Gespräch ging. Er stand auf, was er eigentlich längst hätte getan haben sollen, als sie auf ihn zukam. Er überragte sie um einiges. Selbst unter den gegebenen Umständen, dachte er, tritt sie ganz schön forsch auf für eine Sanitäterin. Schließlich ist sie nicht einmal Ärztin. Er wollte schon einen Blick auf ihre Brust werfen, auf der Suche nach einem Namensschild, unterließ es aber, damit sie ihn nicht dabei erwischte, wie er ihren Busen anstarrte.
»Ich trauere auch nicht um ihn persönlich«, erwiderte Quentin nach einiger Überlegung, »aber ich empfinde eine gewisse Achtung vor dem menschlichen Leben im Allgemeinen. Obwohl ich ihn nicht kannte, kann ich daher sagen, dass mir sein Tod leid tut.«
»Und wenn er ein schlechter Mensch war? Beispielsweise ein Pädophiler.«
Sie hatte ihn belauscht.
»Kann sein. Vielleicht war er aber auch nett. Vielleicht sogar ein großer Wohltäter.«
»Kann sein.«
»Sie haben wohl oft mit Verstorbenen zu tun?« Aus dem Augenwinkel heraus erkannte Quentin flüchtig, dass James mit erstauntem Gesichtsausdruck die Konversation verfolgte.
»Na ja, im Grunde sind wir eher dazu da, die Menschen am Leben zu erhalten. Behauptet man jedenfalls.«
»Bestimmt ein schwerer Beruf.«
»Schon, aber die Toten sind die einfacheren Patienten.«
»Ruhiger.«
»Genau.«
Der Ausdruck in ihren Augen passte nicht so recht zu ihren Worten. Sie musterte ihn.
»Quentin?«, mischte sich James ein. »Lass uns jetzt lieber gehen.«
»Warum haben Sie es denn so eilig?«, fragte die Frau. Sie sah Quentin unverwandt in die Augen. Im Gegensatz zu den meisten anderen schien sie sich mehr für ihn als für James zu interessieren. »Warten Sie einen Augenblick, ich glaube, der Mann hat etwas für Sie hinterlassen.«
Sie nahm zwei große braune Umschläge von einem Marmorbeistelltisch. Quentin runzelte die Stirn.
»Ich glaube nicht, dass die für uns sind.«
»Lass uns jetzt lieber gehen«, sagte James.
»Sie wiederholen sich«, bemerkte die Sanitäterin.
James öffnete die Haustür. Die eisige Luft wirkte wie ein heilsamer Schock. Sie fühlte sich so normal an. Das war es, was Quentin brauchte: gewöhnliche Normalität. Und nicht dieses … was immer es sein mochte.
»Nein, im Ernst«, beharrte die Frau. »Ich glaube, Sie sollten sie an sich nehmen. Es könnte wichtig sein.«
Immer noch sah sie Quentin ins Gesicht. Alle Geräusche um sie herum waren verstummt. Durch die offene Tür pfiff der kalte Wind, und allmählich wurde es auch feucht. Und nur wenige Schritte von ihnen entfernt lag eine Leiche.
»So, jetzt müssen wir aber wirklich gehen«, drängte James. »Vielen Dank. Ich bin sicher, Sie haben alles getan, was in Ihrer Macht stand.«
Die dunklen Haare der hübschen Sanitäterin waren rechts und links zu dicken Zöpfen geflochten. Sie trug einen glänzenden gelben Emailring und eine originelle antike Armbanduhr aus Silber. Ihre Nase und ihr Kinn waren zart und spitz. Sie war ein blasser, dünner, schöner Todesengel, und sie hielt zwei braune Umschläge in der Hand, auf der mit Textmarker in Druckbuchstaben ihre Namen standen. Möglicherweise Kopien, persönliche Empfehlungen. Aus irgendeinem Grund, vielleicht nur, weil er wusste, dass James es nicht tun würde, nahm Quentin den mit seinem Namen an.
»Na schön! Auf Wiedersehen!«, trällerte die Sanitäterin, machte rasch kehrt, ging ins Haus zurück und schloss die Tür. Sie blieben allein auf der Eingangstreppe zurück.
»Okay«, sagte James, atmete durch die Nase ein und anschließend kräftig wieder aus.
Quentin nickte, als stimme er irgendetwas zu, das James gesagt hatte. Langsam kehrten sie über den Plattenweg zum Bürgersteig zurück. Quentin fühlte sich immer noch ein wenig benommen und hatte keine große Lust, mit James zu reden.
»Hör mal«, begann James. »Du hättest den Umschlag vielleicht lieber nicht annehmen sollen.«
»Ich weiß«, antwortete Quentin.
»Du könntest ihn immer noch zurückbringen. Ich meine, stell dir vor, jemand erfährt davon?«
»Wie sollte es jemand herausfinden?«
»Keine Ahnung.«
»Wer weiß, was drinsteckt? Es könnte nützlich sein.«
»Ach so! Dann haben wir also Glück gehabt, dass der Kerl gestorben ist!«, erwiderte James gereizt.
Sie gingen bis zum Ende des Blocks, ohne ein weiteres Wort miteinander zu reden. Jeder war sauer auf den anderen, ohne es zugeben zu wollen. Der nasse Bürgersteig war dunkelgrau, die Regenwolken am Himmel hellgrau. Quentin plagten Gewissensbisse, weil er den Umschlag mitgenommen hatte. Er war wütend auf sich selbst, weil er zugegriffen hatte, und wütend auf James, weil er seinen abgelehnt hatte.
»Wir sehen uns dann später«, sagte James zum Abschied. »Ich muss jetzt zu Julia, sie erwartet mich in der Bibliothek.«
»Stimmt.«
Sie schüttelten sich förmlich die Hände. Es fühlte sich seltsam endgültig an. Langsam schlenderte Quentin die First Street hinunter. Ein Mann war in dem Haus gestorben, das er eben verlassen hatte. Es fühlte sich immer noch an wie ein Traum. Er erkannte – und schämte sich noch mehr –, dass er im Grunde ganz froh war, heute nicht sein Aufnahmegespräch für Princeton über sich ergehen lassen zu müssen.
Es dämmerte. Die Sonne versank bereits hinter der dichten Wolkendecke, die Brooklyn umhüllte. Zum ersten Mal seit einer Stunde dachte er wieder an all das, was er heute noch zu tun hatte: die Physikaufgaben, das Geschichtsreferat, seine E-Mails, den Abwasch, die schmutzige Wäsche. Das Gewicht seiner Pflichten zog ihn hinunter in den dunklen Schacht des Alltags. Er würde seinen Eltern erklären müssen, was geschehen war, und sie würden ihm – auf eine Art und Weise, die er nie richtig erklären und daher auch nie wirklich abwehren konnte – Schuldgefühle einimpfen. Alles würde so sein wie immer. Er dachte an Julia und James, die sich in der Bibliothek trafen. Julia musste an ihrem Referat über Westliche Zivilisation für Mr.Karras arbeiten, einem Sechswochenprojekt, das sie in zwei schlaflosen Tagen abschließen würde, sie konnte das. So brennend er sich auch wünschte, sie wäre seine und nicht James’ Freundin, so wenig konnte er sich vorstellen, wie er sie für sich gewinnen könnte. In der plausibelsten seiner vielen Phantasien starb James, plötzlich und schmerzlos, und Julia sank ihm leise schluchzend in die Arme.
Im Gehen löste Quentin die mit rotem Faden umwickelte Klammer, mit der der Umschlag verschlossen war. Er erkannte sofort, dass dieser weder Kopien noch irgendein offizielles Dokument enthielt. Der Umschlag enthielt ein Notizbuch. Es sah alt aus; die Ecken abgestoßen, bis sie rund und glatt waren, der Deckel stockfleckig.
Auf der ersten, mit Füllfederhalter beschriebenen Seite stand:
Der Zauber von Fillory
Fillory und weiter, Buch sechs
Die Jahre hatten die Tinte verblassen lassen. Doch Der Zauber von Fillory hieß keines der Bücher von Christopher Plover, so viel wusste Quentin. Und jeder richtige Bücherwurm wusste sowieso, dass die Fillory-Serie nur fünf Bücher umfasste.
Als er die Seite umblätterte, fiel ein weißer, einmal in der Mitte gefalteter Zettel heraus. Der Wind trug ihn davon. Er blieb für einen Moment an einem schmiedeeisernen Parkzaun hängen, bevor er erneut von einem Windstoß weggeweht wurde.
In diesem Straßenblock gab es einen Gemeinschaftsgarten, einen dreieckigen Zipfel Land, der zu schmal und verwinkelt war, um den Spekulanten zum Opfer zu fallen. Da die Frage nach dem Eigentümer in ein sumpfiges Loch juristischer Mehrdeutigkeit führte, war das Grundstück vor Jahren von einem Kollektiv engagierter Anwohner übernommen worden, die den für Brooklyn typischen unfruchtbaren Sand herausgebaggert und durch dicken, fruchtbaren Lehm aus dem Hinterland New Yorks ersetzt hatten. Eine Weile lang zogen sie Kürbisse, Tomaten und Frühlingszwiebeln und harkten japanische Ziergärten, aber in letzter Zeit hatten sie den Garten vernachlässigt, so dass zähes Stadtunkraut Wurzeln geschlagen hatte. Es breitete sich rasant aus und erstickte seine zarteren, exotischeren Konkurrenten. In diesem verschlungenen Dickicht verschwand die Notiz.
So spät im Jahr waren alle Pflanzen verwelkt oder im Absterben begriffen, sogar das Unkraut, und Quentin watete hindurch, bis zur Hüfte im Gestrüpp. Trockene Stängel verhakten sich an seinen Hosenbeinen und mit seinen Lederschuhen zertrat er knirschend braune Glasscherben. Ihm ging durch den Kopf, dass das Blatt womöglich nur die Telefonnummer der Sanitäterin trug. Der Garten war schmal, aber erstaunlich langgestreckt. Drei, vier imposante Bäume wuchsen dort, und je weiter Quentin vordrang, desto düsterer und undurchdringlicher wurde das Dickicht.
Er erhaschte einen Blick auf den Zettel, der hoch oben an einer von welkem Wein überwucherten Pergola hing. Quentin befürchtete, er würde über den hinteren Teil des Zaunes fliegen, ehe er ihn erwischte. Sein Handy klingelte: sein Vater. Quentin ignorierte den Anruf. Aus den Augenwinkeln heraus meinte er, etwas hinter dem Farndickicht entlanghuschen zu sehen, doch als er sich umblickte, war es verschwunden. Er kämpfte sich durch abgestorbene Gladiolen, Petunien, schulterhohe Sonnenblumen, Rosenbüsche – trockene, starre Stängel und Blüten, im Tod zu dekorativen Tüllornamenten gefroren.
Seinem Gefühl nach musste er sich jetzt in Höhe der Seventh Avenue befinden. Doch er drang immer weiter vor, wobei er Gott weiß was für giftige Pflanzen streifte. Oh nein, bloß kein beschissener Giftefeu, der hätte ihm gerade noch gefehlt. Merkwürdigerweise ragten zwischen all den welken Pflanzen noch hier und da einige frische grüne auf. Weiß der Himmel, wo sie ihre Nahrung herbekamen. Plötzlich lag ein süßlicher Geruch in der Luft.
Er hielt inne. Auf einmal war es ganz still. Kein Autohupen, keine aufgedrehten Radios, keine Sirenen. Sein Handy hatte aufgehört zu klingeln. Es war bitterkalt und seine Finger fühlten sich taub an. Sollte er umkehren oder weitergehen? Er zwängte sich weiter durch eine Hecke hindurch, wobei er wegen der kratzigen Zweige die Augen schloss und das Gesicht verzog. Er stolperte über irgendetwas, einen alten Stein. Plötzlich wurde ihm übel. Er schwitzte.
Als er die Augen wieder öffnete, stand er am Rande einer riesigen, weitläufigen, vollkommen ebenen grünen Rasenfläche, die von Bäumen umgeben war. Der Geruch nach frischem Gras war überwältigend. Die Sonne schien ihm heiß ins Gesicht.
Die Sonne. Sie stand im falschen Winkel. Und wo zum Teufel waren die Wolken? Der Himmel war gleißend blau. Quentins Gleichgewichtssinn war völlig aus dem Lot. Ihm wurde speiübel. Er hielt ein paar Sekunden lang die Luft an. Dann blies er eiskalte Winterluft aus seinen Lungen und atmete stattdessen warme Sommerluft ein. Sie war gesättigt mit Blütenstaub. Er nieste.
Inmitten der weitläufigen Rasenfläche stand ein großes Haus aus honigfarbenem Stein und grauem Schiefer, geschmückt mit Schornsteinen, Giebeln, Türmen, Dächern und Nebendächern. In der Mitte, über dem Haupthaus, ragte würdevoll ein hoher Uhrenturm auf, der sogar Quentin erstaunte, weil er so gar nicht zu dem Gebäude passte, das ansonsten wie ein Privathaus aussah. Die Uhr war im venezianischen Stil gestaltet: ein einziger spitzer Zeiger kreiste auf einem Blatt mit vierundzwanzig Ziffern. Über einem Flügel erhob sich eine mit Grünspan überzogene Kupferkuppel, die wie ein Observatorium aussah. Zwischen Haus und Rasen erstreckte sich ein Garten mit hübsch gestalteten Terrassenbeeten, Büschen, Hecken und Springbrunnen.
Quentin war sich relativ sicher, dass er nur einige Sekunden lang ganz still stehen bleiben musste, damit alles wieder in seinen normalen Zustand zurückkehrte. Er fragte sich, ob er gerade Opfer eines fatalen neurologischen Fehlprozesses wurde. Vorsichtig spähte er über die Schulter zurück. Keine Spur von dem Garten hinter ihm, nur einige große, dicht belaubte Eichen, die Vorhut eines offenbar recht ansehnlichen Waldes. Kalter Schweiß rann ihm unter den Achseln hervor und lief über den Brustkorb. Es war heiß.
Quentin ließ seine Tasche auf den Rasen fallen und schlüpfte aus seinem Mantel. Ein Vogel durchbrach müde zwitschernd die Stille. Ein Stück von Quentin entfernt lehnte ein großer, dünner Teenager an einem Baum, rauchte eine Zigarette und beobachtete ihn.
Er schien ungefähr in Quentins Alter zu sein. Er trug ein Hemd mit spitzem Kragen und schmalen, blassrosa Streifen. Er sah Quentin nicht an, sondern zog an seiner Zigarette und blies den Rauch in die Sommerluft. Die Hitze schien ihm nichts auszumachen.
»Hey!«, rief ihm Quentin zu.
Jetzt sah der Junge zu ihm herüber. Er nickte Quentin kurz zu, antwortete aber nicht.
Quentin ging zu ihm hinüber, so lässig er konnte. Er versuchte, sich seine Ratlosigkeit nicht anmerken zu lassen. Sogar ohne seinen Mantel schwitzte er wie ein Bär. Er fühlte sich wie ein viel zu elegant gekleideter Engländer, der einen skeptischen Inseleingeborenen zu beeindrucken versucht. Aber eines musste er unbedingt wissen.
»Ist das …?« Quentin räusperte sich. »Sind wir hier in Fillory?«, fragte er schließlich und blinzelte in die grelle Sonne.
Der junge Mann sah Quentin sehr ernsthaft an und zog dann noch einmal lange an seiner Zigarette, dann schüttelte er langsam den Kopf und atmete dabei den Rauch aus.
»Nein«, sagte er. »Außerhalb von New York.«
BRAKEBILLS
Er lachte nicht. Quentin würde das später zu schätzen wissen.
»Außerhalb?«, fragte Quentin. »Wo denn, in Vassar oder so?«
»Ich habe dich durchkommen sehen«, sagte der junge Mann statt einer Antwort. »Komm, du musst jetzt rauf zum Haus gehen.«
Er schnippte die Zigarettenkippe weg und machte sich auf den Weg über den weitläufigen Rasen. Er blickte sich nicht um, um zu sehen, ob Quentin ihm folgte, was dieser zunächst auch nicht tat. Aber dann wurde Quentin plötzlich von der Furcht ergriffen, allein an diesem Ort zurückzubleiben, und eilte im Laufschritt hinterher.
Die Grünfläche war riesig, so groß wie ein halbes Dutzend Fußballfelder. Sie zu überqueren schien eine halbe Ewigkeit zu dauern. Die Sonne brannte Quentin im Nacken.
»Wie heißt du?«, fragte der junge Mann, in einem Ton, aus dem so viel unverhohlene Gleichgültigkeit sprach, dass Quentin gar nicht erst auf die Idee kommen konnte, er interessiere sich ernsthaft für die Antwort. »Quentin.«
»Reizend. Woher?«
»Brooklyn.«
»Wie alt?«
»Siebzehn.«
»Ich bin Eliot. Red nicht weiter, mehr will ich von dir gar nicht wissen.«
Quentin musste sich beeilen, um mit Eliot Schritt zu halten. Irgendwas war komisch an Eliots Gesicht. Während seine Haltung kerzengerade schien, war sein Mund zu einer Seite hin verzogen, in einer unentwegten Halbgrimasse, die krumme und schiefe, in unwahrscheinlichen Winkeln vor- und zurückstehende Zähne entblößte. Als wäre bei seiner Geburt etwas gründlich danebengegangen, als hätte man ihn mit einer verbogenen Hebammenzange rausgezogen.
Trotz seines merkwürdigen Aussehens besaß Eliot jedoch eine Art müheloser Selbstbeherrschung, die bewirkte, dass sich Quentin intensiv seine Freundschaft wünschte. Oder einfach für eine Weile in seine Haut zu schlüpfen. Ganz offensichtlich gehörte er zu den Menschen, die sich in der Welt zu Hause fühlten wie ein Fisch im Wasser, während er selbst ständig paddeln musste wie ein Hund, qualvoll und entwürdigend, nur um an der Oberfläche ein bisschen Luft zu schnappen.
»Wo sind wir hier eigentlich?«, fragte Quentin. »Lebst du hier?«
»In Brakebills?«, fragte Eliot lässig. »Ja, könnte man sagen.« Sie hatten das andere Ende des Rasens erreicht. »Wenn man das Leben nennen kann.«
Eliot führte Quentin durch eine Lücke in einer hohen Hecke. Sie gelangten in ein üppig belaubtes, schattiges Labyrinth. Die Büsche waren sauber und akkurat zu engen, verzweigten, kompliziert verästelten Korridoren gestutzt, die sich regelmäßig zu kleinen schattigen Lauben und Innenhöfen öffneten. Das Gebüsch war so dicht, dass kein Licht hindurchdrang, aber hier und da fiel ein breites Bündel Sonnenstrahlen von oben auf den Weg. Sie kamen an plätschernden Springbrunnen und düsteren, vom Regen blankgewaschenen weißen Steinstatuen vorbei.
Nach gut fünf Minuten verließen sie den Irrgarten durch eine Öffnung zwischen den Sträuchern. Sie wurde von zwei Baumschnittfiguren flankiert, die auf den Hinterbeinen stehende Bären darstellten. Von dort aus gelangten sie auf eine Steinterrasse im Schatten des großen Hauses, das Quentin von ferne gesehen hatte. Er hätte schwören können, dass einer der großen, belaubten Bären ganz kurz den Kopf in seine Richtung gedreht hatte.
»Der Dekan wird jeden Moment runterkommen, um dich zu begrüßen«, erklärte Eliot. »Ich geb dir einen guten Rat: Setz dich da hin«, – und er zeigte auf eine verwitterte Steinbank, als weise er einen allzu anhänglichen Hund in seine Schranken –, »und tu so, als gehörtest du hierher. Und wenn du ihm erzählst, dass du mich hast rauchen sehen, verbanne ich dich in den niedrigsten Kreis der Hölle. Ich bin zwar noch nicht dagewesen, aber nach allem, was ich gehört habe, muss es da fast so schlimm sein wie in Brooklyn.«
Eliot verschwand wieder in dem grünen Irrgarten, und Quentin ließ sich gehorsam auf die Bank sinken. Er starrte hinunter auf die grauen Steinfliesen zwischen seinen Bewerbungsschuhen und auf den Rucksack und den Mantel in seinem Schoß. Das ist unmöglich, dachte er ganz klar. Er formte die Worte im Geist, aber sie schienen keinerlei Bezug zu seiner Umgebung zu haben. Er fühlte sich wie auf einem recht angenehmen Drogentrip. In die Fliesen war ein verzwicktes Muster aus verschlungenen Weinranken eingraviert. Vielleicht waren es aber auch kunstvoll kalligraphierte Wörter, die bis zur Unleserlichkeit verwittert waren. Staubteilchen und Blütenpollen schwebten im Sonnenlicht. Wenn das eine Halluzination ist, dachte Quentin, ist sie ziemlich realistisch.
Die Stille war das Befremdlichste. Wie sehr er sich auch anstrengte, er hörte nicht ein einziges Auto. Er hatte das Gefühl, in einem Film zu sitzen, bei dem man plötzlich den Ton abgestellt hatte.
Eine Glasflügeltür klapperte ein paarmal und wurde dann geöffnet. Ein großer dicker Mann in einem Leinenanzug trat heraus auf die Terrasse.
»Guten Tag«, sagte er. »Sie müssen Quentin Coldwater sein.«
Er sprach äußerst korrekt, als hätte er gern einen englischen Akzent, sei aber nicht prätentiös genug, einen nachzuahmen. Er hatte ein wohlwollendes, offenes Gesicht und schüttere blonde Haare.
»Ja, Sir.« Quentin hatte noch nie einen Erwachsenen – oder sonst irgendjemanden – »Sir« genannt, aber auf einmal fühlte es sich angemessen an.
»Willkommen am Brakebills College«, sagte der Mann. »Ich nehme an, Sie haben von uns gehört?«
»Um ehrlich zu sein, nein«, erwiderte Quentin.
»Nun gut. Sie wurden für eine Aufnahmeprüfung bei uns ausgewählt. Möchten Sie daran teilnehmen?«
Quentin wusste nicht, was er sagen sollte. Das war keine Frage, auf die er sich vorbereitet hatte, als er heute Morgen aufgestanden war.
»Ich weiß nicht«, sagte er und blinzelte mit den Augen. »Ich meine, ich bin mir nicht sicher.«
»Eine absolut verständliche Antwort, aber leider keine akzeptable, befürchte ich. Sie müssen sich entscheiden: Ja oder Nein. Es geht hier ja nur um die Prüfung«, fügte er hilfsbereit hinzu.
Quentin wurde von der irrationalen, aber überwältigenden Vorahnung heimgesucht, was geschehen würde, wenn er ablehnte. Alles wäre vorbei, ehe er auch nur die Silbe »Nein« ganz ausgesprochen hätte. Er würde wieder in dem kalten Regen und der Hundescheiße auf der First Street stehen und sich fragen, warum er einen Moment lang warme Sonnenstrahlen im Nacken gespürt hatte. Aber dazu war er noch nicht bereit. Noch nicht.
»Okay, von mir aus«, antwortete er, in dem Versuch, nicht zu eifrig zu klingen. »Ja.«
»Wundervoll.« Der Mann gehörte zu jenen immerfröhlichen Menschen, bei denen die Heiterkeit nicht ganz bis hinauf zu den Augen reichte. »Dann wollen wir Sie mal prüfen. Mein Name ist Henry Fogg – keine Witze über den Namen bitte, die kenne ich alle –, und Sie können mich mit Dekan ansprechen. Folgen Sie mir. Sie müssten der Letzte sein, wenn ich mich nicht irre«, fügte er hinzu.
Quentin war nicht im Geringsten zum Scherzen aufgelegt. Im Inneren des Hauses war es ruhig und kühl. Ein intensiver, würziger Geruch nach Büchern, Orientteppichen, altem Holz und Tabak lag in der Luft. Der Dekan lief ihm ungeduldig voraus. Es dauerte einige Augenblicke, bis sich Quentins Augen an das Halbdunkel gewöhnt hatten. Sie hasteten durch einen Salon mit düsteren alten Bildern, einen schmalen Flur mit Holzverkleidungen an den Wänden und dann mehrere Treppen hinauf, bis sie zu einer dicken, schweren Holztür gelangten.
Als sie sich öffnete, blickten Hunderte Augenpaare auf und starrten Quentin an. Der Raum war lang und hoch und voller Holztische, die in Reihen aufgestellt waren. An jedem Pult saß ein Teenager mit ernster Miene. Es war ein Klassenzimmer, aber nicht eines von denen, an die Quentin gewöhnt war, wo die Wände aus Beton bestanden und bedeckt waren mit Zetteln und Postern von kleinen Katzen, die in Bäumen hingen, und unter denen in riesigen Lettern Halt durch, Baby! stand. Die Wände dieses Zimmers bestanden aus alten Steinen. Der Raum war sonnenlichtdurchflutet und schien sich endlos weit zu erstrecken, wie bei einem raffinierten Spiegeltrick.
Die meisten Jugendlichen waren etwa in Quentins Alter oder etwas jünger und gaben sich trotz ihrer Nervosität nach außen hin genauso cool wie er. Aber nicht alle. Er sah mehrere Punks mit Irokesenschnitt oder Glatzen und auch eine relativ große Gruppe von Gothics. Ein viel zu großes Mädchen mit einer viel zu großen, roten Brille grinste blöde in die Runde. Einige der jüngeren Mädchen sahen aus, als hätten sie geweint. Ein Junge trug kein Hemd und sein Rücken war mit roten und grünen Tätowierungen bedeckt. Mein Gott, dachte Quentin, welche Eltern erlauben denn so was? Ein Teenager saß in einem elektrischen Rollstuhl. Einem anderen fehlte der linke Arm. Er trug ein dunkles Oberhemd, dessen linker Ärmel zusammengefaltet war und von einer silbernen Klammer festgehalten wurde.
Alle Tische waren identisch. Auf jedem lag ein unbeschriebenes, blaues Testheft und gleich daneben ein sehr dünner, sehr spitzer Bleistift, Härtegrad drei. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft sah Quentin etwas, das ihm vertraut vorkam. Noch ein Platz war frei, weiter hinten im Raum, und er setzte sich und rückte seinen Stuhl mit einem ohrenbetäubenden Quietschen an den Tisch. Für einen Augenblick glaubte er, Julias Gesicht in der Menge zu erkennen, aber das Mädchen drehte sich praktisch sofort wieder um. Ihm blieb keine Zeit, weiter darüber nachzudenken. Dekan Fogg stand vorne und räusperte sich geziert.
»Nun denn«, sagte er. »Noch ein paar Bemerkungen vorab. Während der Prüfung herrscht absolute Stille. Sie können ruhig auf die Unterlagen Ihrer Kollegen schauen, aber sie werden feststellen, dass sie Ihnen leer erscheinen werden. Ihre Bleistifte müssen zwischendurch nicht gespitzt werden. Wenn Sie ein Glas Wasser möchten, heben Sie drei Finger über den Kopf, so.« Er machte es vor.
»Machen Sie sich keine Sorgen darüber, dass Sie sich auf diese Prüfung nicht vorbereitet fühlen. Man kann dafür nicht lernen, wobei gleichermaßen gilt, dass Sie sich schon ihr ganzes Leben lang darauf vorbereitet haben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: bestehen oder durchfallen. Wenn Sie bestehen, folgt für Sie die zweite Stufe der Prüfung. Fallen Sie durch, und die meisten von Ihnen werden das, bringen wir Sie mit einem plausiblen Alibi und sehr wenigen Erinnerungen an die Erlebnisse hier nach Hause zurück.«
Dann fuhr er fort: »Sie haben für den Test zweieinhalb Stunden Zeit. Ab jetzt.«
Der Dekan drehte sich zur Tafel um und malte ein Ziffernblatt darauf. Quentin senkte den Blick auf das leere Heft auf seinem Pult. Es war jetzt nicht mehr leer. Es füllte sich mit Fragen. Die Buchstaben fluteten förmlich das Papier, während er zusah.
Im ganzen Raum raschelte das Papier wie ein abhebender Vogelschwarm. Gleichzeitig senkten sich die Köpfe. Quentin kannte diese Bewegung. Es war die Bewegung einer Menge von hochbegabten Supertest-Knackern, die sich verbissen an ihre Arbeit machte.
Das war in Ordnung. Er war einer von ihnen.
Quentin hatte eigentlich nicht vorgehabt, seinen restlichen Nachmittag – oder Vormittag, was immer das hier war – mit einem standardisierten Test über ein unbekanntes Thema zu verbringen, in einer unbekannten Lehranstalt, in einer unbekannten, entgegengesetzten Klimazone, in der noch Sommer herrschte. Er hätte jetzt in Brooklyn sein, sich den Arsch abfrieren und von irgendeinem älteren Herrn geprüft werden sollen, der unlängst verstorben war. Doch die Logik der augenblicklichen Situation überlagerte seine anderen Sorgen, wie begründet sie auch sein mochten. Er war sowieso nicht der Typ, mit der Logik zu hadern.
Ein großer Teil des Tests bestand aus Mathematikaufgaben, ziemlich einfache Fragen für Quentin, der so übernatürlich begabt in Mathe war, dass seine Highschool ihn zum Unterricht ins Brooklyn College schicken musste. Nichts Gewagteres als ein bisschen knifflige Differential-Geometrie und ein paar verzwickte Beweise aus der linearen Algebra. Aber es gab auch exotischere Fragen. Einige davon schienen völlig sinnlos zu sein. Bei einer Aufgabe wurde die Rückseite einer Spielkarte gezeigt, allerdings nur eine Zeichnung, keine richtige Karte. Sie zeigte eine recht bekannte Illustration, auf der zwei identische Engel Fahrrad fuhren. Er sollte erraten, welche Karte es war. Welchen Sinn sollte das haben?
Später wurde ihm eine Passage aus Der Sturm von Shakespeare vorgelegt. Er sollte eine Phantasiesprache entwickeln und dann das Stück aus dem Sturm in diese erfundene Sprache übersetzen. Anschließend wurden ihm Fragen zur Grammatik und Orthographie seiner Sprache gestellt, und dann – also wirklich, was sollte das? – zusätzliche Fragen über die erfundene Geographie, Kultur und Gesellschaftsstruktur des erfundenen Landes, wo seine Phantasiesprache fließend gesprochen wurde. Anschließend musste er die Originalpassage wieder aus der Phantasiesprache ins Englische rückübersetzen, wobei er besonders auf sich daraus ergebende Verfälschungen in Grammatik, Wortwahl und Bedeutung achten sollte. Mal im Ernst: Er gab bei Prüfungen immer sein Bestes, aber in diesem Fall war er sich nicht ganz sicher, was er eigentlich geben sollte.
Der Test veränderte sich, während er ihn bearbeitete. Der Teil, in dem es um das Leseverstehen ging, zeigte ihm einen Absatz, der verschwand, während er ihn las, und befragte ihn nach dem vollständigen Verschwinden zum Inhalt. Bestimmt ein neuartiges, digitales Papier – hatte er nicht irgendwo gelesen, dass daran gearbeitet wurde? Digitale Tinte? Wirklich tolle Erfindung. Er wurde aufgefordert, ein Kaninchen zu zeichnen, das jedoch beim Skizzieren nicht stillhielt. Sobald es Pfoten hatte, putzte es sich ausgiebig, hoppelte danach über die Seite und nagte die anderen Fragen an, so dass er es mit dem Bleistift jagen musste, um sein Fell zu Ende zeichnen zu können. Schließlich beruhigte er es mit ein paar hastig gekritzelten Radieschen und zeichnete anschließend einen Zaun drumherum, um es in Schach zu halten.
Schon bald vergaß er alles andere und konzentrierte sich ganz darauf, eine Frage nach der anderen in seiner sauberen Handschrift ausführlich zu beantworten, wobei er jede noch so abstruse Anforderung des Tests erfüllte. Erst nach einer Stunde blickte er zum ersten Mal von seinem Pult auf. Sein Hintern tat weh und er rutschte auf seinem Stuhl herum. Die Flecken des durch die Fenster einfallenden Sonnenlichts waren weitergewandert.
Und noch etwas hatte sich verändert. Als er angefangen hatte, waren alle Tische besetzt gewesen; jetzt gab es etliche freie. Dabei hatte er gar nicht bemerkt, dass jemand gegangen war. Ein kalter Kristallsamen des Zweifels bildete sich in Quentins Magen. Mein Gott, die mussten schon fertig sein! Er war es nicht gewöhnt, in der Schule unterlegen zu sein. Seine Handflächen kribbelten vor Schweiß und er wischte sie an seinen Oberschenkeln ab. Was waren das für Leute?
Als Quentin zur nächsten Seite in seinem Heft umblätterte, war sie leer, bis auf ein einziges Wort in der Mitte: FIN, in verschnörkelter Kursivschrift, wie im Abspann eines alten Films.
Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und presste die Ballen seiner schmerzenden Hände auf seine schmerzenden Augen. So, das waren zwei Stunden seines Lebens gewesen, die ihm niemand zurückgeben konnte. Quentin hatte immer noch nicht bemerkt, dass irgendjemand aufgestanden und weggegangen war – dennoch war der Raum auffallend entvölkert. Inzwischen waren nur noch an die fünfzig Jugendliche übrig und es gab mehr leere als besetzte Tische. Es war, als würden sie sich jedes Mal, wenn er den Kopf wegdrehte, still hinausschleichen. Der Punk mit den Tätowierungen und ohne Hemd war noch da. Er musste entweder fertig sein oder aufgegeben haben, denn er alberte herum, indem er ein Glas Wasser nach dem anderen bestellte. Sein Pult stand voller Gläser. Quentin verbrachte die letzten zwanzig Minuten damit, aus dem Fenster zu schauen und einen Wirbeltrick mit seinem Bleistift zu üben.
Der Dekan trat ein und wandte sich an die Anwesenden.
»Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie alle zur nächsten Prüfungsphase übergehen können«, sagte er. »Dieser Teil besteht aus Einzelprüfungen, durchgeführt von Dozenten des Brakebills College. Bis zum Beginn können Sie sich mit einem kleinen Imbiss stärken und miteinander Bekanntschaft schließen.«
Quentin zählte nur noch zweiundzwanzig besetzte Tische, vielleicht noch ein Zehntel der ursprünglichen Gruppe. Bizarrerweise kam ein schweigender, lächerlich korrekter Butler mit weißen Handschuhen herein, der jedem von ihnen ein Holztablett servierte. Darauf lagen ein Sandwich – gegrillte rote Paprika und ganz frischer Mozzarella auf Sauerteigbrot –, eine rundliche Birne und eine dicke Tafel dunkler Bitterschokolade. Dazu schenkte er jedem Teilnehmer ein trübes, sprudelndes Getränk aus einer kleinen Flasche ohne Etikett ein – Pampelmusenlimonade, wie sich herausstellte.
Quentin nahm sein Mittagessen und schlenderte nach vorne zur ersten Reihe, wo sich jetzt die meisten der übriggebliebenen Prüfungsteilnehmer versammelten. Er fühlte sich lächerlich erleichtert, so weit gekommen zu sein, obwohl er keine Ahnung hatte, warum er bestanden hatte, warum die anderen durchgefallen waren und was es für ihn hieß, bestanden zu haben. Der Butler stellte geduldig die klirrende, schwappende Wasserglassammlung vom Tisch des Punks auf ein Tablett. Quentin hielt Ausschau nach Julia, aber entweder hatte sie es nicht geschafft oder sie war es gar nicht gewesen.
»Sie hätten es begrenzen sollen«, erklärte der Punk, der sich als Penny vorstellte. Er hatte ein freundliches Mondgesicht, das seine ansonsten furchterregende Erscheinung Lügen strafte. »Das Wasser, meine ich. Höchstens fünf Gläser für jeden zum Beispiel. Es macht mir Spaß, solchen Mist rauszufinden, die Stelle, an der sich das System mit seinen eigenen Regeln fickt.«
Er zuckte mit den Schultern.
»Ich war eben gelangweilt. Der Test hat mir schon nach zwanzig Minuten gesagt, dass ich fertig bin.«
»Nach zwanzig Minuten?« Quentin war hin- und hergerissen zwischen Bewunderung und giftigem Neid. »Gott, ich habe zwei Stunden dafür gebraucht!«
Wieder zuckte der Punk mit den Schultern und verzog das Gesicht. Was zum Teufel sollte er dazu sagen?
Das Verhältnis unter den Prüflingen schwankte zwischen Kameraderie und Misstrauen. Einige der Jugendlichen erzählten sich, wie sie hießen, wo sie herkamen und wie der Test gelaufen war. Doch je mehr sie ihre Notizen verglichen, desto mehr stellte sich heraus, dass keiner dieselbe Prüfung absolviert hatte.
Die Teilnehmer kamen aus allen Ecken und Enden des Landes. Nur zwei von ihnen stammten aus demselben Inuit-Reservat in Saskatchewan. Sie liefen durch den Raum und jeder erzählte die Geschichte, wie er hierhergeraten war. Keine war genau gleich, aber es gab immer gewisse Ähnlichkeiten: ein verlorengegangener Ball auf der Straße, eine verirrte Ziege in einem Abflussgraben, ein merkwürdiges Zusatzkabel im Computerraum der Highschool, das zu einem Serverschrank führte, der vorher nicht dagewesen war. Und dann: grünes Gras, Sommerhitze und jemand, der sie hinauf in den Examensraum brachte.
Gleich nach dem Mittagessen steckten die Lehrer nacheinander die Köpfe herein und riefen die Namen einzelner Kandidaten auf. Da sie alphabetisch vorgingen, dauerte es nur wenige Minuten, ehe eine strenge Frau zwischen vierzig und fünfzig mit dunklem, schulterlangem Haar Quentin Coldwater aufrief. Er folgte ihr in einen schmalen, holzverkleideten Raum mit hohen Fenstern, durch die man aus erstaunlicher Höhe auf den Rasen blickte, den er vorhin überquert hatte. Das Geplapper aus dem angrenzenden Examensraum war in der Sekunde nicht mehr zu hören, in der die Tür geschlossen wurde. Zwei Stühle standen einander gegenüber an einem langen, abgenutzten, sehr schweren Holztisch.
Quentin schwindelte, als ob er das Ganze im Fernsehen gucken würde. Es war lächerlich. Aber er zwang sich, sich zu konzentrieren. Das hier war eine Prüfung, und er war ein Ass in Prüfungen. Auch hier wollte er gut abschneiden, und er spürte, dass immer mehr auf dem Spiel stand. Der Tisch war leer bis auf ein Kartenspiel und einen Stapel von etwa einem Dutzend Münzen.
»Wie ich gehört habe, magst du Zaubertricks, Quentin«, sagte die Frau. Sie hatte einen ganz leichten Akzent, europäisch, aber ansonsten undefinierbar. Isländisch vielleicht? »Warum zeigst du mir nicht ein paar?«
Tatsächlich liebte Quentin Zaubertricks. Sein Interesse an der Zauberei war vor drei Jahren erwacht, teils inspiriert durch seine Lesegewohnheiten, aber hauptsächlich, um seine außerschulischen Aktivitäten durch eine weitere zu ergänzen, bei der er nicht notwendigerweise mit anderen Leuten kommunizieren musste. Quentin hatte Hunderte emotional karge Stunden nur mit seinem iPod darauf verwendet, Münzen verschwinden zu lassen, Karten zu mischen und in einer Trance der Langeweile künstliche Blumen aus dünnen Plastikstäben entstehen zu lassen. Immer wieder sah er sich körnige, pornoähnliche Lehrvideos an, in denen Männer mittleren Alters vor aufgehängten Betttüchern Zaubertricks in Nahaufnahme zeigten. Die Zauberei, so stellte Quentin fest, war alles andere als romantisch. Sie war trocken, mühselig und trügerisch. Er übte bis zum Umfallen und wurde sehr gut darin.
In der Nähe von Quentins Elternhaus gab es einen Laden, der Zaubereibedarf verkaufte, neben billigen Elektroartikeln, verstaubten Brettspielen, Gummikotze und anderen, teils längst veralteten Scherzartikeln. Ricky, der Verkäufer, der, wie ein Amish-Farmer, einen Bart und lange Koteletten, aber keinen Schnurrbart hatte, erklärte sich widerstrebend bereit, Quentin ein paar Tricks zu zeigen. Es dauerte nicht lange, bis der Lehrling den Meister übertrumpfte. Mit siebzehn konnte Quentin den Scotch and Soda und den schwierigen, einhändigen Charlier Cut, und er konnte das knifflige Mills-Mess-Muster mit drei Bällen und manchmal, wenn er besonders gut in Form war, mit vier Bällen jonglieren. Jedes Mal gewann er in der Schule ein wenig an Popularität hinzu, wenn er seine Geschicklichkeit bewies, indem er eine normale Spielkarte mit entschlossener, roboterhafter Genauigkeit so warf, dass sie aus einer Entfernung von zehn Fuß hochkant in einem der geschmacklosen, styroporähnlichen Äpfel, die es in der Cafeteria gab, stecken blieb.
Quentin griff zuerst nach den Karten. Er war stolz auf seine Mischtechniken, die ihn unendlich viele ermüdende Übungsstunden gekostet hatten. Zur Sicherheit begann er mit einem Faro-Shuffle anstatt dem normalen Mischen der Karten, falls die Dame ihm gegenüber zufällig den Unterschied kannte und wusste, wie verflixt schwierig es war, einen guten Faro hinzubekommen.
Routiniert folgte er einem festgelegten Ablauf, der bereits so kalkuliert war, dass er mit möglichst vielen Fähigkeiten angeben konnte: falschem Abheben, falschem Mischen, Liftmischen, Täuschen, Zaubern, Forcieren. Zwischen den einzelnen Tricks warf er die Karten von einer Hand zur anderen, ließ sie wie einen Wasserfall fließen, wie eine Lawine rollen. Er hatte seine festen Sprüche, die er dazu machte, die aber in dem stillen, luftigen, wunderschönen Raum ungeschickt und hohl klangen, besonders gegenüber dieser würdevollen, attraktiven älteren Dame. Nach kurzer Zeit blieben ihm die Worte im Hals stecken und er führte sein Können schweigend vor.
Die Karten machten raschelnde und schnalzende Geräusche in der Stille. Die Frau beobachtete ihn unablässig. Gehorsam wählte sie eine Karte aus, wenn er sie dazu aufforderte, zeigte aber kein Erstaunen, wenn er diese dann – gegen jede Wahrscheinlichkeit! – in der Mitte eines sorgfältig gemischten Spiels oder in seiner Hemdentasche wiederfand oder sie einfach aus der Luft zauberte.
Er ging zu den Münzen über. Es waren brandneue Fünfcentstücke, tief geprägte Nickel mit guten, scharfen Rändern. Da er auf keine Requisiten zurückgreifen konnte, weder Gefäße noch gefaltete Taschentücher, hielt er sich an Fingerübungen, Tricks, Kunststückchen und Auffangübungen. Die Frau sah ihm einen Augenblick lang schweigend zu, dann langte sie über den Tisch und berührte seinen Arm.
»Machen Sie das noch mal«, bat sie.
Er folgte ihrer Aufforderung. Der Trick war alt – der Wandernde Nickel. Ein Nickel (in Wirklichkeit drei) bewegte sich auf geheimnisvolle Weise von einer Hand in die andere. Quentin pflegte seinem Publikum die Münze wieder und wieder zu zeigen, um sie dann frech wieder verschwinden zu lassen. Irgendwann tat er so, als wüsste er gar nicht mehr, wo sie war, woraufhin sie mitten auf seiner Handfläche erschien, vor aller Augen. Im Grunde war es eine ziemlich simple, wenn gut geübte Nummer, bei der man die Münze immer wieder fallen ließ, geschickt auffing und sie durch die Finger wandern ließ, kombiniert mit einem besonders geschickten Verschwindetrick.
»Noch mal.«
Er machte den Trick noch mal. In der Mitte unterbrach sie ihn. »An der Stelle machen Sie einen Fehler.«
»Wo?« Er runzelte die Stirn. »So wird das gemacht.«
Sie schürzte die Lippen und schüttelte den Kopf. »Ich will es Ihnen zeigen.«
Sie nahm drei Nickel von dem Stapel und zeigte ihm, ohne einen Augenblick zu zögern, und scheinbar vollkommen mühelos eine perfekte Version des Wandernden Nickels. Quentin konnte den Blick nicht von ihren kleinen, rindenbraunen Händen abwenden. Ihre Bewegungen waren geschmeidiger und präziser als bei jedem Profi, den er bisher gesehen hatte.
Plötzlich hielt sie inne.
»Sehen Sie das, wo die zweite Münze von einer Hand in die andere wechseln soll? Sie müssen einen Rückwärts-Pass machen, sehen Sie, so! Kommen Sie rum, damit Sie es genau erkennen können.«
Gehorsam trottete er hinüber auf ihre Seite des Tischs und stellte sich hinter sie, wobei er es tunlichst vermied, in den Ausschnitt ihrer Bluse zu blicken. Ihre Finger waren viel kleiner als seine, und doch verschwand der Nickel zwischen ihnen wie ein Vogel im Gebüsch. Sie zeigte ihm die Bewegung ganz langsam, vorwärts und rückwärts, in einzelnen Abschnitten.
»Aber so mache ich es doch!«, sagte er.
»Zeigen Sie es mir.«
Jetzt lächelte sie ganz offen. Sie griff ihn am Handgelenk, um ihn mittendrin aufzuhalten.
»Und? Wo ist die zweite Münze?«
Er hielt die Hände hoch, mit den Handflächen nach oben. Die Münze war … Aber da war keine Münze. Er drehte die Hände hin und her, wackelte mit den Fingern, sah auf dem Tisch, auf seinem Schoß, auf dem Boden nach. Nichts. Sie war tatsächlich verschwunden. Hatte sie sie geschnappt, während er nicht hingesehen hatte? Bei diesen schnellen Händen und diesem Mona-Lisa-Lächeln war es ihr durchaus zuzutrauen.
»Hab ich mir’s doch gedacht«, sagte sie und stand auf. »Danke, Quentin. Ich schicke dann den nächsten Prüfer herein.«
Quentin sah sie hinausgehen und tastete immer noch an sich herum, auf der Suche nach der fehlenden Münze. Zum ersten Mal in seinem Leben wusste er nicht, ob er bestanden hatte oder durchgefallen war.
Den ganzen Nachmittag über ging es so weiter: Die Professoren gaben sich die Klinke in die Hand. Es war wie ein Traum, ein langer, weitschweifiger Traum ohne erkennbare Bedeutung. Es kam ein alter Mann mit wackelndem Kopf, der in seinen Hosentaschen wühlte und eine Handvoll ausgefranster, vergilbter, verknoteter Seile herauszog, auf den Tisch warf und mit einer Stoppuhr kontrollierte, wie lange Quentin brauchte, um die Knoten zu lösen. Eine schüchterne, hübsche junge Frau, die kaum älter aussah als Quentin, bat ihn, auf der Grundlage seines bisherigen Eindrucks eine detaillierte Karte von dem Haus und dem Grundstück zu zeichnen. Ein schmieriger Kerl mit einem Riesenkopf, der nicht aufhören konnte zu reden, forderte ihn zu einer merkwürdigen Blitzschach-Variante heraus. Nach einer Weile konnte er das Spiel nicht einmal mehr ernst nehmen – es war, als würde hauptsächlich getestet, wie leichtgläubig er war. Ein dicker Mann mit roten Haaren und wichtigtuerischem Gehabe ließ eine winzige Eidechse mit schillernden Kolibriflügeln und riesigen, aufmerksamen Augen im Zimmer fliegen. Der Mann sagte nichts, sondern setzte sich nur auf den Rand des Tisches, der unter seinem Gewicht gequält knarrte.
Da ihm nichts Besseres einfiel, versuchte Quentin, die Eidechse auf seinen Finger zu locken. Sie stürzte aus der Luft nach unten und biss ihm ein winziges Stück Haut aus dem Unterarm, wo ein Blutstropfen erschien. Dann zischte sie ab und knallte gegen das Fenster wie eine Hummel. Der dicke Mann reichte Quentin stumm ein Pflaster, sammelte seine Eidechse ein und verschwand.
Endlich schloss sich die Tür und wurde nicht wieder geöffnet. Quentin atmete tief durch und rollte die Schultern. Offenbar war die Prozession zu Ende, obwohl sich niemand die Mühe gemacht hatte, Quentin in irgendeiner Weise über Ablauf und Ergebnisse zu informieren. Wenigstens hatte er jetzt ein paar Minuten für sich. Inzwischen ging die Sonne unter. Er konnte sie vom Prüfungsraum aus nicht sehen, hatte aber Aussicht auf einen Springbrunnen. Das Licht, das sich im Wasser spiegelte, war von einem kühlen, dunklen Orange. Nebel stieg zwischen den Ästen der Bäume auf. Das College-Gelände war verlassen.
Er rieb sich mit beiden Händen über das Gesicht. Allmählich konnte er wieder einen klaren Gedanken fassen. Gleichzeitig stieg in ihm die längst überfällige Frage auf, was zum Teufel seine Eltern wohl denken mochten. Normalerweise war es ihnen ziemlich egal, wann er kam oder ging, aber sogar sie machten sich irgendwann Sorgen. Die Schule war jetzt schon seit Stunden aus. Vielleicht glaubten sie, sein Bewerbungsgespräch habe sich ungewöhnlich lange hingezogen, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich überhaupt an diesen Termin erinnerten, ziemlich gering war. Aber wenn es hier Sommer war, hatte die Schule vielleicht noch nicht einmal begonnen? Der seltsame Schwindel, der ihn den ganzen Nachmittag über benebelt hatte, ließ allmählich nach. Er fragte sich jetzt, wie sicher er eigentlich hier war. Wenn das ein Traum war, dann sollte er besser so bald wie möglich aufwachen.
Durch die geschlossene Tür hörte er deutlich jemanden weinen: einen Jungen, und er klang viel zu alt, um noch vor den Augen anderer in Tränen auszubrechen. Ein Lehrer sprach leise und streng mit ihm, aber der Junge wollte oder konnte nicht aufhören. Quentin versuchte, nicht darauf zu achten, aber es war ein bedrohliches, unmenschliches Geräusch, das die äußeren Schichten von Quentins hart erarbeiteter Teenager-Coolness ankratzte. Darunter kam etwas wie Furcht zum Vorschein. Die Stimmen wurden leiser; der Junge wurde wohl weggebracht. Quentin hörte den Dekan mit eisiger, abgehackter Stimme reden, als versuche er nicht zu verärgert zu klingen.