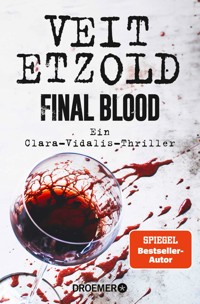9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was wäre, wenn wir nur noch die Wahl hätten zwischen totaler Kontrolle – und totalem Chaos? Der erschreckend realistische Polit-Thriller von Bestseller-Autor Veit Etzold über den internationalen Kampf um die totale digitale Überwachung Vielleicht hätte Tom den Teufel sofort erkennen können. Doch er braucht einen Investor, und der charismatischen Milliardär Dairon Arakis verfügt über die nötigen Mittel. Als Tom begreift, worum es Arakis wirklich geht, ist es beinahe zu spät: Über ein riesiges Hedge-Fonds-Konsortium hat der Milliardär italienische Banken reihenweise in den Bankrott getrieben und Europa steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Die Regierungen sehen sich vor eine Wahl gestellt, die vom Teufel selbst kommen könnte: totales Chaos oder totale Überwachung. In dieser Situation scheint die von Arakis angebotene chinesische Sicherheitstechnologie die einzige Lösung zu sein … Brandaktuell, top recherchiert und an Spannung nicht zu überbieten: Veit Etzolds Polit-Thriller »Final Control« lässt die Supermächte China und Europa im Kampf um Sicherheit, Daten-Kontrolle und digitale Überwachung aufeinanderprallen. Entdecken Sie auch die anderen rasanten Polit-Thriller des Bestseller-Autors zu hochaktuellen Themen: • »Todesdeal« • »Dark Web« • »Staatsfeind«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Veit Etzold
Final Control
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Vielleicht hätte Tom den Teufel sofort erkennen können. Doch er braucht einen Investor, und der charismatische Milliardär Dairon Arakis verfügt über die nötigen Mittel.
Als Tom begreift, worum es Arakis wirklich geht, ist es beinahe zu spät: Über ein riesiges Hedge-Fonds-Konsortium hat der Milliardär italienische Banken reihenweise in den Bankrott getrieben, und Europa steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Die Regierungen sehen sich vor eine Wahl gestellt, die vom Teufel selbst kommen könnte: totales Chaos oder totale Überwachung. In dieser Situation scheint die von Arakis angebotene chinesische Sicherheitstechnologie die einzige Lösung zu sein …
Brandaktuell, top recherchiert und an Spannung nicht zu überbieten: Veit Etzolds Polit-Thriller Final Control lässt die Supermächte China und Europa im Kampf um Sicherheit, Datenkontrolle und digitale Überwachung aufeinanderprallen.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
Buch 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Buch 2
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Buch 3
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Epilog
Dankwort mit ein paar Gedanken zu China
Dramatis Personae
Leseprobe zu »Höllenkind«
Für Saskia
Es ist besser, zu weit zu gehen
als nicht weit genug.
Josef Stalin
Prolog
Der Mann betrat den langen Korridor, von dem die einzelnen Zimmer abgingen und der, wie alle Krankenhausflure, nach einer Mischung aus Desinfektionsmittel und Kernseife roch. Er ging vorbei an den beiden einander gegenüberliegenden Intensivkrankenzimmern, die, ausgestattet nach dem neuesten Stand der Medizintechnik, auf ihre Patienten warteten. Die zwei Zimmer waren identisch, nur der Ausblick war unterschiedlich. Auf der einen Seite hatte man einen Blick auf die Berge, auf der anderen einen Blick auf das Meer. Der Mann hatte beide Zimmer einrichten lassen, weil er nicht wusste, welchen Anblick er eines Tages, wenn er diese Zimmer bewohnen musste, bevorzugen würde. Außerdem würde der Patient etwas Abwechslung gebrauchen können, wenn irgendwann der Ausblick auf die Berge oder die See das Einzige sein würden, das seinem Körper noch Abwechslung bieten konnte. Irgendwann, dann, in der Endphase seiner Krankheit, wenn sein Körper das Grab seines Verstandes sein würde. Irgendwann in der Zukunft würde das sein, das wusste der Mann. Hoffentlich in der fernen Zukunft.
Er betrat den Aufenthaltsraum. Die Ärzte saßen bei einem exquisiten Essen zusammen, das sein Koch eigens für sie vorbereitet hatte. Sie schraken auf, als er den Raum betrat. Er nickte nur in die Runde, so, als wollte er alle beruhigen. Dabei war er es, der beruhigt werden musste. Die Männer und Frauen waren die Besten ihres Fachs, Topmediziner, die er mithilfe einer speziellen Agentur zusammengesucht hatte für den Tag, an dem er dafür nicht mehr die Kraft haben würde. Der Wandel begünstigt den vorbereiteten Geist, hatte mal jemand gesagt.
»Bleiben Sie sitzen«, sagte er. Und dachte: Der Tag, an dem ich euch dringender brauche als alles andere, wird früh genug kommen.
Astrophysiker hatten von dem Pfeil der Zeit gesprochen. Wir Menschen sahen den Pfeil der Zeit in drei Dimensionen.
Dadurch, dass das Chaos im Universum zunahm. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik erklärte, dass die Unordnung im Universum mit jedem Tag größer wurde.
Dadurch, dass die Menschen fühlten, dass die Zeit verging, und zwar nur in eine Richtung. In die Zukunft.
Und dann war da der kosmische Pfeil der Zeit. Der Pfeil, der dafür sorgte, dass das Universum expandierte, sich immer mehr ausbreitete.
Er schaute auf das Team von Ärzten, das er sich ausgesucht hatte. Auf die Geräte, die Maschinen, die Schläuche und die Computer.
Kosmologen hatten das sich ausdehnende Universum mit der Erdkugel verglichen: Von den Polkappen aus breitete es sich aus, wurde immer größer und weiter, bis zum Äquator, und dann schrumpfte es wieder, bis am Südpol das Universum vor dem Ende stand.
Und seither hegte er einen Gedanken, oder war es vielmehr eine kühne Hoffnung: Vielleicht wäre es bei ihm ähnlich? Vielleicht würde er irgendwann, in der fernen Zukunft, wieder da sein, wo er jetzt war, genau hier, an diesem Ort, würde wieder lebendig sein und gesund.
Denn irgendwann, dachte der Mann, wird die Zeit wieder rückwärtslaufen. Dann würde er nach und nach gesund werden. Lange nach seinem Tod würde die Zeit sich irgendwann in die entgegengesetzte Richtung bewegen, und er würde wieder hier stehen. Seit Jahrmillionen oder gar Milliarden tot, aber dann wieder lebendig.
In Jahrmilliarden würde es genauso wie früher sein.
Buch 1
Wir haben schon von übereilter Hast im Kriege gehört, aber noch niemals ist große Weisheit mit großer Verzögerung in Verbindung gebracht worden.
Sun Tzu, Die Kunst des Krieges
Kapitel 1
Shanghai/Pudong, Volksrepublik China
Wie lange muss ich Karate üben, bis ich es kann?, hatte Si seinen Lehrer gefragt.
Bis zu deinem Tode, hatte sein Lehrer, Otake Sensei, geantwortet. Der Buddha, hatte Otake gesagt, hatte neun Jahre in einer Höhle vor einer Wand meditiert, um den Insekten zuzuhören. Du musst dich selbst besiegen, Si, bevor du andere besiegen kannst, hatte Otake gesagt. Du musst dich selbst töten, bevor du andere töten kannst.
Si hieß der massige Chinese, der mit ausgestreckten Fingern in das Fass schlug. Si wurde Se gesprochen, mit kurzem e. Die meisten wussten nicht, was Si auf Chinesisch bedeutete, und das war gut so. Die meisten wussten nur, dass sie vor Si Angst hatten, sobald sie ihn sahen. Ihn oder den riesigen Schatten, den er warf. Er war riesig groß. Und er war schnell. Und das war für die meisten eine ungewöhnliche und in vielen Fällen auch tödliche Mischung. Manche sagten, Si sei eine Mischung aus Oddjob in James Bonds Goldfinger und Gregor Clegane in Game of Thrones. Si aber wusste, dass er noch viel mehr war.
Er holte aus und schlug mit ausgestreckten Fingern mit der Nukite-Technik von oben in das Fass. Bei Nukite schlug man mit den ausgestreckten, aneinandergelegten Fingern einer Hand zu. Wer diese Technik richtig beherrschte, konnte mit seinen Fingern wie mit einem Messer zustechen. Die riesige Skyline von Shanghai hinter dem Fenster in dreihundert Metern Höhe bemerkte er nicht. Die Sonne hinter den getönten Scheiben bemerkte er nicht. Die Millionen von Menschen unten auf der Straße bemerkte er nicht. Er bemerkte nur die Konzentration, den kristallklaren Fokus auf den einen Schlag.
Seine Finger schlugen auf den Boden des Fasses. Dies war der dritte Schlag. Der wichtigste.
Er hatte das Fass für den ersten Schlag mit Erbsen gefüllt und dann bis zum Boden des Fasses geschlagen. Dann hatte er das Fass für den zweiten Schlag gefüllt, diesmal mit Sand. Und wieder hatte er bis zum Boden geschlagen. Und jetzt, beim dritten Mal und beim dritten Schlag, hatte er das Fass mit Bleikugeln gefüllt. Und seine Hand schlug wieder bis zum Boden des Fasses.
Im Ernstfall aber schlug man mit Nukite nicht in irgendein Gefäß mit Bleikugeln, sondern in den Körper des Gegners. Nicht in den Bauch, nicht in die Rippen, sondern hindurch. Das Ziel war immer dasselbe. Das Ziel war nicht, den Gegner zu besiegen. Das Ziel war, ihn zu töten. Doch es gab noch ein größeres Ziel. Das große Ziel war, sich selbst zu töten. Wie der Buddha, der neun Jahre auf die Höhlenwand geblickt hatte. Den Gegner töten und sich selbst.
Von den Ninja wusste Si, dass sie sich eher selbst töteten, als dass ihnen unter Folter Geheimnisse entlockt werden konnten. Manche renkten sich selbst den Unterkiefer aus, um nicht reden zu können.
Si zog die Hand aus dem Fass mit den Bleikugeln heraus. Seine Finger und Zehennägel waren wie Klauen. Er konnte damit die Rinde von einem Baum ziehen, oder einem Menschen die Haut in Streifen abschneiden.
Unser Körper ist eine Waffe, die uns niemand wegnehmen kann, hatte sein Lehrer Otake Sensei gesagt, denn Leben heißt Kämpfen, undLeben heißt Sterben. Abhärtung war das Wichtigste. Si schlug jeden Morgen eine Stunde mit den Handflächen auf einen Stein, dann noch einmal eine Stunde auf das Makiwara, einen mit Reisstroh umwickelten Holzpfahl. Das Üben am Makiwara ist die Seele des Karate, hatte sein Lehrer gesagt. Dann kamen Kämpfe und Kata. Die Kata war am schwierigsten. Da war niemand. Nur Si und der Raum. Si war schon immer groß gewesen, aber früher war er schwach. Er hatte mit Karate begonnen, eben weil er schwach war.
Karate war in Okinawa erfunden worden, doch die Ursprünge des Karate waren jahrtausendealt. Die Bewohner von Okinawa, das zu einem eigenständigen Königreich gehörte, durften während der japanischen Besatzung der Insel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts keine Waffen tragen. Also erfanden sie Karate. Den Kampf ohne Waffen, denn Karate hieß die leere Hand. Die Bewohner hatten ihre Kriegskunst als Tänze getarnt, sodass niemand von den japanischen Besatzern wusste, dass die Bewohner von Okinawa ihre tödlichen Waffen, ihre Hände und Füße, immer dabeihatten.
Alle Kriegsführung basiert auf Täuschung, hatte Sun Tzu gesagt. Si war durch das jahrelange Training groß, stark und gefährlich geworden. Genauso wie China. Genauso wie die Skyline von Shanghai.
Si bewegte seine Finger. Du musst üben bis zu deinem Tod. Der Weg war das Ziel. So muss im Krieg gemieden werden, was stark ist, und geschlagen werden, was schwach ist, hatte Sun Tzu schon 500 Jahre vor Christi geschrieben. Wenn man nur stark genug war, dachte Si, war alles andere automatisch schwach. Selbst die Bleikugeln in dem Fass. Selbst ein Eichenbrett, selbst eine Steinplatte, selbst ein Gegner, der unbesiegbar schien.
Sis Boss betrat den Raum. Si sah seine Silhouette vor der Skyline von Shanghai, dem Oriental Pearl Tower, dem Shanghai Tower, der mit über sechshundert Metern das höchste Gebäude Chinas war. Der Stadtbezirk Pudong war das neue Shanghai. Pu hieß Fluss, dong hieß Osten. Das neue Shanghai war Pudong, das Shanghai des Ostens. Und es war nahe am Meer. Denn das hieß Shanghai: aufs Meer hinaus, von Shang, sich erheben und Hai, Meer.
»Hast du es geschafft?«, fragte sein Boss. Si nickte nur. »Wenn man durch alle Bleikugeln schlägt«, sagte Si und zog seine verhornte Hand endgültig aus dem Fass, »kann man anderen Menschen die Rippen durchschlagen und das Herz herausreißen.«
Er hatte es schon einmal getan, mit Nukite in den Brustkorb eines Mannes geschlagen, die Rippen umfasst und sie herausgerissen. Die Rippen und das Herz. Bei einem Mann, der seinen Boss töten wollte. Der Mann hatte noch seine blutigen Rippen in Sis Hand gesehen und war dann zu Boden gefallen, als hätte man einen Stecker aus ihm herausgezogen.
»Das Herz herausreißen«, sagte Arakis und nickte. »Genau das wird mit allen passieren, die unserer Idee im Weg stehen.«
Kapitel 2
World Economic Forum, Davos, Schweiz
Es war Januar. Tiefster Schnee lag in den Schweizer Bergen. Es war die Zeit, in der das World Economic Forum in Davos stattfand und die gesamte Wirtschaftselite nach Davos flog, um dort den Gurus zu lauschen, zu den neuen Themen, Blockchain, VUCA, Purpose, Diversity, und die richtigen Menschen kennenzulernen, Geschäfte zu machen und die Welt zu beherrschen. In Thomas Manns Zauberberg blieben die Patienten jahrelang in dem Sanatorium in Davos, doch hier war die Veranstaltung nicht einmal eine Woche lang, und die Tage waren vollgestopft. Viele der Teilnehmer hatten ihren ersten Termin um sechs Uhr morgens und den letzten um Mitternacht oder noch später. Wer nicht mindestens zehn Termine pro Tag hatte, war unwichtig. Die Einzigen, die weniger als zehn Termine pro Tag hatten und trotzdem wichtig waren, waren die, die jenseits von allem waren. Die es geschafft hatten und die niemandem mehr hinterherlaufen mussten. Nein, die anderen liefen ihnen hinterher. Sie waren die, die immer auf den Podien saßen und niemals davor. Die Menschen, die in diesem Raum saßen, gehörten dazu. Der Mensch, der vor ihnen stand, ebenso. Es waren die Menschen in dem Raum mit der großen Fensterfront und dem Blick auf die im Mondschein blau schimmernden Berge, die Dairon Arakis misstrauisch musterten. Sie suchten nach neuen Investmentmöglichkeiten für ihr Geld. Das nächste große Ding, das nächste Facebook, das nächste Google, die nächsten Wetten auf Erfolg oder auf Katastrophen. Auf Möglichkeiten, die nicht im Wirtschaftsteil der Zeitungen standen.
Start-ups waren ein Thema, Technologie und Künstliche Intelligenz ein anderes, doch der Grund, warum sie hier hergekommen waren, war Geopolitik. Dinge werden sich ändern, hatte Arakis ihnen vorher gesagt, und nicht nur zum Guten. Die Rothschilds haben gekauft, wenn die Kanonen donnerten. Wann immer etwas schiefgeht, geht es Millionen von Leuten schlecht, aber einige, wenige profitieren, profitieren auch von der Not der anderen. Zu welcher Seite wollen Sie gehören?
Die Menschen, die hier saßen, waren fast ausschließlich Männer, und ganz bestimmt wollten sie profitieren und zu den Gewinnern gehören. Sie gehörten zum Bilderberger Investment Club, der sich nicht nur zu den alljährlichen Bilderberg-Konferenzen, sondern auch im Rahmen des World Economic Forums im schweizerischen Davos traf, allesamt, wie für die Jahreszeit üblich, in Maßanzügen und Winterstiefeln. Drinnen tiefe Ledersessel, Cognacs, Zigarren, draußen Schnee und auf dem Dach Scharfschützen. Alles sogenannte »UHNWIS«, Ultra High Net Worth Individuals, was so viel wie »Ultrareiche Individuen« hieß, Menschen, nach denen sich die Private-Banking- und Wealth-Management-Abteilungen der Banken wie Credit Suisse und UBS die Finger leckten, aber auch Hedgefonds- und Private-Equity-Investoren. Jeder von ihnen war mehrere Hundert Millionen bis mehrere Milliarden schwer. Um in den Club zu kommen, brauchte man eine Menge von Empfehlungen. Solange man aber nicht mindestens einen zweistelligen Millionenbetrag an liquiden Mitteln und Wertpapieren hatte, brauchte man gar nicht erst zu fragen. Und zweistellig hieß eher achtzig Millionen als zehn Millionen. Sie saßen vor Arakis in den Ledersesseln mit dem gleichen Gesichtsausdruck wie die Patrizier im Kolosseum oder im Circus Maximus. Im Sommer waren sie im Bellagio, im Winter in Davos. Die ersten Bilderberg-Konferenzen, das wusste Arakis, hatten in Holland stattgefunden, im sogenannten »Hotel Bilderberg«, doch jetzt war die Konferenz genauso global wie ihre Mitglieder. Und genauso reich.
Der Codename, um dieser kleinen Konferenz beizuwohnen, lautete Caracalla – der Spitzname eines römischen Kaisers, der seinen Bruder und all seine Gegner umbringen ließ und gemeinsam mit Nero und Caligula zu den schlimmsten römischen Imperatoren zählte. Immerhin hatte er die großen Thermen von Caracalla in Rom gebaut. Caracalla hieß auf Lateinisch Kapuzenmann, und genau so unsichtbar waren diese reichen Mitglieder des Bilderberger Investment Clubs, die sich fragten, ob die halbe Stunde im Konferenzraum gut investiert war und sie mehr bekamen als Kaminfeuer, teure Cognacs und Zigarren und einen grandiosen Blick auf die Schweizer Berge.
Arakis musterte die Zuschauer. Waren es die Richtigen?, fragte er sich. Oder waren sie zu satt, zu zufrieden, hatten schon alles gesehen oder glaubten das jedenfalls und wollten nichts Neues mehr erleben? Der Westen war satt und dekadent, ähnlich dem Schicksal von Rom, weshalb Arakis den Namen Caracalla als Codewort ausgewählt hatte. Die Chinesen aber waren hungrig. Sie steuerten mit der Kommunistischen Partei das komplexeste Gebilde der Menschheit, aber trotzdem waren sie schnell und wendig. Sie waren wie die Germanen, die das Römische Reich in die Knie gezwungen hatten. Genauso willensstark, aber sehr viel besser organisiert. Waren die Bilderberg-Konferenz und ihr Investment Club die Spitze westlicher Dominanz oder das erste Anzeichen seines Niedergangs, so wie die riesigen Caracalla-Thermen in Rom, die von den Ostgoten zerstört worden waren? Er wusste es nicht, aber er würde es noch heute Abend erfahren.
Kapitel 3
Kochstraße, Berlin, Deutschland
Tom Bayne ging mit eiligen Schritten die Kochstraße entlang und sah das für Berliner Verhältnisse recht große Hochhaus vor sich in den Himmel ragen. Das Hochhaus an der Ecke Kochstraße und Charlottenstraße erhob sich dort, wo die Kochstraße zur Rudi-Dutschke-Straße wurde. Dahinter kam das Axel-Springer-Gebäude. Der Springer-Konzern hatte sich extrem geärgert, dass die Straße ausgerechnet nach dem Mann umbenannt wurde, der bei den 68er-Demonstrationen einer der größten Feinde der verhassten und angeblich systemtreuen »Springer-Presse« war. Immerhin hieß die Querstraße dahinter »Axel-Springer-Straße«. Tom kannte London, Hamburg und viele andere Großstädte, aber Berlin kam ihm nach wie vor komisch vor. Es war zwar eine Stadt voller Geschichte, aber komplett ohne Tradition, eine Stadt, in der fast alle viel zu viel Zeit hatten und damit überhaupt nichts anzufangen wussten. In den Zwanzigerjahren war Berlin eine Trendstadt der Welt gewesen. Jetzt, sagte man, ging die Stadt vom anything goes dieser Zeit zum nichts geht mehr. Viele sagten, Berlin sei pulsierend, aber der eigentliche Puls war der zwischen Berauschung und Ausnüchterung. Es wurde ständig gefeiert, obwohl es dazu eigentlich gar keinen Grund gab. Berlin-Schönefeld galt als schlechtester Flughafen der Welt, und Berlin war mehr als jede Stadt Abbild eines Deutschlands, das immer sprunghafter und moralisierender wurde, aber eigentlich nichts mehr zustande brachte. Manche Städte assoziierte man sofort mit einem bestimmten Beruf. Bei Hamburg war es der Kaufmann, bei Stuttgart der Ingenieur, bei San Francisco der Programmierer und bei New York der Banker oder Werber. In Berlin war es der Flaschensammler.
Gegenüber dem Gebäude befand sich das Arbeitsamt, der Ort, an dem viele Berliner in ihrem Leben am meisten Zeit verbrachten, doch für die Mitarbeiter der Firma in dem Hochhaus galt das nicht. Zum Arbeitsamt musste niemand, der für das Unternehmen in diesem Hochhaus arbeitete.
Am Ohr hatte Tom sein Smartphone und telefonierte mit seinem Vater in Hamburg, während er ständig Horden von Touristen auswich, die alle auf dem Weg zum legendären Checkpoint Charlie waren, wo es außer einem Wachhäuschen, falschen US- und UdSSR-Soldaten und betrügerischen Hütchenspielern gar nichts zu sehen gab. Aber für die Millionen von Touristen, die jährlich nach Berlin strömten, schien das ausreichend zu sein, solange es genug Alkohol und keine Regeln gab. Und beides gab es in Berlin reichlich: keine Regeln und Alkohol und Drogen im Überfluss.
Tom war halb Deutscher und halb Engländer. Seine Mutter war Krankenschwester in England gewesen und hatte seinen Vater in Hamburg kennengelernt, der Stadt, in der auch die Beatles ihre ersten Erfolge gefeiert hatten. Da in den späten Siebzigerjahren englische Namen als cool galten, hatte Toms Vater Walter den Namen seiner Frau angenommen, obwohl das damals komplett unüblich war. Mary Bayne war gestorben, als Tom zehn Jahre alt gewesen war. Sie hatte ihn früh für englische Literatur begeistert, für Frankenstein von Mary Shelley. Das war eigentlich zu früh für einen Zehnjährigen, aber vielleicht mochte sie sie auch deswegen so gern, weil beide den gleichen Vornamen hatten. Shelley hatte die Frankenstein-Geschichte auf einer Reise nach Genf geschrieben, die sie zusammen mit ihrem Mann Percy Bysshe Shelley und Lord Byron unternommen hatte. Da während der Reise die ganze Zeit schlechtes Wetter herrschte, hatten die drei sich vorgenommen, einen Geschichtenwettbewerb untereinander auszurichten. Dabei war unter anderem Frankenstein herausgekommen.
Besonders fasziniert hatte Toms Mutter Mary und später auch Tom die enge Verbindung zwischen Geburt und Tod, denn Mary Shelley hatte mehrere Kinder verloren. Es war nicht nur der Hinweis auf die Gefahr, die immer lauerte, wenn der Mensch Gott spielte, um die es in Frankenstein ging, sondern es ging auch um die Zerbrechlichkeit des Lebens, was vielleicht dazu geführt hatte, dass Tom zunächst Arzt geworden war.
Tom war nach dem Tod der Mutter bei seinem Vater in Hamburg aufgewachsen, der dort seit einigen Jahren einen sehr erfolgreichen Handwerksbetrieb unterhielt. Als die Firma, bei der sein Vater als Klempner gearbeitet hatte, pleite gegangen war, war er das Wagnis eingegangen, sich selbstständig zu machen. Die Firmenadresse war damals noch das kleine Reihenhaus gewesen, in dem sie wohnten und in dem Toms Mutter immer zu Mitarbeitertreffen am heimischen Abendbrottisch eingeladen hatte. Am Ende war diese Entscheidung von Walter Bayne genau richtig gewesen, denn seine Firma Baynes Bad und Wasser lief sehr gut und hatte sich auf einige Nischenmärkte spezialisiert, die den großen Installationsfirmen für Wasser und Gas in Hamburg nicht glamourös genug waren.
Obwohl Toms Vater in seinen Anfangsjahren wenig Geld gehabt hatte, hatte er dafür gesorgt, dass Tom sich seinen größten Wunsch erfüllen konnte: am UKE Hamburg, dem Universitätsklinikum Eppendorf, Medizin zu studieren. Tom hatte dort im Lauf der Jahre jede Menge Erfahrungen gemacht. Hatte einen Einblick in die Gesellschaft gewonnen. Wenn er nur an all die einsamen Alten, die todkranken Kinder oder die schrägen Vögel dachte, die nachts aus St. Pauli und von der Davidwache gekommen waren. Manche waren dermaßen besoffen gewesen, dass man ihre Wunden ohne Betäubungsspritze hatte nähen können. Aber nichts hatte ihn auf den Befund vorbereitet, der jetzt vor ihm lag. Die Sachlage war ebenso klar wie erschütternd. Der Patient war sein Vater. Und es war amtlich.
»Haben die schon mit dir gesprochen?«, fragte er.
»Ja, haben sie. Es ist Bauchspeicheldrüsenkrebs«, sagte Walter Bayne leise. »Es stimmt leider.«
Der Verdacht hatte schon länger bestanden. Walter Bayne ging es seit geraumer Zeit nicht gut. Wegen seiner Krankheit konnte er kaum arbeiten und hatte bereits einen stellvertretenden Firmenchef, Joost, eingesetzt. Tom hatte in seinem Studium viele Abteilungen des Universitätsklinikums kennengelernt, und er kannte auch den Chefarzt, der den Befund unterzeichnet und ihm aufs Handy geschickt hatte.
Tom wusste, wie tödlich Bauchspeicheldrüsenkrebs war. Dass sogar Steve Jobs von Apple daran gestorben war, der sicher sämtliche medizinischen Möglichkeiten gehabt hatte, stimmte ihn nicht gerade optimistischer bei der Einschätzung dieser Krankheit.
»Pass auf«, sagte Tom. »Ich kläre das mit meinen Kollegen. Schick mir unbedingt auch alle anderen Befunde, die du bekommen hast, als PDF.«
»Als PDF?«
»Sonst fax sie in deine Firma oder mach Fotos davon.«
»Okay, mache ich. Aber kommst du nicht nach Hamburg?«
»Doch, sogar heute Abend schon. Ich würde sie mir gern aber vorher im Zug anschauen und schon ein paar Telefonate tätigen.«
»Okay.«
Tom hatte nach seiner Zeit als Arzt im Praktikum zunächst bei ECC – East Coast Consulting, einer globalen Unternehmensberatung gearbeitet, bei der er festgestellt hatte, dass man mit Medizinprodukten mehr verdienen konnte als in den Kliniken oder Praxen, wobei die Zahnärzte die Geldoptimierung schon gut beherrschten. Den Zahnärzten sagten die echten Mediziner immer, dass sie keine echten Mediziner seien. Dem entgegneten die Zahnärzte, dass die echten Mediziner zwar viel von Medizin verstünden, aber zu blöd zum Geldverdienen seien.
Tom hatte dann angefangen, in Medizin-Start-ups zu arbeiten, in Deutschland, London und seit Kurzem in Shenzhen, der Digitalhauptstadt Chinas. Shenzhen war die Stadt, aus der fast alle Digital- und Überwachungstechnologien des Riesenreiches kamen. Als Amazon den eigenen Aktionären von den Plänen erzählt hatte, demnächst Gesichterkennungs-Software einzusetzen, war das selbst den Amazon-Aktionären zu viel. In China war Gesichtserkennung erst der Anfang. CUMOhieß Toms Firma. Für Cure-Mobile. Eine Kooperation eines invasiven Chips mit der App war bereits im Gange. Allerdings nicht in China, sondern in seiner alten Heimat. In Hamburg am UKE. Vielleicht würde er es schaffen, dorthin morgen einen kurzen Abstecher zu machen, aber das Projekt war noch in der Startphase, von daher dürfte es nicht viel Neues geben.
Bauspeicheldrüsenkrebs, dachte Tom. Laut Bericht nicht mehr reparabel. Die alternativen Behandlungen waren teuer und wurden nicht von allen Krankenkassen bezahlt.
Tom ärgerte sich, dass er das Geld, das er einmal bei einem vorteilhaften Kryptowährungsdeal gemacht hatte, sofort in die Entwicklung seines eigenen Start-ups gesteckt hatte. Jetzt hätte er es für seinen Vater gut gebrauchen können. Aber wie immer kam die Diagnose zu spät. Es war die Grundmisere des Menschen, die er auch in seinem Medizinstudium immer und immer wieder festgestellt hatte: Es war immer alles zu wenig und es war immer zu spät.
Er war bei dem Hochhaus angekommen. Rocket Internet stand auf einem Schild. So hieß die Firma, die einen großen Teil des Gebäudes gemietet hatte.
»Papa, ich muss Schluss machen«, sagte er. »Wir sprechen nachher.« Er schluckte kurz, schaute noch einmal in seine Präsentation und drückte auf den Summer an der Tür. Vielleicht würde Rocket Internet bei seinem Projekt anbeißen. Doch die Nachricht von der Krankheit seines Vaters hatte seine Moral nicht gerade beflügelt. Die Tür öffnete sich, und Tom betrat das Atrium.
Bauchspeicheldrüsenkrebs, dachte er. Ein Motivationstrainer hatte ihm einmal erzählt, dass man in Verkaufsgespräche möglichst optimistisch gehen sollte, jedenfalls dann, wenn man etwas verkaufen wollte.
Das war schon einmal gründlich misslungen.
Kapitel 4
World Economic Forum, Davos, Schweiz
Dairon Arakis atmete durch, bevor er seine Präsentation startete.
Er hatte all das im Silicon Valley gelernt. Vor langer, langer Zeit. Wie man Leute beeindruckt, für sich gewinnt, Dinge verkauft. Bei einem sogenannten Pitch hieß es, großspurig aufzutreten. Es half ihm, sich mit einer großen Gestalt der Geschichte zu vergleichen. Er war Michelangelo, und die Investoren, die ihm seine Idee abkaufen sollten, waren die Medici in Florenz. Oder Papst Julius II. Und das, was er verkaufen wollte, war, im übertragenden Sinne, nichts Geringeres als die Sixtinische Kapelle. Narzisstisch zu sein half auch, wenn man etwas verkaufen wollte, ebenso ein gesunder Mangel an Hemmungen, Empathie und ein Zuviel an Größenwahn. All das waren Charaktermerkmale, die man normalerweise Psychopathen zuschrieb. Sich nie mit einem Nein zufriedengeben, und wenn es dann doch kam, einfach weiterzumachen. Mit den Gedanken begann alles, den richtigen, den positiven Gedanken, das hatte schon Napoleon Hill gesagt, und der hatte es von dem Stahlbaron Andrew Carnegie gelernt. Die Gedanken wurden zur Sprache, die Sprache zur Handlung und die Handlung zum Schicksal. Es blieb allerdings dennoch eine Herausforderung: Sich einfach nur etwas vorzunehmen oder das, was man sich vorgenommen hatte, auch tatsächlich umzusetzen. Dabei war derjenige, der etwas von einem anderen wollte, immer schlechter aufgestellt als der, von dem jemand etwas wollte. Der eine war Arakis, der andere war sein Publikum in Davos. Verkaufen oder eben nicht verkaufen, das war der einzige Unterschied.
Man konnte es auch einfacher beschreiben.
In der Finanzwelt fasste man die Unterschiede zwischen dem Verkäufer und dem Käufer relativ simpel zusammen: Wenn ein Deal nicht zustande kam, knallte der Verkäufer das Telefon auf die Gabel und sagte »Fuck«. Der Käufer hingegen sagte »Fuck« und knallte dann erst das Telefon auf die Gabel.
Dennoch: Wenn der Verkäufer an seine Story glaubte, stieg auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Käufer an die Story glaubte. Wollte er, Arakis, die Welt zu einem besseren Ort machen? Ja, jedenfalls würde er das gleich sagen. Musste er beweisen, dass er wirklich daran glaubte? Nein, das musste er nicht. Es war lediglich wichtig, dass die anderen daran glaubten. Er musste die anderen, die vielen ultrareichen Männer und die wenigen ultrareichen Frauen im Publikum, glauben machen, dass er daran glaubte. Und es war wichtig, dass sie glaubten, dass er daran glaubte. Der Spruch von Sun Tzu war in seinem Kopf: Alle Kriegsführung basiert auf Täuschung.
Kapitel 5
Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg, Deutschland
Tara Helbig kam gerade von ihrer Mittagspause zurück und bewegte sich mit schnellen Schritten auf den Eingang des UKE in der Martinistraße zu. Sie nahm die Steinfassade und den modernen Glasüberbau über dem Eingang kaum noch wahr. Das gesamte Krankenhaus war 2006 generalüberholt worden, doch es bestand noch immer aus vielen kleinen Teilen und Instituten, die noch aus der Zeit kamen, als die Klinik viele verschiedene Pavillons erbaut hatte, um dort die Patienten voneinander abzugrenzen und die Ansteckungsgefahr innerhalb der Klinik einzudämmen.
Sie schüttelte den Kopf, obwohl sie keiner sehen konnte. Sie hatte die Ergebnisse eben per PDF auf ihr Handy bekommen. Was datenschutzrechtlich eigentlich nicht erlaubt, aber technisch nicht anders möglich war. Sie blinzelte und schaute auf die Messergebnisse, runzelte die Stirn und versuchte gleichzeitig, weder etwas von ihrem Take-away-Kaffee zu verschütten noch gegen irgendetwas zu laufen, während sie die Nachricht las. In Asien, hatte sie gehört, waren bereits Spurlinien auf die Bürgersteige gemalt, damit die Einwohner, die auch im Laufen ständig auf ihre Smartphones starrten, nicht ständig auf Kollisionskurs waren.
Die Konzentration von radioaktivem Jod war in fast allen zweihundert Probanden deutlich höher, als sie sein sollte. Wie war das möglich? Die Probanden waren alle junge, gesunde Menschen, keiner von ihnen hatte jemals Schilddrüsenkrebs und eine Radiojodtherapie gehabt. Ihres Wissens nach arbeitete auch keiner von ihnen in einem Strahlenbunker, wie es sie auch im UKE gab. Und selbst wenn bei einem oder zwei der Probanden eine sogenannte Kontamination vorlag, erklärte das nicht die Höhe der Werte und vor allem nicht die Tatsache, dass es fast alle Probanden erwischt hatte. Hatte es wieder irgendeinen Unfall in einem Kernkraftwerk gegeben? Aber davon war ihr überhaupt nichts zu Ohren gekommen. Oder gab es einen Fehler in der Software? Sie glich die übrigen Werte mit den Kontrollblutwerten ab, so gut das auf dem Smartphone ging. Nein, die stimmten alle, es konnte kein Fehler sein. Von derart hohen Jodwerten hatte sie bisher aber nur zweimal gehört: bei dem Reaktorunglück in Tschernobyl und bei der Explosion im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi in Japan. Das wäre die einzige logische Erklärung. Aber das konnte nicht sein.
Sie nahm das Handy und rief ihre Kollegin Miriam an.
Miriam meldete sich nach dem zweiten Klingeln.
»Hi, Tara.«
»Hallo, Miriam. Was ist denn da los? Warum die hohe Konzentration?«
»Das wundert mich auch«, sagte Miriam. »Habe die Daten eben gezogen und dachte, ich schicke sie dir sofort. Das sind ähnliche Werte, wie wir sie damals bei Tschernobyl hatten. Oder auch in Japan bei Fukushima.«
»Hat es denn irgendwas in der Richtung gegeben?«
»Ja, dachte ich auch erst. Ich habe mal eben bei Google geschaut, aber nichts gefunden.«
Tara arbeitete am UKE im Fachbereich Innere Medizin und Immunologie. Ihr Chef, Dr. Imir Khan, ein in Hamburg geborener Pakistani, hatte in Hamburg Medizin und in Stanford Informatik studiert und dann die Idee gehabt, dass man die datengetriebene Medizintechnik nicht nur den Amerikanern und dem Google Spinoff Calico überlassen dürfte. Darum hatte er diverse Initiativen mit Medizin-Start-ups gestartet, wobei eine davon diejenige war, an der Miriam arbeitete. Etwa zweihundert Probanden, die zu einem großen Teil deutsche und internationale Studenten der Uni Hamburg waren, und noch einigen älteren Männern und Frauen, war ein kleiner Chip eingepflanzt worden, der per WLAN oder 5G einen Großteil der medizinischen Daten des Körpers in alle Welt funken konnte. Eine Art Apple Watch XXL.
Das Ziel war, dass in der Medizinwelt der Zukunft Dinge wie Blut abnehmen, Urinproben, Blutzuckerspiegel messen und andere invasive und bei den Patienten oft unbeliebte Messungen künftig nicht mehr nötig waren. Ein junger Mann, der ebenfalls vor einiger Zeit am UKE Medizin studiert hatte, hatte Tara und Imir das Projekt vor etwas vier Monaten vorgestellt, und ihr Chef war sofort überzeugt gewesen. CUMO hieß die Firma. Für Cure-Mobile. Ihr Gründer Tom Bayne hat von einer neuen Welt der Medizin geschwärmt, den möglichen Kosten, die Kliniken damit sparen könnten, und der perfekten Diagnose durch Big Data. Denn ein Computer, der sich durch Hundertausende von akademischen Papern durchpflügen konnte und diese Erkenntnisse dann mit den Symptomen einer Krankheit abglich, wusste am Ende mehr als jeder noch so erfahrene Arzt. Dass hier auch Big Brother herzlich grüßte, war Tara und allen Probanden klar. Bisher hatte das Tool aber sehr gut und eindrucksvoll funktioniert. Nur was sollten jetzt diese seltsamen Messwerte mit dem Jod, als hätte es einen Reaktorunfall gegeben, fragte sich Miriam. Entweder hatte das Gerät einen Fehler, oder hier stimmte etwas ganz anderes nicht.
Tara eilte die Treppen hinauf und im Laufschritt in den zweiten Stock.
Kapitel 6
World Economic Forum, Davos, Schweiz
Arakis schaute noch einmal auf die Folien. Dann begann er zu sprechen. Sparte sich Floskeln wie ich bin … ich habe … ich freue mich, dass Sie hier sind …
»Meine Vision für Europa, für den Kontinent, auf dem wir hier leben«, begann er, »ist auf diesen Seiten zusammengefasst.« Er machte eine kurze Pause. Die Gesichter der Anwesenden waren genauso gelangweilt wie zu Beginn. »Was ist Europa? Ein militärischer Zwerg, der bald auseinanderbrechen wird, ein Kontinent ohne Vision, ohne Technologie und ohne Militär. Und erst recht ohne Ziel und Strategie. Und in ihrem Zentrum die größte Volkswirtschaft, die der Inbegriff der Stagnation ist.« Er wechselte zur nächsten Folie. »Im Westen, jenseits eines riesigen Ozeans, liegt Amerika. Amerika hat einen Vorteil. Oder anders, es hat jetzt noch einen Vorteil mehr. Spätestens seit dem Anfang des Jahrtausends hat Amerika die GAFA, und Sie wissen, was das ist.« Die meisten nickten. Arakis sprach weiter. »Google, Apple, Facebook, Amazon. Europa«, er zeigte nach draußen auf die Berge, »hat nichts dergleichen.« Es kam eine neue Folie. »Schauen wir nach Osten. Asien. Irgendwann trat China wieder auf die Bühne, und mit China kam die BAT. BAT heißt auf Englisch so viel wie »Fledermaus«, aber hier heißt es etwas ganz anderes: Es sind die Namen der chinesischen Techkonzerne. Baidu, Alibaba und Tencent. Davon haben schon einige gehört. Sie sowieso, aber auch die normalen Leute da draußen. Was viele nicht wissen, ist, dass Baidu, das chinesische Google, den Suchalgorithmus mit den berühmten Backlinks, der Google berühmt machte, schon vor Google entwickelt hatte. Ebenso die Möglichkeit, Suchergebnisse mit Werbung zu verbinden. Man kann sich also streiten, ob China die USA kopiert hatte oder schon vorher einiges an digitalen Innovationen aufgebaut hat. Fakt ist aber: Die USA hat GAFA, China hat BAT, und Europa hat noch immer nichts. Im Gegenteil! Es bemüht sich sogar, die paar Industrien, in denen es noch führend ist, selbst zu demontieren, wie zum Beispiel Deutschlands Autoindustrie.«
Arakis sah ein Gähnen in den Gesichtern von einigen Teilnehmern.
Arakis versuchte, sich davon nicht beirren zu lassen. »Der Facebook-Investor Peter Thiel, den ich gut kenne, hat es schon gesagt: Es gibt kaum mehr Innovation, und in Europa gibt es sie erst recht nicht mehr. Wir wollten fliegende Autos, sagte Thiel, und bekamen 140 Zeichen bei Twitter. Und auch das Silicon Valley wandelt sich von der Weisheit der vielen zur Dummheit der Vielen. Thiel hat einiges vorhergesehen. 2005 hielt Thiel einen Vortrag an der Stanford-Universität in Kalifornien und sagte, das nächste Google würde in acht Kilometern Entfernung entstehen. Es waren nicht einmal acht Kilometer. Denn das nächste Google entstand sogar in drei Kilometern Entfernung und nannte sich Facebook.«
Einige der Teilnehmer atmeten geräuschvoll aus und sahen auf die Uhr. Manche pafften mürrisch an ihren Zigarren und bestellten neuen Whiskey.
»In Europa«, fuhr Arakis fort, »gibt es keine Kraft der Innovation. Die einzige Kraft, die Europa durchströmt, ist die Angst. Wir können sie spüren, wir können sie sehen, aber ganz besonders können wir sie riechen. Die Angst vor der Zukunft, deshalb flüchteten sich alle in die Vergangenheit. Was ist leichter oder schwerer? Erinnerung oder Imagination?« Er hielt ein paar Sekunden inne und sprach dann weiter. »Erinnerung ist einfach, denn Erinnerung bezieht sich immer auf das, was war. Das Bekannte. Imagination ist schwer, denn es bezieht sich auf etwas, das es noch nicht gibt. Das Unbekannte. Aber es ist die Imagination, die zum Erfolg führt. Erst die Gedanken, dann die Taten, dann das Schicksal.«
Auf der nächsten Folie prangte eine Zeichnung eines chinesischen Strategen. »Sun Tzu«, sagte Arakis, »hatte es gewusst: Die größte Leistung ist es, den Widerstand des Feindes ohne Kampf zu brechen. Das ist die beste Leistung des Feldherrn. Die schlechteste Idee aber ist es, große Städte zu belagern. Die Chinesen wussten das und wissen das weiterhin. Sie haben ihre Online-Giganten, die BAT, Baidu, Alibaba und Tencent, vor dem westlichen Markt geschützt und westlichen Konzernen im chinesischen Internet den Zugriff verboten, damit die kleinen Baidus, Alibabas und Tencents groß werden konnten und eben nicht gegen befestigte Städte kämpfen mussten. Denn dabei kann man als kleiner Angreifer niemals gewinnen. Doch jetzt«, er hob die Stimme, »jetzt sind die ehemals kleinen chinesischen Angreifer selbst befestigte Städte.« Er blickte in die Augen der Zuhörer und sah nichts darin. Denn diese reichen und selbstzufriedenen Menschen, die vor ihm saßen, waren auch so etwas wie eine befestigte Stadt, bei der er nicht wusste, ob sie ihn und seine Idee einlassen oder überhaupt nur zur Kenntnis nehmen würden. »Irgendwann«, fuhr Arakis fort, denn das wollte er diesen selbstzufriedenen, ultrareichen Typen mit ihren dauerzufriedenen Gesichtern einhämmern, »wird der Wohlstand massiv fallen, und Aufstände, Anarchie und Bürgerkrieg in Europa werden die Konsequenz sein.«
»Und was ist die Lösung?« Eine einzige Frage, von Vincent de Groot, einem schweren, rothaarigen Kerl im Anzug, dem Chef des Bilderberger Investment Clubs.
»Danke für die Frage«, sagte Arakis. »Die einzige Lösung gegen den Aufstieg Chinas ist … China.«
»China?«, fragte de Groot. »Feuer mit Feuer bekämpfen?«
»Exakt! China und die Datenmacht des Riesenreiches. Algorithmic Authoritarianism nennt man diese Strategie Chinas, eine durch und durch digital überwachte Gesellschaft zu schaffen. Eine Gesellschaft, die alles bisher Dagewesene in puncto Totalitarismus und Überwachung übertrifft.
Eine Gesellschaft, die eigentlich keiner wollen kann.
Eine Gesellschaft, die jedoch in einer chaotischen Welt mit bald zehn Milliarden Menschen die einzige Lösung ist.
Eine Gesellschaft, die Europa retten konnte.
Eine Gesellschaft, die ich euch liefern werde. Wenn ihr wollt.« Er kam zum letzten Satz. »Eine Gesellschaft, die euch reich machen wird, wenn ihr von Anfang an dabei seid!«
Kapitel 7
World Economic Forum, Davos, Schweiz
Si war im Nebenraum. Er sah die Menschen. Und er sah seinen Boss. Er wartete. Warten konnte er gut.
Er schaute auf sein Handy. Sah die Textnachricht von Min, seiner Mutter.
Seine Mutter liebte ihn. Sein Vater hatte ihn nicht geliebt. Und darum hatte er ihn Si genannt. Er sah das Zeichen immer vor seinen Augen, wie ein Gesetz. Es wurde 姒 geschrieben. Der Name Si war in der Xia-Dynastie üblich gewesen, wurde aber heute eher gefürchtet. Denn Si hieß auf Chinesisch nicht nur vier, sondern auch »Tod«. Sis Vater Xiang hatte seinen Sohn verflucht, weil er wegen der chinesischen Einkindpolitik viel Geld bezahlen musste, um mehr als ein Kind zu bekommen. Seine Frau hatte zunächst aber nur drei Töchter auf die Welt gebracht, und sein begehrter Sohn, den er immer haben wollte, kam erst als viertes Kind – und damit viel zu spät.
Sis Mutter lebte noch in einem der Hutongs in Peking, in der Yandaixie-Straße. Sie konnte nicht mehr gut sehen. Si besuchte sie, so oft er konnte. Dann las er ihr aus ihren Lieblingsbüchern vor.
San Guó Yânyì, Die drei Reiche. Oder Der Traum der roten Kammer. Sie hörte zu und trank grünen Tee. Sie hatte ihm als Kind die Geschichte von dem Tee erzählt, damals, als bei Si das Zahnen begann und er vor Schmerzen nachts nicht aufhören konnte zu weinen. Der Tee war entdeckt worden, als Shen Nong, der Urvater der chinesischen Kräutermedizin, unter einem Baum Wasser kochte. Dabei fielen einige Blätter in den Kessel. Nachdem Shen Nong davon getrunken hatte, war er erfrischt. Gleichzeitig war damit cha, der Tee erfunden.
Si war oft unterwegs. Sis Vater war tot, und vielleicht war Si ein wenig der Ersatz seines eigenen Vaters; der Vater, der ihn nie gewollt hatte oder ihn viel früher hätte haben wollen. Seine Mutter hatte ihm das schöne Gedicht von Li Zhiyi aus dem 11. Jahrhundert geschickt, das zeigte, dass, was immer passieren würde, sie doch immer verbunden sein würden.
Ich wohne am Kopf des Langen Flusses,
Du wohnst am Ende des Langen Flusses,
Täglich wünsche ich dich herbei, ohne dich zu sehen,
Beide trinken wir Wasser aus dem Langen Fluss.
Wo ist das China, das ich kannte?, fragte seine alte Mutter oft. Fast alle der alten Hutongs waren abgerissen worden, nur einige standen noch, vielleicht als Touristenattraktionen. Wie lange würden die in der Yandaixie noch stehen, fragte Min immer und sah ihren Sohn an. Wenn alles schiefging, würde er seine Mutter einfach mitnehmen. Doch sie würde nicht fortwollen. Sie war eine lao Beijing ren, eine alte Pekingerin. Sie würde eher sterben, als ihre Heimat zu verlassen.
Viele der alten Pekinger waren in den Untergrund gezogen. In Peking sprach man von der Rattenarmee, Millionen von Menschen, die unterirdisch lebten, in Kellern und verlassenen Bunkeranlagen, Menschen, von deren Tätigkeit niemand etwas wissen sollte, wie Prostituierte. Man sagte, sie strömten wie Ratten aus unterirdischen Löchern. Zu viel Konkurrenz war schlecht, wer im Verborgenen arbeitete, hatte weniger Wettbewerb.
Si hingegen war niemals unter der Erde. Si flog immer mit seinem Boss im Privatjet, aber Min hatte noch niemals ein Flugzeug betreten. Sie hatte Peking noch niemals verlassen. Und sie wollte nichts anderes kennen als das alte Peking mit seinen Hutongs, das alte Peking, das es fast nicht mehr gab.
Peking hat seine Seele verloren, sagte seine Mutter, in all den Straßenschluchten aus Glas und Stahl.
Si konnte nicht bestreiten, dass sie recht hatte.
Kapitel 8
World Economic Forum, Davos, Schweiz
Dairon Arakis sah den Rauch, der aus einer zurückgelassenen Zigarre Richtung Decke zog. Die Kenner drückten ihre Zigarre nicht aus. Und sie nahmen auch keine tiefen Züge oder rauchten sie bis zum letzten Zentimeter. Keine der Zigarren hier kostete weniger als fünfzig Euro.
Arakis schaute auf den leeren Raum, in dem die Rauchschwaden durch die Abzugsanlage nach draußen zogen. Auf die Sessel, die Glastische, die halb leeren Cognacgläser und die Aschenbecher, in denen halb aufgerauchte Cohibas und Montechristo-Zigarren lagen. Er kam sich vor wie ein Sänger bei einem Konzert, bei dem niemand zugehört hatte. Dabei hatte er alles gegeben. Er hatte ihnen seine Vision präsentiert. Hatte ihnen gesagt, was passieren würde, was er dagegen tun würde und wie sie alle damit Geld verdienen konnten. Viel Geld. Die Aufforderungen waren immer die gleichen: Das Gegenüber musste etwas tun, es musste etwas mit ihm, Arakis, tun und es musste es jetzt tun. Wenn nicht genau das passierte, kam der Deal nicht zustande. Die bahnbrechende Vision, um Europa wieder zukunftsfest zu machen. Und die Möglichkeit, damit richtig reich zu werden, wenn alle jetzt einsteigen würden, und nicht erst in drei Jahren, wenn das, was jetzt noch revolutionär war, allgemeines Denken wurde, Grundwissen, das die Spatzen von den Dächern pfiffen. Denn so war es doch immer: Man musste früh dabei sein, wenn man viel Geld verdienen wollte, viel früher als alle anderen. Das hatte schon Sun Tzu in Die Kunst des Krieges erkannt: Den Sieg dann zu sehen, wenn ihn alle anderen auch sehen, ist kein Verdienst großer Klugheit.
Doch es war ganz anders gekommen. Die meisten hatten gar nichts gesagt. Ein paar hatten sogar gelacht, hatten die Köpfe geschüttelt und hatten den Raum verlassen. Als würden sie ihn nicht für voll nehmen, als wäre all das eine unterhaltsame Einlage vor oder nach dem Abendessen gewesen.
Arakis kannte dieses Trauma. Darum verletzte ihn das Lachen doppelt. Das Trauma, das er überwunden glaubte, war wieder aufgebrochen. Schon einmal hatten sie ihn ausgelacht. Damals, in Stanford, waren es die US-Investoren gewesen, die Private-Equity-Manager, Venture-Capital-Leute und Business-Angels. Jetzt waren es die Bilderberger. Vielleicht waren diese ganzen selbstzufriedenen, reichen Trottel aus dem Westen einfach Menschen, mit denen er nicht gewinnen konnte, egal, was er tat, und die in seinen Vorträgen immer nur die Vorstellungen eines Clowns sahen und nichts anderes? Er hatte sich damals an China gewandt, weil er in den USA gescheitert war. Jetzt war er auch in Europa gescheitert.
Das war sein zweiter Versuch. Und sein zweites Scheitern. Ein drittes Mal würde es nicht geben. Er ballte die Fäuste und presste die Zähne zusammen.
Im Gegenteil: Jetzt war es an der Zeit, sich zu rächen. Heute hatte er den Bilderbergern eine Freakshow geboten, war deren Hofnarr gewesen. Das würde er aber nicht bleiben, bei Gott nicht. Er wusste, dass er nicht für immer dafür Zeit hatte, dass in ihm eine unbarmherzige Uhr tickte. Dennoch konnte er nicht sofort reagieren. Er kannte das Motto in Quentin Tarantinos Film Kill Bill. Ein Spruch, der auch von Sun Tzu kommen könnte. Ein Spruch, der fast asiatisch klang. Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird.
Kapitel 9
Rocket Internet, Kochstraße, Berlin, Deutschland
»Warte kurz hier«, hatte Laura gesagt, die das Vorzimmer von Philipp Wacker, dem Head of New Ventures bei Rocket Internet, bewachte. »Philipp ist gleich so weit.« Dann hatte sich Laura wieder an ihren Platz gesetzt, die Ohrstöpsel eingelegt und mit mechanischer Präzision auf ihrer ergonomischen Tastatur herumgehackt.
Tom wartete und wartete und wartete. Er hatte den Ausdruck seiner Präsentation, die er dreimal dabeihatte, bestimmt schon zehnmal durchgelesen, doch noch ein paar Fehler gefunden, sich darüber geärgert und die Präsentation dann genervt zugeklappt.
Er erinnerte sich an das Lied, das er einmal auf einer Hochzeit gehört hatte. Er wusste nicht mehr genau, welche Band das war.
Die Wüste wartet auf den Regen
und die Schiffe warten auf die Flut
die Nacht wartet auf den Morgen
warten kann ich auch ganz gut.
Tom trommelte mit den Fingern auf der Lederlehne des Sessels. Es gehörte zum guten Ton von Leuten, die wichtig waren oder sich für wichtig hielten, andere Leute lange warten zu lassen, besonders die, die etwas von ihnen wollten, aber nicht wichtig genug waren, um sofort empfangen zu werden, oder von denen sie den Eindruck hatten, dass sie etwas von ihnen wollten. Philipp von Rocket Internet war da keine Ausnahme und Tom als Leidtragender ebenso wenig. Das GSW-Hochhaus, in dem die größte Start-up-Schmiede des Kontinents residierte, die ihre Anfänge in einem kleinen Kreuzberger Hinterhof hatte, wurde erst seit Kurzem »Rocket Tower« genannt und bildete mit zweiundzwanzigtausend Quadratmetern Europas größten Start-up-Campus.
An der Wand hingen Bilder von der Geschichte von Rocket Internet. Jeder in der Start-up-Szene kannte die Anfänge der Firma in Berlin, als die Samwer-Brüder gemeinsam für eBay eine E-Commerce-Plattform für Deutschland programmieren wollten. eBay hatte abgewunken mit der Begründung, dass der deutsche Markt zu klein sei. Dann hatten die Samwers einfach einen eBay-Klon Namens Alando für Deutschland nachgebaut und diesen dann für mehrere Hundert Millionen Euro an eBay verkauft. Damit begann der Siegeszug von Rocket Internet.
Toms eigener Siegeszug ließ allerdings noch auf sich warten. Er saß auf einem der Ledersessel und blätterte durch die Zeitschriften und Bücher über disruptive Innovation, die auf den Glastischen lagen und auf einem Regal an der Stirnseite des Raumes aufgereiht waren. Die üblichen Verdächtigen wie Shapiro, Innovators Dilemma von Clayton Christensen, Business Model Canvas und Bücher über Design Thinking und Artificial Intelligence. Tom kannte die Diskussionen. Manche glaubten, dass Künstliche Intelligenz oder kurz KI bald alles bestimmen würde. Gesichtserkennung war dabei fast schon ein alter Hut. Es gab bereits Algorithmen, die entscheiden konnten, wer im Unternehmen befördert oder gefeuert werden würde. Andere Algorithmen konnten aus Bewegungsmustern von Menschen am Flughafen ablesen, wer wohl ein Terrorist war. Dann gab es die, die sagten, dass alles komplett übertrieben und KI längst nicht so stark sei, wie man immer behauptete. So gab es zwar bereits halbwegs funktionierende, intelligente Staubsauger und Rasenmäher, aber es gab noch immer keinen Roboter, der richtig putzen oder Wäsche zusammenlegen konnte. Und eine Maschine, die Wartezeit reduzierte, dachte Tom, gab es leider auch noch nicht.
Die Tür öffnete sich.
»Philipp ist so weit«, sagte Laura.
Tom fühlte sich ein wenig wie beim Zahnarzt.
Kapitel 10
Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg, Deutschland
»Da bin ich«, rief Tara, ein wenig außer Atem, und stellte ihren Kaffeebecher auf ihren Schreibtisch. »Zeig mal her!«
»Hier!« Miriam holte einen Laptop und stellte ihn auf Taras Schreibtisch. »Extrem hohe Konzentration. Radionuklid Jod-131. Das Zeug ist gefährlich.«
»Hundertachtundneunzig von zweihundert«, murmelte Tara, »also in fast allen Probanden.«
»Richtig, nur zwei nicht. Oder anders ausgedrückt: Ein Prozent ist nicht betroffen. Das kann also kein genereller Messfehler sein.«
»Aber das Ganze muss doch ein Messfehler sein! Wo soll denn das radioaktive Jod sonst herkommen?«
»Ja, das habe ich mich auch gefragt, ich habe schon einige Messwerte mit der Kontrollblutprobe von gestern abgeglichen. Die sind alle korrekt, die Chips funktionieren also einwandfrei.«
»Ist das radioaktive Jod auch im Labor gemessen worden?«, fragte Tara.
»Nein, das haben wir nicht bestimmen lassen.«
»Dann müssen wir das dringend nachholen«, sagte Tara und setzte sich auf den Schreibtisch, »hast du eine Idee, wo das radioaktive Jod herkommt?«
Miriam nickte. »Habe gerade noch mal nachgeschaut. Jod-131 ist ja sehr flüchtig und kann sich sehr schnell sehr großflächig verbreiten, so ähnlich wie eine Epidemie. Es lagert sich in Pflanzen ab, Milch, Fleisch, Fisch und in der ganzen Nahrungskette.«
»Und durch die Nahrung nehmen wir es auf, und es reichert sich dann in der Schilddrüse an.«
»Genau. Und wenn es radioaktiv ist, was dieses hier ist, dann kann es zu Autoimmunerkrankungen kommen. Oder gleich Krebs. Darum werden ja bei Reaktorkatastrophen Jodpräparate an die Bevölkerung verteilt. Die Schilddrüse ist dann vollgepumpt mit ungefährlichem Job und nimmt kein verstrahltes Jod-131 mehr auf.«
Tara sank von der Schreibtischkante auf ihren Stuhl, wobei sie beinahe den Kaffeebecher umgeworfen hätte. »Mist«, fluchte sie und faltete die Hände unter dem Kinn, während sie den Blick nicht von Miriams Laptop ließ.
»Wir haben hundertachtundneunzig Probanden mit erhöhten Werten von Jod-131. Die müssten wir eigentlich informieren.«
»Das müssten wir.«
»Das kann aber ziemlichen Trubel auslösen, und das würde ich vorher gern mit Imir klären.«
Tara nickte. »Würde ich auch so machen.« Imir war ein Oberarzt, der kein Problem damit hatte, Leute an der langen Leine zu führen und sie ihr Ding machen zu lassen; was bei ihm auch gar nicht anders ging, da er oft unterwegs war, zudem an der Uni lehrte und ständig von einer Konferenz zur nächsten flog. Er konnte aber sehr unangenehm werden, wenn irgendetwas aus dem Ruder lief und er darüber nicht rechtzeitig informiert wurde.
Tara kniff die Augen zusammen. »Zweihundert Probanden. Bei hundertachtundneunzig erhöhtes Jod-131.« Sie hob den Kopf. »Die sind doch alle in Hamburg, oder?«
»Einige der jüngeren Studenten kommen aus aller Welt, aber da jetzt gerade das Semester losgeht, müssten die alle hier sein. Die älteren Probanden sowieso, die studieren ja nicht und leben eh in Hamburg.«
»Wir müssen schauen, ob das ein Messfehler ist oder ob wir tatsächlich irgendein Strahlenproblem haben.«
»Meinst du, die Regierung verschweigt uns etwas?«
»Wäre ja nicht das erste Mal. Pass auf, Miriam, kannst du das Team mobilisieren? Wir müssen die zweihundert Probanden einbestellen und ihnen Blut abnehmen. Dann wissen wir genau, ob hier ein Messfehler vorliegt oder die wirklich alle dieses Jodproblem haben.«
»Kann unser Labor das? So viele, so schnell?«, fragte Miriam.
Tara war keineswegs sicher. »Versuchen müssen wir es.«
»Wird sportlich«, sagte Miriam, »dann kann ich natürlich nichts an dem Paper machen. Da ist nächste Woche Deadline.«
»Vergiss das Paper. Das mach ich zur Not am Wochenende fertig.«
Miriam blickte aus dem Fenster und murmelte etwas vor sich hin.
»Also, ihr schafft das?«, fragte Tara.
»Wie war das bei Dinner for One?I do my very best.«
»Ihr seid die Besten! Dann schlage ich vor, wir klemmen uns ans Telefon!«
Kapitel 11
World Economic Forum, Davos, Schweiz
Arakis wusste, was er war. Ein Outcast. Jemand, der nicht dazugehörte. Er sah die Berge in der Entfernung, blau-weiß im Mondlicht. Groß, unerreichbar, fast so unerreichbar wie der Mond, der über ihnen leuchtete. Er kam sich vor wie Gandalf in Der Herr der Ringe, der gemeinsam mit Pippin auf die Berge von Mordor blickte. Oder kam er sich eher vor wie Pippin und vermisste Gandalf?
Er hatte den Kreis wie ein geprügelter Hund verlassen. Es war wie damals, als er in Stanford abgewiesen worden war.
Er sah die Berge vor sich, wie Festungsmauern. Die Berge waren oben, und er war unten.
Ein riesiger Schatten kam auf Arakis zu und sprach ein paar Worte auf Chinesisch. Es war sein Leibwächter Si. Si war auch ein verstoßenes Kind. Genauso wie Arakis. Si schaute ihn an. Arakis gab ihm kurz zu verstehen, dass es nichts gab, was er tun konnte. Si neigte den Kopf und verließ ihn wieder. Aber er würde wiederkommen. Er würde nicht über ihn sprechen, nicht über ihn lachen. Sondern notfalls nur die Berge mit ihm anschauen. So wie Gandalf es tat. Er würde immer da sein, niemals weggehen und niemals lachen.
Arakis stand noch lange in dem Raum und trank allein einen Whiskey. Dabei schaute er auf die Schweizer Berge. Die Schweiz ist so gut, weil sie nur Leute, Berge und Schnee hat, hatte mal ein Regierungsvertreter aus Singapur gesagt. Da musste man kreativ sein und Höchstleistungen bieten. Singapur hatte nicht einmal Berge und Schnee, dafür aber einen riesigen Hafen und eine exzellente geostrategische Position. Er schaute auf die Schweizer Berge. Aus den Bergen kamen in Der Herr der Ringe die Armeen Mordors. Auch aus diesen Bergen würde etwas kommen. Die Berge, das wusste er, würden ihm helfen, auch diese selbstgefälligen, arroganten Schnösel einzufangen und zu überzeugen. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Aber sie würde kommen. Sie würde kommen, hart und gefährlich.
Im wahrsten Sinne des Wortes wie ein … Erdbeben.
Kapitel 12
Rocket Internet, Kochstraße, Berlin, Deutschland
»Du hast schon mal einen guten Exit gemacht?«, fragte Philipp, als sich beide begrüßt hatten. »Habe ich bei LinkedIn gesehen.«
Der Exit war nicht gut genug, dachte Tom, sonst würde ich nicht hier sitzen. Exit. Sagt man so schön, wenn jemand ein Unternehmen vorteilhaft verkauft hat.
»Ja«, sagte er stattdessen. »Ich war an einem Blockchain und Kryptowährungsprojekt in London beteiligt, das dann unvorhergesehen durch die Decke ging. Der chinesische Staat ist in das Projekt eingestiegen, um die Technik zu nutzen und die Währung und den Zentralbankmechanismus der chinesischen Zentralbank nach und nach auf Kryptowährungen umzustellen. Ganz besonders deswegen, um in Zukunft noch weniger vom Dollar abhängig zu sein.«
»Cool.« Philipp schien tatsächlich beeindruckt zu sein. »Kam dadurch auch der Kontakt zu China zustande?«
»Genauso war es.« Er schob Philipp die Präsentation über den Tisch und lieferte einen sechzigsekündigen Elevator Pitch ab.
»Ein Medical Start-up«, sagte Philipp dann und blinzelte Richtung Fenster, wo die Sonne durch die Jalousien knallte. In einiger Entfernung sah man den Bahn-Tower und die mittelgroßen Wolkenkratzer vom Potsdamer Platz. Der Head of New Ventures blätterte durch den Prospekt. »Invasiv, selbstlernend, online, mit Implantaten.« Er blickte auf. »Wie lernt das Ding? Über Regression, Algorithmen?«
»Unter anderem«, sagte Tom. »Aber das ist ja kalter Kaffee. Wir sind schon einen Schritt weiter.«
»Machine Learning ist kalter Kaffee?«
»Na ja«, Tom versuchte, ein wenig auf die Pauke zu hauen, und hoffte, dass der Schuss nicht nach hinten losging, »schließlich ist der Computer schon 1942 erfunden worden, in Deutschland wohlgemerkt, und die meisten Begriffe zur Künstlichen Intelligenz wie Machine Learning und Predictive Analysis sind doch bereits auf der berühmten Dartmouth-Konferenz im Jahr 1956 definiert worden.« Er holte kurz Luft. »Aber das können unsere Techies noch viel besser erklären. Die stehen natürlich auch gern für ein Gespräch zur Verfügung.«
Philipp nickte. »Eigentlich spannend.«
»Das freut mich«, sagte Tom. Fragte sich aber, was das eigentlich heißen sollte. Auch wenn Tom das schon häufiger bei Pitches gehört hatte.
»Ihr zieht das in China hoch?«, fragte Philipp.
Tom nickte. »Shenzhen.«
Philipp nickte mit Kennermiene. »Krass, was da abgeht. Alles mit Hochgeschwindigkeit, während die Deutschen im Schneckentempo hinterherhinken.« Er sprach Richtung Fenster, dann blickte er Tom an. »Merkel war da vor Kurzem in Shenzhen vor einem Gerät, das Rückenprobleme mit Big Data heilt. Der Entwickler wollte, dass sie sich vor dem Gerät bückt, damit das Ding ihren Rücken vermessen kann.«
»Hat sie das gemacht?«
»Natürlich nicht. Wie sieht das aus? Die Kanzlerin verbeugt sich vor einem chinesischen Hightechprodukt. Dafür hat die Merkel ein Gespür. Dass so etwas bloß nicht falsch ankommt. Auch wenn ihr sonst ja nicht mehr viel gelingt. Auch als Macron Xi Jinping in Paris empfangen hat. Zusammen mit Merkel und Juncker. So als wollte man unbedingt Einigkeit demonstrieren, weil es eigentlich keine Einigkeit gibt. So einer wie Xi merkt das sofort.«
»Egal, ob sich Merkel verbeugt.«