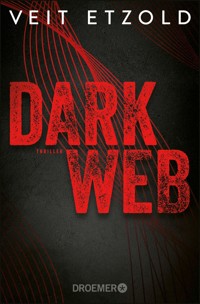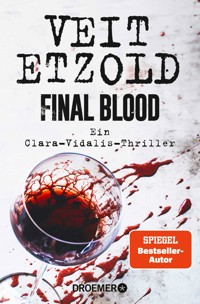Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Clara Vidalis Reihe
- Sprache: Deutsch
Clara Vidalis, Expertin für Pathopsychologie am LKA Berlin, hat gerade die Folgen ihrer Hetzjagd auf den Serienkiller "Der Namenlose" verkraftet, als die Hauptstadt von einer neuen, noch perfideren Mordserie erschüttert wird. Ein Mann, der sich "Der Drache" nennt, ist von einer grausamen Mission erfüllt: Er tötet Menschen, die nur nach außen hin eine vorbildliche gesellschaftliche Funktion ausüben. Und mit seinem satanistischen Hintergrund, seiner absoluten Besessenheit weist er Clara den Weg nach Rom: zum Chef-Exorzisten des Vatikans...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 42 min
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Zitate
Prolog
Erstes Buch - Der Engel und das Schwert
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Zweites Buch - Die Frau und der Drache
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Drittes Buch - Das ewige Feuer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Epilog
Danksagungen
Fußnote
Veit Etzold
SEELEN-ANGST
Thriller
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2013 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Wolfgang Neuhaus
Titelillustration: © shutterstock/Marilyn Volan
Umschlaggestaltung: Manuela Städele
Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-2592-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Die größte Gnade auf dieser Welt ist, so scheint mir, das Nichtvermögen des menschlichen Geistes, all ihre inneren Geschehnisse miteinander in Verbindung zu bringen. Wir leben auf einem friedlichen Eiland des Unwissens inmitten schwarzer Meere der Unendlichkeit, und es ist uns nicht bestimmt, diese weit zu bereisen. Die Wissenschaften – deren jede in ihre eigene Richtung zielt – haben uns bis jetzt wenig gekümmert; aber eines Tages wird das Zusammenfügen der einzelnen Erkenntnisse so erschreckende Aspekte der Wirklichkeit eröffnen, dass wir durch diese Enthüllung entweder dem Wahnsinn verfallen oder aus dem tödlichen Licht in den Frieden und die Sicherheit eines neuen Mittelalters flüchten werden.
H. P. Lovecraft, Cthulhus Ruf
Auslöschung kennt die Natur nicht. Sie kennt nur die Verwandlung. Alles, was die Wissenschaft mich gelehrt hat und weiterhin lehrt, stärkt meinen Glauben an die Fortsetzung unserer spirituellen Existenz nach dem Tode.
Wernher von Braun
Prolog
SATAN, MACHMICHSEHEND
Er sah seine Augen in dem Spiegel, seine Augen und sein Gesicht, das ihm im kalten Licht der Neonröhre wie ein Totenschädel entgegenstarrte. Grau, eingefallen, fast schon tot. In diesem Gesicht fehlte etwas. Der Wille. Ja, der Wille, es zu versuchen, und sei es um den Preis des eigenen Lebens. Und dadurch stärker zu werden als jemals zuvor.
Er senkte den Blick und sah das Skalpell, betrachtete es wieder, wie schon die letzte halbe Stunde. Auch auf der Klinge spiegelte sich sein Gesicht, verzerrt und verschwommen, als wäre er bereits Teil der Geisterwelt, die er beschwören wollte.
Das Triumvirat, dachte er. Die, die zu ihm sprachen. Satan, Luzifer und Asmodeus. Er sah das grelle Licht der Deckenlampe. Durch das hohe Kellerfenster konnte er den pechschwarzen Nachthimmel und die Sichel des Mondes sehen, die wie ein silberner, gekrümmter Dolch aussah.
Du musst es tun, hörte er die Stimme in seinem Kopf.
Da war etwas, das in ihm sprach, ohne er selbst zu sein, tiefer und schwärzer als ein bodenloser Abgrund. Etwas, das dort aus den Äonen der Zeit und der Unendlichkeit des Alls hervorbrach.
Älter als das Leben und dunkler als der Tod.
Er wusste nicht, woher diese Stimme kam. Er wusste nur, dass tief in ihm etwas auf ihn wartete. Und dieses Etwas würde ihn erst loslassen, wenn er getan hatte, was er tun musste.
Satan, mach mich sehend.
Es würde wehtun, furchtbar wehtun. Doch es gab keine andere Möglichkeit für ihn, wirklich sehend zu werden.
Er hob das Skalpell, schaute in den Spiegel und drückte nach kurzem Zögern die Klinge am linken, inneren Augenwinkel in die Augenhöhle. Er verstärkte den Druck, und das erste Blut begann zu fließen. Er nahm den kupfernen Geruch wahr und fühlte das warme Rinnsal, das seine Wange hinunterlief.
Der Schmerz war unvorstellbar, doch er machte weiter, obwohl seine Hände immer stärker zitterten, während er mit der Klinge einen Kreis vollführte, durch Haut und Sehnen, Muskeln und Nervenbahnen schnitt, um das Unmögliche zu vollbringen, das Unaussprechliche, Grauenhafte.
Satan, mach mich sehend.
Er schnitt noch einmal, während das Blut an seinem Nasenflügel hinunterlief und über seinen Hals auf die Tischplatte tropfte. Dann zog er das blutige Skalpell heraus, um es noch einmal anzusetzen, noch einmal den Druck zu verstärken. Wieder spürte er das Knirschen und Schnappen, als Muskeln durchtrennt wurden und das Skalpell den Knochen berührte, während er in einem Delirium aus Schmerz, Schock und Blut starb und wiedergeboren wurde und die Stimme in seinem Kopf ihn weiterhin antrieb, das Verbotene zu tun.
Die Stimme, die aus den Tiefen des Nichts zu ihm sprach.
Älter als das Leben und dunkler als der Tod.
Schließlich hob er die rechte Hand und zog etwas aus der Augenhöhle. Die feinen Äderchen, Muskeln und Nervenstränge verliehen diesem Etwas das Aussehen einer bizarren Blume. Langsam legte er es vor sich auf den Tisch. Warmes, frisches Blut zeichnete groteske Muster auf das schmutzige Metall, während vor seinem inneren Auge gespenstische Horden erschlagener Seelen vorüberzogen, deren Gesang sich in höllischem Crescendo in sein Hirn brannte und seiner Seele das Siegel der Hölle aufdrückte.
LEBEN, TÖTEN, SEHEN.
DU WIRST SEHEN, hatte die Stimme ihm gesagt. MEHR ALS ZUVOR.
Irgendwann war es vollbracht, und er legte das blutige Skalpell beiseite, neben den von Blutspritzern bedeckten Spiegel auf die Tischplatte, die jetzt ebenfalls blutrot gefärbt war. Das Zittern seiner Hände hatte aufgehört. Etwas Unfassbares, nie Erlebtes durchströmte ihn.
Er hatte sämtliche Drogen ausprobiert, hatte Tiere geopfert und ihr Blut getrunken, hatte Menschen gequält, geschändet und getötet, doch die größte Ekstase hatte sein Meister ihm für diesen Augenblick vorbehalten, der ihm zeigte, dass es sich lohnte, ihm zu gehorchen und zu vertrauen. Der ihm zeigte, dass er einer der Auserwählten war.
Das Leben war grausam, doch was danach kam, konnte noch grausamer werden. Er aber würde in dieser Nachwelt, dieser Hölle, über jene herrschen, die er erschlagen hatte. Er würde mehr sein, als er auf Erden jemals gewesen war. Er würde sie finden. Er würde ihr dunkles Geheimnis entschlüsseln. Und er würde sie töten.
Aber er würde noch mehr tun. Er würde sie versklaven. Für alle Ewigkeit.
In der Hölle gab es keine Gesetze. Der Stärkere würde die Schwachen beherrschen. Und der Stärkere würde er sein. Wenn er alles getan hatte, was sein Meister wollte.
Sein Meister hatte nicht zu viel versprochen.
Denn als er auf die blutrote Tischplatte blickte, geschah etwas, was gar nicht möglich war.
Er sah.
Neben dem Skalpell, in einer Pfütze aus Blut und durchtrennten zarten Muskelfasern, sah er im kalten Licht der Neonlampe seine herausgeschnittenen Augen.
Erstes BuchDER ENGELUNDDAS SCHWERT
Wenn Gott zu uns spricht,dann werden wir sterben.
Exodus, 20, 19
1
Clara Vidalis, Hauptkommissarin und Expertin für Forensik und Pathopsychologie am LKA Berlin, schaute aus dem Fenster und blickte auf die Stadt, die in der vom Regen durchweichten Erde lag wie eine aufgedunsene Leiche in einem von Würmern zerfressenen Grab. Es war ein trostloser Februarnachmittag, und der Himmel über dem LKA Berlin sah aus wie das graue Flimmern auf dem Bildschirm eines Fernsehers, der auf einem falschen Kanal lief. Was die junge Frau jedoch nicht davon abhielt, weiterhin aus dem Fenster zu schauen.
Ad plures ire, ging es ihr durch den Kopf. Zu den vielen gehen.
Die alten Römer hatten diese Wendung benutzt. Die vielen, das waren die Toten. Wer zu den vielen ging, der war gestorben. In der gesamten Menschheitsgeschichte war die Anzahl der Toten stets größer gewesen als die der Lebenden. Es gab Berechnungen, wie viele Tote es seit der Entstehung der Menschheit gegeben hatte, und es gab Wissenschaftler, die behaupteten, mit sieben Milliarden Menschen sei bald jener Punkt erreicht, an dem die Anzahl der Lebenden größer sei als die sämtlicher Toten. Blieb allerdings die Frage offen, ob das ein Grund zur Freude war.
Claras Gesicht war hübsch, mit einem südländischen Einschlag, was vermutlich daran lag, dass spanisches und italienisches Blut durch ihre Adern strömte. Nur wenn sie die Lippen zusammenpresste, zeigte sich auf ihrem Gesicht eine Spur jener Härte und Unnachgiebigkeit, die der Beruf ihr abverlangte. Ihr Haar war schwarz, und ihre blauen Augen zeigten jenen eigentümlichen Ausdruck, wie Menschen ihn besitzen, deren Sichtfeld nicht begrenzt ist und die es gewohnt sind, bis zum Horizont zu schauen – und dahinter. Wie Seeleute oder Flugkapitäne.
Doch es war nicht der Blick in den Himmel und über das Meer, der Claras Augen verändert hatte, sondern der Blick in die Abgründe der menschlichen Seele und deren dunkle Seite.
In dem Film The Ring lauert das Böse im Fernseher, ging es ihr durch den Kopf, während sie in den wolkenverhangenen Himmel blickte, und alle, die zu lange hineinschauen, werden wahnsinnig.
Schließlich riss sie sich los und senkte den Blick. Wenn ich hier noch lange Löcher in die Luft starre, verliere auch ich den Verstand.
Sie klappte die Mappe, die sie vorher auf der Fensterbank durchgeblättert hatte, zusammen und steckte das Handy, das daneben lag, in die Hosentasche. Ihre Bewegungen waren geschmeidig, kraftvoll und präzise und ließen erkennen, dass sie Yoga und Kampfsport praktizierte.
Clara hatte eine Pause gebraucht. Sie waren gerade mit einem Verhör fertig geworden. Endlich hatten sie das Geständnis. Zwei Vergewaltiger. Claras Kollege Hermann und zwei Polizisten waren noch unten im Keller, um die Formulare für die Staatsanwaltschaft und das Gericht fertig zu machen.
Vieles hatte gegen die beiden Schuldigen gesprochen, doch sie hatten mit einer Beharrlichkeit geleugnet, die an Frechheit grenzte. Sie hatten zwei Frauen vergewaltigt, eine davon getötet und die Leiche auf einem Waldweg liegen lassen. Der Kopf der Toten war mit einem Pflasterstein zerschmettert worden, Arme und Beine ausgebreitet, das weiße, von Schmutz und Blut befleckte Kleid wie eine Mischung aus Hochzeitskleid und Leichenhemd.
Sollte es ein Engel sein, den die Täter mit der Leiche nachgestellt hatten? Der Verdacht an einen religiös motivierten Mord hatte sich aufgedrängt, doch es war ein physikalisches Phänomen gewesen, das man mit einer Schaufensterpuppe nachstellen konnte: Greift man einem leblosen Menschen von hinten unter die Arme, zieht ihn ein Stück weit und lässt ihn dann fallen, bleibt er meist mit ausgebreiteten Armen liegen.
Und dass die Frau ein weißes Kleid getragen hatte, war Zufall gewesen – genauso wie die Tatsache, dass sie und ihre Freundin auf dem Weg zu ihrem Lieblingsclub an einer Tankstelle mit den falschen Leuten ins Gespräch gekommen waren.
Kein Engel, ging es Clara durch den Kopf. Für sie hatte es nur einen Engel gegeben. Und der war jetzt im Himmel, falls es einen gab.
Clara war achtzehn gewesen, als sie ihre damals zehnjährige Schwester Claudia zum letzten Mal gesehen hatte. Vor mehr als zwanzig Jahren war Claudia von einem geistesgestörten Kinderschänder entführt worden, der eine Vorliebe für Lötkolben, Kneifzangen und das Schreien junger Mädchen hatte.
Kein Vater sollte seine Tochter begraben müssen, sagte man. Und keine ältere Schwester ihre jüngere, fügte Clara in Gedanken hinzu. Aber genau das war geschehen. An diesem Tag hatte Clara sich geschworen, es besser zu machen als die Versager damals, die Polizeibeamten, die Claudia nicht hatten retten können. Sie hatten nicht einmal das Scheusal gefasst, das Claudia getötet hatte.
Damals hatte Clara beschlossen, Polizistin zu werden und anderen zu helfen, wenn sie schon sich selbst nicht helfen konnte. Zielstrebig hatte sie ihren Weg gemacht, bis ins LKA, um Bestien zu jagen wie den Mörder ihrer Schwester. Und nachts noch etwas Zeit zum Schlafen zu haben.
Und in dieser Zeit auch schlafen zu können.
2
Es war schon fast dunkel an diesem Freitagnachmittag in Berlin, und die letzten Strahlen der Wintersonne fielen schräg durch die drei Meter hohen Fenster in das rundum verglaste Büro. Franco Gayo sammelte seine Unterlagen zusammen, um sie in seinem Aktenkoffer verschwinden zu lassen. Dann ging er zum Fenster, blickte auf die Friedrichstraße, die Hochhäuser des Potsdamer Platzes in einiger Entfernung und auf die beiden Fernsehtürme, den im Westen am ICC-Kongresszentrum und den im Osten am Alexanderplatz, die das Panorama wie zwei Bühnenpfosten umrahmten.
Er ging zurück zum Schreibtisch. Die Ledersohlen seiner rahmengenähten Budapester pochten leise auf dem makellos sauberen Parkettboden. Sein Anzug war teuer und roch nach Macht, für den Preis seiner Uhr kauften andere sich Autos, und in seinem Adressbuch stand so ziemlich jeder, der Geld und Einfluss besaß – vorzugsweise beides.
Er würde gleich noch ein rasches Telefonat erledigen müssen, und dann ging es ins Wochenende. Er brauchte diese Atempause. Am nächsten Freitagabend stand der Auftritt in einer Spendengala auf dem Programm. Am Samstagabend war er bei der größten Show im deutschen Fernsehen zu Gast. Am Sonntag dann die Eröffnung eines Benefizkonzerts der Berliner Philharmoniker.
Da seine Sekretärin heute überraschend krank geworden war, suchte Gayo selbst in seinem Outlook nach der Nummer, während allmählich die Dunkelheit dieses Februartages in die Winkel und Ecken des riesigen Büros nahe dem Quartier 101 kroch.
Franco Gayo mochte große, luftige Räume. Damals, als Partner bei der internationalen Anwaltskanzlei Archer & Sullivan, war es nicht anders gewesen. Jetzt, mit seiner Stiftung, mit der er den Ärmsten der Armen helfen wollte, musste es ebenso sein. Viel Einsatz, viel Hilfe, viel Geld. Bigger is better. Gayo selbst hatte nur ein einziges Mal in einem kleinen Verschlag gewohnt, in der Studentenunterkunft an der Harvard Law School.
Er arbeitete nicht mehr als Anwalt, aber was er in Harvard und besonders in der Kanzlei gelernt hatte, half ihm jetzt genauso, vielleicht noch mehr. Do ut des hieß sein gemeinnütziger Verein. Ich gebe, damit du gibst.
Haiti war das neue Betätigungsfeld der Organisation. Offenbar bereitete es dem Schicksal eine perverse Freude, immer jene Menschen am härtesten zu treffen, die ohnehin nichts besaßen. Das Erdbeben der Stärke sieben, von dem Haiti am 12. Januar 2010 um 21.53 Uhr Ortszeit heimgesucht worden war, hatte die Insel in eine Hölle aus Tod und Zerstörung, Krankheit und Hunger verwandelt. Eine volle Minute lang hatten die karibische und die nordamerikanische Platte sich gegeneinander geschoben, wobei das Epizentrum nur 25 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Port-au-Prince lag.
Das Beben hatte gezeigt, dass Gott nicht nur das Messer in die Wunde bohrt, sondern manchmal auch die Klinge abbricht. Es war das stärkste Beben in Nordamerika gewesen und bis zu diesem Tag das weltweit stärkste Beben im 21. Jahrhundert überhaupt, schlimmer noch als das Seebeben in Thailand im Dezember 2004, das den Tsunami ausgelöst hatte. Fast eine halbe Million Todesopfer, zwei Millionen Obdachlose, Terror, Anarchie und Plünderungen waren auf Haiti die Folgen gewesen. Der Schaden von etwa acht Milliarden Dollar hatte auch das letzte bisschen Infrastruktur vernichtet, das noch vorhanden gewesen war.
Präsident René Préval hatte vor seinem zerstörten Palast gestanden und in die Mikrofone der Reporter gesprochen, die sich in das Chaos gewagt hatten. Und die internationale Gemeinschaft reagierte. Die UNO hatte ihre Präsenz um 3500 Mann aufgestockt. US-Präsident Obama hatte die Aktion »Unified Response« ausgerufen und die Altpräsidenten Bush und Clinton aufgefordert, ihre Netzwerke zu nutzen, um private Mittel einzuwerben. Auch aus Deutschland kamen mehr als 50 Millionen Euro.
Private Mittel. Darum ging es Do ut des. Und das sagte Franco Gayo auch. In jeder Talkshow, bei jedem öffentlichen Auftritt. Aber da war noch mehr. Die Kinder in Haiti brauchten eine Zukunft. Die Frage war, ob sie diese Zukunft in der zerstörten Heimat finden konnten. In den nächsten Jahren ganz bestimmt nicht. Haiti benötigte die Kinder für den Wiederaufbau, doch die Insel brauchte auch Führungspersönlichkeiten, Menschen mit »Leadership Skills«, die sie im Westen an Eliteuniversitäten erlernen sollten, um dann nach Haiti zurückzukehren und das Land nach vorne zu bringen. Eher langfristig zwar, aber nur so konnte es gehen.
Das war Franco Gayos Idee, die er propagierte und für die er überall um Spenden warb. Bisher sehr erfolgreich: Er beschäftigte ein Heer von Spendensammlern, die auf Provisionsbasis in den Fußgängerzonen der deutschen Großstädte arbeiteten. Und mit seinen Shows und seiner Medienpräsenz ging er gleichzeitig an die richtig dicken Portemonnaies. Besser und profitabler als Brangelina mit ihrem Tross adoptierter Kinder, die niemand gefragt hatte, ob sie überhaupt adoptiert werden wollen, oder Bono Vox und Bob Geldof mit ihrer beinahe aberwitzigen Afrikashow.
»Die Hilfe muss von innen kommen«, verkündete Gayo in allen Talkshows und auf sämtlichen Galas. »Aber dafür muss sie zuerst von außen kommen.« Das sagte er auch in dem Imagevideo, das eine internationale Werbeagentur, pro bono, kostenlos gedreht hatte. Es zeigte Gayo mit verschiedenen Kindern, mal in einem heruntergekommenen Slum in Haiti, mal vor der Fassade des Trinity College in Oxford, mal vor dem UN-Gebäude in New York.
»Diese Kinder träumen von einer besseren Zukunft«, verkündete er auf dem Video. »Sie wollen ein neues Haiti, doch zurzeit haben sie nicht mal einen Platz zum Schlafen.«
Träumen und Schlafen. Dieser Zweiklang war zugleich das Motto des Vereins, das nicht nur ein Motto war, sondern auch eine Drohung: Wenn ihr uns nicht träumen lasst, lassen wir euch nicht schlafen.
Franco Gayo wählte die Nummer und wartete auf das Freizeichen.
3
Das Böse, dachte Clara Vidalis, kommt immer wieder.
Für Clara kam es fast jeden Tag. Auf ihrer Netzhaut war noch das Bild eines der beiden Vergewaltiger eingebrannt, der ihr vorhin gegenübergesessen hatte, grinsend und feixend, eine umgedrehte Schirmmütze auf dem Kopf. Genau wie sein Mittäter hatte der Mann bei der Vergewaltigung unter dem Einfluss von Psychopharmaka gestanden.
Vergewaltigung und Drogen konnten für die Schuldigen ein zweischneidiges Schwert sein. Einerseits konnten Drogen die Zurechnungsfähigkeit reduzieren. Doch wenn es sich um aufputschende Mittel wie LSD oder Amphetamine wie Kokain handelte, wurden sie meist eingenommen, um noch einen größeren Kick zu haben, um noch öfter zu können.
Clara und Hermann hatten diesen Fall auf den Tisch bekommen, nachdem sie gerade den »Inkubus« gefasst hatten, einen hochgradig geistesgestörten Täter, der sich in seiner Anfangszeit darauf beschränkt hatte, als Stalker Frauen zu verfolgen und vor ihren Wohnungen die Mülleimer zu durchwühlen. Aus den Mülleimern hatte er die benutzten Tampons entwendet und sich daraus eine Art Tee gekocht, von dem er behauptet hatte, dass die Frauen ihm ganz von selbst zu Willen seien, nachdem er davon getrunken hatte.
Inkubus. Ein passender Name, den sich Dr. Martin Friedrich, Chef der Abteilung für operative Fallanalyse, ausgedacht hatte. Ein Inkubus war ein Geist, der besonders schöne Frauen im Schlaf aufsucht, ihre Träume stört und sexuelle Handlungen an ihnen vornimmt. Und das hatte Manfred Heyer, der »Berliner Inkubus«, dann schließlich auch getan. Denn als er feststellen musste, dass sein Tampon-Tee nicht die erwünschte Wirkung bei den Damen seines Herzens entfaltete, hatte er sich wieder »auf die gute alte Vergewaltigung« beschränkt, wie er es Hermann im Verhör beinahe freundschaftlich anvertraut hatte.
Und heute hatten wieder zwei Vergewaltiger gestanden. Der Prozess würde stattfinden – drei bis vier Verhandlungstage –, und das Urteil wurde verkündet. Wieder würden zwei Täter ins Gefängnis gehen, ihre Strafe absitzen, irgendwann wieder freikommen und vielleicht genauso weitermachen wie zuvor. Oder schlimmer.
Ad plures ire. Zu den vielen gehen. Zu den Toten.
Clara blickte zum Himmel. Würde die riesige Welt der Toten dadurch kleiner werden? Sie sah all die Schatten vor sich, denen es nicht erlaubt gewesen war, weiterzuexistieren. Was wäre aus all den Männern und Frauen geworden, hätten sie weitergelebt? Und was wäre vor allem aus den Kindern geworden? Kinder, die in einem kleinen Sarg bestattet wurden und vom Antlitz der Welt gefegt worden waren, als hätten sie nie existiert? Die nur in den Erinnerungen weiterlebten und immer mehr verblassten, je stärker die Zeit die Wunden zudeckte, aber niemals ganz heilte? Was hätten all diese Menschen werden können? Was hätten sie bewirken oder erfinden können? Sie sah all die Namen vor sich in einer nahen Zukunft – Ärzte, Erfinder, Unternehmer. Es waren Namen, die kurz aufblitzten, um dann von einer nuklearen Druckwelle hinweggefegt zu werden, die zu Eis erstarrten und sich dann in Staub auflösten. Namen, die etwas hätten werden können, die aber nichts werden durften. Namen, deren Träger jetzt einen Meter achtzig unter der Erde lagen oder sich in einem Krematorium zu grauer Asche verwandelt hatten, während ihre Mörder im Gefängnis die Zeit absaßen, freikamen und weitermachten.
»Mein Sohn ist für alle Zeiten tot«, hatte eine Mutter einmal zu Clara gesagt, »aber andere Kinder leben noch.« Die Frage war, wie lange.
Half es, wenn sie einen oder zwei der Mörder einbuchtete? Half es den Angehörigen oder den Eltern, die vor Verzweiflung fast wahnsinnig wurden? Oder den Toten selbst? Würden die Ermordeten und Erschlagenen, die in ihren Träumen auftauchten und ihr mit bleichen Gesichtern und blutumrandeten Augen entgegentaumelten, dadurch ihren Frieden finden? Oder sie?
*
Der Inkubus und die beiden Vergewaltiger waren beinahe harmlos im Vergleich zu den Fällen, die Clara und ihre Abteilung im LKA in den Wochen zuvor in Atem gehalten hatten.
Denn bei den letzten beiden wirklich harten Fällen, mit denen Clara sich befassen musste, hatte es keine Verhöre gegeben. Einen Täter hatte sie erschossen, der andere hatte sich selbst in die Luft gesprengt. Und Clara und ihre Kollegen waren dem Tod gerade noch von der Schippe gesprungen.
Es war im Oktober des Vorjahres gewesen. Sie hatten Bernhard Trebcken gejagt, den »Werwolf«, einen grausamen Vergewaltiger, der die Frauen nicht nur missbrauchte, nicht nur tötete, sondern die Leichen vor und nach der Vergewaltigung in psychotischer Raserei zerhackte. Clara und die Beamten des MEK hatten Trebcken in der Wohnung seiner letzten beiden Opfer erwischt, einem lesbischen Paar. Dass zwei Frauen sich miteinander vergnügten, während er selbst leer ausging, hatte Trebcken auf schreckliche Weise ausrasten lassen. Er hatte eine der Frauen vor den Augen der anderen vergewaltigt, getötet und dann mit einer Axt zerhackt.
Clara hatte dem abgrundtief Bösen ins Auge geschaut, als Trebcken die Überlebende als Geisel an sich gedrückt hatte, mit einer Geflügelsäge am Hals. Clara hatte die Heckler & Koch auf Trebckens Stirn gerichtet. Sie hatte die Waffe einem der MEK-Beamten abgenommen, nachdem Trebcken ihm die Nase gebrochen und ihm beinahe den Kehlkopf zerschmettert hatte.
Was passiert, wenn ich nicht schieße?, hatte Clara sich gefragt. Lässt er die Frau dann frei?
Unwahrscheinlich. Er würde ihr über kurz oder lang die Halsschlagader durchsägen und dann, als selbsternannter Märtyrer, im Kugelhagel der Polizei sterben. Also hatte Clara abgedrückt. Weil sie wusste, dass es manchmal nur die Wahl zwischen schlechten und sehr schlechten Entscheidungen gab. Weil sie wusste, dass es manchmal besser war, das Falsche zu tun als gar nichts. Und weil sie wusste, dass Hochgeschwindigkeitsprojektile schneller sind als Nervenimpulse.
In dem Sekundenbruchteil, als der Werwolf seiner Geisel den Hals durchsägen wollte, hatte die Kugel seinen Kopf in eine blutige Ruine verwandelt, deren eine Hälfte noch auf dem Rumpf steckte, während die andere sich über fünf Quadratmeter weißer Wand und einem Kunstdruck von Jackson Pollock verteilt hatte.
Die Augen des Bösen. Clara hatte sie wieder einmal gesehen. Und sie hatte Bernhard Trebcken, als sie abdrückte, ein Einmalticket direkt in die Hölle verschafft.
Der zweite Fall, der das LKA nur anderthalb Wochen später in Alarmbereitschaft versetzt hatte, war weit schwieriger gewesen. Denn der Killer, der sich »Der Namenlose« nannte, war keine wild gewordene Kettensäge wie Bernhard Trebcken, sondern ein eiskalt gesteuertes Projektil, das leise und gezielt direkt ins Nervensystem traf. Der Namenlose, der in den Medien bald auch »Facebook-Ripper« genannt wurde, hatte eine Vorliebe für schöne junge Mädchen, die er mit falscher Identität über Social-Network-Plattformen und Dating-Webseiten kontaktierte, ihre Adresse herausfand, sie aufsuchte und umbrachte.
Clara und den Facebook-Ripper hatte ein dunkles Geheimnis geeint. Und es war dieses Geheimnis gewesen, das der Killer genüsslich und sadistisch vor Clara enthüllt hatte, ehe er gestorben war.
Clara war froh und dankbar, dass es manchmal Phasen der Ruhe gab. Und Kollegen, auf die man sich verlassen konnte. Die einen nicht hängen ließen. Die einem im Haifischbecken der Bürokratie den Rücken freihielten.
Sie hörte schwere, vertraute Schritte, die näher kamen. Es war einer der Kollegen, ohne die Clara nicht wäre, wo sie nun war. Und vor allem, nicht dort geblieben wäre.
Die große Gestalt, die langen Schritte, das dumpfe Pochen der Hacken, die Adlernase zwischen den stahlblauen Augen und die große Hand, die soeben die Krawatte lockerte, gehörten Kriminaldirektor Walter Winterfeld, Claras direktem Vorgesetzten und Chef der Mordkommission des LKA. Clara war Winterfeld damals aufgefallen, als sie sich auf Forensik und Pathopsychologie spezialisierte, und er hatte sie unter seine Fittiche genommen. »Die schlimmsten Verbrecher laufen hier drinnen herum«, hatte er gesagt und damit nicht das LKA gemeint, sondern vor allem die Justiz und ihren Beamtenapparat. »Also sehen Sie zu, dass Sie gleich an den Richtigen geraten, dann haben wir beide mehr davon.«
»Und Sie sind der Richtige?«, hatte Clara in naiver Direktheit gefragt.
»Nein. Aber auch nicht der Falsche. Und das ist hier mehr als genug.«
Bei Winterfeld war das kein leeres Gerede. Er lebte für seinen Job. War nach zwei Ehen geschieden. Nach einer schweren privaten Krise hatte er mehrere üble Gewaltverbrecher und Mörder hinter Gitter gebracht. Gleich nach deren Verhaftung hatte er – damals noch in Hamburg – seine Theorie von der »Präventiven Physiognomie des Verbrechens« aufgestellt, die besagte, dass man allein am Gesicht einer Person erkennen könne, ob sie ein Verbrecher sei oder nicht.
Die Presse war sofort über ihn hergefallen. Eine Hamburger Lokalzeitung zeigte eine Fotomontage mit dem Gesicht Winterfelds und der Uniform Heinrich Himmlers.
Doch seine Aufklärungsquote sprach für ihn. Und das Buch, das er dann schrieb, wurde ein Bestseller. Er hielt Vorträge bei Scotland Yard, in Quantico, Virginia, bei Interpol und an sämtlichen Landeskriminalämtern Deutschlands. »Sichten und vernichten« lautete sein Wahlspruch. Wenn Winterfeld hinter einem Mörder her war, blieb der meist nicht mehr lange in Freiheit.
Dann kam das Angebot vom Innenministerium, eine Abteilung aufzubauen, die die Bekämpfung von Kapitalverbrechen auf deutscher und europäischer Ebene koordinieren sollte. Doch Winterfeld erkannte rasch, dass das nicht sein Ding war, denn es bedeutete Ränkespiele und Rotweinschwenken. Außerdem musste er korrupten Politikern in den Hintern kriechen, die sich ihr Bild von einer heilen und wählerfreundlichen Welt aus wahltaktischen Gründen nicht kaputtmachen lassen wollten.
In Berlin geblieben war er dann aber doch. Das LKA hatte ihm das Angebot gemacht, Chef der Mordkommission zu werden. Und das war dann sein Ding. »Ich muss im Endkundengeschäft bleiben«, hatte er Clara einmal anvertraut. »Es waren die Mörder, die mir die Energie gegeben haben, die Schlammschlacht um die Scheidung zu vergessen und mich wieder auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Ein wenig muss ich ihnen sogar dankbar sein.« Für Winterfeld waren die Täter die Kunden, nicht die Opfer. »Am Ende wissen diese Scheusale, dass sie letztendlich in den Knast oder auf den Friedhof gehören. Und als Dienstleister bringe ich sie genau dorthin.«
Früher hatte Winterfeld immer am offenen Fenster gestanden und sich einen Zigarillo angezündet. Da im gesamten Gebäude offiziell Rauchverbot herrschte, hatte er am Fenster »nach draußen geraucht«, wie er es nannte. Bis ihm sein Arzt gesagt hatte, er bekäme massive Herzprobleme, wenn er so weiterqualmte. Insbesondere, wenn er die Zigarillos weiterhin auf Lunge rauchte. Also rauchte Winterfeld jetzt nur noch am Wochenende, aber nach wie vor auf Lunge.
»Ah, Señora Vidalis«, sagte er nun, als er Clara am Fenster stehen sah. Man hatte immer gute Chancen, mit Winterfeld zu sprechen, wenn man sich nur an ein Fenster stellte, idealerweise im dritten Stock nahe der Kaffeeküche. »Rauchen Sie eigentlich noch, oder sind Sie mal wieder dabei, es sich abzugewöhnen?«
Clara lächelte. »Derzeit gewöhne ich’s mir mal wieder ab.«
»Tüchtig!«, sagte Winterfeld und öffnete feierlich das Fenster wie ein Renaissancekönig, der dem Volk seinen neugeborenen Sohn zeigen will. »Wie ist es gelaufen?«
»Katastrophal. Hat eine Ewigkeit gedauert. Beide haben gelogen, dass sich die Balken bogen.«
Winterfeld schaute in den schmutzig grauen Himmel wie der Steuermann am Ruder eines Schiffes.
»Wussten Sie, dass wir in Berlin von Leichen umgeben sind?«, fragte er, ohne Clara anzuschauen. Das war auch eine seiner Marotten, unvermittelt das Thema zu wechseln. Er schaute nach unten, wohin er früher immer die Asche hatte fallen lassen und wo aufgrund der schieren Aschemenge, die hier heruntergebröselt war, eigentlich der fruchtbarste Boden ganz Berlins sein musste. Vielleicht sollte man dort mal Wein anbauen, dachte Clara. Château Criminel.
»In jeder Stadt, die mehr als ein paar Hundert Jahre alt ist, ist der Boden voll mit Leichen«, philosophierte Winterfeld weiter. »Doch im Fall Berlins kommt ein Ereignis hinzu, das die Anzahl der Toten signifikant erhöht.«
»Sie meinen die Schlacht um Berlin 1945?«
Winterfeld nickte. »Ich habe vorhin mit einem Freund telefoniert, der hier für den Denkmalschutz zuständig ist. Ausgrabungen, bevor das Schloss gebaut wird und so weiter.« Er atmete die kalte Regenluft ein. »Ständig finden die irgendwelche Knochen und Schädel. Als im April 1945 der Fall Clausewitz ausgerufen und Berlin Frontstadt wurde, gab es allein in der letzten Woche vor der Kapitulation mehr als 20 000 Tote. Wenn man von einer Fläche Berlins von 890 Quadratkilometern ausgeht, sind das pro Quadratkilometer mehr als zwanzig Tote.« Jetzt blickte er Clara an. »Das heißt, wenn Sie nur hundert Meter laufen, begegnen sie auf jeden Fall einer Leiche. Und das sind nur die aus der letzten Woche des Krieges.« Er kniff die Augen zusammen. »Und da sich die Schlacht besonders auf die Mitte Berlins konzentriert hat, finden Sie hier wahrscheinlich noch viel mehr.« Er blickte in den Winterhimmel. »Ist das nicht eine interessante Vorstellung? Jeder Berliner geht buchstäblich über Leichen.«
Wider Willen musste Clara lachen.
»Und da wir die Toten in der Regel nicht aufwecken können, graben wir sie aus«, fuhr Winterfeld fort. »Dummerweise gefällt das unseren Politikern nicht, denn jede Leiche, die wir ans Licht holen, macht ihre heile Welt ein bisschen mehr kaputt.«
»So wie dieser Dr. Mertens auf der Pressekonferenz mit dem Namenlosen?«, fragte Clara. Sie musste an die hohlen Worte eines Abteilungsleiters der Senatskanzlei für Inneres denken, als er Clara und das Team um Winterfeld dafür gelobt hatte, den Facebook-Ripper aus dem Verkehr gezogen zu haben. Doch aufrichtig gefreut hatte der Mann sich erkennbar nicht. Lieber tausend Morde, von denen keiner weiß, als zehn Morde, die aufgeklärt werden. Der feuchte Händedruck des Mannes hatte Clara dann auch an die unschönen Zeiten zu Beginn ihrer Karriere erinnert, als sie im Drogendezernat gearbeitet hatte und in den Toiletten irgendwelcher Junkie-Wohnungen mit Gummihandschuhen nach versteckten Kondomen voll Heroin suchen musste.
»Genau wie Mertens, ja«, sagte Winterfeld. »Sie schütteln uns die Hand, sofern die Marionettenfäden es zulassen, aber im Grunde hassen sie uns, denn wir sind die Überbringer der schlechten Nachrichten.« Er blickte Clara an. »Sie wissen, was im Mittelalter mit den Überbringern schlechter Nachrichten geschah?«
»Sie wurden getötet.«
Winterfeld nickte. »Dumm nur, dass die schlechte Nachricht dadurch nicht besser wird. Ermittlungsarbeit ist eine langfristige Sache. Die passt nicht zur Quartalslogik und dem Fünfjahresdenken der Politiker. Die denken von hier bis zur eigenen Nasenspitze, und viele von denen haben sehr platte Nasen.« Er stemmte die Hände in die Hüften. »Wir können nicht auf Befehl Erfolge vorweisen. Wir können nicht so tun, als wäre nichts passiert. Und das Schlimmste ist: Wir können das Grauen nicht aufhalten, wenn es kommt. Und wir können niemanden vorwarnen, wann es kommt.«
Beide schauten eine Zeit lang schweigend in den grauen Himmel, wo eine dunkle Regenwolke wie eine verlorene Seele über den Horizont zog und dann von einer Windböe zerfasert wurde. Dabei musterte Clara Winterfeld aus dem Augenwinkel. Manchmal machte er die Dinge komplizierter, als sie eigentlich waren, was in eigentümlichem Widerspruch zu seinem ansonsten knallharten Pragmatismus stand. Genauso wie seine Behauptung, manchmal über das Zweite Gesicht zu verfügen, was schon bei einigen Kollegen Kopfschütteln hervorgerufen hatte, wäre da nicht seine hohe Aufklärungsquote gewesen.
»Ist das Ihr sechster Sinn, der sich da wieder mal meldet?«, fragte Clara schließlich und lächelte ein wenig spitzbübisch. »Behagt Ihnen die Stille nicht?«
»Nur selten ist Stille wirklich Stille«, erwiderte Winterfeld. »Meist ist sie das Ticken der Bombe vor dem großen Knall.«
»Sie meinen, es ist wieder so weit.« Eigentlich war Clara froh, sich ein paar Monate lang mit »normalen« Mördern beschäftigt zu haben.
»Die Stille«, sagte Winterfeld und schloss das Fenster, »war ein bisschen zu lang, um gesund zu sein. Denn manchmal ist es besser«, er schaute Clara an, »die Bombe explodiert sofort, als wenn sie ewig tickt.«
4
Franco Gayo sprach schon seit etwa sechs Minuten mit Tom, einem seiner Manager, der für ihn überdies eine Art Spin Doctor war und in dieser Funktion dafür sorgte, dass die richtigen Aussagen über die richtigen Kanäle zur richtigen Zeit bei den richtigen Leuten landeten. Something ’s gotta move somewhere sometimes somehow, pflegte Tom zu sagen. Irgendetwas muss irgendwohin, irgendwann, irgendwie.
Doch jetzt glaubte Gayo, nicht richtig gehört zu haben.
»Ich soll selbst ein Kind adoptieren?«, fragte er. »Aber ich bin doch nicht Angelina Jolie. Außerdem habe ich gar keine Zeit für Kinder und … Du meinst, das kommt gut an? Okay, ich kann’s mir ja mal überlegen.« Er ging mit dem schnurlosen Telefon zur Fensterfront und blickte in die Abenddämmerung.
Kinder. Seine Frau, eine hochrangige Politikerin, kannte er praktisch nur noch aus dem Fernsehen, denn ihr Terminkalender war noch voller als seiner. Aber sie war nützlich, denn sie sorgte für kostenlose zusätzliche PR. Ob er sie liebte, wusste er nicht, ob sie ihn liebte noch weniger. Aber darum ging es auch gar nicht. Es ging um das Gesehenwerden, um Aufmerksamkeit. Und am Ende um harte Euros und Dollars.
Hart sein gegen sich selbst und alle, die nicht so wollten wie er, das war Gayos Devise. So war es auch in der Kanzlei immer gelaufen. Associates, die keine Leistung brachten, wurden sofort gefeuert. Partner, die nicht genug Stunden aufschrieben und genügend Umsätze machten, wurden »de-equitized«, wie man das Herauskaufen von Leuten aus der Partnerschaft nannte, die die Firma loswerden wollte. De-Equitizing klang kryptischer und klinischer als »terminieren«, wie man den Abbau von unerwünschtem Personal im Investmentbanking nannte.
Aber jetzt ein Kind adoptieren?
»Wo soll das Kind denn herkommen?«, nahm Gayo den Gesprächsfaden wieder auf.
»Am besten, du adoptierst mehrere, aber immer schön hintereinander, damit die Medien jedes Mal neues Futter kriegen«, sagte Tom. »Ist auch gut für die Karriere deiner Frau.«
»Und woher?«
»Eine selten dämliche Frage«, erwiderte Tom. »Aus Spiekeroog vielleicht? Mann, aus Haiti natürlich, woher denn sonst?«
Gayo ärgerte Toms Direktheit, aber irgendwie mochte er sie auch. In seinem Geschäft hatte er es sonst fast nur mit Beschwichtigern und Speichelleckern, Jasagern und Politikern, UNO-Leuten und Talkshowmoderatoren zu tun. Da war ein bisschen Klartext ganz gut, so wie er es aus der Kanzlei von früher kannte.
»Ich soll mit gutem Beispiel vorangehen, was?«, fragte er.
»Ja. Und Brangelina und all den anderen Spinnern den Wind aus den Segeln nehmen.« Tom atmete hörbar aus. »Schöne und erfolgreiche Menschen werden in unserer Neidgesellschaft sofort niedergemacht. Es sei denn, sie adoptieren hundert arme Negerkinder, so wie Angelina und Brad. Was im Mittelalter der Ablasshandel war, sind heute die Bimbokinder. Das macht ein gutes Gewissen. Für alle. Und es wirkt. Jedenfalls sind Angelinas Gagen seitdem in die Höhe geschossen, auch wenn sie immer mehr abmagert und in The Tourist trotz Make-up so aussah, als wäre sie gerade aus einem Krater in Haiti oder einem Lager der Roten Khmer in Kambodscha gekrochen.«
Ein Kind adoptieren, dachte Gayo noch einmal. Sei’s drum, er würde darüber nachdenken.
»Überleg dir, wie viele. Am besten erst mal zwei, ein Junge und ein Mädchen«, fuhr Tom fort. »Das gibt du nächsten Freitag auf der Gala bekannt. Und bei der Show am Samstag erzählst du es so oft, bis die Leute denken, du hättest die Repeat-Taste verschluckt.«
Gayo verdrehte die Augen. Ich kann es kaum erwarten.
Tom redete unverdrossen weiter. »In unserer aufgeplusterten Mediengesellschaft reicht es halt nicht mehr, den Leuten nur auf die Schulter zu tippen. Man muss einen Vorschlaghammer nehmen, nur dann hat man Aufmerksamkeit.«
»Ich denke darüber nach«, sagte Gayo.
»Was ist eigentlich mit deiner Sekretärin, dieser Susi oder wie sie heißt?«, fragte Tom. »Ich wollte heute ein paar Termine mit ihr klären, aber sie war nie zu erreichen.«
Gayos Miene verfinsterte sich. »Keine Ahnung. Ist nicht gekommen und hat sich auch nicht abgemeldet. Wird schon nichts Ernstes sein.«
»Es kann was Ernstes werden«, sagte Tom. »Einer meiner Informanten von der Luftfahrtbehörde hat mir ein sehr bedenkliches Dokument zugestellt. Da stehen Sachen drin, die eigentlich niemand wissen sollte.«
Gayo spürte, wie ihm heiß wurde. »Über uns?«
»Über uns«, bestätigte Tom. »Wenn davon etwas an die Öffentlichkeit dringt, sind wir so tot wie frittierte Hühnerärsche.«
»Und was steht da drin?« Gayo nahm das Telefon an das andere Ohr.
»Dass es in unserem Non Profit Business eine Sache gibt, die gar nicht existiert.«
»Und welche?«
»Das Non.«
»Das heißt, man wirft uns vor, Gewinne zu machen?«
»Exakt.«
Gayo schwieg nachdenklich. Diese Vorwürfe bekam er häufiger zu hören. Wer etwas Gutes für die Allgemeinheit tat, durfte damit kein Geld verdienen. Möglichst am Existenzminimum bleiben, als würde man auf diese Weise mit den Armen mitleiden und die Welt dadurch noch besser machen, als man es ohnehin schon tat.
»Kann es sein, dass deine Sekretärin irgendetwas ausgetratscht hat?«, fragte Tom.
»Nein«, antwortete Gayo, auf dessen Stirn sich eine Falte gebildet hatte. »Die weiß überhaupt nichts, und das wird auch so bleiben.«
»Wenn sie am Montag ohne Abmeldung immer noch nicht da ist, fange ich an, mir Sorgen zu machen«, sagte Tom. »Und diese Susi sollte das dann auch tun. Undichte Stellen können wir uns nicht leisten. Dafür ist die Sache zu heiß.«
»Hast recht«, sagte Gayo. »Checkst du das noch mal?« Sollte Tom sich darum kümmern, der war eh für das Mikromanagement zuständig. Gayo selbst war müde und wollte raus aus dem Büro. Er schaute auf seinen Tisch, wo die Faxkopie der Baufirma lag. Die würde am Wochenende, am Samstag, das Parkett abschleifen, aus Rücksicht auf die Mitarbeiter.
»Mach ich«, sagte Tom. »Ich ruf dich dann später noch an.«
»Sonst noch etwas?« Gayo war in Gedanken schon beim Rotwein im Bocca di Bacco gleich um die Ecke, wo er zum Abschluss der Woche eine kleine Stärkung zu sich nehmen wollte.
»Ja. Was immer diese Susi getan hat, wir sollten in jedem Fall …«
Toms Stimme brach jäh ab, als hätte jemand den Strom abgestellt. Doch die Lichter brannten noch. Am Strom konnte es also nicht liegen.
Gayo legte auf, wählte noch einmal. Nichts.
Er wartete, ob Tom ihn anrief. Doch das Telefon blieb stumm. Er lauschte in den Hörer. Nichts. Nicht mal ein Besetztzeichen.
Er griff zu seinem Blackberry, scrollte durch das Adressbuch, wählte Toms Nummer. Wieder nichts.
Seine Augen weiteten sich, als er das Zeichen auf seinem Blackberry sah: Kein Empfang. Das war völlig unmöglich. Er war hier im Herzen von Berlin, nicht in irgendeinem Kaff in Somalia.
Er versuchte noch ein paar andere Nummern, bekam aber keinen Anschluss. Nicht einmal bis unten zum Empfang kam er durch, weder mit dem Blackberry, noch mit dem Festnetztelefon.
Kein Empfang beim Empfang, alberte eine Stimme in seinem Kopf, aber er konnte nicht darüber lachen.
Verdammt noch mal, dann eben nicht! Er steckte sein Black-Berry in die Aktentasche, nahm seinen Mantel und ging mit schnellen Schritten durch das Vorzimmer zur Tür.
Erst als sie sich nicht öffnen ließ, wurde Franco Gayo bewusst, dass er Angst hatte.
5
Don Tomasso Tremonte, Adlatus der Glaubenskongregation der römischen Kurie, überquerte mit eiligen Schritten die Piazza Navona. Ein wichtiger Termin mit einem Bischof aus Südamerika im Apostolischen Palast hatte länger gedauert als beabsichtigt. Die Vorlesung würde in fünf Minuten beginnen, und auch wenn er sie nicht selbst halten würde, wollte er in jedem Fall dabei sein.
Er schritt schneller aus. Seine kraftvollen Bewegungen und die raumgreifenden Schritte ließen erkennen, dass neben den geistigen Exerzitien der Sport eine wichtige Rolle in seinem Leben spielte. Außerdem gehörte er mit 45 Jahren zu den jüngsten Würdenträgern der katholischen Kirche.
Die elliptische Form des Platzes, den heute überwiegend Touristen bevölkerten und der voller Cafés und Restaurants war, zeugte noch heute davon, dass die Piazza früher ein römischer Zirkus gewesen war, ähnlich wie der Petersplatz im Vatikan. Und so wie auf dem Petersplatz die Apostel Petrus und Paulus hingerichtet worden waren, was ihn zu heiligem Boden und später zum Zentrum der Christenheit gemacht hatte, war auch die Piazza Navona Schauplatz dramatischer Ereignisse und schrecklicher Grausamkeiten gewesen. Kaiser Domitian, Bruder des Titus, der 70 nach Christus Jerusalem dem Erdboden gleichmachen ließ, hatte hier blutige Wagenrennen und Gladiatorenspiele ausgerichtet. Agones wurden diese Spiele genannt. Aus dem griechischen Wort Agonie leitete sich in vielen Sprachen das Wort für Schmerz ab, und aus der Piazza Agones, dem Platz der Schmerzen, wurde schließlich die Piazza Navona.
Schmerzen, dachte Don Tomasso. Schmerz war oft mit dem Wirken des Bösen verbunden, und dessen Existenz und Beschaffenheit hatte Tomasso sein gesamtes bisheriges Priesterleben hindurch beschäftigt. Denn wenn alles von Gott geschaffen war, dann waren auch das Böse, der Teufel und die Hölle von Gott geschaffen. Alles Böse, aller Schmerz musste somit auch dem Willen Gottes entsprechen.
Und gab es nicht genug Beweise dafür, auch in den Heiligen Schriften? Gott fügte Schmerz und Leid selbst denen zu, die ihm am liebsten waren. »Unter Schmerzen sollst du Kinder gebären«, hatte Gott zu Eva gesagt, nachdem sie im Garten Eden den Apfel vom Baum der Erkenntnis gegessen hatte. Seinen einzigen Sohn Jesus Christus, »eines Wesens mit dem Vater«, wie es im Nizäanischen Glaubensbekenntnis hieß, ließ er geißeln und ans Kreuz nageln.
Doch musste man das Böse ertragen, musste man es hinnehmen, nur weil Gott die Menschen damit geschlagen hatte?
Trotz seiner relativ jungen Jahre kannte Don Tomasso die meisten Geheimnisse der Heiligen Stadt und auch die kleinen und großen Ränkespiele hinter den Kulissen des Heiligen Stuhles. Er wusste, dass es insgesamt drei Päpste gab, nicht nur einen. Da war zunächst der weiße Papst – der, den die Welt kannte. Der rote Papst war der praefectus propaganda fide, der Präfekt für die Evangelisierung der Völker und einer der mächtigsten Männer der Kirche. Der schwarze Papst schließlich war der Generalobere des Jesuitenordens.
Eigentlich fehlt sogar noch einer, dachte Don Tomasso, als er am Vierströmebrunnen vorübereilte und sich vor ihm bereits das Dach der päpstlichen Universität an der Piazza di Sant’Appolinare erhob. Es handelte sich um den Prälaten und Bischof der »Prälatur vom Heiligen Kreuz und Werk Gottes«, kurz Opus Dei. Obwohl eine der jüngsten Gründungen der katholischen Kirche, war das Opus Dei eine der mächtigsten und einflussreichsten Organisationen. »Wir können nur mit Steinen werfen«, hatte einmal ein Mitglied einer katholischen italienischen Laienorganisation gesagt, »die Panzer hat das Opus Dei.«
Die Universität, zu der Don Tomasso unterwegs war, die Pontifica Università della Santa Croce, die päpstliche Universität vom Heiligen Kreuz, war ebenfalls im Jahre 1984 vom Opus Dei gestiftet worden. Viele warfen der Organisation vor, mittelalterliche Ansichten zu hegen, doch der Wind hatte sich gedreht. »Nicht mehr lange, und der Feind ist übermächtig«, sagte man im Vatikan. »Man muss ihn bekämpfen, bevor er die Überhand gewinnt.«
Der Feind, dachte Don Tomasso. Das war der Satan. Der Antichrist. Doch war er Teil von Gottes Plan oder der ewige Widersacher, der so mächtig war, dass er sich selbst dem Willen des allmächtigen Gottes entziehen konnte?
Tomasso dachte an den Abschnitt über das Böse aus der Summa Theologica des Thomas von Aquin. Zwei Dinge sprechen gegen Gott, hatte der heilige Thomas in seiner berühmten Schrift dargelegt. Zum einen die scheinbare Fähigkeit der Naturwissenschaften, alles Geschehen auf der Welt ohne Gott erklären zu können. Zum anderen die Existenz des Bösen. Denn wie passte die Existenz des Bösen zu einem Gott, der im Menschen sein Ebenbild erschaffen und es zur Krone der Schöpfung erkoren hatte? Wie passte die Existenz der Hölle zu einem lieben Gott?
Don Tomasso eilte die Treppen zum Großen Auditorium hinauf. Der Mann, der gleich den Vortrag halten würde, würde einiges zu dem Thema zu sagen haben. Es war ein Mann, den Tomasso besser kannte als alle anderen. Ein Mann, der zu den einflussreichsten, aber auch unheimlichsten Gestalten nicht nur des Vatikans, sondern der gesamten Ewigen Stadt zählte. Ein Mann, dessen Privatsekretär Don Tomasso war.
6
Zum Teufel, dachte Franco Gayo und rüttelte an der Tür. Heute funktioniert aber auch gar nichts!
Er versuchte den Notausgang. Ebenfalls verschlossen. Er tippte noch einmal auf seinen BlackBerry. Noch immer nichts. Der Telefonanschluss aus, kein Handyempfang, die Türen verriegelt …
Vielleicht legt jemand es darauf an. Vielleicht will jemand dich hier einsperren?
Er versuchte, diesen Gedanken zu verdrängen, doch er kroch an die Oberfläche seines Bewusstseins, langsam, bedrohlich, unaufhaltsam.
Aber warum? Will irgendein neidischer Scheißkerl verhindern, dass ich zu meinen Auftritten komme?
Aber die waren erst nächste Woche.
Vielleicht will dieser Jemand etwas ganz anderes.
Mit einem Mal kam es ihm vor, als würden Wände und Decke sich langsam auf ihn zubewegen. Die afrikanischen Skulpturen erschienen ihm plötzlich wie riesige Zähne in einem gigantischen Maul, als wären Decke und Boden Ober- und Unterkiefer, die ihn in der nächsten Sekunde zermalmen würden.
Schrei nicht, wehrte er sich gegen die aufkeimende Panik. Schrei bloß nicht. Wenn du schreist, wird alles nur schlimmer.
Er wusste, jeder Schrei, jede Panikattacke, jeder Schlag gegen die Wand würde sich selbst verstärken, bis er nur noch ein sabberndes Nervenbündel war. Und wer immer ihn hier eingesperrt haben wollte, hätte am Ende gewonnen.
Er lauschte in die Stille.
Nichts.
Sei nicht albern, versuchte er sich zu beruhigen, das klärt sich alles. Gleich rufst du den Hausmeister und …
In diesem Moment hörte er das Lachen. Kurz, abgehackt. Und irgendwie mechanisch.
Scharf zog er die Luft durch die Zähne ein und ballte die Fäuste, dass die Knöchel hervortraten, während vom Magen aus ein stechender Schmerz durch seinen ganzen Körper jagte.
Dann wieder Stille.
Gayo blickte sich um. Das Lachen kam aus dem Vorzimmer, das er gerade eben durchquert hatte. Er ging zurück, griff sich vom Tisch seiner Sekretärin einen Kugelschreiber. Falls jemand hinter der Tür stand, würde er ihm das Ding ins Auge rammen. Er würde …
Wieder das meckernde Lachen, verzerrt und so, als würde eine Schallplatte zu langsam laufen. Das Geräusch schien aus dem Schrank zu kommen.
Was für ein dämlicher Scherz, dachte Gayo. Irgendein Blödmann hat einen Kassettenrekorder in den Schrank gestellt. Aber wann? Und wieso?
Er schlich sich langsam an den Schrank heran, den Kugelschreiber erhoben, das eine Ende zwischen Ringfinger und kleinem Finger, das andere Ende mit dem Daumen abgestützt, sodass er in alle Richtungen zustechen konnte.
Er holte tief Luft und riss die Schranktür auf. Vor ihm ein kleiner Schwarz-Weiß-Fernseher aus den 80ern. Wer hat den hier hingestellt? Der Bildschirm zeigte eine Handpuppe, eine Kasperlefigur. Nur dass die Puppe zwei Hörner hatte. Sollte das den Teufel darstellen? Sehr witzig. Die Puppe wippte hin und her.
Zögernd schob Gayo die Mäntel und Bügel im Schrank beiseite. Aber da war niemand. Natürlich nicht.
Was für ein dämlicher Scherz, dachte er noch einmal und ließ den Kugelschreiber sinken.
In diesem Moment verwischte das Bild. Jetzt sah er eine andere Gestalt. Verschwommen, kaum zu erkennen.
Gayo bewegte sich nach links. Das Bild bewegte sich in die gleiche Richtung. Dann nach rechts. Das Abbild auf dem Bildschirm machte die gleiche Bewegung.
War er das auf dem Bildschirm? Wurde er gefilmt?
Gayo trat näher heran, starrte in das diffuse Flimmern. Doch je näher er kam, desto weniger erkannte er.
Erst als er ein paar Schritte zurücktrat, sah er es. Da schien noch etwas auf dem Bildschirm zu sein. Nicht nur sein eigenes diffuses Abbild, sondern etwas anderes. Und dieses Andere wuchs, richtete sich schemenhaft auf.
Hinter ihm.
Gayo sah den Schatten auf dem Bildschirm, der allmählich größer wurde, und fuhr herum.
Er sah ein Gesicht.
Und dann nichts mehr.
7
Auf dem Gesicht des Kindes spiegelte sich Furcht, als es den fremden Mann mit großen Augen musterte. Den Mann, der ihm den Umschlag hinhielt.
»Lukas« hatten sie den Jungen genannt, als er zu ihnen gekommen war, denn einen wirklichen Namen schien er nicht zu haben. In der Wohnung, aus der er kam, hatte es nicht einmal eine Taufurkunde gegeben. Niemand wusste, woher er kam. Mit seinen dunklen Haaren und den großen braunen Augen sah er jedenfalls ein bisschen südländisch aus.
Am liebsten trug Lukas seine blaue Latzhose. Vorn auf der Brusttasche waren Tick, Trick und Track aufgenäht. Diese Hose trug er auch an diesem Tag, als er zu dem schwarz gekleideten Mann hinaufblickte, der ihm den Umschlag entgegenhielt.
Zögernd machte Lukas einen Schritt auf den Fremden zu, obwohl er eigentlich zurückweichen wollte. Dann machte er noch zwei Schritte. Es waren seltsam ruckartige, roboterhafte Bewegungen, aber so bewegte Lukas sich immer. Manchmal lief er ein paar Schritte, dann stoppte er. Blieb stehen, starrte minutenlang ins Nichts, schluckte und zitterte, als würde er sich an irgendetwas Schreckliches erinnern, das er verdrängt hatte. Manchmal ging er nachts durch die Flure des Heims, mit weit aufgerissenen Augen. »Das Irrlicht« hatten einige der Pfleger ihn genannt, denn er irrte ohne erkennbares Ziel durch die Gänge, auf der Suche nach einer Vergangenheit, die er niemals verstehen durfte.
Und er sprach nie. Die Ärzte redeten von Katatonie oder Mutismus, wenn jemand einen so schweren Schock erlitten hatte, dass er danach nicht mehr sprechen konnte. So war es auch bei Lukas.
In dem Heim, in dem er untergebracht war, hatte man schon viele traumatisierte Kinder gesehen. Kinder, die ausgesetzt worden waren, die man geschlagen, missbraucht und manchmal fast getötet hatte. Doch was mit dem kleinen Lukas geschehen war, hatte selbst den hartgesottensten Pflegern und Rechtsmedizinern den Schlaf geraubt. Und nie hatte jemand den Jungen weinen gesehen. Deshalb hatten die anderen für ihn geweint.
Sie hatten ihn vor drei Jahren nachts auf der Straße gefunden, halb nackt, halb erfroren und in einem Delirium aus animalischer Angst und völliger Lethargie.
Lukas, das Irrlicht.
Doch das Grauen, das danach kam, war noch größer gewesen. In der Rechtsmedizin hatten sie eine neue Abteilung eröffnet, die Abteilung für klinische Rechtsmedizin, wo man rechtsmedizinische Methoden der Analyse auch bei lebenden Opfern anwendete. Tote können nicht sprechen, daher müssen die Ergebnisse der Rechtsmedizin so hieb- und stichfest sein, dass niemand sie vor Gericht anzweifeln kann. Doch nicht nur die Toten schweigen, auch Kinder können manchmal nichts mehr von sich geben. Oder sie trauen sich nicht, weil sie von den Eltern abhängig sind, die sie geschlagen und misshandelt haben. Kinder, die sich nicht vorstellen können, dass die eigenen Eltern ihnen etwas Böses antun, selbst wenn sie es tun. Kinder, die nicht aussprechen wollen, dass sie keineswegs »gestolpert« sind, sondern die Treppe hinuntergestoßen wurden.
Doch Lukas konnte wirklich nicht sprechen.
Manche Pfleger erinnerten sich mit Schaudern an die Nacht, als sie ihn gefunden hatten, an das grelle Licht im Untersuchungsraum und an den Ausdruck in den Augen der Rechtsmedizinerin, der erkennen ließ, dass nicht einmal sie so etwas schon einmal gesehen hatte. Oberkörper und Arme des Jungen waren blau und grün von Hämatomen, der Bauch und die Beine eine schrundige Narbenwüste aus roten, entzündeten Kratern und Striemen. Jemand hatte Lukas mit glühenden Zigaretten gefoltert. Doch sein Peiniger hatte es nicht bei Schlägen und Zigaretten belassen. Er hatte Lukas auch sexuell missbraucht.
Seitdem lebte der kleine Junge in einer Welt, die nur er allein kannte.
Wieder machte Lukas ein paar unsichere Schritte nach vorn, ohne den Fremden aus den Augen zu lassen. Dann ergriff er den Umschlag mit beiden Händen, während der Mann unverwandt auf ihn hinunterstarrte.
»Das könnte dich interessieren«, sagte der Fremde.
Dann drehte er sich um und ging, ohne einen Blick zurückzuwerfen.
Er sah nicht die Tränen des Kindes.
Tränen in Augen, die noch nie geweint hatten.
8
Don Tomasso Tremonte durchschritt den langen Korridor, an dessen Ende sich der Eingang zum Auditorium Maximum der Santa-Croce-Universität befand.
Gott und das Böse.
»Der Feind ist übermächtig«, hieß es im Vatikan. Und auf Geheiß des Papstes war die Zahl der Exorzisten aufgestockt worden, eine Berufsgruppe, von der man glaubte, sie sei mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert verschwunden und würde für immer verschwunden bleiben.
»Viele Menschen glauben, den Teufel gibt es nicht«, hatte der Mann gesagt, der gleich zu den angehenden Priestern im Auditorium Maximum sprechen wollte. »Aber man muss ihn sich als Einbrecher vorstellen, der es darauf anlegt, unerkannt zu bleiben. Des Satans größte Errungenschaft ist die, dass er für nicht existent gehalten wird.« Der Mann, der diese Worte gesagt hatte, war Don Alvaro de la Torrez, Jesuitenpater und Stellvertreter von Don Gabriele Amorth, Chefexorzist des Heiligen Stuhls, dessen Amt Don Alvaro wohl bald übernehmen würde. Amorth war mittlerweile fast neunzig und hatte in seinem Leben Tausende von Exorzismen durchgeführt. Im Vatikan war man einmütig der Ansicht, dass Alvaro ein würdiger Nachfolger Don Gabrieles als oberster Exorzist sein würde.
»Der Exorzist als Nachfolger Christi« lautete das Thema der heutigen Vorlesung Don Alvaros.
Mit eiligen Schritten und voller gespannter Erwartung durchmaß Don Tomasso die hohen Säulengänge der Universität, öffnete die große Tür und betrat das Auditorium Maximum. Alvaro, dessen Pünktlichkeit legendär war, hatte bereits mit der Vorlesung begonnen. Trotz seiner mehr als siebzig Jahre bewegte er sich mit jener Gewandtheit, die Menschen eigen ist, die zielgerichtet und auf geordnete Weise ein langes asketisches Leben geführt haben. Sein vorstehendes Kinn mit dem kurzen grauen Bart und die wachen, durchdringenden Augen unter den buschigen Brauen zeigten eine Willensstärke, die manchmal ans Fanatische grenzte.
Der Beamer des Auditoriums hatte ein Bild des Satans an die Wand geworfen, daneben den berühmten Spruch von Papst Johannes Paul II.: »Wer nicht an den Teufel glaubt, glaubt nicht an das Evangelium.« Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt.
»Was ist der Teufel?«, fragte Don Alvaro nun in perfektem Englisch mit spanischem Akzent. Sein Blick huschte wie das Licht eines Suchscheinwerfers über die Studenten hinweg, deren Pulte sich in Dutzenden Reihen bis zur Kuppel des Saales erhoben. Was den Heiligen Stuhl anging, waren dessen Universitäten so global wie alle Business Schools. Nur sehr viel älter. »Existiert der Satan?«, fuhr Alvaro fort. »Oder existiert er nicht? Ist er stets präsent, oder ist er abhängig von der Stimmung und der scheinbaren Aufgeklärtheit des Menschen? Ist er wie trockene Blätter, die man im Ofen verbrennt oder die der Wind der Zeit hinwegfegt?« Anstatt auf eine Antwort zu warten, sprach er gleich weiter. »So wie Nietzsche einst vom Tod Gottes sprach, sprechen die heutigen Philosophen vom Tod Satans und reduzieren ihn auf ein mittelalterliches Symbol für das Böse. Sie bestreiten, dass es den Teufel gibt, doch sie bestreiten damit die Existenz des Bösen an sich.« Alvaro schritt die Reihen ab, den flammenden Blick auf die Gesichter der jungen Leute gerichtet. »Ihre Dummheit ist so ungeheuerlich, dass sie nur von der Barmherzigkeit Gottes übertroffen wird.«
Er nickte Don Tomasso kurz zu, der unauffällig Platz genommen hatte, und fuhr dann fort, wobei er auf das Zitat Johannes Pauls II. zeigte: »Wer nicht an den Teufel glaubt, glaubt nicht an das Evangelium. Aber das ist noch nicht alles. Wer nicht den Kampf gegen den Teufel als eines der größten Ziele des Christseins aufnimmt, verleugnet Jesus Christus. Selbst das Zweite Vatikanische Konzil stellte fest, dass die Geschichte der Menschheit ein Kampf ist, der mit der Erschaffung der Welt begann und erst mit dem Jüngsten Gericht endet. Der Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Der Kampf gegen das Böse.«