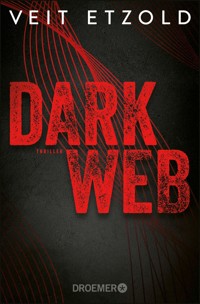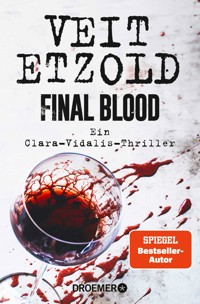9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Clara Vidalis Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein Killer, der wie ein Computervirus agiert: unsichtbar und allgegenwärtig. Er nennt sich der Namenlose, und seine Taten versetzen ganz Berlin in Angst und Schrecken. Hauptkommissarin Clara Vidalis und ihr Team sind in der Abteilung für Pathopsychologie ohnehin schon für die schweren Fälle zuständig, aber die Vorgehensweise dieses Verbrechers raubt selbst ihnen den Atem. Perfide und genial, lenkt er die Ermittler stets auf die falsche Fährte. Und erst allmählich begreift die Kommissarin, dass der Namenlose sein grausames Spiel nicht mit der Polizei spielen will, sondern nur mit einem Menschen: mit ihr, Clara Vidalis. Während die Ermittler noch verzweifelt versuchen, die Identität des Killers aufzudecken, startet der Medienmogul Albert Torino eine neue Casting-Show. Und es gibt jemanden, der diese Show für seine eigenen, brutalen Zwecke nutzen wird: der Namenlose...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Zitat
Prolog
Erster Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Zweiter Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Dritter Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Epilog
Leseprobe »Skin«
Veit Etzold
FINAL CUT
Thriller
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Originalausgabe
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Wolfgang Neuhaus
Titelillustration: © shutterstock/Marilyn Volan
Datenkonvertierung E-Book:
Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-1601-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Könnte ich mir meinen Wohnsitz frei wählen, fiele meine Wahl auf das Herz einer derartigen Stadt aus faulendem Fleisch und zerfallenden Knochen, denn ihre Nähe sendet ekstatische Schauder durch meine Seele, lässt das Blut durch die Adern rasen und mein Herz in der Freude eines Deliriums pochen – denn die Anwesenheit des Todes ist für mich das Leben.
H. P. Lovecraft,
Prolog
Nummer 12! Er stellte die beiden Kanister mit der dunkelroten Flüssigkeit auf den modrigen Boden des Kellers, zog sich den schwarzen Gummianzug aus, knüllte ihn zusammen und schleuderte ihn ins Feuer. Das Plastik warf Blasen, die sich schmatzend und zischend aufblähten und zusammenschrumpften, während die Flammen das Gummi verzehrten und ein stechender Geruch den Raum mit der hohen Decke erfüllte.
Er warf alles, was er getragen hatte, ins Feuer: die Maske, die Brille, die Schuhe.
12 Anzüge.
12 Opfer.
12 Leben.
Ihm dröhnte der Schädel. Grauenvoller Schmerz wühlte in seinem Hirn. Sein Magen war ein Stück brennende Kohle.
Vor sich sah er den Sarg – und das, was sich darauf befand. Er hatte es tausend Mal gesehen. Und immer wieder durchfuhr es ihn wie ein Elektroschock. Die Erinnerung an das Vergangene traf ihn auch diesmal wie ein Hammerschlag, ließ ihn nackt auf die Knie fallen, während er in einem Crescendo des Ekels und der Verzweiflung einen Schwall grüner Galle erbrach.
Dann brach auch er zusammen, lag keuchend und zitternd auf dem steinernen Boden, während das Feuer seine Kleidung verzehrte und seine geröteten Augen sich auf den Sarg richteten, der über ihm in das diffuse Licht des Kellergewölbes ragte.
Und da lag sie.
Seit Jahren.
Seit Jahrzehnten.
Verloren, aber nicht vergangen. Verborgen, aber nicht vergessen. Tot, aber träumend.
Und er lag nackt auf dem feuchten Boden, zuckend, in seinem eigenen Dreck, und irgendetwas staute sich in ihm auf, so wie sich vorhin das Erbrochene gestaut und schließlich Bahn gebrochen hatte. Und dann zerriss sein Schrei die Stille, so schrecklich, wie ihn zuvor nur Luzifer ausstoßen konnte, nachdem er von Gott in den bodenlosen Abgrund gestürzt worden war. Ein Schrei voller animalischer Angst und erstickender Hoffnungslosigkeit.
Er hatte getan, was kein Mensch tun durfte. Etwas, was ihn dazu verdammte, für immer im Feuer der Hölle zu brennen. Etwas, was er sich niemals vergeben würde.
Er hatte den einzigen Menschen getötet, der ihn je geliebt hatte.
Er verlor das Bewusstsein, und Schwärze umgab ihn.
Erster Teil
BLUT
Auch deine Seele wird ein Schwert durchdringen.
Lukas 2,35
1.
»Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes«, flüsterte die junge Frau, die im Beichtstuhl kniete. Ihre Stimme zitterte, als sich die Tränen ankündigten.
»Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und seiner Barmherzigkeit«, sagte der Priester mit ruhiger, sonorer Stimme. Die Frau konnte sein Gesicht durch das gitterartige kleine Holzfenster, das Sünder und Erlöser trennte, nur schemenhaft erkennen.
Sie wusste selbst nicht, was sie jedes Jahr hierhertrieb, immer am 23. Oktober, seit vielen Jahren. War es der Glaube? Nein, sicher nicht. Eher die Schuld, die sich immer wieder in ihr aufstaute und die sie loswerden musste, weil sie wie ein tonnenschwerer Stein auf ihr lastete.
Jedes Jahr sagte sie sich, wie unnütz die Beichte sei. Denn wer konnte garantieren, dass ihre Schuld damit getilgt wurde? Dass sie Vergebung fand? Das vage Versprechen Christi, in Gestalt eines Priesters die Last der Sünde von ihr zu nehmen, hielt der Gottessohn leider so gut wie nie ein. Nur kurz fand sie gewöhnlich nach einer Beichte Frieden, und das wohl auch nur, weil sie die Möglichkeit hatte, ihre Geschichte jemandem zu erzählen. Von den Albträumen und den namenlosen Schrecken wurde sie weiterhin verfolgt.
Sie hatte alles Mögliche versucht: Gesprächstherapie, psychologische Behandlung, Yoga, Tai-Chi, Meditationskurse. Geholfen hatte nichts – da war die Beichte noch das Beste.
Mit jedem Jahr wurde die Schuld unerträglicher. Es war etwas Düsteres, Bösartiges, nicht Greifbares, das sich in ihr aufbaute und emporstieg wie eine von fauligen Gasen aufgeblähte Wasserleiche, die in einem verpesteten, stinkenden Tümpel langsam und gespenstisch nach oben schwebt. Dieses Etwas in ihrem Inneren wurde größer und bedrohlicher, bis sie es nicht mehr ertragen konnte und die aufgeblähte Blase ihrer Schuld aufstechen musste, damit die fauligen Gase entweichen konnten.
Nur dass es nicht lange dauerte, bis der Pestilenzgestank sich wieder in ihr ausbreitete und auf ihre Seele drückte.
Und so fand sie sich jedes Jahr am 23. Oktober in einem Beichtstuhl in der Berliner Sankt-Hedwigs-Kathedrale wieder. Es war die Bischofskirche von Berlin; viele Priester waren abwechselnd hier. Manchmal beichtete sie bei Priestern, die ihre Geschichte schon einmal gehört hatten. Doch den Geistlichen, der ihr diesmal die Beichte abnahm, hatte sie noch nie gesehen.
»Ich bin gekommen, um meine Sünden zu bekennen. Meine letzte Beichte … war vor einem Jahr. Am meisten beschäftigt mich … meine Schwester …«, sagte sie stockend, denn wie jedes Mal wusste sie nicht, wie sie beginnen sollte. »Meine Schwester war acht, als sie entführt wurde. Der Täter … er hat sie vergewaltigt und getötet. Und es war meine Schuld.«
»Wie lange ist das her?«, fragte der Priester.
»Zwanzig Jahre.« Es war der 23. Oktober 1990 gewesen, ein Mittwoch, als sie ihre Schwester das letzte Mal gesehen hatte. Genau um 16 Uhr. »Ich wollte sie von der Schule abholen … von der Musikschule. Sie hat sich auf mich verlassen, aber ich bin nicht gekommen. Deshalb fiel sie dieser Bestie in die Hände.« Sie fing leise zu weinen an. »Er hielt sie tagelang gefangen und hat sie missbraucht … immer wieder. Und am Ende«, ihre Stimme war nur noch ein heiseres Flüstern, »hat er sie umgebracht.« Jetzt kamen die Tränen wie ein Sturzbach der Verzweiflung. »Er hat Fotos davon gemacht … wie er es getan hat …«
Der Priester blieb stumm. Schließlich räusperte er sich. »Das ist eine furchtbare Geschichte. Es ist gut, dass Sie damit zu mir kommen.« Er machte eine Pause. »Hat man den Täter gefasst?«
Eine seltsame Frage für einen Beichtvater.
Die Frau schüttelte den Kopf. »Nein. Die Polizei sagte damals, sie würden alles tun. Heute weiß ich, dass sie nichts getan haben, gar nichts. Sie haben Kaffee aus ihren Pappbechern getrunken, immer wieder auf die Uhr geschaut und um vier Uhr Feierabend gemacht, während meine Schwester vor Angst und Schmerzen wahnsinnig wurde. Ich weiß es genau.«
»Woher?«
»Weil ich auch zu dem Verein gehöre. Aber ich bin anders als diese Versager damals. Denn ich jage solche Ungeheuer wie den Mörder meiner Schwester. Ich jage und ich töte sie.«
»Sie sind bei der Polizei und jagen Mörder?«
»Serienkiller.« Sie schluckte. »Manchmal weiß ich nicht, ob es klug ist, denn immer wieder werde ich daran erinnert, wie ich bei meinem ersten und schrecklichsten Fall versagt habe. Aber es ist meine Bestimmung. Ich muss diese Bestien jagen … ich muss sie finden, und ich muss sie töten …« Sie weinte wieder.
Sie konnte das Nicken des Priesters durch das Holzgitter sehen. »Ihr Hass ist verständlich. Aber Sie dürfen nicht Tod mit Tod vergelten. Jesus hält uns dazu an, Milde zu zeigen. Um Vergebung zu finden, muss man anderen vergeben.«
»Auch dem Mörder meiner Schwester?«
»Auch ihm.«
Sie machte eine lange Pause. Vergebung für diesen Vergewaltiger? Diesen Schänder und Schlächter? Unmöglich. Ihr Hass auf diese Kreatur war grenzenlos. Sie wollte ihn in Stücke reißen, das Blut aus ihm herauspressen und die Überbleibsel zu Pulver zerstampfen, bis von dem Mörder nichts mehr übrig blieb als ein rot gefärbter Nebel.
Sie wartete, bis ihr innerer Aufruhr abgeklungen war. »Was geschieht mit dem Mörder, wenn er stirbt?«, fragte sie dann. »Was glauben Sie?«
Der Priester faltete die Hände. »Mord verstößt gegen das fünfte Gebot. Und es ist eine schwere Todsünde. Wenn er nicht beichtet und aufrichtige Reue zeigt, erwartet ihn die ewige Verdammnis.«
»Die Hölle«, sagte sie. Sie schluckte und wischte sich mit der Hand die Tränen ab. »Ich werde erst wieder ruhig schlafen können, wenn ich ihn dorthin befördert habe. Wird er leiden in der Hölle?«
»Die Kinder von Fatima hatten Anfang des letzten Jahrhunderts eine Vision von der Hölle, die ihnen die Gottesmutter zeigte.« Der Priester zitierte die Höllenvision, die er offenbar auswendig kannte: »›Sie trieben im Feuer dahin, emporgeworfen von den Flammen, die aus ihnen selbst hervorbrachen, ohne Schwere und Gleichgewicht, unter Schmerzens- und Verzweiflungsschreien, die mich vor Entsetzen erstarren ließen.‹«
»Das ist gut«, sagte die Frau. »Etwas anderes hat er auch nicht verdient.«
»So dürfen Sie nicht denken«, sagte der Priester. »Auch Zorn ist eine Sünde. Und die Hölle bedeutet ewige Qual. Kein Christ sollte sich wünschen, dass jemand dorthin kommt.«
»Ich hoffe, dass man ihm dort die Haut abzieht, dass man ihn kastriert und in Stücke schneidet, dass man ihn foltert und quält bis ans Ende der Zeit!«, zischte sie und ballte die Fäuste. »Und es ist mir egal, ob ich dafür selbst in der Hölle schmoren muss.«
»Wie heißen Sie?«
»Clara.«
»Ich sehe, Clara, dass Ihr Schmerz groß ist und Hass Ihre Seele erstickt.« Der Priester schlug das Kreuzzeichen. »Doch Gott der Vater hat in seiner unendlichen Gnade Jesus Christus geschickt zur Vergebung der Sünden.« Er blickte Clara an. Trotz des engmaschigen Holzgitters, das sie trennte, sah sie Mitgefühl in seinen Augen, als er die Lossprechungsformel vortrug. »Im Dienste der Kirche spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.« Wieder schlug er das Kreuzzeichen. »Sprich vor der Mutter Gottes ein Ave Maria und versuche, die Bitterkeit aus deinem Herzen zu verbannen. Die Gottesmutter wird für dich beten.« Er schaute sie an. »Und ich werde es auch tun.«
Clara erhob sich. »Lohnt sich diese Mühe bei mir denn überhaupt?«
»Keiner ist verloren«, sagte der Priester. »Ich kann eine gequälte Seele nicht sich selbst überlassen. Ich werde dich in meine Gebete mit einschließen. Und Christus wird dir verzeihen.«
»Gut«, sagte Clara. »Doch wenn ich dem Täter begegnen sollte, werde ich ihm mit Sicherheit nicht verzeihen.« Sie erhob sich, während der Priester sie aufmerksam anschaute.
»Ich werde ihn töten.«
Clara Vidalis, Hauptkommissarin beim Morddezernat des LKA Berlin und Expertin für Forensik und Pathopsychologie, erhob sich und verließ den Beichtstuhl mit schnellen Schritten, bevor die Tränen ihr die Stimme nahmen.
2.
Das Internet ist ein allgegenwärtiges, weltumspannendes Netzwerk, das die Kommunikation von jedem mit allen ermöglicht, den beinahe gedankenschnellen Austausch von Informationen, der die Welt gleichsam auf die Größe eines Computerchips schrumpfen lässt. Die Menschen reden nicht mehr miteinander, sondern mit Webseiten, sie treffen sich nicht mehr, sondern tauschen sich über soziale Netzwerke aus. Sie setzen sich Reizen aus, die auf die gleichen Nervenbahnen im Hirn einwirken wie Nikotin und Kokain. Elektronische Drogen. 60 Milliarden E-Mails werden täglich weltweit verschickt, eine digitale Kakophonie der Kommunikation, die die Lebenswelt der Menschen immer mehr aus der Wirklichkeit in eine künstliche Welt aus Bits und Bytes verlagert.
Frühere Endgeräte musste man mittels klobiger Knöpfe bedienen, während die heutigen iPhones und iPads gestreichelt und liebkost werden wollen wie eifersüchtige Geliebte, die niemanden neben sich dulden.
Und so, wie jeder Himmel seine Hölle hat, schafft das Internet sich seine eigene Schattenwelt und seine eigene Negierung der vernetzten und scheinbar aufgeklärten Gesellschaft.
Denn das Internet ist nicht nur das größte Kommunikationsmedium und der umfassendste Wissensspeicher aller Zeiten. Das Internet ist zugleich der größte Tatort der Welt. Von Kinderpornos bis zu Horrorclips – echt oder gestellt –, von Anleitungen zum Suizid bis zu Bauanleitungen für Bomben, von Happy-Slapping-Videos zu Aufnahmen tödlicher Unfälle und Katastrophen bis hin zu Bildern betrunkener Jugendlicher, die in einer Ecke liegen, nackt inmitten der eigenen Exkremente und für alle Welt sichtbar, ist das Internet ein moderner Pranger voller Obszönitäten und Abartigkeiten, eine Schattenwelt, in der sich die dunkelsten Begierden, die perversesten Abgründe und die grausamsten Phantasien manifestieren.
Die Website giftgiver.de war eine dieser Seiten. In homosexuellen SM-Kreisen ist ein »Giftgiver« ein Mann, der bei ungeschütztem Analverkehr das HIV-Virus überträgt. Die Krankheit in sich zu tragen, sie weiterzugeben und andere zu infizieren – eigentlich ein Akt des Verbrechens – wird bei den Giftgivers als Tugend betrachtet. Ein Schneeballsystem der Perversion, in dem man nur weitergibt, aber niemals erlöst wird.
Jakob war einer der User, die fast täglich auf giftgiver.de ihre bizarren Phantasien auslebten, Kontakte knüpften und sich für Sexorgien und schäbige Parkplatz-Treffs verabredeten. Jakob war längst »gestochen« worden, wie die Entjungferung von Männern in der Szene genannt wird. Irgendwann hatte er sich bei ungeschütztem Analverkehr auf einer dunklen Kellerparty das HIV-Virus eingefangen. Seitdem war er selbst ein Giftgiver, der nicht nur das Virus in sich trug, sondern selbst ein tödlicher Erreger war.
Jakob war außerdem ein »Sub« oder »Bottom« – einer, der sich benutzen, quälen, erniedrigen ließ. Er spielte die »Frau«, bei Gangbangs, befriedigte andere mit dem Mund und ließ sich schlagen, fesseln und bespucken. Es erregte ihn sogar, wenn andere auf ihn urinierten. Die anderen, das waren die »Dominanten«, die »Doms« oder »Tops«.
Doch irgendwann reichte ihm selbst das nicht mehr. Nachdem er die verschiedensten sadomasochistischen Phantasien ausgelebt hatte, wollte er bis an die Grenzen gehen: Er wollte sich fesseln und mit einem Skalpell schneiden lassen. Jakob wusste selbst nicht, ob diese Phantasie schon immer in ihm gelauert hatte wie ein verborgener, tückischer Dämon, oder ob die ständige Beschäftigung mit der virtuellen Hölle der SM-Seiten diese Begierde in ihm geweckt hatte.
Schließlich gab er bei giftgiver.de folgende Anzeige auf:
Geiler Boy, 31, 182, 78. Rasiert, schlank. Schwanz 17/5. Möchte von attraktivem Dom gequält werden, vielleicht mit Messern? Mache alles mit, nur keine Verstümmelung etc. Melde dich.
Noch am selben Tag erhielt er die Antwort:
Dom, 39, 191, 90. Fessle dich mit Handschellen ans Bett, dann besorg ich es dir mit Skalpellen. Du kannst sie auf einer Website bestellen (Anhang). Gefällt dir mein Foto?
Der Fremde sandte Jakob ein Foto, das nur seinen trainierten Körper zeigte; sein Gesicht war hinter einer schwarzen Maske verborgen. Aber der athletische Körper gefiel Jakob. Außerdem schickte er Jakob ein Formular, das ihn als Arzt und Geschäftskunden auswies, sodass er die Skalpelle auf einer Website für Chirurgiebedarf bestellen konnte. Jakob entschied sich für Einwegskalpelle mit grünem Plastikgriff.
Eine erregende Mischung aus Furcht und Lust erfüllte ihn, als er auf der Website auf den »Bestellen«-Knopf drückte, nachdem er seine Kreditkartennummer eingegeben hatte. Was, wenn der Fremde die Grenzen nicht einhielt? Wenn er, Jakob, ihm hilflos ausgeliefert wäre? Seltsamerweise erregte ihn dieser Gedanke umso mehr.
Als nach vier Tagen die Skalpelle kamen, schrieb Jakob wieder eine Mail:
Skalpelle sind da. Wann kommst du?
Umgehend erschien die Antwort:
Bin in einer halben Stunde bei dir. Lass die Wohnungstür auf, damit ich reinkann. Fessle dich mit einer Handschelle ans Bett. Alles andere erledige ich. Mach ein Foto von dir und schick es mir auf meine Nummer, damit ich sehe, dass du alles richtig gemacht hast.
Jakob knipste das Foto und schickte es an die Mailadresse, die er erhalten hatte.
Nach wenigen Minuten hatte er alles vorbereitet und sich mit einer Hand ans Bett gefesselt. Die Wohnungstür ließ er offen. Die Skalpelle lagen bereit.
Dann begann das Warten.
Endlich hörte er Schritte auf dem Flur.
Eine Mischung aus Lust, Erregung und Angst erfasste ihn.
3.
Albert Torino stellte seinen Blackberry auf Empfang, stopfte seine Papiere und den Laptop in seine schlangenlederne Aktentasche und ging mit wackligen Beinen über den Gang der Boeing 747, die soeben aus São Paulo in München gelandet war. Er zog seinen Rollkoffer aus der Gepäckablage über sich und ließ sich von der Flugbegleitung sein dunkelblaues Nadelstreifensakko geben, während er sich gleichzeitig ein Aspirin einwarf, zerkaute und die bitteren Krümel ohne Wasser schluckte. Er hatte kaum geschlafen, wie fast immer, wenn er die Nacht im Flugzeug unterwegs war. Und das, obwohl man in der Business Class seinen Sitz in ein Bett verwandeln konnte und sogar noch Kissen, Decken, Kulturbeutel und weiteren Firlefanz gestellt bekam, auf den die Gäste hinten im Viehtransport gefälligst zu verzichten hatten.
Vielleicht liegt es daran, überlegte Torino, dass man dadurch, indem man sich ganz auf den Schlaf einstellt, eine Erwartungshaltung erzeugt, die das, was man erreichen will, eben nicht eintreten lässt – nämlich den Schlaf.
Sonst konnte Torino überall gut schlafen, besonders bei Marketingpräsentationen irgendwelcher Werbefuzzis, die seiner Firma mal wieder überflüssige Brandingkampagnen andrehen wollten.
Er genoss den bitteren Geschmack des Aspirins, der sich in seiner Mundhöhle ausbreitete. Tatsächlich schien der Kopfschmerz ein wenig nachzulassen.
Albert Torino war Medienmanager. Nachdem er ein paar Jahre bei großen Privatsendern gearbeitet hatte und dort für einige ebenso umstrittene wie erfolgreiche Formate verantwortlich gewesen war, hatte er seine eigene Firma gegründet, die Integrated Entertainment, bei der ihm kein hirnloser Verwaltungsrat hereinreden und keine impotenten Controller etwas verbieten konnten. Er war der Boss; die Finanzierung für sein nächstes Projekt stand zu 80 Prozent, und seine Idee war brillant: In Brasilien suchten sie Straßenjungen aus den Slums von São Paulo, trainierten sie und hetzten sie beim Ultimate Fighting in Käfigen aufeinander. Die Zuschauer konnten vorher ihren Favoriten auswählen und bestimmen, wer gegen wen kämpfen sollte.
Dasselbe, hatte Torino sich überlegt, könnte man auch mit einem Superstar-Format machen. Die Waffen der Straßenjungs sind ihre Fäuste, die der Frauen ihr Aussehen. Lass die Girls mit ihren Waffen gegeneinander antreten wie die Ultimate Fighter aus den Slums, nur eben mit ihrer Schönheit und weiblicher List statt mit den Fäusten, und lass das Publikum entscheiden, wer die Schönste ist. Und der Zuschauer, der die richtige Frau gewählt hat, kann etwas Außergewöhnliches gewinnen.
Was?
Na, was wohl?
Torinos Idee würde die Medienlandschaft erschüttern. Deutschland war New Orleans, und er war der Hurrikan Katrina.
Die Stewardess am Ausgang nickte ihm zu, während er sie von oben bis unten musterte. Schnuckelig, dachte er, wenn auch nicht vergleichbar mit dem, was in Brasilien herumläuft. Aber wir leben ja auch im verkniffenen Deutschland.
Er durchquerte den Gang, wobei er Rollkoffer und Ledertasche hinter sich herzog, während der Geschmack des Aspirins allmählich aus seinem Mund verschwand. Das Kinn vorgereckt, während seine braunen Augen unruhig umherhuschten, erweckte Albert Torino den Eindruck, überall dabei sein zu wollen und ständig in Sorge zu sein, etwas Wichtiges zu verpassen. Er bewegte sich mit der fast schon grazilen Eleganz und Leichtigkeit, die eigentümlicherweise vielen untersetzten Menschen eigen ist. Die schwarzbraunen Haare gegelt und nach hinten gekämmt, die Haut braun gebrannt, konnte er fast als Sunnyboy durchgehen, wären da nicht die paar Kilo zu viel auf den Rippen gewesen, die der Sieg von gutem Essen und Wein über Diät und Fitnessstudio mit sich brachte.
Er nestelte mit der linken Hand den Ohrhörer seines Blackberrys aus der Tasche und steckte ihn ins Ohr. Fünfzehn neue Nachrichten. Wie jedes Mal nach einem Zwölfstundenflug. Nachdem er die letzte Nachricht abgehört hatte, hellte seine Miene sich auf. Tom Myers war da.
Torino beschleunigte seine Schritte, während er das Kinn noch weiter nach vorn reckte und die Lufthansa Senator Lounge ansteuerte.
4.
Der Mann war von Kopf bis Fuß in einen schwarzen Latexanzug gekleidet. Darüber trug er einen schwarzen Mantel. Er war groß, mindestens eins neunzig, mit sportlicher Figur. Seine Bewegungen waren geschmeidig und nahezu geräuschlos, wie man sie bei Kampfsportlern beobachtet – eine pantherhafte Leichtigkeit, die binnen eines Wimpernschlags in explosive Brutalität umschlagen kann. Über einer schwarzen Latexmaske trug er eine Gummibrille; in den Händen, die in Gummihandschuhen steckten, hielt er zwei große schwarze Sporttaschen.
Er zog die Tür mit dem Fuß zu und durchquerte mit schnellen Schritten den Korridor.
Jakob lag auf dem Bett, die linke Hand an das Gitter gefesselt. Aus der Hi-Fi-Anlage dröhnte Sweep von Blue Foundation.
»Ich werde dir einen Höhepunkt verschaffen, wie du ihn noch nie erlebt hast«, sagte der Mann, bewegte sich mit insektenhafter Geschwindigkeit ans Bett und ließ die zweite Handschelle um Jakobs freies Gelenk zuschnappen. Sein Blick schweifte durch das große Zimmer. Zuerst blickte er auf den Laptop, der auf dem Schreibtisch stand. Die Giftgiver-Seite war geöffnet, ebenso Jakobs Profil. Der Mann ging zur Stereoanlage, drehte die Musik lauter, huschte dann wieder zum Bett und zog Jakob einen breiten Streifen schwarzes Isolierklebeband über den Mund, bevor dieser überhaupt wusste, wie ihm geschah.
Jakob wurde mulmig zumute. Was, wenn er an den Falschen geraten war? Zugleich erregte ihn die Unsicherheit, und Wellen von Adrenalin zogen ekstasegleich durch seine Adern.
Der Mann ging zum Tisch und brach eines der Einwegskalpelle aus der Plastikverpackung. Dann öffnete er eine der zwei schwarzen Sporttaschen und holte eine Edelstahlschale hervor, wie sie im Krankenhaus verwendet wird, außerdem zwei kleine Plastikeimer.
Was geht hier ab?, fragte sich Jakob, halb ängstlich, halb in erwachender Ekstase. Klinikspielchen? Fäkalerotik? Was will der Typ mit den Eimern?
Jakob hatte den Gedanken kaum zu Ende geführt, als der Fremde ihm auch schon mit beängstigender Routine beide Füße mit Handschellen an das Bett kettete.
Ein neuer Song lief auf der CD, Poker Face von Lady Gaga. Er hörte die erste Strophe.
Russian Roulette is not the same without a gun.
Er näherte sich Jakob, das Skalpell in der rechten, die Metallschale in der linken Hand. Er ließ die stumpfe Seite des Skalpells über Jakobs nackten Oberkörper gleiten. Jakob stöhnte dumpf und bekam eine unglaubliche Erektion. Dann drehte der Fremde das Messer um und führte es mit leichtem Druck über Jakobs Oberkörper, wo es eine dünne, blutige Spur hinterließ. Jakob bebte vor Lust.
And baby when it’s love, if it’s not rough, it isn’t fun.
»Du wirst dich immer an mich erinnern«, sagte der Mann.
Noch bevor Jakob sich fragen konnte, wie diese Bemerkung gemeint war, zog der Fremde mit der Klinge einen längeren und tieferen blutigen Schnitt über Jakobs Brust. Jakob schrie vor Lust. Als der Fremde einen dritten Schnitt machte und gleichzeitig über die pralle Wölbung in Jakobs Hose streichelte, bekam Jakob einen heftigen Orgasmus.
Der Fremde sprach weiter. »Denn ich werde der Letzte sein, den du siehst.« Mit diesen Worten, bei denen Jakob ekstatisch in seine Hose ejakulierte und fast besinnungslos wurde, bewegte der Fremde das Skalpell mit einem schnellen Stoß nach vorne und schnitt Jakob die Halsschlagader durch. Jakobs Augen blickten verstört zur Seite, gleichermaßen mit Überraschung und Schock erfüllt. Blut schoss in pulsierenden Fontänen hervor, ein neuer Orgasmus des Todes, der dem anderen auf die Sekunde folgte, während Jakob gutturale Laute durch das Klebeband hindurch von sich gab, die zusammen mit der lauten Musik eine bizarre Geräuschkulisse bildeten. Er versuchte, sich zu erheben, doch der Fremde presste seinen Körper mit unglaublicher Kraft auf das Bett. Blut spritzte auf Teppich und Nachtschrank, auf dem zerfledderte Pornomagazine und DVDs lagen. Dann bog er Jakobs Kopf mit brutaler Energie zur Seite, um das Blut in die Metallschale abfließen zu lassen.
Als die Schale und die Plastikeimer fast voll waren, erschlaffte Jakobs zuckender Körper. Alles Leben erlosch in seinen weit aufgerissenen Augen, in denen sich zuvor Erstaunen und Entsetzen gleichermaßen gespiegelt hatten.
Der Fremde ging zum Laptop, klickte sich durch die Seiten, machte sich ein paar Notizen, klappte das Laptop zu und verstaute es in einer der beiden Sporttaschen, zusammen mit Akku und Wireless-Modem. Er öffnete die zweite Sporttasche und holte zwei Plastikbehälter hervor. Dann griff er wieder zum Skalpell und näherte sich der Leiche auf dem Bett.
Die Arbeit war noch nicht beendet.
Im Gegenteil.
Sie hatte gerade erst begonnen.
5.
Clara atmete tief durch, als sie zu der riesigen Deckenkuppel hinaufschaute, die sich hoch über ihr spannte und die ihr ein Gefühl der Freiheit und zugleich der Geborgenheit vermittelte. Sie kniff die Augen zusammen, um trotz der Tränen klar sehen zu können, während die Worte des Priesters in ihrem Kopf nachhallten: Um Vergebung zu finden, muss man anderen vergeben.
Was hatte dieser Geistliche wohl schon alles für Geständnisse gehört, die für immer in seinem Herzen verschlossen bleiben mussten und die er nur mit Jesus und mit Gott teilte, wie das Beichtgeheimnis es verlangte? Clara fragte sich flüchtig, ob der Mörder ihrer Schwester ebenfalls gebeichtet hatte. Dann gäbe es einen Priester, der wusste, wie der Mörder aussah, was er getan hatte, und vielleicht sogar wo er zu finden war. Gab es also jemanden, der alles wusste, es aber niemals verraten würde?
Clara vertrieb den Gedanken wie ein lästiges Insekt: Eine Bestie wie der Mörder ihrer Schwester hatte mit Gott bestimmt nichts am Hut.
Die Statue der Muttergottes, vor der Dutzende Kerzen brannten, erhob sich vor ihr zur Linken des Altars. Maria trug das Jesuskind im Arm; unter ihr glühte die Sichel des Mondes, während über ihr die Sonnenstrahlen leuchteten. Der Freund einer Freundin, ein Kunsthistoriker, hatte Clara einmal erklärt, dass die unbefleckte Maria in der Offenbarung des Johannes auf einer Mondsichel stand:
Und es erschien ein Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen.
Und sie war schwanger und schrie in Schmerzen des Gebärens. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen; sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu fressen.
Dieser Abschnitt hatte sich Clara auf seltsame Weise eingeprägt. Nicht nur, weil die Vorstellung eines gefräßigen Drachen, der ein unschuldiges kleines Kind verschlingen will, so erschreckend war, sondern weil Clara sich ständig an ihre eigene Situation erinnert fühlte, an ihre Schwester Claudia, auf die sich ebenfalls ein Drache des Bösen gestürzt hatte. Doch während in der Bibel das Kind vom Erzengel Michael gerettet wird, der den Drachen – den Satan – besiegt, hatte Claras Drache ihr alles genommen.
Wenn Gott wirklich so gütig ist, wie die Kirche behauptet, warum interessieren wir Menschen ihn dann so wenig?, fragte sich Clara. Wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Ist Leben immer Leiden? Und wenn das Leben die Folter des Körpers ist, ist die Hölle dann die Folter der Seele?
Clara verharrte schweigend vor der Marienstele, während die Kerzen das Halbdunkel des Kircheninneren in einen Flickenteppich aus Licht und Dunkel verwandelten.
Maria, dachte sie. Der einzige Mensch in der Geschichte der Schöpfung, der angeblich vollkommen rein und ohne Sünde gelebt hat. Und die Beförderung folgte prompt: Mutter des Gottessohnes, Königin des Himmels.
Doch wenn es überall so viel Reinheit gäbe, müsste Clara sich einen neuen Job suchen.
Sie warf einen Euro in den Messingbehälter und zündete gleich zwei Kerzen für Claudia an. Ich werde dich nie vergessen, sagte sie in Gedanken, während sich zwei weitere Lichter dem Flickenteppich der Farben im halbdunklen Gewölbe hinzugesellten.
Ein metallisches Geräusch ließ Clara zusammenzucken. Ein großer, kräftiger Mann warf ebenfalls Münzen in den Behälter und zündete eine Kerze an. Seine Bewegungen besaßen eine Geschmeidigkeit, wie Clara sie bei Mitgliedern von Sondereinsatzkommandos gesehen hatte. Seine Haare waren blond und sehr kurz geschnitten, und er trug eine Brille aus mattem Edelstahl.
»Wahre Schönheit ist immer unnahbar, nicht wahr?«, sagte er, schaute auf die Marienfigur und blickte dann Clara an. Seine linke Hand zuckte ein wenig, als er die Kerze auf den Boden stellte.
Clara nickte bloß. Der Mann war nicht unsympathisch, aber ihr war nicht nach Reden zumute.
Der Mann schien es zu bemerken. »Entschuldigung«, sagte er und trat zurück. »Ich wollte Sie nicht belästigen. Auf Wiedersehen.«
Clara verharrte vor der Statue und blickte dem Fremden hinterher, während die zwei Kerzen, die sie angezündet hatte, flackerndes Licht und huschende Schatten auf das Antlitz Marias warfen.
6.
Alles ekelt mich an. Die Menschen, das Leben und ich mich selbst. Manchmal glaube ich, ich bin schon seit Jahren tot, und man hat nur vergessen, mich zu begraben. Vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte den Selbstmord, den ich damals am See vorgetäuscht habe, wirklich begangen. Damals habe ich einen Abschiedsbrief geschrieben, bin ins Wasser gestiegen, weit hinausgeschwommen und habe meine Jacke in der Mitte des Sees gelassen. Dann zurück zum Ufer – und dann habe ich das Heim nie wiedergesehen. Seitdem halten mich alle für tot, und so soll es auch sein.
Vielleicht bin ich ja wirklich tot. Vielleicht ist das, was ich jetzt für die Wirklichkeit halte, nur ein Traum. Und falls ich noch lebe, soll ich jetzt Ernst machen? Eine Überdosis Insulin oder Schlaftabletten, ein stabiler Balken und ein Strick an der Decke, ein schneller Schnitt mit einer Rasierklinge?
Aber ich habe eine Mission zu erfüllen. Das Mädchen heißt Jasmin. Sie hat heute bei Facebook in die Welt posaunt, dass sie übers Wochenende nach Hannover fährt. Also kann ich in ihrer Wohnung ungestört alles vorbereiten. Ich habe sie am Hauptbahnhof gesehen. Viele haben sie gesehen, und viele haben ihr mit gierigen Blicken hinterhergestarrt. Denn sie sah aus wie Elisabeth damals. Schön, blond und strahlend.
Auch der Kerl Ende zwanzig, mit dem sie am Bahnhof einen Kaffee getrunken hat, war scharf auf sie. In den Augen dieses Typen habe ich gesehen, dass er die Blonde haben wollte, unbedingt, doch in der dumpfen Verzweiflung, die hinter der Gier in seinem Blick schlummerte, lag Hoffnungslosigkeit. Der Kerl wusste, dass er die Blonde niemals kriegen wird. Er wusste, dass sie wahrscheinlich froh war, als sie zum Zug musste und einen Grund hatte, ihn loszuwerden.
Warum hatte der Kerl sich überhaupt mit ihr getroffen? Er muss doch gewusst haben, dass die Begegnung eine Begierde in ihm weckt, die nie gestillt werden kann und die ihn für lange Zeit unglücklich machen würde.
Vielleicht reichte es ihm ja, sich der Illusion hingeben zu können, die Frau seiner Träume wenigstens getroffen zu haben –, auch in dem Wissen, dass er nie seinen Schwanz in sie reinbekommen wird. Oder er wollte vor sich selbst nicht als Versager dastehen, der eine Chance ungenutzt lässt, auch wenn sie noch so jämmerlich gering ist. Wahrscheinlich hat er sie ohnehin nur getroffen, um beim Masturbieren mal wieder ein klares Bild vor Augen zu haben.
Ob der Typ auch mal ein Killer wird? Einer, der die lebendige Frau im Café eintauscht gegen eine aufgeschnittene und ausgeweidete Leiche, weil tote Frauen nicht Nein sagen? Ich werde es nie erfahren, aber der Gedanke ist interessant.
Jasmin kommt am Sonntagabend zurück. Das steht nicht bei Facebook, sondern in ihrem bahn.de-Konto, in das ich mich eingehackt habe. Deshalb werde ich am Sonntag mein Haus verlassen. Ich werde Jasmin in ihrer Wohnung erwarten. Und ich werde sie töten.
7.
Die Abenddämmerung hatte den Himmel in ein ähnliches Farbenmeer verwandelt wie die Kerzen das Kirchengewölbe in der Sankt-Hedwigs-Kathedrale. Clara stieg in ihren Dienstwagen, einen schon ziemlich betagten Audi, fuhr die Allee unter den Linden hinunter und bog nach links in die Friedrichstraße ab, Richtung Tempelhof, zur Zentrale des LKA Berlin.
Clara arbeitete bei der Mordkommission, in der Abteilung für Forensik und Pathopsychologie, die vor Kurzem aufgestockt worden war. Je größer eine Stadt, desto mehr Geistesgestörte gab es dort, und Berlin machte da keine Ausnahme. Also wollte der Senat auf diesem Feld nicht untätig erscheinen.
Clara würde noch ungefähr zwei Stunden im Büro sein, einen Kollegen treffen, ein paar Akten zu ihrem alten Fall abarbeiten und dann nach Hause fahren. Bis auf den 23. Oktober, der ihr schon während der vergangenen Tage zu schaffen gemacht hatte, war die Woche ausgesprochen entspannt verlaufen, was auch nötig gewesen war. Der letzte Fall, den sie gemeinsam mit Kriminaldirektor Winterfeld gelöst hatte, ihrem Vorgesetzen und Chef der Mordkommission, war die Jagd auf den »Werwolf« gewesen, einen psychopathischen Killer, der eine blutige Schneise durch Berlin gezogen hatte. Er hatte in Berlin sieben Frauen auf bestialische Weise getötet, Vergewaltigung vor und nach dem Tod inklusive. Der Fall hatte bei allen Beteiligten die Nerven bis zum Zerreißen strapaziert, zumal der Polizeipräsident befohlen hatte, die Presse strikt aus dem Fall herauszuhalten, was die Sache nicht gerade leichter gemacht hatte.
Clara lenkte den Wagen in die Friedrichstraße und fuhr auf die großen kastenförmigen Bürogebäude zu, die sich zwischen den klassizistischen Fassaden der alten Stadthäuser erhoben.
Mit Winterfeld, 59 Jahre alt und in zweiter Ehe geschieden, hatte Clara schon oft zusammengearbeitet. Ganz durchschaut hatte sie ihn aber noch immer nicht. Einerseits ein knallharter Pragmatiker, der keinen Firlefanz duldete, behauptete er allen Ernstes, so etwas wie ein Zweites Gesicht zu haben. Sein Meisterstück hatte er abgeliefert, als er – damals noch in Hamburg – den »Tütenmörder« gefasst hatte, einen Päderasten, der Kindern Plastiktüten über den Kopf gezogen hatte, während er sie vergewaltigte. Es hatte diesen Mann erregt, wie die Gegenwehr der Kinder wegen des Sauerstoffmangels immer mehr erlahmte, bis sie bewusstlos wurden und starben, während er sich an ihnen verging. Der Mann war Berufsschullehrer gewesen, einer von den Typen, die das Weihnachtskonzert an der Schule organisieren und jeden Morgen als Erste den Schnee vor ihrem Haus fegen. Ein richtiger Biedermann.
Hannah Arendt hatte den Begriff der »Banalität des Bösen« geprägt. John Wayne Gacy war so ein unscheinbarer Vertreter gewesen. Heinrich Himmler ebenfalls. Und Klaus Beckmann, der Tütenmörder, gehörte auch dazu.
Winterfeld hatte Clara damals unter seine Fittiche genommen, gemeinsam mit Sarah Jakobs, einer ebenfalls begabten jungen Kommissarin, die ein paar Jahre später als Clara beim LKA angefangen hatte, dann allerdings zum Dezernat für Wirtschaftskriminalität abgewandert war. Clara hatte sie lange Zeit nicht gesehen. Es ging das Gerücht, Sarah habe irgendeine Riesengeschichte aufgedeckt und lebe jetzt mit neuer Identität an einem unbekannten Ort, bis Gras über die Sache gewachsen war.
Sarah war so etwas wie Claras kleine Schwester, allerdings die »große kleine Schwester«. Die dunkelblonde, braunäugige Frau wirkte wie das Gegenstück zur schwarzhaarigen, blauäugigen Clara, der man den südeuropäischen Einfluss ansah. Tatsächlich strömte italienisches, spanisches und deutsches Blut in ihren Adern.
Sie vermisste Sarah in der von Männern dominierten Welt, in der sie arbeitete. Die meisten Kommissare und leitenden Beamten waren Männer, genau wie der Großteil der Täter. Oft hatte Clara an lauen Sommerabenden mit Sarah auf ihrem Balkon in der Schönhauser Allee gesessen, ein Glas Weißwein getrunken und sich unterhalten, während unten das Leben brodelte. Es gab nichts, das mehr nach Sommer aussah als die Farbe von gekühltem Weißwein in einem von der Kälte beschlagenen Glas im Gegenlicht der untergehenden Sonne, und für Clara war es der Inbegriff von Entspannung. Keine Kellner, die einen stundenlang warten ließen. Keine Touristen, die sich mit vollen Rucksäcken und dicken Hintern an den Stühlen der Cafés vorbeidrängten. Keine nervige Musik, mit der der Barkeeper die Gäste bespaßen zu müssen glaubte. Nur ein Tisch, zwei Stühle und Weißwein, während unten auf der Straße die Leute unterwegs waren, Nachbarn sich unterhielten und Fahrradklingeln rasselten. Aus offenen Autofenstern dröhnte Musik, die jäh leiser wurde, sobald die Wagen an den Ampeln beschleunigten, dies alles untermalt vom Zwitschern der Spatzen und dem Gurren der Tauben.
Sie hatten über ihre Fälle gesprochen, hatten sich über korrupte Wirtschaftsbosse, Schmugglerringe und Menschenhandel, über Raubmord, Tötungen im Affekt und Serienkiller unterhalten. Oft hatten sie aber auch über ganz normale Dinge gesprochen: über die Bücher, die sie zurzeit lasen, über Ausstellungen, die gerade in der Stadt zu sehen waren, und natürlich über Männer, bei denen die netten leider meist langweilig waren und die, die nicht langweilig waren, immer schon mit einem Fuß im Bett der Nächsten standen.
Auf Höhe der Choriner Straße, wo Clara wohnte, kroch von Zeit zu Zeit die U-Bahn aus dem Untergrund, um dann hoch über der Straße auf einem Stahlgerüst ein paar hundert Meter dahinzurollen und kurzzeitig von der U-Bahn zur S-Bahn zu werden, bevor sie auf Höhe der Bornholmer Straße wieder im Boden verschwand.
Clara musste an Vincent denken, den Freund Sarahs, der an einem ihrer gemeinsamen Sommerabende eine Horrorgeschichte von H. P. Lovecraft erzählt hatte: In der Antarktis entdeckten Forscher in einer unterirdischen Höhle einen gigantischen Wurm, der durch Tunnel unter dem Eis kroch und durch seine schiere Größe dafür sorgte, dass mehrere Teammitglieder den Verstand verloren. Das Ding, das nicht sein darf, hatte Lovecraft den Wurm genannt. Einer der Forscher, der am Ende der Geschichte in der Irrenanstalt landete, konnte bis zu seinem Lebensende nur noch die New Yorker U-Bahn-Stationen von Battery Park bis Central Park herunterbrabbeln. Es ist aber nicht der Wurm, der am Ende unheimlich ist, hatte Vincent gesagt, es ist die U-Bahn. Die moderne Welt versucht, die Ungeheuer der Vergangenheit zu überwinden, schafft aber neue Geister, die vielleicht sogar noch schrecklicher sind.
Clara hatte verstanden, was Vincent meinte, als wieder eine U-Bahn donnernd aus ihrem unterirdischen Reich hervorgeschossen war wie ein gigantischer Aal, der ein Insekt auf der Wasseroberfläche verschlingen will. Die Archetypen, hatte Vincent gesagt, sind tief in uns verwurzelt. Wir wissen, dass es keine Ungeheuer gibt, fürchten uns aber vor ihnen, weil diese Urangst so alt ist wie die Menschheit selbst.
Clara steuerte den Wagen vorbei am Tempelhofer Ufer, fuhr den Mehringdamm stadtauswärts, parkte den Wagen in der Tiefgarage des LKA und betrat den Aufzug. Während sie über den Flur im dritten Stock ging, hörte sie die Mailbox ihres Handys ab. Nichts Wichtiges, Gott sei Dank.
Sie ging in die Küche und schenkte sich an der uralten, rumpelnden und röchelnden Kaffeemaschine einen Becher ein. Sie hatte sich abgewöhnt, Kaffee anders als schwarz zu trinken, jedenfalls, wenn sie auf der Arbeit war. Schwarzen Kaffee gab es überall; man musste nicht umständlich nach Milch fragen, die ohnehin meist sauer war, und Zucker und Süßstoff waren entweder schlecht für die Zähne oder die Figur oder beides. Was nicht bedeutete, dass Clara sich nicht bei Starbucks mal einen übercremigen, übersüßten Caramel-Macchiato gönnte, aber Dienst war Dienst und Starbucks war Starbucks.
Clara wollte gerade die Küche verlassen, als sie schwere Schritte auf dem Flur hörte. Kriminaldirektor Winterfeld kam ihr entgegen, den obersten Hemdknopf offen, die Krawatte gelockert, in der Hand eine Packung La-Paz-Zigarillos, die er umständlich öffnete, während seine gebogene Adlernase die Luft auf dem Gang durchschnitt wie der Bug eines Schiffes das Wasser und der Blick aus seinen blauen Augen auf Clara gerichtet war.
»Ah, Señora Vidalis«, sagte er, fuhr sich mit der Hand durch seine kurzen grauen Haare und öffnete bedächtig das große Fenster gegenüber der Kaffeeküche, um wieder mal »nach draußen zu rauchen«, wie er es nannte. Es hatte immer etwas sehr Feierliches, wie Winterfeld das Fenster aufmachte, beinahe wie ein Priester, der das Tabernakel öffnet, um die geweihten Hostien für die Eucharistie herauszunehmen.
»Leisten Sie einem alten Mann Gesellschaft«, fuhr er fort, während er das Fenster ganz öffnete und der kühle Herbstwind in den Flur wehte. Winterfeld atmete die frische Luft ein, die schon ein wenig nach Schnee und Winter roch, um gleich darauf den Zigarillo zu entzünden und Rauchwolken in die Abendluft zu pusten.
Sie standen eine Zeit lang nebeneinander. Clara hielt den Kaffeebecher mit beiden Händen und genoss die wohlige Wärme, während die Herbstluft sie ein wenig frösteln ließ. Winterfeld blies dabei beinahe meditativ und in kurzen Abständen Rauch in die Abenddämmerung.
»Heute ist der Dreiundzwanzigste«, sagte er schließlich, ohne Clara anzuschauen. »Sie müssen nicht darüber reden, aber ich hoffe, es geht Ihnen einigermaßen gut.« Winterfeld kannte Claras Geschichte.
»Ja, ich war wieder beichten«, sagte Clara und trank den Kaffee in kleinen Schlucken. »Ich weiß gar nicht, warum ich das immer wieder tue, aber es geht mir danach tatsächlich ein bisschen besser. Jedenfalls hilft es mehr als das Yoga, das ich auch mache.« Sie bewegte die Schultern auf und ab. »Ich bin beim Yoga bald so weit, dass ich mir selbst den Arm auskugeln kann, aber ruhiger macht es mich nicht.«
»Kann nützlich sein, das mit dem Armauskugeln, aber die Idee mit der Beichte ist auch nicht schlecht«, sagte Winterfeld. »Die Brüder«, damit meinte er die katholische Kirche, »haben in gewisser Weise die Psychoanalyse erfunden. Das mag den Agnostikern nicht passen, ist aber so. Sich einfach alles von der Seele reden – so läuft das bei der Kirche, und so läuft es auch bei Freud. Du musst es sagen, du musst es aussprechen, dann geht es dir besser.« Er blickte Clara an. »Wie oft hatten wir hier schon Mörder, die sich freiwillig gestellt haben, weil sie es nicht mehr aushielten, mit ihrer Schuld allein zu sein?«
Clara nickte. »Wie sagte der Kollege vom FBI, der letztes Jahr hier war? Not everyone is built for guilt.«
»Wo er recht hat, hat er recht«, sagte Winterfeld und zog an seinem Zigarillo.
Wieder schwiegen beide eine Zeit lang.
»Was ich noch sagen wollte …«, Winterfeld fuhr sich durch die Haare und paffte an seinem Zigarillo. »Sie haben bei der Fahndung nach dem Werwolf hervorragende Arbeit geleistet. Ein so unorganisierter, animalischer Täter ist mir noch nie untergekommen. Ich will gar nicht wissen, wie die Gerichtsverhandlung abgelaufen wäre.« Winterfeld zuckte die Schultern. »Na ja, nun liegt unser Freund erst mal im Kühlraum in Moabit und nächste Woche dann eins achtzig tiefer. Dann kann er ein bisschen in sich gehen.« Ein leichtes Lächeln umspielte seine Lippen, als er sich wieder Clara zuwandte. »Ich soll Ihnen auch von Bellmann Glückwünsche ausrichten. Sie kennen ja den alten Spruch: Wenn Wasser bergauf fließt, bedankt sich jemand für einen Gefallen, und Bellmann ist da bestimmt keine Ausnahme, aber diesmal scheint es ihm ernst zu sein. Er will unbedingt noch mal mit Ihnen reden und Ihnen persönlich für den großartigen Job danken. Wie lange sind Sie noch hier?«
»Bis Freitag«, sagte Clara. Noch zwei Tage, um den Fall abzuschließen und den Papierkram zu erledigen, dann war erst einmal Urlaub angesagt. Zwei Wochen. Sie wusste noch nicht wohin. Wahrscheinlich Last Minute. Irgendwo. Irgendwie.
»Er wird noch mal vorbeikommen. Bis morgen Mittag ist er in Wiesbaden beim BKA, aber dann stehen Sie ganz oben auf seiner Prio-Liste.«
»Das freut mich«, sagte Clara, die gegenüber Bellmann, dem Chef des LKA Berlin, stets gemischte Gefühle hatte. Er war ein hervorragender Organisator, aber wenn es mal nicht so lief, wie er es gerne gehabt hätte, konnte er sehr unangenehm werden, insbesondere, wenn er im Nachhinein davon erfuhr.
»Und?«, fragte sie dann und blickte Winterfeld spitzbübisch an. »Was macht Ihr sechster Sinn? Ich hatte damit gerechnet, dass Ihnen die Stille nicht gefällt, weil es keine Stille ist, sondern nur die Ruhe vor dem Sturm. Oder haben wir diesmal wirklich Stille?«
Winterfeld zuckte die Schultern und ließ die Asche drei Stockwerke nach unten fallen, wo sie zwischen Sträuchern und Heizungsrohren zerfaserte.
»Manchmal ist Stille wirklich Stille. Aber Sie haben recht. Meist ist sie nur die Lautlosigkeit des Laserpointers im Zielfernrohr, bevor der Schuss fällt.« Er atmete tief aus und schob die Zigarilloschachtel in seine Hosentasche. »Aber vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir wirklich ein bisschen Ruhe. Sie ja ohnehin, Sie machen Urlaub, und Hermann und ich werden den ganzen Papierkram erledigen, mit den Psycho-Typen über das Täterprofil des Werwolfs sprechen und dann hoffentlich ein geruhsames Wochenende haben.«
Hermann war Winterfelds Assistent und zudem ein Experte für Computerkriminalität, ein großer, schweigsamer Mann mit kahl geschorenem Kopf, der immer hundert Prozent präsent war, wenn es darauf ankam. Er konnte furchterregend aussehen – und es auch sein. Er kam Clara wie ein Grizzlybär vor, der immer genug Honig bekommen musste, damit er ein Teddybär bleibt.
Winterfeld stieß ein letztes Mal Rauch aus, zerdrückte den Zigarillo am Fenstersims und warf den Stummel in die Dunkelheit.
»Apropos Psychos«, sagte er dann, wobei er das Fenster wieder schloss. »Martin Friedrich ist noch im Büro. Sie wollten ihn doch kennenlernen. Morgen fliegt er nach Wiesbaden, um auf der Herbsttagung des BKA einen Vortrag zu halten, und ich weiß nicht, ob er vor Ihrem Urlaub zurückkommt.«
»Na, dann werde ich ihn mal besuchen«, sagte Clara und trank den Kaffee aus. »Vierter Stock?«
»Wo sonst?«
»Das klingt so, als gehöre er dorthin.«
Winterfeld blickte sie wieder an, ganz der erfahrene, gütige Lehrmeister, der er schon während ihrer Ausbildung gewesen war. »Die Vier«, sagte er, »ist bei den Chinesen eine Unglückszahl, weil sie ähnlich klingt wie das Wort für Tod.«
Clara lächelte. »Wieder was gelernt. War es schwer, diesen Bezug vom Zaun zu brechen?«
»Einfach war es diesmal nicht.« Winterfeld lächelte ebenfalls. »Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend!« Damit drehte er sich um und stapfte den Gang hinunter.
8.
»Entschuldigung«, sagte die Empfangsdame am Schalter der Senator Lounge, nachdem Torino schon drei, vier Schritte an ihr vorbei war. »Darf ich Ihre Karte sehen? Sind Sie Senator?«
»Was soll ich denn sonst sein?«, fragte Torino unwirsch und wedelte mit der Karte, als würde er eine Fliege verscheuchen. »Ein Schlangenbeschwörer?«
Er betrat die neue Senator Lounge. Nachdem die Lufthansa und der Flughafen fast zwei Jahre lang geheimniskrämerisch die Baustelle verriegelt hatten, war Torino mehr als enttäuscht, als er die neue Lounge sah. Was, zur Hölle, hatten diese Idioten eigentlich die ganze Zeit gemacht? Schnaufend stellte er Tasche und Rollkoffer ab und wiegte Ausschau haltend den Kopf hin und her. Das können sich auch nur deutsche Bauarbeiter und Handwerker erlauben, dachte er. Ab sieben Uhr morgens Krach machen, außer Pfusch nichts zustande bringen und am Ende eine Rechnung präsentieren, auf die jeder Investmentbanker neidisch wäre.
Er ließ den Blick weiter über die Lounge schweifen und entdeckte seinen Gesprächspartner. Tom Myers, Managing Director von Xenotech, hatte sich aus dem Olymp der HON-Travellers, dem höchsten Zirkel, reserviert für die besten Kunden der Lufthansa, in die Niederungen der Senator Lounge begeben – zum einen, weil Albert Torino »nur« Senator war, zum anderen, weil der Anteil der VIPs, die Gesprächsfetzen aufschnappen konnten, hier viel geringer war. Am besten war es ohnehin, man setzte sich gleich in die Business Lounge, wenn man ungestört sein wollte. Da saßen nur subalterne Vertriebschefs und Praktikanten von irgendwelchen Unternehmensberatungen, die allesamt nichts zu melden hatten.
Tom Myers war verantwortlich für die globale Strategie von Xenotech, dem größten Webportal der Welt. Xenotube, der Videokanal des Internetgiganten, war die meistbesuchte Videopage der Welt – ein Kanal, zu dem allein Myers den Schlüssel hatte wie ein Petrus des Internets.
Torino hatte Xenotube für sein neues Show-Format ins Auge gefasst. Nun würde er Myers bearbeiten müssen, da dieser von Torinos pornographischem Star-Aktienmarkt nicht allzu viel hielt, auch wenn er die Idee »prinzipiell in Ordnung« fand, wie er beteuerte. Verstanden, so glaubte Torino, hatte er sie allerdings immer noch nicht.
Myers – rotblond, mit blauen Augen und vorstehendem Kinn, das sich wie eine Klippe in die Lounge reckte – hatte das Gesicht in einer Financial Times vergraben, über deren Rand er von Zeit zu Zeit hinweglugte, um abwechselnd auf den Eingang der Lounge und die elektronische Tafel mit den Abflugzeiten der Flüge zu blicken.
»Albert«, sagte er und erhob sich, als er Torino erblickt hatte. »Here you are! How was your flight?«
»Work and pleasure in good measure«, sagte Torino und sprach auf Englisch weiter. »Habe die Präsentation für die Investoren fast fertig, Essen war okay, schlafen konnte ich wieder mal kaum.«
Myers wies mit einer Hand auf den Sessel neben sich, während Torino seine Tasche und den Koffer abstellte, sich am Automaten einen Cappuccino zog und sich neben Myers in den Sessel sinken ließ.
»Also«, begann Myers. »Kommen wir zur Sache, ich muss in zwanzig Minuten in den Flieger nach Frankfurt. Du willst einen Aufguss von American Idol oder Deutschland sucht den Superstar machen, richtig?«
»Quatsch.« Torino gab Zucker in seinen Cappuccino, während er ein wenig umständlich mit einem langen Löffel in dem Becher rührte. »Das ist alles Schnee von gestern. Die üblichen Star-Formate sind von Spießern gemacht, für die es schon ein Skandal ist, wenn jemand Sex vor der Ehe hat.«
»Das sagen sie alle.« Myers nippte an seinem Wasser. »Ich habe deine Mail nur überflogen, aber ich hab zumindest so viel verstanden, dass der User sich seinen Superstar selbst aussuchen kann.«
»Korrekt«, sagte Torino. »In den üblichen Formaten ist es so, dass dem Zuschauer die Kandidaten vor die Nase gesetzt werden, die dann von der Jury gesagt bekommen, dass sie nichts weiter sind als überflüssige Embryonalzellen, die sich lieber heute als morgen von der Brücke stürzen sollten. Für einen kleinen Bruchteil gilt das aber nicht – und die werden die neuen Stars.«
»Funktioniert ja auch nach wie vor«, sagte Myers.
»Ja, weil die Couch-Potatos da draußen in Zombieland«, er wies Richtung Tür der Senator Lounge, als würde dort eine andere Welt beginnen, »alles schlucken. Solange niemand mit etwas wirklich Neuem aufwartet, ist jeder mit dem gleichen Käse zufrieden, auch wenn es alter Käse ist, der schon tausend Mal umgedreht wurde.«
»Und?«
»Und?«, fragte Torino zurück. »Das hat doch nichts mit der vielbeschworenen Mitmachkultur der neuen Medien zu tun. Dem Zuschauer wird diktatorisch etwas vorgesetzt, was er vielleicht gar nicht sehen will. Nur weil es den Machern gefällt, heißt das nicht, dass es dem Zuschauer gefällt. Der Wurm«, Torino hob den Zeigefinger, »muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler!«
»Netter Vergleich«, sagte Myers. »Und weiter?«
»Gegenfrage«, erwiderte Torino. »Was denkst du als Zuschauer, wenn du zum Beispiel auf schlanke Models stehst, der Sender dir aber die Schwabbelkolonne von den Weight Watchers aufs Auge drückt? Oder du stehst auf Vollschlanke, aber im Fernsehen ist Miss Äthiopien angesagt?«
Myers reckte sein Kinn in Richtung Zeitungsstand und kaute auf der Unterlippe. »Vielleicht käme ich dann auf die Idee, dass ich gerne mal selber entscheiden würde, wer da auftaucht.«
»Genau«, sagte Torino. »Du willst als Zuschauer die Möglichkeit haben, dein eigenes Topmodel aussuchen zu können.«
»Das heißt, die Zuschauer setzen auf die richtigen Models? Wie beim Pferderennen?«
»Korrekt.« Torino nickte, während er in seinem Cappuccino rührte und einem Tross chinesischer Geschäftsleute hinterherblickte, die an ihnen vorbei Richtung Ausgang pilgerten. »Die Models können sich auf der Plattform eine eigene Website einrichten, auf der sie sich den Zuschauern präsentieren – so wie in diesen Kontaktforen, wo man Freundschaften, Sex oder was auch immer suchen kann. Gleichzeitig können die Zuschauer ihre Favoritin über diese Plattform auswählen und Punkte vergeben.«
»Und geboten wird mit Geld?«
»Womit denn sonst? Wir leben in der Wirklichkeit. Wer viel Geld auf eine Aktie setzt, bringt damit den Kurs in Bewegung, genau wie in der Sendung der Kurswert des jeweiligen Models nach oben geht. Die zwanzig Frauen, die am Ende den höchsten Kursstand haben, werden zum Casting in die Sendung eingeladen.«
»Darum heißt die Sendung Shebay? Weil man auf die Frauen bieten kann?«
Torino nickte. »Unter anderem. Die Zuschauer stellen das Portfolio an Frauen zusammen, das es in die Sendung schafft. Aus diesen Frauen wählen wir dann die Miss Shebay. Der Zuschauer ist also unmittelbar an der Auswahl der Gewinnerin beteiligt. Wenn wir Glück haben, gilt das Ganze nicht mal als Glücksspiel, und wir können Server, Marketing und alles andere bequem aus Deutschland heraus steuern.«
Myers nippte wieder an seinem Wasser und faltete die Financial Times zusammen. »Du sagtest ›unter anderem‹. Was denn noch?«
Torino grinste. »Wir haben doch gerade davon gesprochen, dass man sich als Zuschauer oft ärgert, wenn einem im Fernsehen irgendwelche Miezen aufgetischt werden, die man auch nach drei Jahren Kloster nicht mit der Kneifzange anfassen würde.«
»Ja, verstanden«, sagte Myers und steckte Zeitung und Laptop in seine Tasche. »Darum das Auktionsverfahren wie am Aktienmarkt.«
»Genau«, sagte Torino. »Das ist das Angebot, das der Zuschauer sich selbst auswählt.«
»Fehlt nur noch die Nachfrage.«
»Richtig«, sagte Torino und beugte sich vor. »Oder besser, die Begierde.« Er ließ den Löffel los und legte die Fingerspitzen aneinander. »Tom, wie oft hast du in einer solchen Show schon eine Frau gesehen, die du so scharf fandest, dass du am liebsten sofort mit ihr in die Kiste gestiegen wärst?«
»Wie du weißt, bin ich glücklich verheiratet, und deshalb …«
»Erzähl keinen Stuss. Geht doch jedem so. Und genau da liegt das Problem. Du siehst die geilsten Tussen im Fernsehen und die schärfsten Profile auf irgendwelchen Kontaktforen – solange du Mister 08/15 bist, der tausenddreihundert netto nach Hause bringt, wirst du keine von denen rumkriegen.«
»Natürlich nicht«, sagte Myers. »Ist ja auch ’ne Fernsehsendung und kein Besuch im Bordell.«
»Warum eigentlich nicht?«, fragte Torino scheinbar unschuldig und unwissend.
»Weil Glotze nun mal Glotze ist, und Puff ist Puff.«
Torino klatschte leise in die Hände. »Und hier setzen wir an. Frauen oder Aktienmarkt, Glotze oder Puff – bei uns ist es beides!«
Myers kaute wieder auf der Unterlippe. »Soll das heißen, die Zuschauer kriegen die Chance, mit einer der Miezen ins Bett zu steigen?«
»Bingo. Jeder kann eine Nacht mit seiner Favoritin gewinnen, egal ob sie Miss Shebay wird oder nicht, und jeder kann eine Nacht mit der Siegerin gewinnen.«
»Und die am meisten zahlen, haben die höchsten Chancen?«
»Ja. Aber es bleibt auch eine kleine Chance für alle, die nicht so viel Knete haben.« Torino lächelte. »Der Durchschnittszuschauer da draußen in Zombieland hat nun mal nicht so viel Geld. Wäre es anders, würde er nicht so lange vor der Glotze hängen, sondern sich den Arsch aufreißen, um noch mehr Geld zu verdienen, so wie wir. Aber irgendjemand muss sich ja um die kleinen Leute kümmern, und das sind wir. Wir sind die wahren Marxisten. Bei uns kann auch der Kleinverdiener den Superstar vögeln. Gleiches Recht für alle.«
Myers trank sein Wasser aus und klappte seine Tasche zu. »Du bist in etwa so marxistisch wie Ronald Reagan. Wissen die Ladys denn, auf was sie sich einlassen?«
»Was denkst du? Das ist alles wasserdicht. Die AGBs müssen sie unterschreiben, und dann werden sie rechtlich auch noch mal eingenordet. Die Anwälte sind schon an den letzten Formulierungen dran.«
»Und wenn irgendein versiffter Proll auftaucht, muss die Kleine sich trotzdem von dem besteigen lassen?«
»Nun ja, wir stellen gewisse Mindestanforderungen an die Hygiene. Grundsätzlich aber gilt: Wer schön sein will, muss leiden. Und wer berühmt sein will«, Torinos Mundwinkel zuckten nach oben, während er Myers unverwandt musterte, »noch mehr.«
Myers schwieg eine Zeit lang. »Ziemlich schräge Idee«, sagte er dann. »Aber es passt in unsere kranke Zeit. Ihr müsst nur aufpassen, dass euch das rechtlich nicht um die Ohren fliegt. Oder sendet ihr aus Holland?«
Torino blickte Myers unverwandt an. »Wie viele User haben allein in Deutschland im vergangenen Monat eure Website besucht?«
»Ungefähr zehn Millionen.«
»Dann ist alles doch ganz einfach.« Torino trank seinen Cappuccino aus und ließ den Becher auf den Tisch knallen. »Wir senden erst mal übers TV. Wenn es rechtliche Probleme gibt, senden wir als Livestream – auf der Landing Page von Xenotube.«
»Ihr wollt unsere zehn Millionen Nutzer für euren Schweinkram?« Myers erhob sich und blickte zur Uhr. Es war ihm anzusehen, dass er Torinos Idee faszinierend, aber auch ein wenig abstoßend fand.
»Schweinkram, der Furore machen wird«, sagte Torino, »und der aus euren zehn Millionen Nutzern auf einen Schlag zwanzig Millionen macht.«
Myers schulterte seine lederne Umhängetasche. »Ich weiß nicht …«
»Doch, du weißt«, sagte Torino. »Und du hast jetzt eine Stunde Flugzeit bis nach Frankfurt, um dich zu entscheiden.«
»Ich denke darüber nach.« Er schüttelte Torino die Hand.
Torino nickte. »Aber nicht zu lange. Das Leben ist kurz. Zeit ist Geld. Und ein Jahr …«
»Ich weiß«, sagte Myers, wobei man sehen konnte, wie es hinter seiner Stirn arbeitete. »Ein Jahr sind fünf Internet-Jahre.«
9.
Prof. Dr. Martin Friedrich, Leiter der Abteilung für operative Fallanalyse des LKA, war eine Koryphäe. Er hatte am Universitätsklinikum der Charité und am Johns Hopkins in Baltimore Medizin und Psychiatrie studiert, hatte an der Universität von Virginia und in Quantico Forensik belegt und in Harvard, London und Berlin Vorlesungen über das »Täterprofil des Serienkillers« gehalten. Friedrich war ein Workaholic, der das Wort Freizeit nicht kannte.
Nach dem Medizinstudium und der Ausbildung zum Psychiater hatte er beim FBI das Profiling gelernt – die Analyse der Persönlichkeit eines Serienmörders –, bei keinem Geringeren als Robert Ressler, dem Mann, der Thomas Harris beim Schreiben von Das Schweigen der Lämmer geholfen hatte. Ressler hatte nicht nur das Profiling zur Perfektion entwickelt, er hatte auch den Begriff »Serienkiller« geprägt. Vorher hatte man von »Massenmördern« gesprochen, doch dieser Begriff war nicht ganz korrekt: Dem klassischen Massenmörder geht es darum, mit einem Mal möglichst viele Menschen zu töten, während der Serienkiller immer wieder tötet.
Clara hatte mehrere Bücher von Ressler gelesen, darunter Whoever Fights Monsters und I Have Lived in the Monster. Sie hatte auch die Interviews von Ressler gelesen, die er mit berüchtigten Serienkillern geführt hatte, darunter mit John Wayne Gacy, der bis zu seiner Hinrichtung bestritten hatte, dreiunddreißig junge Männer getötet zu haben, weil er dies bei seiner Achtzigstundenwoche als Unternehmer »zeitlich gar nicht geschafft« hätte – wobei sich dann allerdings die Frage stellte, woher die mehr als zwanzig halb verwesten Teenager-Leichen kamen, die unter dem Keller seines Hauses gefunden wurden.
Ressler hatte auch das Interview mit Jeffrey Dahmer geführt, dem »Kannibalen von Milwaukee«, der Schwule in Bars aufgerissen, mit zu sich nach Hause genommen, narkotisiert, vergewaltigt, getötet und seziert hatte. Dann hatte er die Leichen ausgekocht und aus den Knochen und Schädeln Altäre und Schreine in seinem Wohnzimmer errichtet. Einige hatte er gefoltert, hatte ihnen bei vollem Bewusstsein die Schädeldecke aufgebohrt und ihnen Säure ins Gehirn geträufelt, um sie auf diese Weise zu willenlosen Lust-Zombies zu machen. Dahmer hatte ausgesagt, er habe sich einsam gefühlt und geahnt, dass er nie einen Menschen finden würde, der mit ihm zusammenleben wollte – jedenfalls keinen lebenden. Deshalb habe er beschlossen, Tote bei sich zu haben oder – besser – deren Überreste. Dahmer starb schließlich im Gefängnis, getötet von einem Mithäftling, der ihm einen Besenstiel durchs Auge ins Gehirn rammte.
Doch Gacy und Dahmer waren Ausnahmen. Die meisten Serienkiller töteten entsprechend ihrer sexuellen Präferenz. Und da der Großteil der Serienkiller männlich ist und die meisten Männer heterosexuell veranlagt, sind die typischen Opfer von Serienkillern – Frauen!
Wow, hatte Clara damals gedacht, ich bin im richtigen Job gelandet!
Mit Martin Friedrich hatte Clara vorher nur indirekt zu tun gehabt: Friedrich hatte dem Team um Kommissar Winterfeld ein detailliertes Täterprofil des »Werwolfs« erstellt, ohne dass Clara und Winterfeld damals gewusst hatten, dass Friedrich bereits für sie arbeitete: Da es Bellmann und dem Polizeipräsidenten wichtig gewesen war, die Presse aus dem Fall herauszuhalten, wurden auch innerhalb der Abteilungen chinesische Mauern errichtet. Und da Martin Friedrich erst seit vier Wochen für das LKA in Berlin arbeitete und deshalb noch niemand wusste, ob »der Neue« schon da war oder nicht, lief alles nach Plan.
Friedrich, so hatte Clara erfahren, begeisterte sich für Schottland. Dort verbrachte er die meisten Urlaube, in der Regel allein mit einem ganzen Koffer voller Bücher, darunter stets ein Exemplar der gesammelten Werke Shakespeares. In dem forensischen Gutachten zum Werwolf, das Friedrich für die Ermittler geschrieben hatte, hatte er sämtliche Teammitglieder aufgefordert, Shakespeare zu lesen, den »besten Psychologen der Menschheitsgeschichte«. Wenn Sie Shakespeare lesen, hatte er notiert, finden Sie alle Höhen und Tiefen, deren die menschliche Seele fähig ist. Das Lachen und die Freude, die Komik und das Absurde, aber auch das Verborgene, Grausame und Unaussprechliche. Insbesondere hatte es ihm die tragische Figur des Macbeth angetan, der von seiner diabolischen Gattin zum Mord am schottischen König angestiftet wurde.