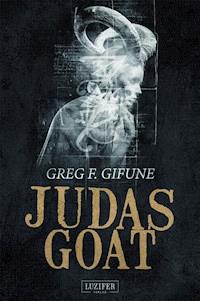Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Spannender und intelligenter Gruselroman" [Lesermeinung] "Greg Gifune hat mit diesem Roman mal wieder gezeigt, wie man auch ohne Tonnen von Blut für schlaflose Nächte sorgen kann! Uneingeschränkt empfehlenswert!" [Lesermeinung] "Ein sehr atmosphärisches, kurzweiliges Buch, das einen (zumindest mich) immer weiter lesen lassen will und über das eigene Ich nachdenken lässt." [Lesermeinung] Inhalt: Für Seth Roman, seinen jüngeren Bruder Raymond und ein paar Freunde sollten es ein paar Tage voller Spaß und Entspannung in einer Hütte in den Wäldern Maines werden. Eine Woche Kartenspielen und Trinken - fernab des stumpfen Arbeitsalltags. Doch als eine junge Frau in ihre Hütte taumelt - die Kleider blutbefleckt - ändert sich ihr Leben für immer. Die Frau bringt etwas mit in die Hütte; alt und tödlich, böse und unmenschlich. Etwas, das Raymond seltsam vertraut vorkommt, einem jungen Mann, den seit seiner Kindheit unerklärliche nächtliche Schrecken verfolgen, die ihn noch als Erwachsenen quälen. Als ein schwerer Schneesturm einsetzt, scheint die Nacht lebendig zu werden und ein unheilvolles Spiel beginnt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalte
Finstere Nacht
Copyright
Widmung
Impressum
Alpha
Kapitel 1
Teil 1: Davor
Kapitel 2
Teil 2: Schläfer
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Teil 3: Zeit der Finsternis
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Teil 4: Unter Wölfen
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Omega
Kapitel 39
Kapitel 40
Der Autor
Danksagung
Leseempfehlungen
Der LUZIFER Verlag
Copyright © by Greg F. GifuneAll rights reserved. No part of this book may be used, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the written permission of the publisher, except where permitted by law, or in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. By arrangement with Greg F. Gifune
Impressum
ISBN E-Book: 978-3-95835-088-5
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen und senden Ihnen kostenlos einen korrigierten Titel.
Liebe Leser, der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ALPHA
»Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde … als sich eure Philosophie jemals erträumen könnte.«
- William Shakespeares Hamlet
KAPITEL 1
Es gibt in unserer alltäglichen Welt viele Orte, die für die Verdammten, die Verlorenen und die Hoffnungslosen reserviert sind. Diese Beobachtungszelle war nur ein Beispiel unter vielen. Steril, leblos und mit einem schrecklichen Altweiß gestrichen. Der Raum beherbergte einen langen Tisch, zwei Plastikstühle und sonst so gut wie nichts. Ein Lautsprecher, Mikrofone und ein Kamerasystem waren an einer Wand installiert, ein Sichtspiegel an der anderen. In einem der Plastikstühle saß ein hagerer Mann, der so aussah, als hätte er Schreckliches durchgemacht. Gleichzeitig umwehte ihn jedoch eine merkwürdige Aura von Gefasstheit, die in absolutem Kontrast zu seinem Aussehen zu stehen schien. Seine Hände waren mit Handschellen gefesselt und ruhten vor ihm auf dem Tisch, die Finger waren lässig ineinander verschränkt. Er starrte einfach geradeaus, die Augen leer. Auf der anderen Seite des Spiegels stand Detective Frank Datalia und sah zu, wie sein Partner, Detective Dexter Clarke, den Mann alleine zurückließ und die Tür hinter sich schloss. »Er sagt, er wird reden, aber nur mit dir«, sagte Clarke mit einem genervten Tonfall in der Stimme. »Ja«, sagte Datalia, »das habe ich gehört.« »Schon schlimm, wenn man so beliebt ist, oder?« »Was ist denn mit seinem Anwalt?« »Es soll wohl ein Pflichtverteidiger auf dem Weg sein.« Clarke stieß einen matten Seufzer aus. »Wir nehmen immer noch auf, Audio und Video, das volle Programm. Willst du nicht einfach reingehen und schauen, was du aus ihm rausholen kannst?« »Irgendwas stimmt nicht mit dem«, sagte Datalia, während er den Mann durch die Scheibe hindurch studierte. »Der ist viel zu gelassen. Diese eiskalten Typen sind mir immer wieder suspekt.« »Der Wichser zeigt keinerlei Reue, kein Schuldgefühl, er sitzt einfach nur da mit diesem Gesichtsausdruck – als hätte er uns etwas voraus.« Datalia zuckte mit den Schultern. »Vielleicht hat er das ja.« Clarke hielt die dünne Akte hoch, die das Wenige an Informationen enthielt, das sie gesammelt hatten, und schaute wieder in den Spiegel. »Schau ihn dir an. Entspannter geht es nicht. Der ist einfach total psycho. Dieses Stück Scheiße ist komplett unmenschlich!« »Das ist genau das Problem mit der Sorte, Dex.« Datalia griff mit der einen Hand den Türknauf und mit der anderen nahm er seinem Partner die Akte ab. »Die sind einfachzugottverdammt menschlich.« Der Mann schien aus seiner Trance zu erwachen, als der Detective das Zimmer betrat. Er betrachtete Datalia von oben bis unten, als würde er ihn zum ersten Mal wirklich wahrnehmen. Frank Datalia hatte gerade seinen vierundvierzigsten Geburtstag gefeiert, war von durchschnittlicher Größe und hatte leichtes Übergewicht. Die überschüssigen Pfunde trug er jedoch selbstbewusst und er war stets makellos gekleidet. Er hatte einen ordentlich gestutzten Kinnbart und sah exakt so italienisch aus, wie sein Name klang. Sein Haar war oben schon verdächtig dünn geworden, und die Seiten waren grau gesprenkelt. Das Bestechendste an ihm waren eigentlich seine Augen. Nicht, weil sie besonders schön oder tiefgründig wirkten, sondern weil sie eine eindringliche Melancholie ausstrahlten. Bestimmt waren sie einst heiter und voller Leben gewesen, doch die Dinge, die sie über die Jahre mit ansehen mussten, hatten das Feuer in ihnen gelöscht. So waren sie zu beeindruckenden Mahnmalen geworden. »Detective Clarke sagte, Sie wollen mit mir reden?« Der Mann nickte. »Ich würde ihnen gerne erzählen, was passiert ist.« »Sie stehen unter keinerlei Zwang, mit uns zu reden, bevor Ihr Anwalt eintrifft.« »Ich willige hiermit ein, in Abwesenheit eines Anwaltes mit Ihnen zu sprechen«, sagte der Mann sanft. »Sie werden sowieso kein Wort davon glauben – und daraus mache ich Ihnen nicht einmal einen Vorwurf – aber ich möchte es Ihnen trotzdem erzählen, weil es die Wahrheit ist, Detective Datalia. Die Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit, so wahr mir Gott helfe.« »Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Alles, was Sie sagen, kann und wird gegen Sie verwendet werden können, verstehen Sie das?« »Ja, Detective, ich verstehe.«
TEILS EINS
DAVOR
»Er aber sprach zu ihnen:Ich sah den Satan vom Himmel fallenwie einen Blitz.«
- Lukas 10:18
KAPITEL 2
Er hatte keine Ahnung, warum er von einem Gewitter geträumt hatte, und dann auch noch in Kombination mit einem Schneesturm, aber so war es eben. Zunächst kam ihm keine Idee, was das bedeuten oder symbolisieren sollte. Aber der ungewöhnlich wilde, fast schon übernatürliche Sturm hatte ihn mit einem Gefühl der Bedeutungs- und Hilflosigkeit zurückgelassen. Später wurde ihm klar, dass das Heulen des Windes in seinem Traum andere Geräusche überdeckt hatte – grauenhafte Klänge, die kein Mensch jemals hören sollte. Reißende Haut, splitternde Knochen, zerfetzende Kleidung. Dazu die schreienden Echos von Schmerz, unglaublichem, quälendem Schmerz. Das Himmelreich geriet aus den Fugen und irgendwo, tief aus den Abgründen des Schlafes, kam das kranke Murmeln von Geistern. Stimmen, die in Finsternis gehüllt waren, und vom Getöse eines Blizzards verschluckt wurden. Kurz bevor der Himmel zersplitterte, hinabfiel und wie Scherben auf ihn einprasselte, wurde das Flüstern der Toten wieder zu Schreien. Sein Bruder war fort. »Raymond!« Ein eisiges Frösteln ließ ihn erwachen. Es war kalt, viel kälter als es hätte sein dürfen – wenn die Tür nach draußen nicht offen gestanden hätte! Atem dampfte aus seinem Mund und den Nasenlöchern wie Nebel, er waberte wie magischer Rauch und zog auf der Suche nach dem Dach durch die Dunkelheit. Für einen kurzen Moment war sich Seth Roman nicht sicher, wo er war, doch als er den Raum um sich herum endlich einordnen konnte und sich aufsetzte, erinnerte er sich an die Hütte. Der Mond war in dieser Nacht nicht einmal besonders hell, aber es war genug Licht, dass er die Betten neben dem seinen und die beiden Schlafsäcke auf dem Boden ausmachen konnte. Louis hatte sich das nächstgelegene Bett ausgesucht und war ebenfalls wach. Er lag ausgestreckt auf dem Bauch, den Kopf leicht vom Kissen erhoben, seine Haare waren verwuschelt und das Gesicht eine Grimasse aus Unbehagen und Verwirrung. In einem der Schlafsäcke auf dem Boden lag Darian. Er schlief fest. Ein Arm ragte hervor und er schnarchte leise. Raymond hätte eigentlich in den zweiten Schlafsack schlüpfen sollen, nachdem sie alle zu Bett gegangen waren, doch dort war niemand. Der Reißverschluss war komplett heruntergezogen, der Sack weit aufgeworfen, als wäre er schnell und hektisch verlassen worden. Die Eingangstür stand offen. Draußen wütete ein Schneesturm, der Schübe eisiger, arktischer Luft in die Hütte pustete. Seth starrte die Tür für einen Moment einfach nur an, er war nicht in der Lage zu begreifen, was er da sah. Das Flüstern aus seinem Traum verzog sich schließlich und ließ ihn alleine. »Was ist los?«, fragte er mit belegter Stimme. Oder hatte er die Worte nur gedacht? Das alles fühlte sich immer noch wie ein Traum an, unscharf und dumpf, als ob der Schlaf ihn noch nicht vollends losgelassen hätte und versuchte, ihn zurück in die Finsternis zu ziehen. Während er so da lag und versuchte, sich einen Reim auf die Situation zu machen, verlor die Zeit jegliche Bedeutung. Obwohl seine Augen offenblieben, spielten sich Szenen aus dem vorigen Tag auf seiner geistigen Leinwand ab. Diese Projektion zeigte ihm noch einmal in allen Einzelheiten, was er bereits gesehen hatte …
***
Raymond hatte sie als Erster bemerkt, doch schon eine Sekunde später hatten alle sie gesehen. Trotz der offensichtlichen Brisanz der Lage konnte keiner von ihnen sprechen oder reagieren. Es war, als wären sie alle gelähmt. Die Frau – eigentlich war es mehr ein Mädchen – brach mit ihrem kleinen Körper aus den Schatten hervor und stolperte ungelenk einen Hügel in der Ferne hinunter. Als wäre sie aus dem Nichts erschienen, tauchte sie auf einmal aus dem dichten Wald auf und rannte, so schnell sie konnte. Sie stolperte, um ein Haar verlor sie die Balance und fiel, doch im letzten Augenblick zuckte ihr Körper fast unmenschlich und sie blieb auf den Beinen – nicht einmal langsamer wurde sie. Sie bewegte sich mit der getriebenen Schnelligkeit einer Verfolgten auf die kleine Lichtung zu, die Seth und die anderen von dem umliegenden Wald trennte. Seth schaute an ihr vorbei in den Wald, aus dem sie gekommen war, aber da war nichts – niemand, der hinter ihr her war. Und dennoch bewegte sie sich, als ob die Tore der Hölle hinter ihr aufgesprungen wären. Je näher sie kam, desto zierlicher und jünger erschien sie. Ihr langes Haar war zerrupft und verschwitzt; es bedurfte genau so dringend einer gründlichen Wäsche wie der Rest von ihr. Mit diesen abgewetzten Jeans und dem rot bestickten Shirt, das an 70er-Jahre Hippiemode erinnerte, wirkte sie wie jemand, der einer Zeitmaschine entsprungen war. Trotz der Kälte war sie barfuß und trug nicht einmal eine Jacke, aber das schien sie nicht zu stören. Ihre Augen strahlten eine Form von panischer Angst aus, die Seth selten zuvor gesehen hatte, und ihre Bewegungen ähnelten denen eines wilden Tieres, das in die Ecke gedrängt wurde und bereit war, um sein Leben zu kämpfen. Als sie nur noch etwa zehn Meter von der Hütte entfernt war, blieb sie ruckartig stehen, wobei sie mit den Armen ruderte wie jemand, der an einem Abgrund stand und die Balance halten wollte. Ihr Kopf zuckte blitzschnell hin und her, angstvoll taxierte sie die vier Männer, die plötzlich in ihrem Weg standen. In gebückter Haltung taumelte sie rückwärts, die Arme nun nach vorne ausgestreckt, als müsse sie die Männer, die sie nicht aus den Augen ließen, abwehren. »Ganz ruhig«, sagte Seth, während seine Gedanken rasten. »Ruhig.« Auf die kürzere Entfernung konnte er sehen, dass ihr Gesicht mit Dreck beschmiert war, ihre Füße waren durch den gefrorenen Boden teilweise schon aufgeplatzt, und sie schien nicht älter als siebzehn zu sein. Die beunruhigendste Erkenntnis war allerdings, dass ihr Hemd gar nicht rot bestickt war. Die Sprenkel, Spritzer und Flecken darauf, waren frisches Blut. Darian ließ das Feuerholz fallen, das er getragen hatte. Er und Louis hatten es von einem großen Stapel außen an der Hütte geholt, während Seth und Raymond gerade dabei waren, den Geländewagen endgültig auszuladen. Es war wahrscheinlich das erste Mal, dass alle vier Männer gleichzeitig draußen standen, seit sie gestern angekommen waren. Doch die Nachricht aus dem Radio, dass der schwere Schneesturm, der eigentlich für später in der Woche angekündigt war, nun schon diesen Nachmittag beginnen sollte, trieb sie zur Eile an. Sie wussten, dass sie zwölf bis fünfzehn Stunden in der Hütte festsitzen würden, vielleicht sogar länger. Die junge Frau bewegte sich weiter in dieser merkwürdigen, gebückten Pose, ihre Augen weit aufgerissen und wild. »Was ist los?«, fragte Darian, wodurch er die merkwürdige Stille brach – seine normalerweise feste Stimme klang jedoch zittrig und unsicher. »Es ist alles in Ordnung, was – was ist passiert?« Sie antwortete nicht, ihre Augen sprangen nur hektisch von einem Mann zum anderen. Louis blickte in den Wald hinter ihr. »Verfolgt Sie jemand?« Seth näherte sich ihr ein wenig, doch sie sprang zurück. Er öffnete seine Hände und hielt sie vor sich. »Es ist alles in Ordnung, niemand will Ihnen etwas tun, verstehen Sie das? Alles ist gut, Sie sind in Sicherheit!« »Sie blutet ziemlich stark«, murmelte Louis. »Fräulein«, sagte Seth ruhig, »alles ist in Ordnung, alles okay, beruhigen Sie sich, ja?« Louis verlagerte seine Aufmerksamkeit von ihr auf den dunklen Wald und zurück. »Nun reden Sie schon, wir müssen wissen, was hier los ist! Ist jemand hinter Ihnen her, oder was? Wir können Ihnen nicht helfen, wenn wir nicht wissen, was los ist!« Darian warf ihm einen bösen Blick zu. »Spinnst du, Louis, warum schreist du sie so an? Sie steht unter Schock!« Eine Böe eisigen Windes drückte durch die Baumreihen auf die Lichtung und wehte ihnen kalt entgegen. Der graue Himmel drohte mit Schnee. Es würde bald losgehen. »Ich hole mein Gewehr!« Louis wandte sich der Hütte zu. Seth signalisierte allen, die Klappe zu halten und sich nicht zu bewegen, doch ließ er dabei die Hände oben und den Blick auf dem Mädchen. Louis hatte recht; sie musste eine schwere Wunde haben, wahrscheinlich im Bauchbereich, denn ihr Hemd war an der Körpermitte komplett mit Blut durchtränkt. »Es ist alles gut«, versicherte er ihr erneut, »wir werden Ihnen nichts tun! Wir wollen Ihnen helfen, verstehen Sie das?« Nachdem sie wieder nicht antwortete, drehte sich Seth langsam und schaute zu den anderen. Weder Louis noch Darian hatten sich bewegt, und Raymond, der am nächsten an der Hütte stand, hielt ein paar Extradecken im Arm, die er aus dem Auto geholt hatte. In diesem Moment umgab ihn eine merkwürdige Distanziertheit – noch stärker als sonst, dachte Seth – denn sein Ausdruck strahlte etwas übertrieben Analytisches aus. Er studierte die junge Frau geradezu, suchte sie mit seinen Augen ab, und plötzlich änderte sich etwas in seinem Gesicht – als würde ihm langsam ein Gedanke dämmern. Die Frau gab einen stöhnenden Laut von sich, der tief aus ihrer Kehle kam, mehr ein Knurren als ein Versuch, verständlich zu kommunizieren – und ihre Körperhaltung entspannte sich, soweit das in ihrem Zustand möglich war, in einer langsamen, kollabierenden Bewegung. Als ihre Schultern zusammengesunken waren, sah sie noch kleiner und fragiler aus als zuvor. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen – vielleicht zu schreien – aber diesmal kam überhaupt kein Klang zustande. Stattdessen schüttelte sich ihr gesamter Körper und ihre Augäpfel rollten sich so weit nach hinten, dass nur noch Weiß zu sehen war. Seth schoss nach vorne und versuchte, sie aufzufangen, aber sie brach zusammen und schlug mit einem ungesunden Krachen auf den Boden, bevor er sie erreichen konnte. »Jesus!« Er rutschte neben ihr auf die Knie, schob eine Hand unter ihren Kopf und hob ihn vorsichtig einige Zentimeter vom Boden. Mit seiner anderen Hand überprüfte er ihren Puls. Der war stabil und überraschend stark, aber sie war bewusstlos. »Wir müssen sie nach drinnen schaffen«, sagte er, während er krampfhaft versuchte, sich an alles zu erinnern, was er jemals über Erste Hilfe gelernt hatte. »Schnell, packt mit an!« »Vielleicht ist es genau das Falsche, sie jetzt zu bewegen, Mann!« Louis kam näher. »So heißt es doch immer! Schwerverletzte nicht bewegen!« »Das gilt aber nur bei Nacken-, Kopf- oder Rückenverletzungen, oder?« Darian stieg über die Holzscheite, die er hatte fallen lassen, und kniete sich neben Seth und die junge Frau. »Ja gut, aber sie ist gerade voll mit dem Kopf auf den Boden geschlagen!« Seth ignorierte Louis' Kommentar und begab sich in eine hockende Position, wobei er seine freie Hand unter den Rücken des Mädchens schob. »Wir müssen sie nach drinnen bringen und Druck auf die Wunde ausüben, bevor sie verblutet!« Als er sich langsam aufrichtete, sackte die junge Frau völlig leblos in seinen Armen zusammen. Während Seth sich in Bewegung setzte, nickte er Raymond zu: »Bring die Decken mit rein, wir müssen sie irgendwie warmhalten! Komm schon, schnell!« »Vorsichtig«, sagte Louis, »du musst ihren Nacken gerade halten!« Als sie die Hüttentür erreicht hatten, überholte Darian sie und machte das nächstgelegene Bett frei, indem er einige leere Bierdosen auf den Boden fegte. Louis folgte ihm, doch er nahm direkt eine Position neben der Tür ein, von der er zusehen konnte, ohne im Weg zu stehen. Seth stolperte herein und legte das Mädchen vorsichtig auf die Matratze. »Oh Gott, da ist so viel Blut«, sagte er atemlos, als er feststellte, wie befleckt seine eigene Kleidung inzwischen war. Er kniete sich neben das Bett und rollte langsam das Hemd des Mädchens hoch. »Bringt ein paar Handtücher«, rief er in den Raum. Raymond trat fast schon demonstrativ langsam durch die Tür, die Bettdecken immer noch in den Armen. »Wir sollten sie in ein Krankenhaus schaffen.« »Das würde sie nicht überleben. Wir müssen die Blutung stoppen, oder sie hat nicht mal mehr Minuten.« »In den Ort sind es dreißig Minuten mit dem Auto, und das an einem guten Tag mit freien Straßen«, sagte Louis. »Und ihr habt das Kaff ja gesehen. Da wohnen nicht mal fünfzig Leute; ein Krankenhaus gibt es ganz sicher nicht. Scheiße, wir könnten von Glück reden, wenn die da überhaupt einen Arzt haben. Hier in der Gegend kann man nur raten, wie weit das nächstgelegene Krankenhaus entfernt ist.« »Hat sie eine Schusswunde?«, fragte Darian. »Eine Kugel in die Gedärme soll ja die übelste Verletzung von allen sein.« Louis machte einen langen Hals, um über Seths Schulter sehen zu können. »Sie wäre nicht in der Lage gewesen, so zu rennen, wenn sie eine Kugel im Bauch hätte, glaub mir. Auf keinen Fall.« Seth hörte gar nicht mehr zu. Er lenkte seine gesamte Aufmerksamkeit auf die junge Frau. Ihr Hemd trennte sich mit einem schmatzenden Geräusch von der Haut, die Baumwolle war komplett mit Blut durchtränkt. Es tropfte. Er zog das Hemd bis zum Brustansatz hoch. Sie trug keinen BH, aber das Blut reichte auch gar nicht so weit nach oben. Die Ausbreitung beschränkte sich auf den Bauchbereich. Darian tauchte nun wieder an Seths Seite auf, diesmal mit einem Handtuch. Seth wischte vorsichtig die Blutpfütze um ihren Bauchnabel weg, während sich ihr Brustkorb langsam hob und senkte. Ansonsten blieb ihr Körper jedoch regungslos. Seth blinzelte anschließend mehrmals, in der Hoffnung, sein Sehvermögen würde zurückkehren. Denn das, was er da sah, ergab einfach keinen Sinn. »Ich glaube, ich spinne.« »Was ist los?«, fragte Louis. »Ich kann …« Seth wischte weiter mit dem mittlerweile vollgesogenen Handtuch über die Haut, inzwischen mit schnelleren und weitaus weniger vorsichtigen Bewegungen. »Da ist keine … ich kann keine Wunde finden!« Darian lehnte sich zu ihm herüber. »Wo zur Hölle ist sie?« »Es gibt keine.« Seth ließ das Handtuch fallen, es klatschte mit einem feuchten Beiklang auf den Boden. Die Hände und Handgelenke der jungen Frau waren zerschrammt, ihre Fußknöchel ebenso, und ihre Füße hatten diverse Schnittwunden erlitten. Aber jetzt, wo das Blut weggewischt war, erschien ihr Bauchbereich sauber und unverletzt. Louis trat einen halben Schritt zurück. »Dann ist das verdammte Blut von jemand anderes!« »Ray, pack sie in die Decken ein. Sie zittert immer noch und steht wahrscheinlich unter Schock.« Seth stand auf und fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Trotz der Kälte war sie feucht vor Schweiß. »Und mach' die Tür zu. Wir müssen sie warmhalten.« »Wir müssen sie hier raus bringen«, sagte Raymond nüchtern, »in ein Krankenhaus.« Louis durchquerte den kleinen Raum mit langen Schritten, schnappte sein Gewehr aus einem Schrank in der Ecke und begann, es zu prüfen. »Ich werde mal diesen Abhang im Auge behalten. Sie ist auf jeden Fall gerannt, als würde sie jemand verfolgen.« Raymond stand immer noch apathisch herum, deswegen ging Darian auf ihn zu, griff sich die Decken und fing an, das Mädchen dick darin einzupacken. »Es ist doch so: Wir haben keine Ahnung, was hier los ist oder was passiert sein könnte. Wir müssen die Polizei rufen!« Seth ging auf die Tür zu. »Mein Handy ist im Auto.« »Wie ich schon sagte, das funktioniert nicht«, erinnerte ihn Louis, »hier oben gibt es keinen Empfang.« »Scheiße, ja.« Seth blieb wie angewurzelt stehen. »Dann müssen wir in den Ort fahren und einen Polizisten suchen. Selbst ein so kleiner Ort muss doch mindestens einen Cop haben.« »Das Problem ist nur, dass es schon schneit.« Louis, der jetzt wie ein Wachposten an der Tür stand, das Gewehr fest im Griff, beobachtete den Wald, aus dem die junge Frau gekommen war. Obwohl es noch hell draußen war, fielen bereits die ersten Flocken. »Den Wetterwichsern zufolge wird das ein verdammt heftiger Sturm.« »Den Wetterwichsern zufolge sollte der aber erst viel später in der Woche losgehen«, sagte Darian. »Also vielleicht braucht man denen auch nicht alles zu glauben.« »Wenn wir es jetzt probieren, besteht aber die Gefahr, dass wir nicht mehr hierher zurück können, bis der Sturm vorbei ist. Wir müssten bis morgen warten.Fallser bis morgen überhaupt schon aufhört.« Seth warf einen Blick auf das Gewehr. »Kannst du das Ding bitte weglegen? Das sieht einfach albern aus.« »Es sieht aber nicht mehr albern aus, wenn ich dir damit deinen Arsch rette!« »Um Himmels willen, Louis,wovorwillst du mich denn retten?« »Genau darum geht es doch, oder?« Louis trat heraus auf die Veranda der Hütte, wobei sein Atem sichtbar wurde. »Wir haben keine Ahnung, was da draußen ist.« »Hör mal. Offensichtlich ist jemand schwer verletzt worden, und–« »Wow. Siehst du, darauf wäre ich nie von alleine gekommen.« Seth hatte überhaupt keine Lust auf Louis' Sarkasmus, aber statt ihn anzugehen, machte er ein paar Schritte durch den Raum. Er versuchte, die Anspannung, die durch seinen Körper peitschte, in etwas Produktives umzumünzen. »Was meinst du, was wir tun sollten, Mother?« »Ich bin nicht sicher«, antwortete Darian, »aber wir müssen herausfinden, wo das Blut herkommt.« »Vielleicht hat sie jemanden gehalten, der geblutet hat«, sagte Louis. »Schau dir mal Seths Hemd an; der hat sie nur ein paar Schritte getragen.« Seth zuckte mit den Schultern. »Wie das zustande kam, ist doch völlig immateriell, wir müssen–« »Immateriell?« »Du weißt, was ich meine.« »Nein, Mann, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was du meinst.« »Lou, wir müssen das Mädchen so oder so zu einem Arzt schaffen. Ab dem Punkt können die Behörden dann übernehmen.« »Absolut«, stimmte Darian zu. »Das alles hat nichts mit uns zu tun. Es ist nur so: Falls hier jemand in der Nähe schwer verletzt ist, dann müssen wir ihn oder sie so schnell wie möglich finden!« »Aber wir haben keine Ahnung, wo das Mädel herkam«, stellte Louis fest. Raymond zündete sich eine Zigarette an und rauchte sie ruhig. »Es kommen eine ganze Menge Szenarios infrage«, sagte Seth. »Absturz von einem Leichtflugzeug, Angriff von wilden Tieren, ein Jagdunfall – wer weiß?« »Ihr seid jetzt nicht mehr in der Stadt, Jungs.« Louis starrte immer noch in den Wald, der Gruppe hatte er den Rücken zugewandt. »Klar gibt es hier oben eine Menge kleiner Flugzeuge, aber wenn eins abgestürzt wäre, dann hätten wir das gehört und gesehen – zumindest als Rauchsäule am Himmel. Bei einem Jagdunfall hätten wir die Schüsse gehört. Wenn hier jemand ein Gewehr abfeuert, dann hört man das über Meilen entfernt so klar wie einen Glockenschlag. Und was wilde Tiere angeht, so ein Angriff wäre schon möglich, aber ziemlich unwahrscheinlich.« Er schaute lange genug über die Schulter, um den anderen einen allwissenden Blick zuzuwerfen. »Ich kenne die Gegend hier, okay? Ich weiß, wovon ich rede.« »Du leihst dir die Hütte vielleicht ein, zwei Mal im Jahr von deinem Onkel«, erinnerte ihn Seth, »du kommst hier für ein Wochenende mit deinen Kindern hoch, hackst ein bisschen Holz, machst ein Lagerfeuer und läufst mit dem Gewehr rum … und deswegen bist du ein Experte?« »Auf jeden Fall mehr als du, Meister, da kannst du deinen Arsch drauf verwetten!« »Na schön, wie wäre es dann mal mit einem intelligenten Rat, mit dem wir wirklich was anfangen können?« »Was denkst du denn, was ich gerade mache? Ihr Jungs seid zum ersten Mal hier oben. Ich mache das schon seit ein paar Jahren. Mehr sage ich gar nicht, okay?« Louis nahm seinen Wachdienst an der Tür wieder auf. »Was auch immer. Ihr großen Waldläufer werdet euch schon was einfallen lassen.« Raymond rauchte weiter seine Zigarette, schaute nun aber auf den Boden. »Reißt euch zusammen, es gibt hier Verletzte.« Darian sprang auf. »Wir müssen uns überlegen, was wir machen, und das muss schnell gehen!« »Louis, du hast mir mal gesagt, dass es hier in der Gegend noch andere Hütten gibt«, sagte Seth. »Welche liegt am nächsten in die Richtung, aus der sie kam, hinter diesem Bergrücken?« »Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wie man hierher kommt, und wie man wieder wegkommt. Das ist so ziemlich alles. Darum habe ich euch ja schon gesagt: Nicht alleine in den Wald gehen. Man kann sich hier draußen leicht verirren.« »Ja, aber du hast doch gesagt, es gibt hier noch andere Hütten in der Nähe.« »Klar, diese Wälder sind voll mit solchen Hütten, aber es gibt keine Karte von denen oder so was. Das Einzige, was ich mal gesehen habe, ist Rauch aus einem Kamin, das war schon irgendwo hinter diesem Bergrücken. Aber nicht auf diesem Trip.« »Dann könnte sie aber von dort gekommen sein.« »Könnte schon sein, aber wenn man nicht ganz genau weiß, wo man hin muss, kann man den ganzen Rest seines Lebens durch diese Wälder ziehen und dabei nichts und niemanden finden. Das versuche ich euch die ganze Zeit zu sagen. Das ist hier nicht irgendein Park mit ein paar Bäumen wie in der Stadt. Wir reden hier von richtig tiefem Wald, der Wildnis von Maine. Das ist kein Ponyhof. Schon gar nicht zu dieser Zeit des Jahres, verdammt. Hier in der Gegend triffst du ein paar schlechte Entscheidungen und bist im Handumdrehen tot.« »Gut, dann ist die einzige Alternative, sie in den Wagen zu schaffen und in den Ort runter zu fahren. Wenn wir dort wegen des Schneesturms nicht mehr weg können, dann bleiben wir eben da, was soll sein.« Raymond brach schließlich sein Schweigen. »Es gibt eine Sache, an die habt ihr Jungs noch gar nicht gedacht.« Die anderen drehten sich gleichzeitig in seine Richtung. »Vor ein paar Jahren war ich in so einer Bar in Florida«, fuhr er fort, »ein richtiger Scheißladen. Zwei Typen hatten sich über irgendwas gestritten und fingen an, sich zu prügeln. Die anderen dachten natürlich, das sind bloß zwei besoffene Idioten, die ein bisschen Dampf ablassen müssen. Nur, dass einer von denen dann ein Messer gezogen und den anderen abgestochen hat. Richtig krass, direkt hier rein.« Raymond deutete auf die rechte Seite seines Nackens. »Das Blut ist auf diesen Wichser gesprüht wie aus einem Gartenschlauch, der volle Pulle aufgedreht ist. Der andere war tot, bevor der Krankenwagen ankam. So viel Blut hab ich noch nie in meinem Leben gesehen.« »Warum erzählst du uns den Scheiß?«, fragte Louis, »Was zur Hölle willst du damit sagen?« »Ich will damit sagen«, erklärte Raymond ruhig, »als die ganze Sache vorbei war, hatte der Angreifer genauso viel Blut am Körper, wie die arme Sau, die er abgestochen hatte.« Stille breitete sich in der Hütte aus, und Raymond begab sich zur Tür. Er nahm einen letzten Zug von seiner Zigarette und schnipste sie über Louis' Schulter nach draußen. »Versteht ihr, was ich meine?« »Unterm Strich wissen wir einfach nicht, was hier passiert ist«, sagte Darian. »Ray hat recht. Sie könnte ein Opfer sein, aber sie könnte genau so gut eine Gestörte sein, die jemanden verletzt oder getötet hat. Es kann das eine oder das andere sein, aber nach meinem Verständnis sind das beides Argumente dafür, sie in den Ort zu schaffen. Soll die Polizei sich um den Rest kümmern.« Ein Husten unterbrach ihn. Die junge Frau war erwacht. Sie war immer noch erschöpft und konnte sich in die Decken gewickelt kaum bewegen, aber nachdem ihre Hustenattacke vorüber war, versuchte sie, zu sprechen. »Keine Polizei, nein … keine Polizei, bitte.« Ihre Stimme klang kratzig und brüchig, als hätte sie lange nicht gesprochen.»Bitte.«Louis trat näher an sie heran. »Was ist los? Ist jemand hinter Ihnen her?« Die Frau musterte ihn einen Moment mit ihren glasigen Augen. Etwas Speichel lief ihr aus dem Mundwinkel. »Nein«, presste sie hervor. »Nicht … nicht mehr.« Seth drängte sich dazwischen und hockte sich neben das Bett. »Niemand hier wird Ihnen etwas tun, okay?« Er legte seine Hand sanft auf ihre. Sie war klamm und kalt. »Sie sind in unser Camp gekommen, als wäre Ihnen jemand auf den Fersen. Wir haben Sie hier rein gebracht, um Sie aufzuwärmen. Sie sind jetzt in Sicherheit, verstehen Sie das?« Sie nickte langsam, mit großer Anstrengung. »Können Sie uns sagen, was passiert ist?«, fragte er, wobei er den gleichen, ruhigen Tonfall beibehielt, wie zuvor. »Wir müssen wissen, was los ist, damit wir Ihnen helfen können, okay?« »Mir ist … so kalt.« »Der Kaffee ist noch warm«, sagte Darian und begab sich in Richtung Kochecke. »Ich bringe Ihnen eine Tasse.« »Ich bin Seth.« Seth prüfte, ob sie noch gut in die Decke eingepackt war, dann deutete er reihum auf die anderen. »Das ist mein Bruder Raymond. Das ist Louis, und da drüben haben wir Darian. Wir nennen ihn Mother.« »Christy«, sagte sie mit schwerer Zunge. »Wie alt sind Sie, Christy?« »Neunzehn.« Seth war sich nicht sicher, ob er das glauben sollte. »Sind sie ganz alleine hier oben?« Sie starrte ihn an, als hätte sie die Frage nicht verstanden. »Sind Sie mit Ihren Eltern unterwegs, oder–« »Nein.« »Irgendwelche Freunde, vielleicht–« »Ich habe meine Eltern schon … lange nicht gesehen.« Darian kam mit einer dampfenden Tasse Kaffee zurück und drückte sie Seth in die Hand. Da dieser fürchtete, Christy könnte zu schwach sein, um das Gefäß selbst zu halten, hielt er die Tasse an ihre Lippen und ließ sie einen Schluck nehmen. Als die Wärme in ihrem Kreislauf ankam, schien sie sofort wacher zu werden, und innerhalb weniger Momente war sie geistig völlig anwesend. Seth half ihr weiter beim Trinken, bis sie ihm die Tasse schließlich abnahm und selbst zum Mund führte. »Danke«, sagte sie sanft. »Christy«, begann Seth mit einem gezwungenen Lächeln, »dein Hemd war in Blut getränkt.« Sie nahm noch einen Schluck Kaffee, wobei sich ihre Augen langsam von einem Mann zum nächsten bewegten. »Er wollte mich umbringen.« »Wer? Wer wollte dich umbringen?« »Dieser Mann … er hatte mich in der Nähe von Portland per Anhalter mitgenommen.« »Wo ist er jetzt?« »Immer noch in seiner Hütte … ich …« Als ihre Stimme versagte, glitzerten Tränen in ihren Augen. »Ich habe ihn da zurückgelassen.« »Also ist das sein Blut auf deinem Hemd?« »Ich komme eigentlich aus Florida«, sagte sie kleinlaut, »aber ich bin von zu Hause weggelaufen, als ich sechzehn war. Mein Vater ist gestorben, als ich elf war, und mit meiner Mutter bin ich nie klargekommen. Ich musste da raus.« Sie hielt die Tasse näher an ihr Gesicht und wärmte sich an dem Dampf. »Ich kannte ein anderes Mädchen aus der Schule, das auch abhauen wollte. Wir waren zusammen für ein paar Jahre auf der Straße unterwegs, zogen von Ort zu Ort, aber dann hatten wir uns mit ein paar irren Bikern aus South Carolina eingelassen, und Jeanie – das war meine Freundin – ist mit denen weitergezogen. Sie hat mich alleine gelassen, aber damals war ich schon siebzehn, und alleine zurechtzukommen war kein Problem.« Sie zeigte ein kurzes, nachdenkliches Lächeln, bevor sie noch einen Schluck Kaffee nahm. »Total faszinierend«, maulte Louis, »aber wir haben nicht nach deiner Lebensgeschichte gefragt! Warum bist du blutbeschmiert durch den Wald gerannt?« Christys Augen verengten sich. Sie versuchte, zu fokussieren. »Sorry, ich …« »Vergiss das erst mal«, sagte Seth. »Erzähl' weiter.« »Ich hatte überlegt, mir mal Kanada anzuschauen. Ich war noch nie dort und alle erzählten immer, wie schön es ist. Im Winter muss man sich eigentlich an wärmere Gegenden halten, wenn man auf der Straße lebt, aber ich dachte, dieses Jahr gehe ich mal nach Norden. Montreal oder so. Da wollte ich schon hin, seit ich ein kleines Mädchen war.« Sie schien sich ein wenig zu entspannen und zog die Decke mit ihrer freien Hand näher an sich heran. »Ich war also gerade auf dem Weg dahin, per Anhalter, und dieser Typ hat mich kurz hinter Portland aufgesammelt. So ein Redneck, ein Hinterwäldler, ihr wisst schon. Aber ich bin schließlich schon seit Jahren alleine unterwegs, ich kann auf mich aufpassen, okay?« Ihre Stimme wurde brüchig. Sie schaute in ihre Kaffeetasse hinein und drückte sie auf einmal Seth in die Hand, als würde der Inhalt sie plötzlich anekeln. Er nahm sie ihr ab, und Christy rutschte noch tiefer in die Decken hinein, während eine einzelne Träne ihre Wange hinab lief. Obwohl sie im ersten Moment unglaublich jung erschien, verriet ein genauerer Blick in ihr Gesicht, dass ihr kurzes Leben verdammt hart gewesen sein musste. Ein Mädchen ihres Alters sollte nicht so stumpfe Augen haben, die einerseits abgehärtet und desillusioniert wirkten, gleichzeitig aber voller Sorge waren. Seth war sich sicher, dass sie nicht nur ein kleines Mädchen war, das tough wirken wollte – sie war es wirklich. »Wenn man auf der Straße lebt, dann muss man manchmal Dinge tun …«, murmelte sie, »… man muss überleben.« Louis schüttelte den Kopf. »Okay, ich kapiere. Du bist 'ne Nutte.« »Ignoriere ihn.« Seth warf Louis einen vernichtenden Blick zu, dann wandte er sich mit einem viel freundlicheren Gesichtsausdruck wieder Christy zu. »Das machen wir auch die ganze Zeit.« »Ich bin keine Nutte – also, nicht wirklich … ich meine, ich habe schon so einige Sachen gemacht, um zu überleben, auf die ich nicht gerade stolz bin … aber ich stehe jetzt nicht an der Straßenecke unter einer Laterne, ich–« »Christy«, sagte Seth ruhig, »was ist mit dem Mann passiert, der dich im Auto mitgenommen hat.« Ihr Gesicht leerte sich, die Emotion verschwand. »Er hat mich früh morgens eingesammelt. Also so richtig früh, noch im Morgengrauen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die ganze Nacht gelaufen bin, oder ob ich anhielt, um ein bisschen zu schlafen … Ich kann mich einfach nicht erinnern. Aber als er neben mir stoppte, war ich noch nicht weit von Portland entfernt. Von der Nacht davor weiß ich nur noch, dass ich unglaublich müde war. Ich hatte meinen Rucksack dabei und hatte überlegt, mich einfach in den Wald neben der Straße zu legen. Es war kaum Verkehr, so gut wie gar keine Autos, und es hat geregnet. Ich erinnere mich … ich erinnere mich an den Regen. Der war so schön kühl. Ich meine diese total schöne, friedliche Art von Regen, wisst ihr? Jedenfalls war ich so müde und meine Beine taten weh vom Laufen – ich bin an dem Tag echt viel gelaufen – und ich erinnere mich, wie schön der Regen war, bis er zu einem Sturm wurde … einem richtigen Unwetter. Ich hatte Angst – eigentlich weiß ich gar nicht genau, warum. Ich meine, ist ja nicht so, als wäre ich noch nie in einen Sturm geraten. Aber da war irgendwas komisch, irgendwas fühlte sich falsch an. Irgendwie so, wie ein übler Trip.« »Schon klar«, seufzte Louis, »Welche Art von Drogen hattest du genommen?« Christys Gesichtsausdruck sprang zurück aus dem tranceartigen Zustand und sie sah auf einmal wieder ganz traurig und schwach aus. »Ich rauche manchmal ein bisschen Gras, na und?« »Das ist voll in Ordnung«, versicherte Seth, »was ist aus dem Mann geworden?« »Ich kann mich nur erinnern, wie er am nächsten Morgen rechts ran gefahren ist, um mich mitzunehmen. Es war total früh, das habe ich ja schon gesagt, und irgendwie kam mir der Typ komisch vor. Aber ich war so müde und es waren weit und breit keine anderen Autos unterwegs, also bin ich eingestiegen.« Ihre Gesichtszüge verkrampften sich, offensichtlich zwang sie sich dazu, Dinge zu erzählen, an die sie sich am liebsten gar nicht erinnern wollte. »Er sagte, dass er bis nach Cutler fahren würde, und das ist voll nah an der kanadischen Grenze. Er meinte, er könnte mich die ganze Strecke mitnehmen. Er hat auch nichts probiert, wenn ihr wisst, was ich meine, aber irgendwas stimmte mit ihm nicht. Wenn man in so vielen komischen Autos mitgefahren ist, wie ich, dann kriegt man dafür so 'ne Art sechsten Sinn. Aber mir war klar, dass ich auf den Typen angewiesen war, also dachte ich, ich schaue einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt.« »Nach ein paar Stunden schlief ich ein«, fuhr sie fort. »Das sollte man nie machen, wenn man per Anhalter fährt, aber ich konnte nichts dagegen machen … ich konnte die Augen nicht mehr offen halten. So bin ich dann eingeschlafen. Ich weiß nicht, wie lange ich weg war, aber als ich aufwachte, waren wir nicht mehr auf dem Highway. Davon bin ich nämlich aufgewacht; die Straße war auf einmal total hubbelig, und ich habe gesehen, dass wir auf irgendeiner Schotterpiste durch den Wald fuhren. Ich fragte ihn, was los sei, und wo wir hinfahren, aber er … er sagte einfach gar nichts. Stattdessen hat er mich geschlagen; plötzlich hat er mir mit dem Handrücken auf den Mund geschlagen. Ich konnte es gar nicht glauben, und dachte:Dieser Typ wird mich töten, er wird mich vergewaltigen und mich dann hier im Wald vergraben.Wir waren schließlich schon in totalem Niemandsland und ich hatte keine Chance, abzuhauen.« Seth musste einen Anflug von Zorn herunter schlucken. Die Vorstellung, dass jemand Christy etwas antat, brachte sein Blut zum Kochen. »Hast du deswegen die blauen Flecken an den Handgelenken und Knöcheln?« Christy starrte die Wunden an ihren Unterarmen an, als hätte sie vergessen, dass sie existierten. »Er hat mich immer gefesselt, wenn er mich nicht gerade …« Sie ließ, ihren Kopf sinken und weinte leise. »Es ist alles in Ordnung.« Seth legte ihr eine Hand auf die Schulter und drückte sie sanft. »Du bist jetzt in Sicherheit. Niemand wird dir mehr wehtun.« »Er brachte mich in eine Hütte«, sagte sie schließlich, wobei sie sich die Tränen aus dem Gesicht wischte. »So ähnlich wie die hier, nur nicht so hübsch. Sie war älter und dreckig, ziemlich heruntergekommen. Ich weiß nicht, wie lange ich dort war. Ein paar Tage vielleicht, ich … ich bin nicht sicher. Die meiste Zeit war ich gefesselt und hatte die Augen verbunden. Er war irre. Er hat mir immer wieder gesagt, wenn ich versuche zu fliehen oder wenn ich mich wehre, dann würde er mich töten, mich in kleine Stückchen zerschneiden und dann im Wald vergraben. Er sagte, niemand würde mich jemals finden, weil keiner nach mir suchen würde. Niemand würde sich um eine herumstreunende Hure sorgen.« »Wir müssen sie in ein Krankenhaus bringen«, sagte Darian leise. Aber Christy fuhr fort, als hätte sie ihn nicht gehört. »Er hatte diese riesige Axt, und eines Nachts war er total betrunken, und hat gesagt, er schneidet mir das Herz raus. Ich hatte die ganze Zeit schreckliche Albträume … nur … dass es eigentlich keine Albträume waren, weil ich wach war, und ich dachte, vielleicht verliere ich den Verstand. Ich dachte immer wieder über den Regen nach und den komischen Sturm in dieser Nacht, das ging mir einfach nicht aus dem Kopf. Geht es immer noch nicht.« Christy fuhr sich durch die Haare und machte dabei ein leises, wimmerndes Geräusch. »Ich wusste, dass er mich in dieser Nacht töten würde. Die Augenbinde hat er mir immer abgenommen, wenn er mich vergewaltigt hat, aber meine Hände waren die ganze Zeit gefesselt. Bei diesem letzten Mal war es aber anders, da hat er das Seil durchgeschnitten und meine Hände freigelassen. Dadurch habe ich gewusst, dass er mich nun töten wollte. So wie ein großes Finale, wisst ihr? Er hat sogar die Axt in meine Nähe gelegt, sodass ich sie theoretisch erreichen könnte. Das hat er vorher noch nie gemacht. Wahrscheinlich dachte er, ich bin inzwischen so verängstigt und kraftlos, dass ich mich nicht mehr wehren würde. Aber genau das habe ich getan. Er war echt total besoffen, und dann fing er an, sich die Hose aufzumachen«, fuhr sie fort, »da sah ich eine Chance, also habe ich sie genutzt und …« Sie fing wieder an, zu schluchzen. »Jesus Christus«, rief Louis, »sie hat diesen Typen verdammt noch mal umgebracht!« Christys Kopf schnellte nach oben, ihre Augen suchten Louis durch die Tränen. »Ich wollte es nicht, ich schwöre bei Gott! Ich wollte – ich wollte ihn einfach nicht in meiner Nähe haben, ich – ich wollte nicht, dass er mich noch mal anfasst. Als ich mir die Axt geschnappt habe, da wollte ich doch nur, dass er mich gehen lässt … aber er kam auf mich zu, also habe ich die Axt mit aller Kraft, die ich noch hatte, geschwungen. Ich wollte ihn nur von mir fernhalten, ich …« Sie schwieg für einen Moment. »Er ist direkt in die Klinge gerannt. Sie hat ihn in der Magengegend erwischt. Er fiel über mich, wir kippten beide um, und er landete direkt auf mir drauf. Wir lagen auf dem Boden, und ich bekam ihn nicht von mir runter. Er gurgelte und blutete, und ich trat und zappelte und schrie … ich … ich wollte ihn wegstoßen.« Christy atmete tief ein und dann ganz langsam aus. »Irgendwie hab ich ihn dann von mir runter bekommen, dann bin ich zur Tür rausgerannt und in den Wald. Ich wusste nicht mal, wo ich war, aber ich rannte, so schnell ich konnte. Nach einer Weile sah ich Rauch über den Baumwipfeln und versuchte, in die Richtung zu laufen. Das muss von eurem Kaminfeuer gewesen sein, schätze ich.« »Als du rausgerannt bist, hat da der Mann noch gelebt?«, fragte Darian. Louis beantwortete die Frage: »Scheißegal. Inzwischen ist er tot. Darauf kannst du wetten. Mit so einer Wunde ist der Typ wahrscheinlich innerhalb von Minuten ausgeblutet.« Christy schlang die Arme um ihren Oberkörper und zitterte. »Lou hat recht«, sagte Raymond aus der anderen Zimmerecke, »der muss inzwischen tot sein.« Seth stand auf und rieb sich die Augen. »Der Wichser hat es nicht anders verdient.« »Da gebe ich dir absolut recht«, sagte Darian. »Aber wir dürfen nicht vergessen, es geht hier um Kidnapping, Vergewaltigung und wahrscheinlich Mord. Wir müssen die Polizei verständigen.« »Richtig«, stimmte Seth zu, »absolut richtig.« »Bitte«, sagte Christy plötzlich, »bitte ruft nicht die Cops.« »Wenn es sich so abgespielt hat, wie du sagst, hast du nichts zu befürchten«, erklärte Louis. »Das war reine Notwehr.« »Ihr versteht das nicht.« Sie war jetzt so aufgeregt, dass sie fast aus dem Bett stieg. »Ich kann nicht zur Polizei gehen, auf keinen Fall!« Seth ging wieder in die Hocke und hielt ihre Schultern, dann schob er sie sanft zurück in die Decken. »Ruhig«, sagte er, »ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung, es istalles in Ordnung.« Christy erschlaffte wieder und lehnte sich zurück, während frische Tränen ihre Wangen befleckten. »Ich hatte schon oft Ärger mit den Cops«, sagte sie, »Ich bin vorbestraft; bin schon ein paarmal festgenommen worden.« »Weswegen?«, fragte Louis. »Kiffen. Und einmal wegen Prostitution.« »Das ist jetzt aber egal«, erklärte ihr Seth, »dieser Mann hat dich entführt und angegriffen, er hat sogar gedroht, dich umzubringen. Du hattest alles Recht, dich zu wehren. Da spielen deine Vorstrafen überhaupt keine Rolle.« »Du redest wie ein Anwalt.« Sie beäugte ihn mit einer Mischung aus Interesse und Besorgnis. »Oder wie ein Cop.« »Ich bin aber weder das eine noch das andere«, versicherte er ihr mit einem verunglückten Lächeln. »Ich bin Kundendienstmanager. Ich verdiene mein Geld damit, Leute zu beruhigen.« Sie kämmte sich mit den Fingerspitzen die Haare aus dem Gesicht. »Ich hatte aber schon oft genug mit den Bullen zu tun. Die glauben jemandem wie mir einfach nicht. Erst recht nicht hier in der Gegend. Da kennt jeder jeden, das habe ich schon erlebt. Die sind alle miteinander verwandt. Deswegen wird mein Wort nichts zählen, jedenfalls nicht, wenn es gegen einen von ihren Leuten geht.« »Das ist nicht unser Problem, Fräulein.« Louis durchquerte den Raum mit langen Schritten und stellte sein Gewehr wieder in den Schrank. »Hol' dir einen Anwalt.« »Bitte«, sagte sie zu Seth, »ich war schon im Gefängnis. Ich kann da nicht hin zurück, das halte ich nicht aus. Esgehtnicht.« »Das kann ich nachvollziehen«, sagte Raymond. Aber statt auf den Kommentar seines Bruders einzugehen, sagte Seth: »Ray, ich hab ein paar alte Sweatshirts in meinem Koffer, kannst du ihr bitte eines davon bringen? Und bring auch ein Paar Socken mit!« Er machte Christy gegenüber eine Geste in die gegenüberliegende Ecke des Raumes, wo sich die Tür zum Badezimmer befand. »Da drin kannst du dich waschen und umziehen. Wir haben leider keine Schuhe übrig, aber die Socken sind hoffentlich besser als nichts. Auch wenn sie ein paar Nummern zu groß sein dürften.« Sie nickte. »Hast du Hunger?« »Ja, ein bisschen, aber … ich bin einfach nur müde.« »Darian macht heute Abend sein weltberühmtes Gulasch. Ist bestimmt bald fertig.« Raymond erschien an seiner Seite und hielt ein altes, graues Sweatshirt und ein paar dicke, weiße Socken in der Hand. Seth nahm sie ihm ab und hielt sie Christy vor die Nase. »Zieh dich doch erst mal um, und dann versuche, ein bisschen zu schlafen. Wegen des Sturms wird sich hier in nächster Zeit sowieso niemand wegbewegen können. Wir sprechen dann später über den ganzen Rest.« Sie nahm ihm die Kleidungsstücke vorsichtig aus der Hand, als wären sie Schätze von unermesslichem Wert. »Danke.« Seth half ihr, aus dem Bett zu kommen. Als sie aufstand, fielen die Decken zu Boden. Das Blut auf ihrem Hemd war dunkler geworden und wirkte dadurch irgendwie noch beunruhigender. Die Männer taten alle ihr Bestes, sich nichts anmerken zu lassen. Christy bewegte sich langsam und man sah, dass es ihr Mühe bereitete. Ihre Beine waren ganz offensichtlich nicht stark genug, um sie zu tragen, aber immerhin kam sie überhaupt vorwärts. Bevor sie ins Badezimmer schlüpfte, schaute sie sich noch einmal nach den Männern um – als würde sie sichergehen wollen, dass sie noch da waren. Dann schloss sie die Tür hinter sich. »Was zur Hölle hast du vor«, fragte Louis, »sie kann nicht hierbleiben, Mann!« »Was sollen wir denn sonst machen, sie aussperren?« Darian bedeutete ihnen, näher zusammenzurücken. »Nicht so laut, Jungs! Das arme Mädchen hat schon genug durchgemacht.« »Glaubst du ihr etwa, Mother?« »Ja Louis, das tue ich«, bestätigte Darian, »Ich sehe keinen Grund, warum sie lügen sollte.« »Ich glaube ihr auch«, bekräftigte Seth. »Wir müssen trotzdem die Polizei informieren«, fügte Darian hinzu. »Es geht hier immerhin um Mord, selbst wenn es Notwehr war, und damit will ich nichts zu tun haben. Sobald der Sturm vorüber ist, fahren wir in den Ort und verständigen die Polizei. Ende der Diskussion.« »In Ordnung«, sagte Seth. »Die Kleine tut mir unglaublich leid, aber wir dürfen uns da nicht noch tiefer reinreiten.« »Wir wissen doch überhaupt nicht, was wirklich passiert ist«, warf Louis ein, »Verdammt noch mal, das ist meine Hütte, und–« »Es ist die Hütte deines Onkels«, fiel Darian ihm ins Wort. »Beruhige dich.« »Was auch immer. Fakt ist, die Hütte ist Eigentum meiner Familie, und damit bin ich verantwortlich für das, was hier drin passiert, okay?« »Was sollen wir denn deiner Meinung nach machen?«, fragte Seth. »Du bist doch derjenige, der gesagt hat, dass wir nicht mehr hierher zurückkommen, sobald der Sturm richtig loslegt. Wir sitzen im Augenblick hier fest, richtig? Ich weiß, es ist eine irre Situation, aber was haben wir für Optionen?« Louis verschränkte die Arme vor der Brust und schüttelte langsam seinen Kopf. »Wenn der Sturm wirklich so stark wird, wie angekündigt, dann werden wir hier einschneien. Vielleicht kommen wir nicht mal vor Freitag zurück auf die Hauptstraße. Das ist in zwei Tagen. Wie zur Hölle soll das gehen, wenn sie hier übernachtet und alles? Was, wennsieder Psycho ist?« Seth dachte kurz nach. »Lasst es uns unauffällig machen, aber wir halten nachts abwechselnd Wache, okay? Wie wäre es damit? Sobald sie zu Bett geht, bleibt einer auf, bis wir wissen, dass sie keine Gefahr für uns ist.« »Mir gefällt das Ganze überhaupt nicht, aber ich schätze, es gibt keine andere Möglichkeit«, sagte Louis zerknirscht. »Du bist die ganze Zeit so ruhig, Ray«, sagte Seth, »Was denkst du?« »Ich denke, dass ich jetzt mal eine rauchen gehe.« Raymond ging in Richtung Tür, die Kippenschachtel in der Hand. »Super«, platze es aus Louis hervor. »Vielen Dank für deinen hilfreichen Input, Mann!« Ray schüttelte eine Zigarette aus der Packung, steckte sie sich in den Mundwinkel und zündete sie mit einem Zippo an. »Der Sturm ist schon da, der Schnee fällt bereits, was sollen wir noch lange reden? Wie Seth schon sagte, niemand geht hier nirgendwohin.« Er erstickte die Flamme, indem er den silbernen Metalldeckel des Feuerzeugs zuschnappen ließ. Dann zog er die Tür auf und trat nach draußen. »Jedenfalls nicht in nächster Zukunft.«
***
Die Erlebnisse des Vortages verblassten und Seth fand sich in der Gegenwart wieder, nachts in der Hütte. Er blinzelte die letzten Erinnerungen fort, als ihm klar wurde, dass er immer noch im Bett lag und die offene Tür anstarrte. »Was ist los?«, fragte er noch einmal. Statt sich zu artikulieren, schüttelte Louis seinen Kopf. Seine Bewegungen waren ruckhaft und merkwürdig zögerlich, als ob er gerade erst lernen würde, mit seinem Körper umzugehen. Seth schwang die Beine herum, bis seine Füße den Boden berührten. Selbst in den dicken Wollsocken konnte er fühlen, wie die Kälte durch die Dielen zog. Er rieb sich die Augen und stand auf. Louis drückte seinen Oberkörper hoch und verdrehte den Kopf über die Schulter, um Seths Blick folgen zu können. Als er mitbekam, dass die Tür offen war, stand er blitzschnell auf den Beinen. Genau wie Seth trug er lange Unterwäsche, einen Pullover und ein paar dicke Socken. »Warum zur Hölle steht die Tür offen?«, fragte er müde. Er warf einen Blick auf die Stelle am Boden, wo Raymond eigentlich liegen sollte. »Wo ist Ray?« Seth zuckte mit den Schultern, er war immer noch nicht ganz da. »Ich weiß nicht, ich – er muss nach draußen gegangen sein.« »Nachdraußen? Wieso denn das?« »Keine Ahnung, ich bin selbst gerade erst aufgewacht.« Der Schnee hatte bereits eine kleine Düne an der Türschwelle gebildet. »Die Tür muss schon eine Weile offen sein«, murmelte Seth, »Ich glaube, ich bin von der Kälte aufgewacht.« Louis kratzte sich am Kopf und sah zum Kamin hinüber. Abends hatten sie dort Feuer gemacht, aber das war schon lange heruntergebrannt. Die Hütte hatte weder Heizung noch Elektrizität oder laufendes Wasser, nur eine Chemietoilette im Badezimmer. »Warte mal«, sagte er, »Vielleicht ist er nur auf dem Klo. Vielleicht war das Türschloss nicht richtig eingeschnappt, und die Tür ist vom Wind aufgestoßen worden.« Seth fühlte beim Erfassen dieser Möglichkeit sofort eine unglaubliche Erleichterung und ging auf die Badezimmertür zu. Innen brannte kein Licht, aber die Tür war leicht geöffnet. »Ray?« Als niemand antwortete, gab Seth der Tür einen kleinen Schubser. Sie schwang langsam auf und gab den Blick nach innen frei. Der winzige Raum war leer. Seth wandte sich wieder Louis zu und schüttelte den Kopf, wobei seine Erleichterung wieder zu Sorge wurde. Er näherte sich der Vordertür, so weit er konnte, ohne in die Schneewehe zu treten und starrte in die Nacht hinaus. Nichts war zu sehen, außer Dunkelheit und Schneeflocken. »Raymond«, rief er, »Ray?« »Warum zur Hölle würde er nach draußen gehen?« Louis schnappte sich seine Jeans vom Fußende des Betts und stieg mit einer wackeligen, hüpfenden Bewegung hinein, die Seth unter allen anderen Umständen wahrscheinlich zum Lachen gebracht hätte. Dann machte er sich auf die Suche nach seinen Stiefeln. Seth drehte sich hilflos von der Tür weg. »Ich … ich weiß nicht.« »Es muss irgendwas passiert sein!« Je mehr Seths Verstand sich schärfte und vom Traumzustand entfernte, um so mehr wusste er, dass Louis recht hatte: Es war etwas passiert. Etwas Schlimmes. Raymond war noch nie hier oben gewesen, er kannte sich in der Umgebung überhaupt nicht aus. Und was das Ganze noch schlimmer machte: Keiner aus der Gruppe hatte Erfahrung mit der Wildnis. Louis war der Einzige, der ab und zu mal campte und etwas mehr über die Natur hier oben wusste. Aber das war nicht sehr viel. Unterm Strich waren sie alle nur Stadtkinder. Wenn man nun noch den unerwarteten Schneesturm mit einbezog, der die Dimensionen eines Blizzards hatte, dann deutete alles auf eine Katastrophe hin. »Warte mal einen Moment«, sagte Louis plötzlich. »Christy ist auch weg!« Der Rest des vorigen Abends war ein bisschen verkrampft aber insgesamt ereignislos verlaufen. Sie hatten sich kaum mit Christy unterhalten, da sie die meiste Zeit geschlafen hatte und nur für das Abendessen aus dem Bett kam. Später in der Nacht hatten sie dann Feuer gemacht und sich schließlich schlafen gelegt. Von den drei vorhandenen Betten hatten sie eines Christy zugeteilt und dann Münzen um die beiden anderen geworfen. Seth und Louis hatten gewonnen, also hatten Darian und Raymond mit Schlafsäcken vorlieb nehmen müssen. Aber all das schien Seth immer noch nebulös und nicht greifbar zu sein, als ob in den Tiefen seiner Erinnerung noch andere Dinge existierten, an die er denken wollte, an die er sich erinnernmusste, es aber nicht konnte. Es schien ihm alles so irreal. Waren das wirklich Erinnerungen, oder nur Träume? Seth fiel wieder ein, dass er schon einmal in dieser Nacht aufgewacht war, und Raymond in einem Stuhl am Kamin sitzen sehen hatte, wie er in die Flammen starrte. Wie verabredet hatte er die erste Schicht übernommen, um wach zu bleiben und ein Auge auf Christy zu werfen. »Ray«, hatte Seth geflüstert, »alles in Ordnung?« Als Antwort hatte er nur ein leichtes Nicken erhalten. »Ich bin als Nächster dran. Dann legst du dich in mein Bett, okay? Wenn ich fertig bin, nehme ich den Schlafsack, ist kein Problem.« »Alles gut. Ich wollte mir sowieso das Feuer noch ein bisschen ansehen. Bin gar nicht wirklich müde.« Seth schaute rüber zu dem Bett, wo Christy friedlich schlummerte. »Bist du sicher, dass mit dir alles in Ordnung ist?« »Ich hab einfach ein bisschen viel getrunken.« Raymond hielt eine Flasche Jack Daniels hoch und lächelte schelmisch. Er hatte schon den ganzen Abend damit verbracht, die Flasche war fast leer. »Leg dich ruhig wieder hin und schlaf noch ein bisschen, mir geht's gut.« Das schien alles so verdammt lange her, dachte Seth, so entfernt und verschwommen, als wäre es vor Jahren passiert und nicht vor ein paar Stunden. Darian wurde wach, während Seth und Louis sich anzogen, doch er blieb zitternd in seinem Schlafsack liegen. »Was ist denn … was … was ist los?« Er tastete hektisch nach seiner Brille, fand sie und setzte sie auf. »Das ist ja die reinste Kältekammer hier!« »Ray ist draußen«, erklärte Louis ihm, »Christy ist auch weg.« »Was? Wieso?« Statt eine Antwort zu geben, zog Seth seine Jacke über und folgte Louis zur offenen Tür. Er kickte im Vorbeigehen in die Schneewehe, die sich an der Türschwelle gebildet hatte, und schlüpfte dann hinaus in die Nacht. Ein endloses Meer weißer Flocken taumelte ihm entgegen, der Hintergrund bloß dichteste Dunkelheit. Die resultierende Sichtweite betrug kaum mehr als ein paar Meter. »Ich kann keine Fußabdrücke sehen, aber der Schnee kommt so schnell runter, dass sowieso alles innerhalb von Minuten verdeckt ist!« Louis formte mit seinen Händen einen Schalltrichter und schrie in die Dunkelheit hinaus. »Ray! Hey, Ray!« Seine Stimme hallte durch die nahe gelegenen Bäume, bevor sie vom Sog des Windes verschluckt wurde. »Was zum Henker kann sie dazu getrieben haben, da raus zu gehen?«, fragte Darian hinter ihnen. »Ich wusste es doch, wir hätten dieser Schlampe nicht trauen dürfen!« Louis drehte sich zu Seth. »Hol das Gewehr. Ohne das Ding machen wir keinen Schritt weiter.« »Sei nicht albern. Wir stehen hier mitten in einem Blizzard!« »Hol einfach das Gewehr, es ist in der Kammer.« »Wir reden hier über meinen Bruder, Louis! Wir müssen ihn finden. Jetzt sofort!« Louis starrte ihn an, sein verkrampftes Gesicht kaum beleuchtet. »Dann hol das verdammte Gewehr!« Nach einem kurzen Innehalten nickte Seth schließlich und tat wie ihm geheißen. Darian steckte immer noch in seinem Schlafsack, doch er kämpfte sich in eine stehende Position hoch und hopste in kleinen Sprüngen zu ihnen herüber. »Seid vorsichtig! Geht bloß nicht zu weit raus!« Louis und Seth traten hinaus in die Dunkelheit.