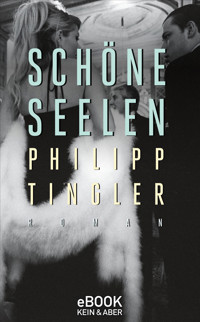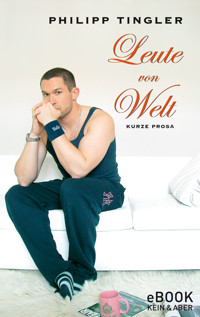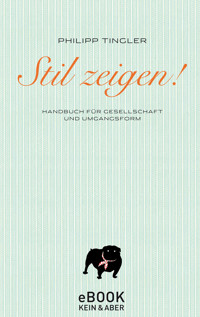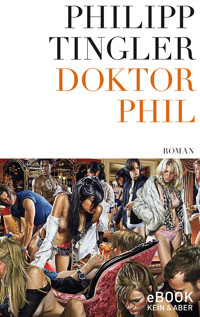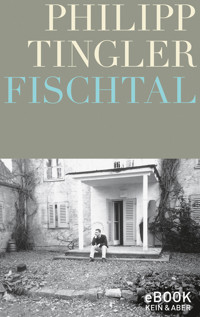
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gustav bewohnt mit seiner Großmutter ein Haus namens Fischtal und lebt inmitten einer Gesellschaft, deren größte Sorge es zu sein scheint, dass die Putzfrau heimlich das Konfekt isst. Doch je mehr er im Fischtal über seine Familie erfährt, desto deutlicher wird ihm, dass es mit dem Nervenkostüm dieser Verwandtschaft nicht zum Besten steht. Man zahlt einen Preis für das Wahren der Fassade.
Als die Großmutter Jahre später stirbt, kehrt Gustav zur "Sichtung der Erbmasse" ins Fischtal zurück. Es ist sein letzter Besuch in der Festung einer Welt, wo kühler Realitätssinn, glatte Oberfläche und puritanische Sittenstrenge gepredigt werden und über andere Menschen streng Gericht gehalten wird. Aber dabei immer griffbereit in der krokodilledernen Handtasche stets griffbereit: der silberne Flachmann und die Pillendose von Cartier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Inhaltsverzeichnis
» Impressum
» Weitere eBooks von Philipp Tingler
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Philipp Tingler wurde 1970 in Berlin (West) geboren. Studium der Wirtschaftswissenschaften und Philosophie in St. Gallen, London und Zürich. Hochbegabten-Stipendium, Doktorarbeit über Thomas Mann und den transzendentalen Idealismus Immanuel Kants. Diverse Beiträge für Anthologien sowie für Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk und Fernsehen, u. a. für den Westdeutschen Rundfunk, Schweizer Radio DRS, Vogue, Stern, Neon und NZZ am Sonntag. Kolumnen u. a. in GQ und Welt am Sonntag. 2001 Ehrengabe des Kantons Zürich für Literatur, 2008 Kasseler Literaturpreis für komische Literatur.
Weitere Titel von Philipp Tingler bei Kein & Aber: Juwelen des Schicksals (2005), Leute von Welt (2006), Stil zeigen! (2008), Doktor Phil (2010) und Leichter Reisen (2011) sowie die CD Das Abc des guten Benehmens (2008).
Der Autor lebt in Zürich.
www.philipptingler.com
ÜBER DAS BUCH
Die letzten Tage von West-Berlin sind angebrochen. Allerdings merkt davon niemand etwas, jedenfalls nicht in Zehlendorf. Dort bewohnt der siebzehnjährige Gustav zusammen mit seiner Großmutter ein Haus namens Fischtal. Gustav lebt inmitten einer Gesellschaft, deren größte Sorge es zu sein scheint, dass die Putzfrau heimlich das Konfekt isst. Doch je mehr er im Fischtal über seine Familie erfährt, desto deutlicher wird ihm, dass es mit dem Nervenkostüm dieser Verwandtschaft nicht zum Besten steht. Man zahlt einen Preis für das Wahren der Fassade. Als die Großmutter Jahre später stirbt, kehrt Gustav zur »Sichtung der Erbmasse« ins Fischtal zurück. Es ist sein letzter Besuch in der Festung einer Welt, wo kühler Realitätssinn, glatte Oberfläche und puritanische Sittenstrenge gepredigt werden und über andere Menschen streng Gericht gehalten wird. Aber dabei immer griffbereit in der krokodilledernen Handtasche: der silberne Flachmann und die Pillendose von Cartier.
»Verzweifelt amüsant, hinreißend absurd, zum Heulen komisch.«
taz
Gewidmet der Erinnerung
an meine Großmutter
Doris Schopohl (1911–1996)
INHALTSVERZEICHNIS
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
ERSTER TEIL
in dem wir die Hauptfigur und einige andere wichtige (und weniger wichtige) Figuren kennenlernen, vor allem jede Menge Tanten
1.KAPITEL
Zauber des Letzten
»Ich weiß nicht«, flüsterte Lilli und fasste Gustav am Arm, »ist es richtig, was wir hier tun?«
»Was meinst du?«, fragte Gustav zurück.
»Ich meine, hier das Haus auszuräumen«, erwiderte Lilli. »Damit will ich sagen: Das ist doch im Grunde … nun ja: skrupellose Raffgier – und steht somit gegen alles, was mir anerzogen wurde.«
Die schwere Eichentür öffnete sich knarrend. Sie hatte immer geknarrt, weshalb unbemerktes nächtliches Nachhausekommen für Gustav nie ein einfacher Vorgang gewesen war, denn seine Großmutter hörte (obschon sie das Gegenteil behauptete) zwar nicht mehr alles, aber das Knarren der Haustüre war ihr doch so vertraut, dass es sie noch in ihrem Schlafzimmer in der Beletage alarmierte. Und dann konnte es passieren, dass sie plötzlich am Kopfe der Treppe erschien, die mit einem schweren himmelblauen Teppich bespannt war, und direkt auf die Haustüre zulief. Dort stand sie, im Nachthemd, und verlangte Rechenschaft. Das war immer sehr unangenehm für Gustav. Deshalb hatte er mit der Zeit eine perfekte Übung darin entwickelt, die Türe mit den leicht verwitterten Messingbeschlägen so zu handhaben, dass sie sich ohne jedes Geräusch öffnete. Man musste dazu einen präzisen kleinen Schwung anbringen, indem man die Haustüre zunächst ganz langsam, ab einem gewissen kritischen Punkt jedoch sehr zügig aufdrückte. Das war nun nicht mehr nötig. Gustavs Großmutter war gestorben.
Vor ihnen lag also die Treppe. Nach rechts und links verzweigte sich der Korridor, einer jener langen Korridore, die charakteristisch für die Bauart Berliner Häuser sind. Es war dunkel. Dabei war draußen heller Vormittag. Nun, nicht vollkommen hell. Es war einer jener nebligen Juni-Vormittage, die charakteristisch für den Berliner Frühsommer sind. Jedenfalls in Zehlendorf. Gustavs Großmutter war tot, und es war Zeit, die Erbmasse zu sichten.
»Wir tun hier nichts Unrechtes!«, sagte Gustav, »wir sichern bloß das Erbe, bevor die Familie einfällt. Du weißt, Lilli, dass ich meine Familie liebe. Auch wenn ich den einen oder anderen manchmal mit dem Auto überfahren möchte. Nein, weiß Gott, wir tun hier nicht Unrechtes. Und meine Großmutter wäre auf unserer Seite! Man kann zwar sagen, dass wir, sie und ich, nun, dass wir beide unsere Differenzen hatten …«
»Du meinst das eisige, ungemütliche Schweigen, das nur hin und wieder durch Beleidigungen unterbrochen wurde?«, erkundigte sich seine Freundin.
»Das ist der normale Umgangston bei uns zuhause«, erklärte Gustav, wobei sein Mund einen widerwilligen Ausdruck annahm.
»Gewiss«, sagte Lilli, »das ist völlig normal. Ich … ich habe nur so ein unangenehmes Gefühl in der Magengrube – so, als würde ich einem Unfall in Zeitlupe zusehen. Als ob wir schreckliche und egoistische Menschen wären! Außerdem ist es hier kalt und dunkel. Was, wenn ich hinfalle und irgendwelche meiner Organe dabei kaputtgehen?«
Gustav hob ein wenig das Kinn, als hätte er einen Stoß empfangen, und antwortete: »Da du von schrecklichen und egoistischen Menschen sprichst: Tante Gretel ist unterwegs hierher. Sie hat die Inventarliste in ihrer Handtasche und dürfte momentan emotional so stabil sein wie ein Käfig voller Ratten in einem brennenden Crack-Labor. Reiß dich also zusammen, Elisabeth! Gehorche mir einfach blind und roboterhaft und führe jeden Befehl aus, egal wie klein oder absurd er dir erscheint!«
Bei seinen letzten Worten packte Gustav seine alte Kameradin am Arme und schüttelte sie ein wenig, um sie zur Besinnung zu bringen.
»Schon gut, schon gut!«, machte Lilli, »das war bloß so ein Anflug. Los geht’s! Ich muss sowieso um sechs Uhr zur Maniküre bei Amanda sein. Die ist verdammt schwer zu kriegen. Und würdest du mich freundlicherweise loslassen. Du hast den Griff eines Eisenbahnbremsers.«
Der Nebel war gewaltig, ja er schien vor den efeubewachsenen Mauern nicht haltzumachen, sondern schwärzlich durchs Haus zu quellen, zog in gespenstischen Schwaden über die angesprungenen Kacheln aus Solnhofer Platten, die den Boden des Korridors bedeckten, umflorte die Möbel, den hohen, von einem Mahagoni-Frontispiz bekrönten Biedermeierspiegel neben einer kleinen Sitzbank zur rechten Hand, die Garderobe und weiter hinten die Marmorkonsole vor der Küche zur linken. Der Marmor war schwarz, wie der Nebel. Und wie die Bananen, die in einer Schale aus durchbrochenem preußischem Porzellan auf der Konsole lagerten. Gustavs Großmutter hatte irgendwann erklärt, sie würde von nun an zum Frühstück eine Banane essen, und seither hatte Hildchen die Order, Bananen zu kaufen – Bananen, die auf der Konsole lagerten, denn natürlich aß Gustavs Großmutter niemals Bananen zum Frühstück. Insofern waren die Bananen praktisch immer schwarz gewesen, auch als noch Leben im Hause war.
Für einen Augenblick hörte Gustav das Ticken. Das Ticken von Pfennigabsätzen im Korridor. Seine Großmutter hatte bis zuletzt hochhackige Schuhe getragen, hochhackige Schuhe aus butterweichem Saffianleder mit stechenden Pfennigabsätzen und pfeilscharfer Spitze. Dieses Schuhwerk erhöhte ihre feingliedrige, zierliche Gestalt in der Art jener Stelzschuhe, wie man sie im alten Griechenland auf der Bühne anzuschnallen pflegte. Noch in seinem Zimmer in der ersten Etage hatte Gustav jeden ihrer Gänge über den Korridor verfolgen können. Damals. Tick-tick-tick. Ihre Schritte klangen wie das Metronom, das auf dem Blüthner-Flügel im Musikzimmer stand, und ihre hohen Hacken spiegelten sich in den cremefarbenen Kacheln, die sich wie eine Eisfläche vor ihr ausbreiteten. Das hatte nie was Gutes zu bedeuten, dieses Ticken. Dieses ewige Ticken! Übrigens hatte sich Gustavs Mutter gelegentlich darüber mokiert, dass man in diesem Alter noch mit derartigen Schuhen herumlaufen könne. Das sei nicht gesund und gar gefährlich.
Aber jetzt standen die Pfennigabsätze in drei Reihen oben im Ankleidezimmer. Größe sechsunddreißig, beinahe Puppenschuhe. Jedes Paar steckte in einem Beutel aus rohrzuckerfarbenem Leinen, auf den das Monogramm von Gustavs Großmutter gestickt war. Zu den Pfennigabsätzen hatte sie meistens (jedenfalls zu der Zeit, als sie das Haus nur noch verließ, um zum Friseur zu fahren) einen taillierten Kittel aus feiner, schlohweißer Baumwolle getragen. Diese Kittel, von denen eine erkleckliche Zahl vorhanden sein musste, stammten aus der Praxis von Gustavs Großvater. Sie waren in Hüfthöhe mit großen Taschen versehen, die offenbar für medizinische Instrumente gedacht waren, und endeten eine Handbreit unter dem Knie, die makellosen Unterschenkel von Gustavs Großmutter freigebend, wohlgeformt in schwarzem Nylon.
»Okay«, sagte Gustav, indem er das Ticken der Pfennigabsätze mit einer kleinen Willensanstrengung verscheuchte und sich in derselben Bewegung an seine Freundin wandte, »wir haben wenig Zeit. Wir gehen jetzt da rein, und wenn du etwas siehst, was auf der Liste mit einem Kreuz versehen ist, dann packst du es ein, halt dich daran fest, egal, was passiert. Du hast doch die Liste, die ich dir gefaxt habe?«
»Jawohl, Comandante!«, erwiderte Elisabeth, genannt Lilli, und hielt die Liste hoch, ein etwa zwanzigseitiges, von einer Heftklammer zusammengehaltenes Inventar des Hauses, das im Auftrag der Familie von einem Auktionshaus erstellt worden war.
»Gut«, sagte Gustav, »es geht los. Und zwar mit dem Holzschnitt dort hinten, diese Frau mit dem Ding auf dem Kopf, außerdem die Zeichnung mit dem Hahn … nein, warte, die lassen wir für meinen Bruder … und den Gong – nein, nicht den Gong. Den darf Gretel haben. Gretel kann übrigens jeden Moment hier auftauchen. Wir müssen uns wirklich beeilen. Ich wette, sie rast jetzt schon die Transitstrecke hinunter …«
»Ach«, machte Lilli, »die Transitstrecke. Das war früher.«
»Es wird jedenfalls kein Zuckerschlecken«, sagte Gustav, »du kriegst es hier mit meiner Familie zu tun. Vertraue niemandem.«
»Willst du mir Angst machen?«, fragte Lilli leicht zischelnd, denn sie war soeben damit beschäftigt, den Sitz ihres Lippenstiftes im spiegelnden Deckglas ihrer zyklopischen Armbanduhr zu kontrollieren, zu welchem Zweck sie ihre beneidenswert hübschen Zähne fletschte. »Ich habe Angst vor vielen Dingen«, zischelte sie weiter, »Angst vor dem nächsten Ricky-Martin-Album, Angst davor, dass die Sonne ausbrennt oder dass sie irgendwann aufhören, diese Speckschwarten in Tüten zu verkaufen, die ich liebe … aber nicht davor, mit ein paar alten Tanten um irgendwelche Kupferstiche und Bodenvasen zu rangeln!«
»Die Angst wird dir das Leben retten«, erwiderte Gustav.
Lilli hatte wirklich makellose Zähne. Gustav auch.
2.KAPITEL
Das Nervöse ist nicht totzukriegen
Vom Korridor aus waren sieben Türen zu sehen. Alle standen offen. In einige waren gelbliche Glasscheiben eingesetzt, zum Beispiel in diejenigen, die zum Wohnzimmer führten. Das Wohnzimmer war der größte Raum im Erdgeschoß und beherbergte neben einem Kamin aus schwarzem Marmor und eingebauten Schränken und Regalen aus Grunewaldbuche auch den Esstisch, ein beachtliches, kreisrundes Möbel aus schwarzem Palisander. Der Tisch war für etwa fünfzehn Personen zugeschnitten, denn vor einigen Jahrzehnten hatten größere Gesellschaften in diesem Hause gegessen (wobei hier Kinder nicht mitgezählt sind. Die hatten separat zu sitzen). In der Politur der Tischplatte war trotz der Düsternis deutlich der Fleck zu erkennen, den die herunterfallende glühende Asche einer Zigarette von Gustavs Großmutter vor langer, langer Zeit dort hineingebrannt hatte. Der Fleck war von allen möglichen Leuten auf alle möglichen Arten ausgedeutet worden.
Vom Wohnzimmer aus gelangte man über einen offenen Durchgang ins Musikzimmer. Diesen Durchgang flankierten Vorhänge aus schwerer, goldgelber Seide. Zerschlissen und angerissen, mit silbernen Schnüren gerafft und mit Spitzen unterlegt, fielen sie üppig und massiv auf das Parkett hinab. Die Vorhänge waren nur an Weihnachten geschlossen worden. Vor der Bescherung. Das letzte Mal war dies etwa 1973 geschehen. Im Übrigen war dieses Musikzimmer, in dem der schwarze Blüthner-Flügel stand und eine ansehnliche Kopie von Menzels Flötenkonzert hing, dem Präsidenten der Berlinischen Baugesellschaft zu verdanken, der mit seiner Familie das Haus nach dessen Errichtung zunächst bewohnt hatte. Der Präsident war ungefähr das, was man in Gustavs Familie »eine humoristisch angeflogene Persönlichkeit« nannte: ein Charakter mit einer musischen, beinahe lässigen Einstellung dem Leben gegenüber und, trotz seiner ohne weiteres respektablen Stellung, mit einer Neigung zum Müßiggang. Er stand den Künsten nahe. Ziemlich bedenkliche und jedenfalls sehr zweischneidige Vorlieben, wenn man auf Gustavs Großmutter hörte. So etwas hatte nämlich den unangenehmen Beigeschmack von Extravaganz und auch ein wenig Liederlichkeit.
Jedenfalls hatte der Präsident, ohne Zweifel herrliche Anlagen des Geistes und des Herzens in sich tragend, das Haus um das großzügige Musikzimmer erweitern lassen – einen langgestreckten Anbau im Parterre, der sich sanft in den Garten zog und vorzüglich die Komposition des Gebäudes ergänzte. Er pflegte hier Hauskonzerte abzuhalten, die in Zehlendorf gesellschaftliche Ereignisse darstellten. Gustavs Familie, die Musik viel lieber hörte als veranstaltete, weil das weniger anstrengend schien (und weil man außerdem selten den richtigen Ton traf), benutzte das Musikzimmer später, wie gesagt, bloß für die Weihnachtsfeierlichkeiten, ließ es aber unversehrt. Der Flügel hatte natürlich schon lange an Klangfülle eingebüßt, aber mit dem Pianopedal, welches die hohen Töne so verschleierte, dass sie an mattes Silber erinnerten, konnte man dafür inzwischen die seltsamsten Wirkungen erzielen.
»Lass uns zügig eine Runde drehen«, sagte Gustav, »und das Inventar kontrollieren. Dabei können wir gleich auch noch nach den Kassetten mit dem Silber Ausschau halten.«
»Sehr schön«, erwiderte Lilli und strich zärtlich über den Rahmen des hohen Spiegels im Eingang, »ich komme mir vor, als wäre ich vier Jahre alt und hätte mich im KaDeWe verlaufen.«
Vom Musikzimmer gelangte man über den Wintergarten ins Zimmer von Gustavs Großmutter – einen Raum mit deckenhohen Bücherregalen und einem unbequemen Biedermeiersofa, auf dem die Hausherrin ihren Mittagsschlaf zu halten gepflegt hatte, weshalb dieses Zimmer als ihres betrachtet wurde. Ein dreireihiger Leuchter hing an einer goldenen Kette von der Decke. Seine kristallene Krone war einigermaßen löchrig. Dies hätte eigentlich dazu führen sollen, dass er jetzt mehr Licht verbreitete, von den acht Glühbirnen funktionierten immerhin noch fünf – doch auch die konnten nicht viel ausrichten. Es blieb düster, und zwar nun umso mehr, als dass irgendjemand, wahrscheinlich eine der letzten Krankenschwestern von Gustavs Großmutter, aus einem nicht nachvollziehbaren Grund Pappe vor die Fenster im Erdgeschoß geklebt hatte.
Es war düster, und es roch, wie es hier immer gerochen hatte: nach altem Papier und nach noch älterer Bitterschokolade von Erich Hamann, nach Tabak, Staub und abgelaufenen Medikamenten. Dazwischen strich irgendetwas anderes, ein herber, böser, phantasmagorischer Hauch, nicht jedem vernehmbar, oh nein, lediglich ein böser kleiner Hauch … der Schein der Farben in Menzels Flötenkonzert verfärbte sich trüb und verworren, die Fontäne des Lüsters erzitterte, und es verschlimmerte sich mit jedem Tag, mit jeder feinen Verwirrung und Verirrung der Nerven. Etwas Spukhaftes hockte in den stolzen und steifen Möbelstücken und schlich durch die knarrende Haustür, etwas Hysterisches. Es durchstieß die Fassade, wirbelte das verdorrende Laub im Springbrunnen auf, strich über die Tastatur des Blüthner-Flügels und machte nicht halt vor der schnurgeraden Treppe mit dem himmelblauen Teppich, die in die Beletage führte. Dort lag das Schlafzimmer von Gustavs Großmutter. Dort war sie gestorben. Daneben befand sich das Ankleidezimmer, das neben Zweiteilern von Chanel und Mainbocher stapelweise taillierte Kittel aus feiner, schlohweißer Baumwolle beherbergte. Irgendwas stimmte hier nicht. Es gibt ein kollektives Fieber. Es gibt eine kollektive Störung der Sinnesfunktionen. Es gibt eine Pandemie des Irreseins und eine noch weit bedrohlichere des Irrefühlens. Man hätte sich nicht übermäßig gewundert, wenn plötzlich die Glyzinie tot von der Fassade gefallen wäre. Es wäre nicht stilwidrig gewesen. Gustav wäre verduftet. Aber er war hier zuhause. Und der Mensch braucht ein Zuhause. Jedenfalls ein bürgerliches Exemplar wie Gustav.
Trotz dem schlechten Licht war nebenbei nicht zu übersehen, dass aus mehr als einem stolzen und steifen Möbelstück das Seegras hervorguckte.
»Was ist mit diesen afrikanischen Fruchtbarkeitsstatuen?«, fragte Lilli und streckte die Hand aus nach dem weiblichen Teil eines aus grobem Holz geschnitzten Figurenpaars mit ziemlich aggressiven Zähnen.
Sie standen neben dem Esstisch. Gustav und Lilli standen dort, meine ich, nicht die Holzfiguren. Diese standen auf der aus lackiertem Buchenholz und Rohrgeflecht bestehenden Verkleidung eines Heizkörpers vor einem mit Pappe zugeklebten Fenster und fletschten die hölzernen Zähne. Drei Streifen nebliges Frühsommerlicht fielen durch Risse in der Pappe.
Überhaupt war, nicht nur im Wohnzimmer, jede Fläche vollgestellt mit Gegenständen, meist Vasen und durchbrochenen Schalen aus preußischem Porzellan, dazwischen ein paar Bücher, Gläser, Münzen und Fotografien sowie, mitten auf dem Esstisch, das silberne Papiermesser von Gustavs Großvater, ein spielzeughaftes und albernes Ding in Form eines Kavalleriesäbels. Dessen Spitze zeigte zufällig auf den Brandfleck.
»Das sind, soviel ich weiß, Hausgötter«, sagte Gustav, »Friederike hat sie mitgebracht, aus Bali. Oder Indonesien oder von irgendwo dort, du weißt schon, von der anderen Seite der Welt.«
»Oh, was macht Friederike?«, erkundigte sich Lilli, die Friederike, genannt Riekchen, Gustavs jüngste Tante, einigermaßen gut kannte.
»Hat Aspirin genommen, liegt in der Badewanne und hört Arien.«
»Wagner?«
»Nein, Verdi. Übrigens will Riekchen diese Figuren. Das ist das Einzige, was sie will. Und den Ring mit dem Skarabäus. Ansonsten interessiert sie die … äh … Abwicklung des Hauses nicht. Sagte sie. Genau genommen sagte sie, sie würde höchstens noch ein Streichholz dranhalten …«
Draußen, vor den verklebten Fenstern, erhob sich ein Wind. Kalk rieselte hinter der Tapete.
»Ich habe aber gehört, dass die Familie ihr das Weinlaub-Service zugesprochen hat«, fuhr Gustav fort, während er einige der ausgestellten Porzellanstücke auf ihre Herkunft prüfte, »sozusagen in Anerkennung ihrer Verdienste um meine Großmutter. Riekchen war ja die Einzige, die sie in ihren letzten Jahren regelmäßig besucht hat. Bekanntlich. Die anderen haben sich selten sehen lassen. Oder nie. Gretel natürlich, wenn sie Geld brauchte. Von meiner Tante Charlotte hingegen geht der Ausspruch, sie hätte nichts dagegen, wenn ihre Mutter die Kellertreppe hinunterfiele. Ist das zu fassen? Dieses Haus ist voller Zeug, voller Klickerkram, voller preisloser Kostbarkeiten – und Riekchen kriegt das Weinlaub-Porzellan! Als Anerkennung! Ich bin überzeugt, dass sie das Muster nicht mal leiden kann.«
3.KAPITEL
Pillen und Portwein
Im Wohnzimmer stand eine bauchige, englische Kommode aus poliertem Nussbaum, deren zylindrischer Leib im Wesentlichen Arzneimittel barg. Auch die Wandschrnke im Korridor waren gefllt mit Tabletten und Tinkturen, Seren, Salben und Sften. Die meisten dieser Prparate, die noch aus der Praxis von Gustavs Grovater stammten, waren inzwischen lngst verboten. In Gustavs Familie, die grtenteils eine Arztfamilie war, hatte man sich lange einen ungezwungenen Umgang mit Medikamenten bewahrt. Das heit: Man konsumierte sie hufig. Stndig. Gustavs Grovater zum Beispiel brauchte Gewaltkuren, als sein Organismus mit dem Alter immer unvollkommener arbeitete. Unter anderem schlrfte er ein stark eisenhaltiges Serum, flaschenweise. Seine sich verschlimmernde Zuckerkrankheit hingegen therapierte er mit lauwarmer Coca-Cola (aus der er mit einem hlzernen Quirl die Kohlensure rhrte) und Gummibrchen. Gustavs Gromutter fr ihren Teil hatte, solange ihr Enkel sich erinnern konnte, jeden Tag mindestens fnf Aspirin geschluckt und auerdem noch etwelche weitere Pillen, deren Sinn und Herkunft Gustav nie entschlsselte. Ein paar davon waren sicherlich gegen die Epilepsie, an der sie nach der Entfernung eines Hirntumors zu leiden hatte. Gustav fragte nicht danach. Derlei Fragen waren untersagt und verstieen gegen das Hausgesetz. Er bemhte sich nur, eine mglichst unbeteiligte Miene aufzusetzen und im Konversationston schnell irgendwas Harmloses zu sagen, wenn seine Gromutter beim Mittagessen eine Pillendose aus poliertem Silber zckte, in die ihr Monogramm graviert war.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!