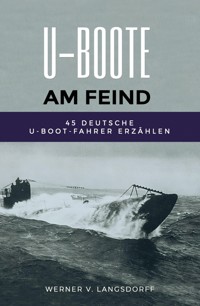Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch gibt einen umfassenden Einblick in den Kriegsalltag deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg. 71 Erlebnisberichte beleuchten den Krieg anhand einzelner Schicksale. Zu Wort kommen zahlreiche deutsche Kampfflieger wie Immelmann, Boelcke, Udet, Plüschow, Richthofen, Plauth, Christiansen, Siegert u. v. m. Unglaubliche Geschichten erzählen von haarsträubenden Luftkämpfen und brenzligen Situationen am Rande des Todes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Flieger am Feind
Einundsiebzig deutsche Luftfahrer erzählen
von
Werner v. Langsdorff
______
Erstmals erschienen bei:
C. Bertelsmann, Gütersloh, 1934
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
© 2017 Klarwelt-Verlag
ISBN: 978-3-96559-053-3
www.klarweltverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
Zum Geleit!
Zwei Kriegsflüge aus dem Jahre 1914 - Von Albert Mühlig-Hofmann
Kriegsflüge über Tsingtau - Von Gunther Plüschow
Erste Bomben auf Dünkirchen - Von Wilhelm Siegert
Im Westen Anfang 1915 - Von Hugo Geyer
Bombenflug im Hochgebirge - Von Josef Kissenberth
Der Erste! - Von Max Immelmann
Zwei Stunden am Seil - Von Franz Schneider
Luftkampferlebnis - Von Oswald Boelcke
Kriegsflüge über dem Kanal - Von Friedrich Christiansen
Frontflug 1916 - Von Hans Adam
Luftkampf über Smyrna - Von Hans Joachim Buddecke
L 48 stirbt - Von Carl Mieth
L 48 brennt über England - Von Heinz Ellerkamm
Tagebuchblatt aus der Sinaiwüste - Von Richard Euringer
Aus dem Tagebuch eines Bombenfliegers - Von Georg Wulf
Einer gegen vierundzwanzig - Von Eduard Ritter v. Schleich
Ausbruch - Von Horst Merz
Zu zweit im feindlichen Geschwader - Von Friedrich Knevels
Aus hinterlassenen Papieren - Von Rudolf Berthold
Boelckes letzter Flug - Von Erwin Böhme
Aus der Marineluftschifffahrt - Von Richard Frey
Ungleicher Kampf - Von Willy Leusch
Bahnsprengung hinter der Front - Von Fritz Heymann
Im Osten gestrandet - Von Martin Bischoff
Flug auf dem Schwanz - Von Josef Schmidt
Als Jagdflieger 1917 - Von Heinrich Gontermann
Letzter Flug - Von Friedrich Karl Prinz von Preußen
Landung im Niemandsland - Von Emil Schaefer
Luftkampf über Toul - Von Hugo Geiger
Als Jagdflieger bei Richthofen - Von Joachim v. Schoenebeck
Der Achte! - Von Hermann Göring
Drei an einem Tage - Von Rudolf Windisch
Abgeschossen - Von Georg Geigl
Ich kannte ihn nicht - Von Werner v. Langsdorff
Kopfschuß im Luftkampf - Von Manfred Freiherr v. Richthofen
Bruch zwischen Haifischen - Von Otto Stein
Ballonsiege, brennend am Schirm und Voß - Von Paul W. Bäumer
Heimkehr mit totem Führer - Von Peter Hallström
Der neue Franz - Von Carl Töpfer
Kampf in der Dämmerung - Von Adolf Ritter v. Tutschek
Dreimal Glück - Von Leo Leonhardy
In der Staffel Göring - Von Helmuth Dilthey
Gulle, Rammkeil und Muck - Von Rudolf Lochner
Der Scheich von Ras-el-Ain - Von Gerhard Felmy
Einen Flügel verloren - Von Hans-Ioachim v. Hippel
Mein schwerster Kampf - Von Martin Dietrich
Da steht die Wurst! - Von Erik Thomas
Sprung ins Dunkel - Von Ernst Struck
Vierfacher Ballonsieg - Von Fritz Ritter von Roeth
Luftkampf im Osten - Von Gustav Ehinger
Segelflug im Kriege - Von Walter Angermund
Artillerieflieger über Albert - Von Paul Freiherr v. Pechmann
Tagebuchblatt eines Jagdfliegers - Von Rudolf Stark
Ein Munitionslager geht in die Luft - Von Hermann Köhl
Flügelbruch - Von Gustav Koch
Nachtbombenflug - Von Alfred Keller
Abschuss ohne Schuss - Von Willy Neuenhofen
Vergaserbrand - Von Paul Vogel
Absturz in See - Von Karl Krumbein
Als Jagdflieger bei Kriegsende - Von Karl Plauth
F. d. L. † - Von Horst Freiherr Treusch v. Buttlar-Brandenfels
„Ich hatt' einen Kameraden — — —“ - Von Gerhard Vollschwitz
Abschuss und abgeschossen! - Von Willy Thoene
Kriegs-Butter-Flüge - Von Boby Zuest
Fast! - Von Ernst Udet
Letzter Absprung - Von Peter Rieper
Letzter Frontflug - Von Lothar Freiherr v. Richthofen
Unser Kommandeur - Von Kurt Bauer
Jagdflieger gegen Tanks - Von Robert Ritter v. Greim
Erste Welle - Von Bruno Erich Schröter
Fluchterlebnis - Von Carl Menkhoff
Unsere Mitarbeiter
Zum Geleit!
ier erzählen einundsiebzig deutsche Luftfahrer eigene Erlebnisse aus dem Krieg. Einundsiebzig von zehntausend können naturgemäß nur einen winzigen Ausschnitt des großen Geschehens geben. Dieser Ausschnitt aber ist wahr, denn sie erzählen nur vom täglichen Kampf des deutschen Fliegers und Luftschiffers im Krieg.
Die deutsche Luftwaffe ist vom ersten bis zum letzten Tag des Krieges ununterbrochen im Angriff geblieben.
Siebentausendachthundertneunundzwanzig deutsche Luftfahrer gaben im Krieg ihr Leben für Deutschland. Ihrem Gedenken soll dieses Buch dienen.
Diese Flagge wehte auf allen Kriegsfahrten
der Marine-Luftschiffe L 9, L 22, L 38, L 42, L 71
Zwei Kriegsflüge aus dem Jahre 1914 - Von Albert Mühlig-Hofmann
en Anfang des Weltkrieges erlebte ich in Graudenz als Oberleutnant im Fliegerbataillon Nr. 2. Zu Beginn hatten wir Erkundungsflüge bis Warschau durchgeführt und waren dabei von Freund und Feind gleich heftig und erfolglos beschossen worden. Während der Schlacht bei Gumbinnen erlebten wir, dass die Führung unseren Meldungen, zum Nachteil der Operationen, keinen Glauben schenkte; in der Schlacht bei Tannenberg hatten wir Flieger dann erfolgreich mitwirken können und waren dabei an einzelnen Tagen bis zu neun Stunden in der Luft gewesen. Nachdem auch Rennenkampf aus Ostpreußen hinausgeworfen war, wurde das 17. Armeekorps, zu dem meine Abteilung gehörte, über das südliche Schlesien gegen die Weichsel angesetzt. Bei Radom und Iwangorod spielten sich diese Kämpfe ab und schließlich lagen wir mit dem 17. AK unter Generalfeldmarschall v. Mackensen gegenüber von Warschau in einem Bogen vor den Forts dieser Festung. Die Unterbringung war denkbar kümmerlich. Auch das Wetter ließ so gut wie alles zu wünschen übrig; nur hin und wieder konnten wir der Artillerie beim Schießen helfen.
Da traf die Nachricht ein, dass nördlich von der Stellung des 17. AK. eine sibirische Schützendivision unsere Stellungen durchbrechen und unsere rückwärtigen Verbindungen zerstört habe. Reserven zur Vernichtung des Gegners waren im Armeeabschnitt nicht verfügbar. Aber weit im Rücken lag eine Landsturmbrigade im 80 Kilometer entfernten Skiernievieze unter dem Befehl des Generalleutnants v. Wrochem. Die Russen hatten aber unsere sämtlichen rückwärtigen Verbindungen unterbrochen, so dass es nur auf dem Luftwege möglich war, der Brigade v. Wrochem Befehle zu überbringen. Am Nachmittag erhielt ich den Auftrag, nach Skiernievieze zu fliegen. Es war schon seit Tagen besonders schlechtes Wetter. Starker Regen hatte den Boden aufgeweicht, schwere Wolken hingen bis auf die Erde und starker Wind sorgte für die erforderlichen Böen. Militärisch war der Auftrag nicht schwierig, weil feindliche Gegenwirkung kaum zu erwarten war, aber fliegerisch war er nicht leicht. Zunächst einmal galt es, bei dem herrschenden Wetter Skiernievieze überhaupt zu finden, denn es war ziemlich ausgeschlossen, dauernd in Erdsicht zu fliegen; dann musste bei Sliernievicze ein geeignetes Fluggelände aus der Luft ausgesucht werden, möglichst dicht bei der Stadt. Nun bestehen die Acker in jener Gegend aus schmalen, etwa eineinhalb Meter breiten Streifen, die durch tiefe Furchen voneinander getrennt sind. Die Landung musste also parallel mit den Furchen derart erfolgen, dass die Räder auf den Streifen liefen, nicht aber in die Furchen gerieten, da in diesem Falle die Fahrgestellachse einen Kopfstand oder Überschlag verursacht hätte. Die gleichen Schwierigkeiten boten sich wieder beim Start. Der Rückflug musste schließlich zum Teil in der Dunkelheit durchgeführt werden. Unterstützt wurde ich bei der Durchführung dieses Auftrages durch meinen Beobachter Nordt, heute Chef des Stabes des Präsidenten des D. L. V., und wir benutzten einen Albatros- Doppeldecker mit vorne liegendem 100 PS-Mercedes-Motor, mit guter Stabilität und ausgezeichneten Flug-, Lande- und Starteigenschaften.
Wir flogen ab und schaukelten in geringer Höhe etwa eine Stunde bis nach Skiernievicze, unterwegs wiederholt erfolglos von russischen Patrouillen beschossen. Die Landung gelang glatt, und wir überbrachten unseren Befehl an Exzellenz v. Wrochem, der sich sofort mit seinen Offizieren beriet. Wir baten ihn auftragsgemäß um das Ergebnis der Beratung und seinen Entschluss, damit von der Front aus die geeigneten Maßnahmen zur Unterstützung seiner Aktion eingeleitet werden könnten. Er teilte uns dann mit, dass seine Truppe natürlich nicht mit aktiven Verbänden verglichen werden könnte; Nachtgefechte könne er seinen Leuten nicht zumuten, aber mit Vorsicht und Schonung angesetzt, würde die Brigade ihre Pflicht tun. Er wolle den Nachmittag zu Vorbereitungen verwenden, die dringend erforderlich seien, und werde am Abend um zehn Uhr aufbrechen. Mit diesem Bescheide wurden wir entlassen. Start und Rückflug gingen glatt vonstatten, obgleich das Wetter sich nicht gebessert hatte und es immer dunkler wurde. Auch die Landung erfolgte bei fast völliger Dunkelheit glatt, und wir meldeten dem Generalkommando das Ergebnis unseres Fluges. Drei Tage später erfuhren wir, das; die durchgebrochenen Russen in Stärke von 3000 Mann und 33 Offizieren gefangengenommen waren und dass daran die von uns in Marsch gesetzte Brigade v. Wrochem einen namhaften Anteil gehabt habe.
Als einige Zeit darauf bei der Festung Iwangorod, die die Österreicher hatten erstürmen wollen, durch einen Ausfall der Besatzung die österreichische Front durchbrochen war und unsere rückwärtigen Verbindungen aufs schwerste bedroht wurden, musste unsere Stellung geräumt werden. Durch gründliche Zerstörung aller Verkehrswege und -mittel — selbst die Isolatoren an den Telegraphenstangen wurden zerschlagen — wurde das Vordringen der Russen aufgehalten, und es ist dadurch ja auch gelungen, sie, abgesehen von einigen Patrouillen, von deutschem Boden fernzuhalten. Als die Armee wieder deutschen Boden betrat, sahen wir überall sorgenvolle Gesichter. Doch im Armeeoberkommando, das inzwischen Exzellenz v. Mackensen übernommen hatte, war eine wirksame Operation ausgearbeitet worden: Die Russen konnten der Zerstörungen wegen nur langsam vordringen; daher wurden sämtliche deutschen Truppen mit geringfügigen Ausnahmen aus Schlesien mit der Bahn abtransportiert, etwa 100 Kilometer vor der Front des Gegners vorbeigeführt und östlich von Posen ausgeladen. Von dort erfolgte ein wirksamer Stoß in die Flanke des Gegners in Richtung Lodz. Es gab unerhörte Marschleistungen der deutschen Truppen, und eine Zeitlang schien es, als ob sich in Lodz ein zweites Tannenberg wiederholen sollte. Rings um Lodz standen deutsche Kräfte, aber diese waren leider zu schwach. Die Russen wirkten aus Nordosten von Warschau und aus Südosten von Iwangorod gegen Lodz und schoben sich zwischen die Truppen, die Lodz in weitem dünnen Kreise umschlossen hielten. So wurde eine bedeutende Truppenabteilung, darunter das 25. Reservekorps unter General Scheffer v. Boyadel, die Garde-Reserve-division unter General Litzmann, ein Kavalleriekorps und eine Brigade des 1. Armeekorps, von den Russen, etwa in der Gegend von Brzeziny, umzingelt. Offene Funksprüche der Russen wurden aufgefangen, in denen bereits Züge für den Abtransport der Gefangenen angefordert wurden, und bei den deutschen Kommandostellen war man seit langem ohne Nachricht über den Verbleib der Truppen. Die Stimmung war sehr ernst. Da bekam ich zusammen mit meinem Beobachter Nordt auf dem Gefechtslandeplatz in Zgierz bei Lodz den Auftrag, die deutschen Truppen in der Gegend von Brzeziny zu suchen. Die Flugzeuge des 1. AK., die der Lage nach in erster Linie für diesen Flug hätten herangezogen werden müssen, konnten diesen Auftrag, bei dem es auf eine Landung in unvorbereitetem Gelände ankam, nicht ausführen; es waren „Tauben“, die schon auf dem Flugplatz häufig Kopf standen und instandsetzungsbedürftig wurden. Ein solches Missgeschick war bei dem beabsichtigten Fluge fast mit Sicherheit zu erwarten und hätte die Auslieferung des Flugzeuges an den Gegner bedeutet.
Unser Auftrag wurde uns nur mündlich erteilt, man rechnete damit, dass wir in Feindeshand fielen, und daher durften wir nichts Schriftliches und keine Karte mit Einzeichnungen mit uns führen. Man befürchtete vor allem, dass die abgeschnittenen Truppen über ihre Lage nicht hinreichend unterrichtet seien und Mangel an Munition und Verpflegung hätten, so dass sie nicht zur Armee durchbrechen könnten. Wir sollten also die abgeschnittene Armeeabteilung über die Lage unterrichten, Erkundigungen über die Stimmung und den Kampfwert der Truppen einziehen und der Armeeabteilung den Befehl überbringen, bei Strykow durchzubrechen, wo von außen energisch entgegengearbeitet werden würde.
Der uns erteilte Auftrag lag uns sehr; von unseren früheren Flügen kannten wir die Gegend bei Brzeziny gut und wussten auch, dass dort Landegelände war. Außerdem war das Wetter herrlich, ein klarer Frosttag. Die Entfernung war auch nicht groß. Hin- und Rückflug würden, abgesehen von der Erkundung, je etwa eine halbe Stunde dauern. Die fliegerischen Umstände waren diesmal sehr günstig, umso schwieriger beurteilte man die militärischen Verhältnisse. Zunächst konnten wir die Front, wenn wir nicht sehr viel Zeit verlieren wollten, nur in geringer Höhe überstiegen. Dann mussten wir kurz die Lage erkunden und dabei unsere Truppen suchen, über deren Aufenthalt man seit acht Stunden im ungewissen war. Dann musste ein höherer Stab festgestellt und schließlich in seiner Nähe ein Landeplatz ausgemacht werden. Denn die Zeit reichte nicht, um etwa nach der Landung noch einen größeren Fußmarsch zur Übermittlung der Befehle durchzuführen; hinzu kam, dass wir leicht das Opfer von feindlichen Patrouillen werden konnten, wenn das Gelände uns zwang, allzu weit von unseren Truppen entfernt zu landen. Auf alle Fälle mussten wir darauf gefasst sein, im Falle einer Beschädigung unseres Flugzeuges bei der Landung den Rückmarsch und Durchbruch bei der Truppe mitzumachen. Im Generalkommando befürchtete man, ohne es uns zu sagen, das Schlimmste. Wir merkten nur aus dem Ernst des Abschiedes, dass man kaum mit einem Wiedersehen rechnete.
Wir machten uns schnell zum Fluge fertig, starteten und gingen in 600 Meter Höhe über die Front. Auch damals noch, glaube ich, schossen unsere Truppen auf uns; will aber zu ihrer Ehre annehmen, dass ich mich getäuscht habe. Ganz heftig jedenfalls war die Beschießung durch die Russen, wenn auch erfolglos. Das Flugzeug war wohl in der geringen Höhe zu schnell aus dem Gesichtsfeld entschwunden, als dass ein wirkungsvolles Feuer auf uns hätte abgegeben werden können; jedenfalls blieben wir unversehrt. Nun flogen wir weiter nach Brzeziny und suchten unsere Truppen. Bald fanden wir auch in der Gegend, wo sie zu erwarten waren, lange Marschkolonnen. Der Lage nach konnten es nur die gesuchten Verbände sein. Auch ein Stab schien die Kolonne zu begleiten. Wir setzten also zum Gleitflug an und versuchten mit dem Glase Näheres festzustellen. Auffallend war zunächst, dass wir nicht beschossen wurden.
Oswald Boelcke
Manfred Freiherr v. Richthofen
Dann rief mir Nordt plötzlich zu: „Lauter Russen, lauter Russen;“ beobachtete nochmals mit dem Glase und sagte dann: „Es sind aber auch Deutsche dabei.“ Meiner Bitte, festzustellen, wer denn die Gewehre habe, konnte er nicht mehr entsprechen, denn inzwischen waren wir unten, und ich landete etwa parallel zu der Marschkolonne. Während des Ausschwebens konnte ich noch feststellen, dass es sich um russische Gefangene handelte. Wäre mir das nicht möglich gewesen, so beabsichtigte ich, wieder Gas zu geben, und wir hätten unser Glück möglicherweise nochmals an anderer Stelle versuchen müssen. So aber setzte ich, wenn auch noch nicht völlig beruhigt, auf dem großen Feld auf, wir waren bei den gesuchten Truppen. Auch einer anderen Gefahr waren wir bei der Landung aus dem Wege gegangen: eine Anzahl ziemlich großer, auf dem Feld zerstreut umherliegender Steine hatten wir vermieden, sie hätten uns leicht verhängnisvoll werden können. Es war für uns in jeder Beziehung ein Glückstag, denn unmittelbar neben uns hielt ein Divisionsstab des 25. Reservekorps. Aber den Standort des Generalkommandos war dem Divisionsstabe nur bekannt, dass gerade ein Stellungswechsel durchgeführt werde. So sahen wir von einer weiteren Landung bei Exzellenz v. Scheffer-Boyadel ab.
Während mein Beobachter sich unseres Auftrages entledigte, kam ich mit einigen Offizieren ins Gespräch, deren Augen von den kriegerischen Erfolgen leuchteten. Ich konnte mich auch davon überzeugen, dass die Truppen für den in der kommenden Nacht geplanten Durchbruch sowohl genügend Verpflegung als auch besonders Munition hatten. So wandelte sich die besorgte Stimmung in große freudige Erregung. Ein junger Leutnant sagte zu mir: „Was sagen Sie zu uns, sind wir nicht tüchtige Leute!“ Es wurde mir schwer, seine Freude zu dämpfen, aber ich antwortete ihm: „Das wohl, aber Sie müssen noch schwer kämpfen, Sie sind von der Armee abgeschnitten und wir bringen Ihnen gerade den Befehl, wo Sie die feindlichen Linien durchbrechen sollen.“ Kurz bevor wir abflogen, kamen Infanteristen und meldeten in unverkennbar sächsischem Dialekt: „Herr General, da hinten steht noch ’ne Kanone im Sumpf; mein Freund und ich konnten sie nicht herausziehen, es wäre aber doch schade, wenn wir sie stecken ließen!“ Nun, die Kanone wurde geholt und der Durchbruch gelang glänzend unter Mitnahme der Gefangenen und der erbeuteten Geschütze. Eine Waffentat ersten Ranges!
Nach Abmeldung beim Divisionsstab flogen wir zurück. Der Start ging auf dem großen Feld glatt vonstatten, einige Steine hatte ich noch hinwegräumen lassen. In großer Kurve umflogen wir den Stab und die Kolonnen und winkten ihnen für die Nacht guten Erfolg. Unsere Stimmung war wunderbar gehoben. Alle Befürchtungen der Generalkommandos, die uns entsandt hatten, waren zerstreut; ja sogar noch ein beachtlicher Erfolg zu melden. Da war es uns dann auch gleichgültig, ob wir etwa beschossen würden. In ganz geringer Höhe ging’s wieder über unsere Linien zurück, und bald landeten wir glatt auf dem Gefechtslandeplatz. Die günstige Meldung, die wir erstatten konnten, wirkte recht belebend; und der kommandierende General Exzellenz von Pannewitz überreichte uns für die gute Durchführung unseres Auftrages das Eiserne Kreuz 1. Klasse. Dann mussten wir unsere Meldung auch im Generalkommando des 1. Armeekorps erstatten, wo Exzellenz von Scholz über die Nachrichten vom Befinden seiner Brigade sehr erfreut war und uns in liebenswürdiger Weise bewirtete.
Bei einbrechender Dunkelheit flogen wir nach unserem Abteilungsflughafen zurück, landeten dort einmal wieder bei völliger Dunkelheit und ließen es uns im Kameradenkreise bei Abendbrot und Ungarwein gut sein.
Meinen Beobachter und mich täuschte diese allseitige lebhafte Anerkennung für unseren Flug nicht darüber hinweg, dass weniger unsere Leistung der Grund dafür war, sondern mehr der Inhalt der erstatteten Meldung. Wäre die Lage unserer Truppen bei Brzeziny weniger günstig gewesen, so hätten wir mit ungleich größeren Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, aber ich glaube nicht, dass dann die Anerkennung gleich freudig gewesen wäre. Im Kriege wie im ganzen Leben entscheidet eben nicht die Leistung, sondern der Erfolg!
Kriegsflüge über Tsingtau - Von Gunther Plüschow
anz außerordentlich wurde das Fliegen für mich als einzigstem Flieger in Tsingtau erschwert durch den kleinen, von hohen Bergen wie ein Kessel eng umschlossenen Flugplatz und die ganz außerordentlich schwierigen Luftverhältnisse. Durch die hohen, schroffen Gebirge, durch den Wechsel von Land und Wasser und durch die starke Sonnenbestrahlung war die Turbulenz der Luft ganz ungewöhnlich stark und die Luftverhältnisse schon morgens um acht Uhr so ungünstig, wie sie in Deutschland während der heißesten Jahreszeit um die Mittagsstunden kaum vorkommen.
Hinzu kam, dass meine „Taube“, welche für normale Verhältnisse zu Hause gebaut war, in dieser dünnen Luft zu schwer war, mein Motor hundert Umdrehungen zu wenig machte und ich mit einem selbstgebauten Ersatzpropeller flog. So konnte ich nicht daran denken, einen Beobachter mitzunehmen. Alles irgend Entbehrliche riss ich aus meinem Flugzeug heraus, um es zu erleichtern. Benzin und Öl wurden so bemessen, dass es eben ausreichte, ja oft ließ ich sogar meine Lederjacke zu Hause, nur um mit dem Flugzeug aus dem Platz herauszukommen.
Denn jeder Start musste glücken; sonst war es um mich und mein Flugzeug geschehen. Und wie oft hat es nur an einem Haar gehangen, dass das Flugzeug nicht zerschellte!
Manchmal, wenn ich nach Süden zu startete, setzten am Ende des Platzes, ungefähr da, wo das Fort Hu-Tchuen-Huk mit dem Meere zusammenstößt, enorme Fallböen ein, das Flugzeug fiel direkt unter mir weg, ich riss es eben noch über die Geschützrohre des Forts frei, dann fiel das Flugzeug wieder schwer durch und oft handelte es sich nur um Handbreiten, dass ich es über dem Meeresspiegel wieder abfing, wo es sich langsam erholte und zu klettern anfing.
Beim besonders schwierigen Stark nach Norden, nach West und Ost kam überhaupt nicht in Frage, musste ich im äußersten Südzipfel des Platzes starken. Nach wenigen hundert Metern musste ich über meinen Schuppen, mehrere Villen und unseren Kirchhof weg, der bereits an einem zirka 150 Meter hohen schmalen Sattel lag, der von beiden Seiten von den Felsmassen des Bismarck-Berges und der Iltis-Berge eingeschlossen wurde. Sowie ich links den Bismarck-Berg hinter mir hatte, kamen die ersten Seitentäler, und aus diesen setzten scharfe Böen ein, mein Flugzeug bekam einen mächtigen Stoß und legte sich schwer nach Steuerbord über, und trotz voller Verwindung konnte ich das Flugzeug nicht wieder aufrichten. Seitensteuer durfte ich nicht geben, um nicht in die Felsen hineinzurennen. So raste denn mein Flugzeug in dieser Stellung mit der rechten Flügelspitze nur wenige Zentimeter von den unter mir liegenden Baumkronen und Felsmassen entfernt durch dieses Höllental hindurch, und ich konnte nichts weiter tun, als mein Steuer mit eiserner Ruhe führen, um nicht unten zu zerschellen. Viel ich dann endlich auf der anderen Seite über dem Wasser der Kiautschoubucht schwebte und mein Flugzeug wieder vernünftig wurde.
Ich will’s gestehen, heiß und kalt hat’s mich bei jedem Start überlaufen, und ordentlich froh war ich, als ich ihn hinter mir hatte und mich höher und höher schraubte, bis ich endlich meine zweitausend Meter erreicht hatte. Das war allerdings eine Geduldsprobe. Manchmal kam ich in einer Stunde hinauf. Gewöhnlich aber dauerte es bis zu eindreiviertel Stunden. Während dieser ganzen Zeit flog ich weit, weit draußen über See, um den Schrapnells, die die Japaner nach mir sandten, zu entgehen.
Was konnte ich noch lange darüber nachdenken, dass ich ein Landflugzeug hatte, und dass ich bei der geringsten Motorpanne ertrinken musste. Es wäre ja doch dasselbe gewesen, als wenn eine Panne oder womöglich ein Volltreffer mich über dem Lande erreicht hätten. Im ganzen Schutzgebiet gab es nur Felsen, Schluchten und außer meinem Flugplatz nicht ein einziges Plätzchen, wo ich hätte heil landen können.
Sobald ich dann über dem Feinde war, drosselte ich den Motor so, dass das Flugzeug die Höhe von selber hielt. Dann hängte ich meine Karte vor mich an das Höhensteuer, nahm Bleistift und Notizheft zur Hand und beobachtete nach unten, zwischen Tragfläche und Rumpf hindurchsehend, den Feind. Das Höhensteuer ließ ich ganz los, und die Seite steuerte ich mit den Füßen.
Eine Stellung umkreiste ich dann so lange, bis ich alles ausgemacht, in die Karte eingetragen, mir genau aufgeschrieben und eine ganz genaue Skizze angefertigt hatte. Ich hatte bald eine solche Übung darin, dass ich oft, ohne überhaupt aufzusehen, eineinhalb bis zwei Stunden nach unten beobachtete und alles genau aufschrieb.
Und wenn mir dann das Genick steif wurde, drehte ich mich um und sah nach der anderen Seite hinunter. Bis ich dann endlich mit meinen Aufzeichnungen zufrieden war und ein Blick auf die Benzinuhr mich belehrte, dass es höchste Zeit sei, umzukehren, um noch meinen Platz zu erreichen.
Mein Flugzeug wurde natürlich während der ganzen Stunden, die ich über den feindlichen Stellungen schwebte, auf das heftigste mit Gewehren und Maschinengewehren beschossen. Und als das nichts half, kamen die Schrapnells. Die waren allerdings eklig.
Als ich an einem herrlichen Morgen mit prächtigem blauem Himmel von einer Aufklärung zurückkam und landen wollte, schwebten über meinem ganzen Landungsplatz lauter kleine weiße Wölkchen in etwa dreihundert Meter Höhe, die von oben ganz allerliebst aussahen. Aber bald merkte ich, dass die Japaner sich wieder einmal einen Scherz mit mir erlaubten, denn die Wölkchen waren Sprengwolken von 10 ½-Zentimeter-Schrapnells.
Aber was half es; Zähne zusammen und durch! Und vier Minuten später stand meine Maschine, aus zweitausend Metern Höhe im Sturzflug kommend, wohlbehalten auf dem Platz; und so schnell ich konnte, rollte ich mit ihr in den Schuppen, dessen Dach durch Erde geschützt war.—
Erste Bomben auf Dünkirchen - Von Wilhelm Siegert
„as ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn! Verstand ist stets bei Wen’gen nur gewesen!“
Als ich in Metz in den Monaten Februar und April l913 mit der Ausbildung von Nachtflügen begann, wackelten verschiedene Köpfe. Es ging dabei viel besser, als man hatte zu glauben wagen können. Kein ernster Unfall trat ein. Die vorurteilsvollen Gespenster und gespensterischen Vorurteile verflüchtigten sich unter Zurücklassung des üblichen Gestankes, als wir ihnen zu Leibe rückten. Trotzdem mussten erst die Ausschreibungen der Nationalflugspende die nicht befehlsmäßig erfassbare Fliegerwelt zu neuen Nachtflügen ermuntern. Aber auch da ließen nur Einzelpersönlichkeiten sich von Überzeugung und Ehrgeiz treiben.
So war denn mein Plan, bei Nacht Bombenflüge im Geschwader zu unternehmen, prädestiniert zu dem Urteil, das schon 1913 mein eigener Adjutant in einer Denkschrift über Nachtflüge niedergelegt hatte: „Geradezu frevelhaft!“ Denn immerhin schrieben wir erst den Winter 1914/15. Aber ich ließ nicht locker, denn umsonst hatte ich doch nicht das „Fliegerkorps der Obersten Heeresleitung“ unter dem sinnigen Namen „Brieftauben-Abteilung 0“ in die Hände gedrückt bekommen. Man stelle sich vor: 36 Flugzeuge mit je 100 PS, fabelhaft bewaffnet mit Seitengewehren, Selbstladepistolen und Schnellfeuerflinten, die aus einem Museum „besorgt“ worden waren! Was tat’s, dass man drüben längst Maschinengewehre hatte! Kapitän solch einer Streitmacht zu sein, verpflichtet, und ich wusste wirklich, dass mein stolzes Kollegium Haare auf den Zähnen hatte. Also zitterten wir eines Nachts Ende Januar 1915 los. Vierzehn Flugzeuge, vom gitterschwänzigen Archäopterix der bayerischen „Hiasln“ bis zur schnittigen Albatros B I und der alten guten Tante Aviatik. Dazu leichte Bewölkung und schneidender, böiger Wind. Hempel flog mich unvollkommen befingerten Chef auf stolzer Aviatik. Ostende hatte ein Leuchtfeuer nach oben gestellt; dann ging’s ein paar Kilometer über See, bei fünfundzwanzig Grad Kälte in kriegmäßiger Höhe von eintausendeinhundert Metern. Der Mond beschien die Brandung der Nordsee. Dahinter fuchtelten Scheinwerfer, spielten Leuchtkugeln aller Farben Ball, flammten Mündungsfeuer auf, brannten Gehöfte und Fabriken. Unsere Sternsignale: „Nicht schießen!“ tropften herab, Sprengpunkt um Sprengpunkt der englischen Flugabwehr kam herauf, so dass man jedes Mal das Zifferblatt der Höhenmesser und Tourenzähler ablesen konnte. Das Strahlen- und Flammengewirr machte neuesten Kunstrichtungen alle Ehre. Und dazu hörte man das Knacken von Granaten, deren Brüllen das Toben des Motors Gott sei Dank überschrie. Zauberflötendekoration, bei der der Funkenflug unter uns stampfender Kriegsschiffe nicht fehlte und manchmal auch das Aufglühen eines Auspufftopfes eines unserer Flugzeuge. Ohne Positionslichter nachtwandelten wir vertrauend auf Wahrscheinlichkeitsgesetze. Bis strahlend wie eine Geburtstagstorte die Festung Dünkirchen vor uns lag, um die man ebenso sinnig wie unzweckmäßig Scheinwerfer im Kranze aufgebaut hatte.
Und so gerieten wir denn in die richtige Festesstimmung und landeten unsere einhundertdreiundzwanzig Bomben in diesen lichtumrahmten schwarzen Trichter, wo jeder Aufschlag als Blitz und Treffer säuberlich erkennbar war. Wir sahen uns nicht und flogen nachtwandlerisch unter-, über- und nebeneinander, aber des Kindes Engel lenkte alle Bomben um uns herum. Dann ging’s mit Kompass, denn Wolken kamen in rauen Mengen, heim, um mit Liebe die Geschoßnarben zu verkleben, die uns wohl hauptsächlich das heiße Interesse eigener Truppen beigebracht hatte. Natürlich hatten wir nur „Greise, Frauen und Kinder“ getroffen, wie sich das immer für die „feigen Überfälle fliegender Boches“ auf all die „harmlosen Städte“ unserer lieben Nachbarn im ganzen Orlog geziemte. Nur eigenartig, dass man dann für Racheschießen so viel Pulver verschwendete. Zumal wir längst die „offene Stadt Verdun“ mit unseren nächtlichen Besuchen beehrten, als unser harmloser Platz in Ghistelles beaast wurde, an dem nur einige ausgediente Waggons standen, an Stelle unseres .schönen Schlafwagenzuges.
Im Westen Anfang 1915 - Von Hugo Geyer
ebruar 1915: Ich war damals Flugzeugführer des 1. Bombengeschwaders unter Führung meines alten verehrten Friedens-Bataillons-Kommandeurs Major Siegert. Wir lagen an der belgischen Küste. Die neuen Bombenflugzeuge aus der Heimat waren eingetroffen. Sie waren etwas simpler Natur, das hundertpferdige Beobachtungsflugzeug war so umgebaut, dass an Stelle des Beobachtersitzes ein Gestell wie ein Vierflaschenkasten eingebaut war, aus dem ein Dutzend 10-Kilogramm-Bomben nacheinander in die Tiefe geschickt werden konnten. Beim Auslösen blieben sie manchmal in der Führung stecken, entsicherten sich langsam durch Drehen des Windrädchens und machten sich erst bei der Landung auf die Reise. Das war nicht angenehm, weil sie dann dicht hinter dem Flugzeug explodieren konnten. Schmierseife half diesem Übel ab.
Die freundliche Heimat hat sich wohl gedacht, dass Bombenflugzeuge unsichtbar seien, oder dass der Gegner, der bereits mit Maschinengewehren ausgerüstet war, vor solch einem gänzlich unbewaffneten Flugzeug nur hochachtungsvoll den Hut ziehen würde. Selbst wenn die Staffeln des Geschwaders geschlossen flogen, musste der Gegner bald merken, dass wir eine leichte Beute für ihn werden konnten. Major Siegert wusste, dass in der Heimat an einem Flugzeugmaschinengewehr konstruiert wurde. Es sollten deshalb einige Flugzeuge, mit diesen Maschinengewehren ausgerüstet, den Schutz der unbewaffneten Bombenträger übernehmen. Das war gut möglich, denn die feindlichen Jagdflugzeuge tauchten auch nur einzeln auf. Ich bekam deshalb den Befehl, nach Berlin zu fahren, unter Einsetzen aller Druckmittel ein Maschinengewehr herauszuholen und bei der Firma Aviatik den Einbau zu beaufsichtigen. Nach hartem Kampf wurde mir auch tatsächlich das erste, aber noch nicht als frontreif erklärte Maschinengewehr in die Hände gedrückt, und ich reiste mit ihm zur Fabrik nach Freiburg. Aber die Art des Einbaues hatten sich weder die Inspektion noch die Fabrik ernstlich den Kopf zerbrochen; zum mindesten lag noch keine Erfahrung vor. Man munkelte etwas von einem Drehkranz an dem rückwärtigen Sitz, aber das erschien mir eine etwas phantastische Erfindung, zumal sie nur ein Schießen nach rückwärts gestattete, während ein Schutzflugzeug für ein Bombengeschwader doch den Gegner angreifen muss. Wir kamen deshalb bei Aviatik auf eine andere Lösung. Wir erweiterten den Beobachtungssitz so, dass man darin stehen bzw. auf den nun seitlich angeordneten Benzintanks knien konnte, bauten zwei Zapfen ein, einen links vorn und einen rechts hinten. Der „Franz“ lernte es auch schnell, das Maschinengewehr im Flug von einem Zapfen auf den anderen zu setzen. Ein Bügel schützte den Propeller vor Schussverletzungen. Mit diesem Flugzeug machte ich von Freiburg aus meinen ersten Versuchsflug gegen den Feind. Im Beobachtersitz saß wieder mein alter Freund Kühn vom I. R. 105, mit dem ich zahlreiche und schöne Fluge vor dem Kriege und viele erfolgreiche über dem Feind durchgeführt hatte. Jeder wusste, dass er sich auf den anderen verlassen konnte, ein Blick genügte zur Verständigung. Die Kampfesfreude leuchtete aus seinen scharfen Späheraugen, die neue Waffe war ihm wohlvertraut.
Am Hartmannsweilerkopf am Südauslauf der Vogesen erschien auch freundlicherweise ein französisches Farman-Flugzeug, das uns siegesgewiss mit seinem auf der vorderen Gondel montierten Maschinengewehr angriff. Wir ließen den Gegner ziemlich nahe herankommen, und als er seine erste Serie von fünfundzwanzig Schuss verschossen hatte, bekam er von meinem Franz eine Ladung von fünfzig Schuss. Das war offensichtlich so überraschend, dass der Führer zunächst vor Verblüffung am Knüppel zog und dann den größtmöglichen Tiefenausschlag gab, um sich im Sturzflug diesem Ungeheuer, das auf einmal keine leichte Beute mehr war, zu entziehen. Der Einbau hatte sich grundsätzlich bewährt, die Zapfen wurden verschiebbar ausgebildet, es wurde ein zweites M. G. eingesetzt und es gelang uns auch, nach weiteren Probeflügen und Probeluftkämpfen mit dem ersten an der Front eingesetzten Maschinengewehr den ersten Abschuss eines französischen Bombers aus einer Staffel heraus und damit die Befreiung Badens von den täglichen Bombenangriffen zu melden. Das später eingeführte starre Maschinengewehr für den Führer machte die damalige Konstruktion überflüssig.
Bombenflug im Hochgebirge - Von Josef Kissenberth
ir lagen als Alpenkorps-Fliegerabteilung im Sommer 1915 im Hochgebirge. Am 31. Juli 1915 war ein Bombenflug nach Cortina d’ Ampezzo angesetzt.
Da wir die Gegend von früheren Flügen mit Doppelsitzern schon kannten, war ich auch mit zwei Kameraden dazu ausersehen. Heute konnten wir allerdings keine Beobachter mitnehmen, sonst wären unsere „Parasols“ mit ihrer Bombenlast nicht mehr über die Bergspitzen weggekommen. Damals gab es ja noch keine Maschinen, die uns mühelos in achtzehn Minuten auf sechstausend Meter trugen, sondern wir mussten froh sein, wenn wir in endloser Zeit nur halb so hoch stiegen. Dazu kamen noch die widrigen Luftwirbel und Hochwinde, die die Flugzeuge hundert Meter und mehr wieder hinabdrückten. Auch manche Stellungen der Italiener waren ganz verdächtig hoch gelegen. —
Wir fuhren also gegen sechs Uhr abends — eher war wegen der zu starken Böen über dem Hochgebirge nicht an Fliegen zu denken — von unserem Quartier auf den zwischen Toblach und Niedendorf gelegenen Flughafen hinaus. Unsere drei „Parasols“ standen schon vor den Zelten. Freilich hatte die feuchte, nur ungefähr hundertfünfzig Meter lange Wiese die in ihrer Mitte noch eine Erhöhung aufwies und rings von Sumpf umgeben war, mit einem Flugplatz in Schleißheim wenig Ähnlichkeit, und Start und Landung waren jedes Mal ein Kunststück.
Hermann Göring
Deutscher Luftsieg
Wir verstauten unsere Bomben in den eigens dazu erfundenen Abwurfvorrichtungen. Ich baute auch außerdem noch meine Kammer ein, obwohl ich auf den Gesichtern der Beobachter lesen konnte, dass sie nie und nimmer einem Flugzeugführer eine einigermaßen gelungene Aufnahme zutrauten. Bald waren wir fertig und gegen sieben Uhr wurde gestartet. Das Wetter, von dem wir hier im Hochgebirge noch viel mehr abhängig waren als im Flachland, war nicht ganz einwandfrei, und tiefe Wolken hingen am Himmel. Aber es wird schon halten! Meine Kameraden hatte ich bald aus den Augen verloren. Ich trachtete vorerst nur danach, möglichst rasch hochzukommen. Nach etwa einer halben Stunde war ich so weit, verließ das Pustertal, flog am Dürrenstein, der den Flieger immer mit besonders heftigen Böen bedenkt, vorbei, glitt an den wuchtig geformten Felsmauern der Croda Rossa vorüber und hinein in den von Monte Pelmo, Tofana, Cristallo, Sorapitz umrandeten Talkessel von Cortina, alles Namen, die ein Bergsteigerherz höherschlagen ließen, für deren Naturschönheiten ich aber heute wenig Begeisterung zeigen konnte. Viel wertvoller war für mich die Entdeckung, dass die Cima Pomanon heute mit einer Wolkenbank zugedeckt war und ich sie also ungestört überfliegen konnte. Die Italiener, die mich gestern mit ihren Maschinengewehren so eklig angeleuchtet und meinem neuen „Parasol“ mehrere Treffer beigebracht hatten, werden in Wut geraten sein, dass sie heute dem „aviatico maledetto“ nichts anhaben konnten. Inzwischen kamen auch schon die ersten Häuser von Cortina in Sicht. Ich war in eintausendfünfhundert Meter Höhe über ihnen, machte alles zum Abwurf fertig, flog das Ziel genau an, schätzte, wieviel ich vorhalten musste, und ließ dann die sieben Bomben fallen. Den Aufschlag konnte ich allerdings nicht beobachten, denn ich hatte mit dem Abfangen der Böen, die hier ganz besonders heftig waren, genug zu tun, um meine Maschine im Gleichgewicht zu erhalten. Schleunigst machte ich mich aus dem Staube. Aufnahmen konnte ich von Cortina nicht mehr machen, da es unten schon zu dunkel war. Ich schlug die Richtung nach dem Cristallo ein, da der Pomanon frei lag und ich den von dort drohenden Maschinengewehren aus dem Weg gehen wollte. Wenige Meter flog ich über den Cristallo-Gletscher dahin. Im Betrachten seines ewigen Eises in den dunkelblauen Schlünden kam mir die Schönheit und der Zauber des Fluges über dem Hochgebirge so recht zum Bewusstsein. Die letzten Strahlen der sinkenden Sonne, durch die Nebelfetzen in mehrfarbiges Licht gebrochen, lagen auf den wuchtigen Klippen und Spitzen. —
Bei der Landung empfing mich die traurige Nachricht, dass der eine meiner Kameraden kurz nach dem Start, anscheinend infolge eines starken Luftwirbels, tödlich abgestürzt war. — Unser Flug aber hatte Erfolg gehabt. Wie uns unser Führer, Oberleutnant Hailer, wenige Tage danach mitteilte, ergaben Gefangenenaussagen, dass elf Bomben ihr Ziel getroffen hatten.
Der Erste! - Von Max Immelmann
ür den 1. August 1915 hatte ich Fernauftrag. Das Auto wurde aber abbestellt, weil kein Flugwetter sei. Also konnte man weiterschlafen. Kurz darauf wüstes Geknatter. Also schnell zum Platz. Mein Beobachter sagt, er hielte es für aussichtslos, aufzusteigen, die Fernsicht sei zu schlecht. Also flogen wir nicht. Aber ich ärgerte mich. Es waren noch immer zehn Feinde in der Luft. Boelcke sah man in der Ferne einen anderen Eindecker verfolgen. Ich nicht faul, ziehe den zweiten Fokker aus dem Stall und brumme ab. Als ich zweitausend Meter hoch bin, ziehen über mir zwei Feinde dahin, etwa zweitausendfünfhundert Meter hoch. Sie fliegen Richtung Arras, ich komme von da. Ich war froh, dass sie mich nicht angriffen, denn sechshundert Meter tiefer wäre ich wehrlos gewesen. Als ich fast in Douai war, traf ich abermals zwei Feinde, die von Boelcke verfolgt wurden. Sie waren alle drei etwa dreitausendzweihundert Meter hoch und flogen in Richtung Arras. Plötzlich sah ich Boelcke steil nach unten gehen. Schwere Ladehemmung. Als ich halbwegs zwischen Douai und Arras war, sah ich vor mir einen neuen Flieger. Wir waren etwa in gleicher Höhe. Ich konnte nicht sehen, ob es ein feindlicher Flieger oder ein unsriger war. Erst als ich näher kam, sah ich, dass er über Vitry Bomben abwarf: Feind.
Ich stieg noch etwas und flog auf ihn zu. Etwa achtzig bis hundert Meter war ich höher, in der Geraden etwa fünfzig Meter entfernt. Groß und deutlich sah ich die französischen Abzeichen: blau-weiß-rote Ringe. Nun war kein Zweifel mehr. Die beiden anderen Feinde kamen jetzt auch auf mich zu, wenngleich sie noch viel höher waren. Ich musste also schnell handeln. Wie ein Habicht stürzte ich mich auf den Gegner und schoss mit meinem Maschinengewehr. Für einen Augenblick glaubte ich, in ihn hineinzufliegen. Nach etwa sechzig Schuss hatte ich eine Ladehemmung. Das war recht unangenehm, denn um sie zu beseitigen, brauchte ich beide Hände. Ich musste also freihändig fliegen, was mir noch neu und fremd war, aber es gelang. Auch zwei weitere Ladehemmungen konnte ich beseitigen. Inzwischen hatte der Feind Richtung Arras genommen. Schnell setzte ich mich neben ihn und schnitt ihm den Rückweg ab. Beim Kampf waren wir etwa vierhundert Meter tiefer gekommen. In meinen Feuerpausen hörte ich nur noch leise das Maschinengewehrknattern der Feinde über mir. Ich hielt mich beständig über meinem Opfer. Nach Vierhundertfünfzig bis fünfhundert Schuss — der Kampf hatte etwa acht bis zehn Minuten gedauert — ging der Feind in steilem Gleitflug nieder. Ich ging ihm nach. Schießen konnte ich nicht mehr. Das Maschinengewehr versagte. Als ich sah, dass er gelandet war, landete ich sofort neben ihm, stieg aus und ging auf ihn zu. Kein Mensch war in der Nähe. Ich ohne jede Waffe. Werden die Insassen Widerstand leisten? Es war ein unangenehmer Augenblick. Schon von weitem rief ich: „Prisonniers!“ Erst jetzt sah ich, „dass nur einer drin saß. Er hatte die rechte Hand erhoben zum Zeichen, dass er keinen Widerstand leisten wolle. Ich ging zu ihm, gab ihm die Hand. „My arm is broken, you shot very well!“ Jetzt erst sah ich, dass er am linken Arm schwer verwundet war. Ich half ihm beim Aussteigen und legte ihn ins Gras, zog ihm die Handschuhe aus und schnitt die Ärmel von Lederrock, Uniform und Hemd auf. Der Unterarm war durchschossen.
Schon kamen von allen Seiten Autos an. Allerseits wurde mir herzlich Glück gewünscht. Er hatte etwa vierzig Treffer im Apparat. — Boelcke, der den Kampf von unten beobachtet hat, ist auf dem Platz umhergelaufen und hat gerufen: „Die schießen uns den Immelmann kaputt!“ Sie haben ihn aber nicht kaputtgeschossen. Meine Kurven und Gleitflüge, überhaupt mein ganzes Fliegen soll ausgesehen haben, als flöge ich schon wochenlang auf Fokker. Als Auszeichnung habe ich das Eiserne Kreuz l. Klasse bekommen. Nun habe ich den schönsten Orden, den ein junger Offizier überhaupt bekommen kann.
Zwei Stunden am Seil - Von Franz Schneider
m 26. August 1915 kehrte das Zeppelin-Luftschiff LZ 79, Kommandant: Hauptmann Gaißert, von einer Kriegsfahrt nach Russland zum Hafen Posen zurück. Die Landung gestaltete sich schwierig, da der Wind stark und das Schiff zu leicht war. Ich gehörte zum Landungstrupp, der mühsam das Schiff Meter um Meter heruntergeholt hatte. Plötzlich wurde das Schiff durch eine Böe wieder hochgerissen. Vor mir griff eben noch ein Unteroffizier zu, und ich sah, wie er zu Boden gerissen wurde. Da war ich auf einmal in fünfzehn Meter Höhe! Ich hing mit beiden Händen fest am Tau und mit den Beinen frei in der Luft. Der Kahn ging immer höher. Das Tau, an dem ich hing, war hundertfünfzig Meter lang. Ich hing etwa vierzig Meter unter dem Schiff. Das Ende des Taues lag immer noch auf der Erde, da sich der Trupp bemühte, es noch zu halten. Aber das Schiff stieg doch, nun hing das Tau schon lang, so dass ich es mit den Beinen erwischen und festhalten konnte. Ich hing im Kletterschluss, über mir noch zwei Kameraden, die auch festgehalten hatten.
Wir hofften erst auf sofortige neue Landung, aber das Schiff fuhr über die Stadt zur russischen Grenze. Das Tau drehte sich einmal links, einmal rechts herum. Für uns hieß es, entweder festbinden oder bis ans Schiff hinaufklettern. Aber da waren noch die beiden anderen Kameraden über mir. Ich hielt mich daher mit der rechten Hand und den Beinen fest, um mit der linken Hand das Ende unter meinen Füßen heraufzuziehen und mich dann festzubinden. Aber auch dazu reichten meine Kräfte nicht aus. Das Tau war zu schwer. Ich musste daher so weit heruntergehen, dass es sich gut hantieren ließ. Fünf bis sechs Meter waren nun zwischen mir und meinem nächsten Kameraden. Ich rief ihm zu, er solle so lange oben bleiben, bis ich mich festgebunden habe. Aber er kam doch nach, immer schneller, weil seine Kräfte schon anfingen zu versagen. Nun stand er mit beiden Füßen schon auf meinen Händen. Er wäre wohl abgestürzt, wenn er nichts Festes unter seinen Füßen gehabt hätte. Ich hatte mir schon vorher das Tau ein paarmal um das linke Bein gewickelt und hielt das Bein so, dass es mit dem Körper einen rechten Winkel bildete. Der Kamerad setzte sich darauf. Wir saßen nun in der Schlinge um mein Bein, konnten uns erst einmal etwas erholen, obwohl mir schon die Beine einschliefen. Nach einer halben Stunde kamen wir in die Wolken. Der Nebel war so dicht, dass wir nur das Stück Tau in unserer Nähe sahen. Vom Schiff, sogar vom weiter oben hängenden dritten Kameraden sahen wir nichts. Alles still, bis auf das Summen der Motoren. Dann waren wir über der Wolkenschicht unter blauem Himmel.
Auf einmal gab es einen Ruck! Das Tau gerissen? Die oberste Schlinge löste sich, wir rutschten zusammen immer schneller, etwa vierzig bis fünfzig Meter. Beide Hände schmerzten durch die Reibung am Tau. Ein zweiter Ruck! Ich überschlug mich rückwärts, wusste nicht, was geschah, sah, wie mein Kamerad in die Tiefe stürzte und in den Wolken verschwand. Ich dachte erst, ich sauste auch hinunter, da sah ich erst, dass der Abstand zwischen uns immer größer wurde. Ein Blick nach oben: Das Seil, das ich erst um mein Bein gewickelt hatte, war nicht gerissen, sondern beim Überschlagen zusammengezogen und um den linken Fuß fest verschlungen. Ich hing nun mit dem Kopf nach unten, während das Schiff noch stieg. Ich fror in meinen Drillichsachen sehr in über dreitausend Meter Höhe. Das Bein schmerzte fürchterlich, war dick und abgestorben. Ich versuchte das Tau zu lösen, um mich in die Tiefe zu stürzen, weil ich es nicht mehr aushalten konnte, aber das Tau war zu fest.
Wir waren nun viertausend Meter hoch, wie uns später die Besatzung erzählte. Bis jetzt hatte sich mein oberster Kamerad im Kletterschluss gehalten. Er kam jetzt langsam herunter, setzte sich auf mein Bein. Konnte nicht mehr, wollte sich festbinden. Ich versuchte erst, ihm das Ende heraufzureichen, aber er erreichte es nicht. So legte ich mir das Tau um mein rechtes Bein und gab es ihm so hinauf. Er band sich fest und ich schlang mir das Ende noch ein paarmal um den Leib, damit ich ganz sicher hing.
Nach zwei Stunden ging das Schiff wieder zur Landung herunter. Wir sahen endlich wieder die Erde! Mein Kamerad zog seine Uhr auf und fragte mich, ob ich im Besitz eines Fahrscheines wäre. Die Luft wurde wärmer. Da war die Luftschiffhalle. Ich hing immer noch mit dem Kopf nach unten.
Durch die Höhenfahrt war das Schiff zu schwer geworden. Am Tau hundert Meter unter dem Schiff kamen wir zuerst mit der Erde in Berührung, wurden wie ein Fußball herumgeschleudert, erst etwas fest auf ein Stoppelfeld gesetzt. Blieben ein Weilchen liegen, wurden wieder in die Höhe gerissen und zum zweiten Male auf den Boden geschleudert. Ein paarmal ging das, dann wurden wir mitgeschleift. Mein Kamerad fiel aus der Schlinge, mit mir ging’s auf und ab über Gräben und Felder.
Sehen konnte ich nichts mehr. Augen, Ohren, Nase, Mund, — alles war voll Sand. Hauptsache: Kopf hochhalten, um nicht aufzuschlagen1 Ein Grenzstein stellte sich mir entgegen. Da rissen zwei Mann vom Landungstrupp, die vorausgeeilt waren, das Seil kurz beiseite. Ich wurde noch ein Stück geschleift und blieb dann liegen. Ein Sanitätsauto kam. Die Sanitäter schnitten den Knoten durch und legten mich auf die Trage, um mich für sieben Wochen ins Lazarett zu schaffen.
Luftkampferlebnis - Von Oswald Boelcke
m Am 13. März 1916 war wieder großer Luftbetrieb. Früh kam ich gerade dazu, wie über dem Fort Douaumont ein Deutscher von einem avion de chasse angegriffen wurde. Letzteren habe ich mir gleich vorgenommen und verjagt— es war eine reine Pracht, wie er ausriss. — Nachmittags gegen ein Uhr sah ich ein französisches Geschwader beim „Toten Mann“ über die Front Richtung Dun fliegen. Ich suchte mir von ihnen einen etwas rechts vom Geschwader abhängenden Voisin-Doppeldecker aus und stieß auf diesen los. Da ich sehr hoch über ihm war, kam ich schnell ran und schoss ihm die Jacke voll, ehe er noch die Situation richtig kapiert hatte. Er machte sofort kehrt, um nach der Front auszureißen. Ich griff ihn nochmals energisch an, da kippte er nach rechts und verschwand unter meinem Flügel. Ich glaubte, er stürzte ab, drehte aber gleich wieder bei, um ihn weiter im Auge zu behalten, und sehe zu meinem Erstaunen, dass der Gegner sich wieder aufrichtet. Ich gehe natürlich nochmals auf ihn los, — da erblickte ich etwas ganz Sonderbares. Der Beobachter war aus dem Apparat rausgeklettert und saß auf dem linken Tragdeck, hielt sich an den Streben fest, sah erschreckt auf mich und winkte mit der Hand. Das Bild sah sehr kläglich aus, und ich zauderte einen Augenblick, auf ihn zu schießen. — Er war ja gänzlich wehrlos. Ich hatte dem Apparat die Steuerorgane zerschossen, und die Maschine war abgestürzt: um sie wieder in die Gewalt zu bekommen, war der Beobachter rausgeklettert und hatte sich auf den einen Flügel gesetzt, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ich schoss noch einige Schuss auf den Führer, um den Gegner ganz runter zu bekommen. Da wurde ich von einem zweiten Franzosen gestört, der seinem Kameraden zu Hilfe kam.
Da ich nur noch wenig Patronen hatte und auch schon über den Schützengräben war, drückte ich mich nun schleunigst. Der feindliche Apparat ist dann noch eine kurze Strecke im Gleitflug geflogen, schließlich aber doch aus niedriger Höhe abgestürzt. Er liegt vor einer unserer Feldwachen östlich des Dorfes Malancourt. Man kann ihn von unserer Front aus deutlich liegen sehen.
Kriegsflüge über dem Kanal - Von Friedrich Christiansen
m 19. März 1916 wurde ein Bombenangriff angesetzt mit dem Ziel der Zerstörung der in den Hafenanlagen und zur Abfahrt nach Frankreich verladenen ungeheuren Mengen von Kriegsmaterial.