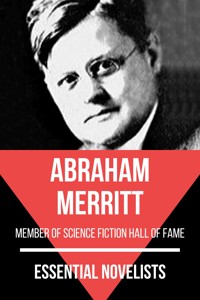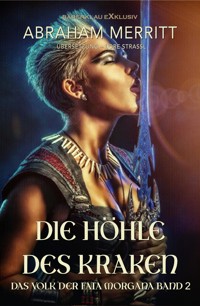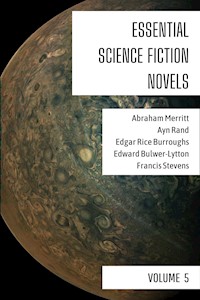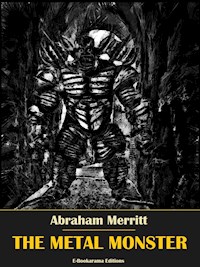3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie sterben in Sekunden – niemand weiß, woran!
Und dann lachen die Toten, böse und triumphierend …
Doch dem Arzt Dr. Lowell lassen die rätselhaften Todesfälle keine Ruhe. Mit Freunden der Toten verfolgt er mehrere Spuren. Und dann bringt ihm ein Polizist eine überfahrene Puppe.
Sie blutet aus zahlreichen Wunden … und ist ein Abbild der ersten Toten …
Der Klassiker »BURN, WITCH, BURN!« ist die Geschichte einer bösartigen alten Frau, die »magisch-belebte« Puppen ausschickt, um ihre Opfer auf perfide Weise zu töten …
Endlich liegt wieder die erste deutsche Ausgabe des Klassikers BURN, WITCH, BURN! von Abraham Merritt in der Übersetzung der unvergleichlichen Lore Straßl vor, die mit ihrem Mann, dem Autor und Herausgeber HUGH WALKER, viele Klassiker der Horror- und Fantasyliteratur mit ihren deutschsprachigen Erstveröffentlichungen bekannt gemacht hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Abraham Merritt
Flieh, Hexe, flieh!
Unheimlicher Roman
Originaltitel: BURN, WITCH, BURN!
Aus dem Amerikanischen von Lore Straßl
***
Impressum
Neuausgabe
Copyright dieser deutschen Ausgabe © by Übersetzer Lore Strassl/Bärenklau Exklusiv
Cover: © Steve Mayer nach Motiven, 2023
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv.
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Flieh, Hexe, flieh!
Vorwort
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Der Autor Abraham Merritt
Weitere Werke von Abraham Merritt,
Das Buch
Bärenklau Exklusiv präsentiert »Flieh, Hexe, flieh!«, eine Übersetzung aus dem Amerikanischen von Lore Sraßl.
Sie sterben in Sekunden – niemand weiß, woran!
Und dann lachen die Toten, böse und triumphierend …
Doch dem Arzt Dr. Lowell lassen die rätselhaften Todesfälle keine Ruhe. Mit Freunden der Toten verfolgt er mehrere Spuren. Und dann bringt ihm ein Polizist eine überfahrene Puppe.
Sie blutet aus zahlreichen Wunden … und ist ein Abbild der ersten Toten.
Der Klassiker »BURN, WITCH, BURN!« ist die Geschichte einer bösartigen alten Frau, die »magisch-belebte« Puppen ausschickt, um ihre Opfer auf perfide Weise zu töten.
Endlich liegt wieder die erste deutsche Ausgabe des Klassikers BURN, WITCH, BURN! von Abraham Merritt in der Übersetzung der unvergleichlichen Lore Straßl vor, die mit ihrem Mann, dem Autor und Herausgeber HUGH WALKER, viele Klassiker der Horror- und Fantasyliteratur mit ihren deutschsprachigen Erstveröffentlichungen bekannt gemacht hat.
***
Flieh, Hexe, flieh!
Vorwort
Ich bin Facharzt für Neurologie und Geisteskrankheiten und spezialisiere mich auf die Psychologie des Abnormen, ein Gebiet, auf dem ich mir einen Namen gemacht habe. Ich arbeite eng mit zwei der bekanntesten New Yorker Krankenhäuser zusammen und wurde sowohl hier als auch im Ausland mit Ehrungen überhäuft. Ich erwähne das – selbst auf die Gefahr hin, dadurch erkannt zu werden – nicht aus Eitelkeit, sondern weil ich damit auf meine Kompetenz hinweisen möchte, die Ereignisse, über die ich berichten werde, vom wissenschaftlichen Standpunkt aus zu beurteilen.
Ich sagte bereits, dass ich riskiere, erkannt zu werden, denn Lowell ist nicht mein echter Name. Er ist ebenso erfunden wie die Namen aller Beteiligten. Warum ich es vermeide, die echten Namen zu verwenden, wird bald genug klar werden.
Ich lege dies alles überhaupt nur ausführlich nieder, weil ich das Bedürfnis habe, mich jemandem anzuvertrauen und vielleicht so mit mir selbst über die Tatsachen und Beobachtungen ins Reine zu kommen, die ich in meinen Krankenberichten unter der Überschrift »Die Puppen der Madame Mandilip« eingetragen habe.
Natürlich könnte ich das auch in Form einer Niederschrift an eine der medizinischen Gesellschaften tun, aber ich bin mir nur allzu klar darüber, wie meine verehrten Kollegen auf diese Aufzeichnungen reagieren würden, mit welchem Verdacht, welchem Spott, oder gar welcher Abscheu sie mich in Zukunft betrachten würden – so sehr gegen alle akzeptierten Normen sind diese Geschehnisse und Beobachtungen.
Obwohl ich nach wie vor ein sehr orthodoxer Mediziner bin, frage ich mich nun, ob es nicht vielleicht doch einige Dinge mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als jene, die wir uns eingestehen; Kräfte und Energien, die wir stur verleugnen, weil wir innerhalb der engen Grenzen unseres gegenwärtigen Wissens keine Erklärung für sie finden. Kräfte, deren Existenz im Volksglauben, in den alten Überlieferungen aller Völker verwurzelt sind, und die wir als Mythen und Aberglauben abtun, um unsere Unwissenheit zu rechtfertigen.
Eine Weisheit, eine Wissenschaft von unvorstellbarem Alter, älter noch als alle Geschichtsaufzeichnungen, die jedoch nie völlig aussterben oder verloren gehen wird. Ein Geheimwissen, dessen dunkle Flamme zu allen Zeiten von seinen Priestern und Priesterinnen gehütet und von Jahrhundert zu Jahrhundert weitergegeben wurde. Die dunkle Flamme verbotener Erkenntnis, die in Ägypten loderte, noch ehe die Pyramiden errichtet wurden; die in den längst unter dem Sand der Wüste Gobi zerfallenen Tempeln glühte; die den Söhnen Ads vertraut war, welche Allah, wie die Araber erzählen, wegen ihrer Zauberkünste zu Stein erstarren ließ, zehntausend Jahre ehe Abraham durch die Straßen Urs in Chaldäa wandelte; die in China bekannt ist und den Lamapriestern in Tibet, den burjätischen Schamanen der Steppe, genau wie den Medizinmännern der Südsee.
Dunkle Flammen des finsteren Wissens – welche die Schatten von Stonehenges düsteren Menhiren schwärzer werden ließ; in späterer Zeit genährt von der Hand römischer Legionäre, und mächtig auflodernd, warum weiß niemand, im mittelalterlichen Europa. Die dunkle Flamme, die immer noch brennt, die nie erloschen ist, nie an Kraft verloren hat.
Doch genug der langen Vorrede. Ich beginne dort, wo diese dunkle Flamme – wenn es sie wahrhaftig gibt – zum ersten Mal ihre Schatten auf mich warf.
1. Kapitel
Als ich die Stufen zum Krankenhauseingang hochschritt, hörte ich die Turmuhr einmal schlagen. Normalerweise schlafe ich zu dieser Zeit längst, aber ich hatte einen sehr interessanten Fall übernommen und meinen Assistenten Braile gebeten, mich sofort zu benachrichtigen, wenn sich am Befinden des Patienten etwas ändern sollte. Gerade hatte ich nun seinen Anruf erhalten. Es war eine klare Novembernacht, und ich blieb im Schatten des Portals stehen, um noch ein paar Minuten den herrlichen Sternenhimmel zu bewundern. In diesem Augenblick brauste ein Auto um die Ecke und hielt vor dem Treppenaufgang.
Ich fragte mich, was das zu dieser späten Stunde sollte, als ein Mann ausstieg. Er warf einen scharfen Blick die menschenleere Straße auf und nieder, ehe er die Tür weit aufriss. Ein zweiter Mann kletterte aus dem Auto. Die beiden bückten sich und schienen im Wagen herumzuhantieren. Dann richteten sie sich auf, und ich sah, dass sie die Arme unter die Schultern eines dritten gelegt hatten. Als sie näher kamen, bemerkte ich, dass sie ihn nicht stützten, sondern regelrecht trugen. Sein Kopf war auf die Brust gesunken und sein Körper baumelte schlaff zwischen den beiden.
Ein vierter stieg aus dem Wagen.
Ich erkannte ihn. Es war Julian Ricori, ein berüchtigter Unterweltboss, der sich bereits zur Zeit des Alkoholverbots einen Namen gemacht hatte.
Bis jetzt hatte mich noch niemand bemerkt. Ich trat aus dem Schatten. Sofort hielten die beiden mit ihrer Last an. Ihre freien Hände fuhren blitzschnell in ihre Jackentaschen. Der Grund dafür war unmissverständlich.
»Ich bin Dr. Lowell«, stieß ich hastig hervor. »Arzt in dieser Klinik. Bitte kommen Sie herein.«
Die Männer dachten nicht daran, meiner Aufforderung Folge zu leisten. Sie ließen kein Auge von mir, aber sie rührten sich auch nicht vom Fleck. Ricori stellte sich vor sie. Auch seine Hände steckten in den Taschen. Er musterte mich, dann nickte er den anderen zu. Ich spürte förmlich, wie die Spannung nachließ.
»Sie sind mir nicht unbekannt, Doktor«, sagte er freundlich in merkwürdig korrektem Englisch. »Aber Sie sind da ein bedenkliches Risiko eingegangen. Darf ich Ihnen für die Zukunft den Rat geben, nicht so unerwartet aus dem Dunkeln aufzutauchen, wenn Sie Fremden gegenübertreten. In dieser Stadt könnte das sehr gefährlich sein.«
»Aber Sie sind mir kein Fremder, Mr. Ricori.«
»Dann, muss ich sagen, waren Sie doppelt unvorsichtig.« Er lächelte schwach.
Einen Moment herrschte ungemütliches Schweigen.
»Da Sie also wissen, wer ich bin, werden Sie verstehen, dass ich mich hinter geschlossenen Türen sicherer fühle als hier im Freien.«
Ich öffnete das Portal. Die beiden Männer schleppten ihre Last ins Haus. Ricori und ich folgten ihnen. Meine ärztliche Pflicht verlangte, dass ich mich gleich um den offensichtlich kranken Mann kümmerte. Als ich mich ihm zuwandte, warfen seine beiden Träger Ricori einen fragenden Blick zu. Ich hob den Kopf des Patienten.
Fast etwas wie ein Schock durchzuckte mich. Die Augen des Mannes standen weit offen. Er war weder tot noch bewusstlos, aber in seinem Gesicht sah ich einen Ausdruck von unbeschreiblichem Entsetzen, wie es mir in meiner langjährigen Erfahrung mit Normalen, Irren und Grenzfällen noch nie begegnet war. Es war nackte Furcht, gepaart mit unvorstellbarem Grauen. Die vergrößerten Pupillen schienen wie die Ausrufezeichen der Erregung, die sich auf seinen Zügen spiegelte. Sie starrten durch mich hindurch und an mir vorbei. Und gleichzeitig hatte es den Anschein, als sähen sie in sein Inneres – als erblickten sie den fürchterlichen Alptraum nicht nur vor, sondern auch in sich.
Ricori hatte mich gespannt beobachtet. »Was könnte diesen grauenvollen Zustand ausgelöst haben? Ich bin bereit, eine größere Summe für die Aufklärung zu bezahlen. Natürlich möchte ich, dass mein Freund wieder geheilt wird, Dr. Lowell. Aber ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein: Ich gäbe meinen letzten Pfennig für die Gewissheit, dass jene, die ihm das angetan haben, mir nicht dasselbe tun können.«
Auf meinen Wink hatte man Pfleger geschickt, die den Patienten auf eine Bahre legten. Ricori zupfte mich ganz leicht am Ärmel. »Ich habe viel über Sie gehört, Dr. Lowell. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie diesen Fall persönlich übernähmen.«
Ich zögerte.
Beschwörend fuhr er fort: »Könnten Sie nicht alles andere einem Kollegen übergeben und sich nur meinem Freund widmen? Ziehen Sie hinzu, wen Sie für richtig halten – und machen Sie sich keine Gedanken wegen der Kosten.«
»Einen Moment, Mr. Ricori«, unterbrach ich ihn. »Ich kann die Patienten, die mir anvertraut sind, nicht einfach abschieben. Mein Assistent Braile und ich werden jedoch den Fall übernehmen, und Ihr Freund wird ständig unter Beobachtung und Aufsicht meiner fähigsten Leute sein. Sind Sie damit einverstanden?«
Er stimmte zu, obwohl ich sah, dass ihn diese Lösung nicht völlig befriedigte. Ich sorgte dafür, dass der Kranke in einem der Zimmer für Privatpatienten isoliert wurde. Danach erledigten wir die üblichen Formalitäten. Ricori nannte als Namen des Patienten Thomas Peters, der seines Wissens keine näheren Verwandten habe, und bestätigte, dass er die Behandlungskosten übernehmen würde. Als »Anzahlung« holte er einen Tausend-Dollar-Schein aus seiner Brieftasche.
Ich fragte Ricori, ob er bei der Untersuchung anwesend sein wolle. Er lehnte nicht ab. Er sprach zu den beiden, die Peters hereingeschleppt hatten, woraufhin sie links und rechts des Portals Posten bezogen. Ricori und ich begaben uns zu dem Patienten. Braile, nach dem ich gerufen hatte, beugte sich gerade über ihn und studierte mit sichtlicher Verwunderung dessen Gesichtsausdruck. Zufrieden stellte ich fest, dass man die Walters, eine ungewöhnlich tüchtige und gewissenhafte Krankenschwester, zu diesem Fall abbeordert hatte.
Braile hob den Kopf und blickte mich an. »Vermutlich ein Rauschgift«, meinte er.
»Vielleicht. Aber wenn, dann eines, das mir noch nie untergekommen ist«, erwiderte ich. »Sehen Sie sich doch mal seine Augen an.«
Ich drückte Peters’ Lider zu. Kaum hatte ich meine Finger weggezogen, öffneten sie sich wieder, ganz, ganz langsam, bis sie erneut weit offen standen. Mehrmals versuchte ich noch, sie zu schließen. Immer öffneten sie sich wieder der Ausdruck des Entsetzens, des unbeschreibbaren Grauens blieb unverändert.
Ich begann mit der Untersuchung. Der Körper war völlig schlaff. Wie eine Puppe, dachte ich unwillkürlich. Es war, als sei jegliche Motorik erstorben. Und dennoch war keines der üblichen Lähmungssymptome feststellbar. Der Körper reagierte auch auf keinerlei Reiz, obwohl ich bis zu den Nervensträngen vordrang. Die einzige Reaktion war eine geringe Verengung der Pupillen bei stärkster Lichtbestrahlung.
Der Pathologe Hoskins entnahm Blutproben. Danach untersuchte ich die Haut Zentimeter um Zentimeter. Ich fand weder einen Einstich, noch eine Verletzung, noch eine Schürfwunde oder einen Bluterguss. Selbst als wir mit Ricoris Erlaubnis, die dichten Körperhaare entfernt hatten, entdeckte ich absolut nichts, das auf eine intramuskuläre oder venöse Injektion einer Droge hingewiesen hätte. Ich ließ den Magen auspumpen und nahm Proben der Ausscheidungsorgane, einschließlich der Haut. Ich untersuchte Mund- und Nasenschleimhäute. Sie schienen völlig normal und gesund. Trotzdem nahm ich Abstriche davon. Der Blutdruck war niedrig, die Temperatur etwas unternormal, aber das musste nicht unbedingt etwas bedeuten. Ich injizierte Adrenalin, was jedoch absolut keine Reaktion bewirkte. Das wiederum schien mir recht bedeutungsvoll.
»Armer Teufel«, murmelte ich. »Ich werde alles versuchen, dich von diesem Alptraum zu befreien.«
Ich spritzte eine kleine Dosis Morphium. Genauso gut hätte ich Wasser nehmen können – keine Reaktion. Daraufhin gab ich ihm so viel ich verantworten konnte. Seine Augen mit dem Ausdruck unverminderten Entsetzens und Grauens blieben offen. Auch am Puls und der Atmung änderte sich nichts.
Ricori hatte mir die ganze Zeit mit größtem Interesse zugesehen. Es gab nichts mehr, was ich im Augenblick noch tun konnte. Ich sagte es ihm.
»Jetzt kann ich nur noch auf die Laborbefunde warten«, erklärte ich. »Um ehrlich zu sein, ich stehe vor einem Rätsel. Ich kenne keine Krankheit und kein Gift, die diesen Zustand hervorrufen könnten.«
»Aber Dr. Braile sprach doch von einer Droge …«
»Nur eine Vermutung«, unterbrach ihn Braile hastig. »Leider kenne auch ich keine Droge, die diese Symptome verursacht.«
Ricori warf einen scheuen Blick auf Peters’ Gesicht und schüttelte sich.
»Haben Sie eine Ahnung«, fragte ich, »ob Peters in ärztlicher Behandlung stand? Aber auch wenn er nicht unter einer Krankheit litt, gab es vielleicht irgendetwas, das ihm zu schaffen machte? Oder fiel Ihnen etwas Ungewöhnliches an seinem Benehmen auf?«
»Ich muss leider alle Fragen verneinen. Peters war in den vergangenen Wochen fast ständig mit mir zusammen. Es fehlte ihm absolut nichts. Noch heute Abend speiste er bei mir. Er war bester Laune, und wir unterhielten uns sehr angeregt. Plötzlich hielt er mitten im Wort inne und schien zu lauschen. Dann rutschte er mit einem Mal vom Stuhl und sank zu Boden. Als ich mich über ihn beugte, befand er sich bereits in dem Zustand, wie Sie ihn jetzt vor sich haben. Es geschah genau um null Uhr dreißig. Ich brachte ihn sofort hierher.«
»So wissen wir zumindest die exakte Zeit des Anfalls. Wie gesagt, im Moment können wir nichts weiter tun. Wenn – wenn Sie vielleicht nach Hause gehen möchten …«
Fast verlegen spielte er mit seinen sorgfältig manikürten Fingern. »Dr. Lowell«, murmelte er schließlich. »Falls mein Freund stirbt, ohne dass Sie die Todesursache festzustellen vermögen, komme ich für die üblichen Behandlungs- und Krankenhauskosten auf – doch für nicht mehr. Falls er stirbt und Sie entdecken die Ursache nach seinem Ableben, gebe ich Ihnen einen Scheck über hunderttausend Dollar, die Sie für wohltätige Zwecke verwenden mögen. Finden Sie den Grund seines gegenwärtigen Zustands jedoch solange er am Leben ist und gelingt es Ihnen, ihn zu heilen – gebe ich Ihnen die gleiche Summe.«
Braile und ich starrten ihn fassungslos an. Ich musste mich sehr bemühen, meine Entrüstung zu zügeln. »Ricori«, sagte ich schwer, »Sie und ich leben in verschiedenen Welten, darum versuche ich, Ihnen ruhig zu antworten, so schwer es mir auch fällt. Glauben Sie mir, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um herauszufinden, was Ihrem Freund fehlt, und ihn zu heilen. Ich täte es auch, wenn er und Sie bettelarm wären. Er interessiert mich als Fall, der meine ärztlichen Fähigkeiten herausfordert. Sie jedoch interessieren mich nicht im Geringsten, genauso wenig wie Ihr Geld und Ihr Angebot. Betrachten Sie es als zurückgewiesen. Ich hoffe wir verstehen uns.«
Er schien absolut nicht beleidigt. »Durchaus«, erwiderte er. »Umso mehr freue ich mich, dass Sie sich des Falles annehmen.«
»Das wäre damit geklärt. Wie kann ich Sie erreichen?«
»Ihre Erlaubnis vorausgesetzt, ließe ich gern zwei meiner … nun, Beauftragten dieses Zimmer ständig bewachen. Falls Sie mich benötigen, brauchten Sie ihnen lediglich Bescheid zu geben. Ich komme dann sofort.«
Ich lächelte, aber er fuhr sehr ernst fort. »Sie erinnerten mich, dass wir in zwei verschiedenen Welten leben, Dr. Lowell. Meine ist nicht so sicher und geschützt wie Ihre. Darum muss ich meine Vorkehrungen treffen.«
Natürlich war es ein recht ungewöhnliches Ansuchen. Aber irgendwie empfand ich fast etwas wie Sympathie für Ricori und verstand ihn.
»Meine Männer werden Ihnen keineswegs zur Last fallen«, versprach er.
»Nun gut, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich werde das Nötige mit der Krankenhausverwaltung regeln.« Auf seine Bitte hin sandte ich einen Pfleger zum Portal, und er kehrte mit einem der beiden Männer zurück, die Ricori dort postiert hatte. Ricori flüsterte ihm etwas zu, woraufhin er das Zimmer wieder verließ.
Bald darauf erschienen zwei gut gekleidete höfliche Männer mit wachsamen Augen. Einer warf einen Blick auf Peters. »Himmel«, entfuhr es ihm.
Ricori und seine beiden Männer untersuchten das Zimmer sorgfältig. Ehe sie zum Fenster hinausblickten, von dem sie sich bisher vorsichtig ferngehalten hatten, bat Ricori mich, das Licht ausschalten zu dürfen. Erst dann begutachteten sie die steile Hauswand, die von hier sechs Stockwerke tief hinabführte. Gegenüber dem Fenster erhob sich lediglich ein Kirchturm.
»Danke«, murmelte Ricori. »Sie dürfen das Licht wieder andrehen.« Er wandte sich zum Gehen, blieb jedoch vor der Tür stehen und sah mich an. »Ich habe viele Feinde, Dr. Lowell. Peters war meine rechte Hand. Einer meiner Feinde tat ihm das an, um mich zu treffen. Vielleicht, weil er nicht an mich selbst herankommen konnte. Ich sehe mir Peters an, Doktor, und zum ersten Mal in meinem ganzen langen Leben habe ich Angst – ich Ricori. Ich habe kein Verlangen danach, der Nächste zu sein, kein Verlangen in die Hölle zu blicken!«
Wie treffend er es ausgedrückt hatte! Es war genau das Gefühl, das ich selbst noch nicht in Worte gekleidet hatte.
Er legte die Hand auf die Klinke, dann zögerte er. »Noch etwas. Sollte irgendjemand sich telefonisch nach Peters’ Befinden erkundigen, dann gestatten Sie bitte meinen Leuten, den Anruf zu beantworten. Falls jedoch jemand persönlich nach ihm fragt, lassen Sie ihn heraufkommen, doch keinesfalls mehr als einen zu selben Zeit. Auch wenn sie behaupten Verwandte zu sein, erlauben Sie meinen Männern, sie zu empfangen und auszufragen.«
Er schüttelte mir die Hand, ehe er das Zimmer verließ. Ein weiteres Paar seiner so tüchtig aussehenden Leibwächter erwartete ihn. Ich blickte ihnen nach. Einer schritt vor ihm, der andere hinter ihm her, und ich sah, dass Ricori sich bekreuzigte.
Wäre ich religiös, hätte ich es sicher ebenfalls getan. Peters’ Gesichtsausdruck hatte sich verändert. Entsetzen und Grauen waren verschwunden. Immer noch schien er jedoch durch mich hindurch und in sich hineinzusehen, aber nun war es ein Ausdruck teuflischer Erwartung, und unwillkürlich drehte ich mich um, um zu sehen, welche Ausgeburt der Hölle auf mich zugeschlichen kam.
Nichts. Einer von Ricoris Leuten saß neben dem Fenster im Schatten und beobachtete die Fenster im Kirchturm. Der andere hockte unbewegt bei der Tür.
Braile und Schwester Walters starrten Peters nun ebenfalls wie vor Grauen gebannt an. Und dann wandte auch Braile den Kopf und blickte genauso hinter sich, wie ich es getan hatte.
Plötzlich schien Peters sich unserer Gegenwart bewusst zu werden. Seine Augen betrachteten uns, streiften durch den ganzen Raum. Sie leuchteten vor dämonischer Freude wie der Ausdruck eines seit Langem aus seiner heißgeliebten Hölle verbannten Teufels, dem plötzlich die Rückkehr gestattet wird.
Vielleicht war es aber auch die unheilverkündende Lust eines Gesandten des Satans, dem erlaubt wurde, sich auf der Erde auszutoben?
Wohl weiß ich, wie fantastisch, wie unwissenschaftlich meine Vergleiche sind, aber anders vermag ich diese merkwürdige Veränderung nicht zu beschreiben.
Abrupt erlosch die höllische Freude, und der alte Ausdruck des Entsetzens und Grauens kehrte zurück. Unwillkürlich atmete ich erleichtert auf, denn es war, als hätte sich etwas abgrundtief Böses aus ihm zurückgezogen. Die Schwester zitterte am ganzen Körper, und Braile fragte mit heiserer Stimme: »Soll ich ihm eine Spritze geben?«
»Nein«, wehrte ich ab. »Ich möchte, dass Sie den weiteren Ablauf genau verfolgen, ohne dass er durch Drogen beeinflusst wird. Ich gehe jetzt zum Labor. Bitte lassen Sie kein Auge von ihm.«
Hoskins blickte vom Mikroskop hoch. »Nichts zu finden. Ich würde sogar sagen, der Bursche erfreut sich einer bemerkenswerten Gesundheit. Allerdings habe ich erst die Ergebnisse der einfacheren Tests.«
Ich nickte. Irgendwie hatte ich das bedrückende Gefühl, dass auch die anderen Ergebnisse negativ ausfallen würden. Ich war von der wechselnden höllischen Angst, dämonischen Erwartung und teuflischen Freude in Peters’ Zügen und Augen mehr erschüttert, als ich zugegeben hätte. Der ganze Fall beunruhigte mich und löste in mir das alptraumhafte Gefühl aus, vor einer Tür zu stehen, die ich unbedingt öffnen musste, aber ich hatte weder einen Schlüssel noch vermochte ich das Schlüsselloch zu finden. Des Öfteren habe ich schon festgestellt, dass mir die Konzentration am Mikroskop hilft, über meine Probleme ungestört nachzudenken. Ich ließ mir deshalb von Hoskins ein paar von Peters’ Abstrichen geben und begann sie zu studieren – nicht, weil ich etwas zu finden erwartete, sondern eben nur, um in Ruhe zu überlegen. Ich hatte mir gerade den vierten Objektträger vorgenommen, als mir plötzlich bewusst wurde, dass es das, was ich da sah, gar nicht geben konnte. In einem der weißen Korpuskeln glühte ein phosphoreszierender Funke wie eine winzige Lampe.
Zuerst dachte ich an einen Lichteffekt, aber wie ich den Objektträger auch drehte, der Funke blieb. Verwirrt rieb ich mir die Augen, dann bat ich Hoskins durch das Mikroskop zu blicken.
Auch er drehte und wandte das Glasplättchen. Ungläubig schüttelte er den Kopf. »Ein phosphoreszierender Punkt inmitten einer Leukozyte, der auch bei variiertem Licht stabil bleibt. Ansonsten scheint das Korpuskel normal zu sein.«
»Das Ganze ist völlig unmöglich«, stöhnte ich. Ich versuchte dieses Korpuskel zu isolieren, aber als ich es berührte, platzte es. Der Leuchtpunkt wurde flach, und etwas wie ein Miniaturblitz zuckte über den im Mikroskop sichtbaren Teil des Objektträgers – danach war die Phosphoreszenz verschwunden.
Wir nahmen uns einen Abstrich nach dem anderen vor. Nur noch zweimal entdeckten wir eines dieser winzigen Leuchtkörperchen, und auch diese beiden zerbarsten bei Berührung und sandten einen Blitz aus. Das war alles.
Das Labortelefon läutete. Hoskins nahm es ab. »Braile bittet Sie, sofort zu kommen.«
»Machen Sie weiter, Hoskins«, bat ich und rannte zu Peters’ Zimmer. Das Erste, das ich sah, war Schwester Walters, die mit kalkweißem Gesicht und geschlossenen Augen mit dem Rücken zum Bett stand. Braile hatte das Stethoskop auf Peters’ Brust angesetzt und horchte ihn ab. Ich warf einen Blick auf den Patienten und blieb wie gelähmt stehen. Eine fast panische Angst wollte mir das Herz zuschnüren. Wieder drückte sein Gesicht eine teuflische Erwartung aus, noch viel stärker als beim ersten Mal, die kurz darauf einer diabolischen Freude Platz machte, und auch sie war diesmal viel intensiver. Doch sie hielt nicht lange an. Teuflische Erwartung und diabolische Freude wechselten nun in schnellem Rhythmus. Sie flackerten über Peters’ Gesicht wie – wie das Phosphoreszieren in den Leukozyten.
»Sein Herz blieb vor drei Minuten stehen!«, presste Braile durch die Zähne hervor. »Er müsste tot sein, aber … sehen Sie nur!«
Peters’ Körper streckte und verkrampfte sich. Ein unheimlicher Laut kam von seinen Lippen – ein Kichern, leise zwar, aber durch Mark und Bein gehend – das höhnische Lachen eines Teufels. Der Wächter am Fenster sprang so heftig auf, dass sein Stuhl zu Boden krachte. Das Lachen erstickte und erstarb langsam. Peters’ Körper lag reglos.
Ich hörte das Öffnen der Tür. »Wie geht es ihm, Dr. Lowell?«, erkundigte sich Ricori. »Ich konnte nicht schlafen« Da sah er Peters’ Gesicht.
»Heilige Mutter Gottes!«, hörte ich ihn murmeln. Er sank auf die Knie. Ich sah ihn nur aus den Augenwinkeln, weil ich meinen Blick nicht von Peters abwenden konnte. Sein Gesicht war das eines triumphierend grinsenden Unholds – alles Menschliche war ausgelöscht –, das Gesicht eines aus der Hölle eines mittelalterlichen Malers entsprungenen Dämons. Seine nun absolut bösartig wirkenden blauen Augen starrten Ricori an.
Noch während ich ihn betrachtete, bewegten sich die toten Hände. Langsam bogen sich die Arme am Ellbogen, die Finger zogen sich zu Klauen zusammen. Der tote Körper rührte sich unter der Decke.
Erst jetzt fiel der unheimliche Bann von mir. Seit Stunden bewegte ich mich zum ersten Mal wieder auf vertrautem Boden. Es war die Totenstarre, rigor mortis, die mit einer Geschwindigkeit einsetzte, wie ich es nie erlebt hatte.
Ich zog schnell die Decke über die boshaft starrenden Augen. Dann blickte ich Ricori an. Er war immer noch auf den Knien, bekreuzigte sich und betete. Und neben ihm, einen Arm um seine Schultern, kniete Schwester Walters. Auch sie betete.
Die Kirchturmuhr schlug fünf.