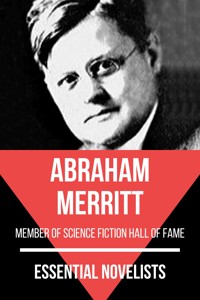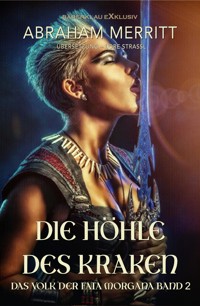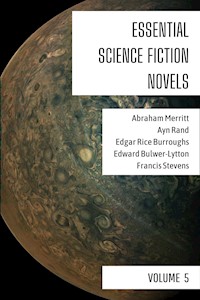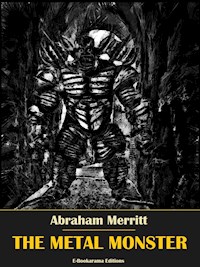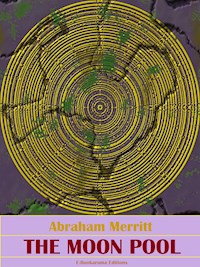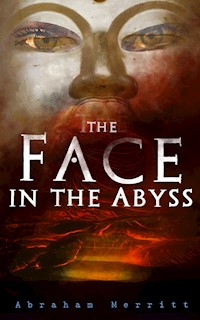3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Von der Hoffnung erfüllt, mithilfe einer seltsamen Landkarte einen Schatz der alten Inkas zu finden, macht sich Nicholas Graydon, ein Bergbauingenieur, zusammen mit drei Abenteurern auf den Weg in ein Gebiet der Kordilleren, das bisher noch kein Weißer betreten hat.
Habgier, Goldfieber und Hass machen die Expedition zu einem Fiasko. Nur Graydon überlebt – und er gelangt nach Yu-Atlanchi, dem verbotenen Land. Dort, unter Geschöpfen, die zeitlos sind und die den Tod nicht kennen, lernt Graydon, der Mann des 20. Jahrhunderts, die Wunder und Schrecken eines Volkes kennen, das viel älter als die Menschheit ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Abraham Merritt
Die Schlangenmutter
Fantasy Roman
Originaltitel: THE FACE IN THE ABYSS
Aus dem Amerikanischen von Lore Straßl
***
Impressum
Neuausgabe
Copyright dieser deutschen Ausgabe © by Übersetzer/Bärenklau Exklusiv
Cover: © Steve Mayer nach Motiven, 2023
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Die Schlangenmutter
1. Suarra
2. Die unsichtbaren Baeobachter
3. Das weiße Lama
4. Das fliehende Geschöpf
5. Die Elfenhörner
6. Das Gesicht am Abgrund
7. Die bewachte Grenze
8. Die Echsenmenschen
9. In Huons Bau
11. Das Volk ohne Tod
12. Die verborgene alte Stadt
13. Die Höhle der Froschfrau
14. Der Schatten der Echsenmaske
15. »Leih mir deinen Körper, Graydon!«
16. Die Höhle mit den bemalten Wänden
17. Überfall auf Huons Bau
18. Die Arena der Dinosaurier
19. Die Schlangenmutter
20. Die Weisheit der Schlangenmutter
21. Die Höhle des verlorenen Wissens
22. Das Fest der Träumer
23. Suarras Gefangennahme
24. Braut der Echsenmänner
25. Nimirs Halsband
26. Ragnarök in Yu-Atlanchi
27. Der Abschied der Schlangenmutter
Der Autor Abraham Merritt
Weitere Werke von Abraham Merritt,
Das Buch
Bärenklau Exklusiv präsentiert »Die Schlangenmutter«, eine Übersetzung aus dem Amerikanischen von Lore Sraßl.
Von der Hoffnung erfüllt mit Hilfe einer seltsamen Landkarte einen Schatz der alten Inkas zu finden, macht sich Nicholas Graydon, ein Bergbauingenieur, zusammen mit drei Abenteurern auf den Weg in ein Gebiet der Kordilleren, das bisher noch kein Weißer betreten hat. Habgier, Goldfieber und Hass machen die Expedition zu einem Fiasko. Nur Graydon überlebt – und er gelangt nach Yu-Atlanchi, dem verbotenen Land. Dort, unter Geschöpfen, die zeitlos sind und die den Tod nicht kennen, lernt Graydon, der Mann des 20. Jahrhunderts, die Wunder und Schrecken eines Volkes kennen, das viel älter als die Menschheit ist.
***
Die Schlangenmutter
1. Suarra
Nicholas Graydon begegnete Starrett in Quito. Das heißt, Starrett kam dort zu ihm. Graydon hatte schon viel von dem bekannten Abenteurer der Westküste gehört, aber bisher hatten ihre Pfade sich nie gekreuzt. Also öffnete er seinem Besucher mit unverhohlener Neugier die Tür.
Starrett kam sofort zur Sache. Graydon kannte doch sicher die Legende des Schatzzugs, der Pizarro das Lösegeld des Inkas Atahualpa hatte bringen sollen? Und hatte bestimmt gehört, dass die Beauftragten den Schatz irgendwo in der Wildnis der Anden versteckten, als sie vom Mord an ihrem Herrscher erfuhren?
Natürlich kannte Graydon die Legende und hatte sogar schon einmal in Betracht gezogen, den Schatz zu suchen.
Das sagte er auch. Starrett nickte. »Ich weiß, wo er ist«, behauptete er.
Graydon lachte. Doch schließlich überzeugte Graydon ihn, oder zumindest davon, dass er etwas wusste, was des Nachgehens wert wäre.
Graydon gefiel der große Mann. Er war von einer geraden Freimütigkeit, die ihn den Zug von Grausamkeit in Augen und Kinn des Abenteurers übersehen ließ. Er habe noch zwei Kameraden, die mitkommen würden, sagte Starrett.
Graydon fragte, wieso sie an ihn gedacht hatten. Starrett machte kein Hehl aus dem Grund. Weil er, Graydon, sagte er, sich die Kosten für die Expedition leisten konnte. Jeder der vier sollte einen gleichen Anteil des Schatzes bekommen. Falls sie ihn entgegen aller Erwartung nicht fanden, würden sie bestimmt auf wertvolle Bodenschätze stoßen, aus denen sich Geld machen ließe, schließlich war Graydon nicht umsonst erstklassiger Mineningenieur.
Graydon überlegte. Im Augenblick hatte er keine Verpflichtungen. Er war jetzt vierunddreißig, und seit er vor elf Jahren vom Institut für Bergbau der Universität Harvard promoviert war, hatte er sich nie einen Urlaub gegönnt. Die Auslagen konnte er sich leisten, damit hatte Starrett recht.
Außerdem würde das Ganze ein bisschen Aufregung in sein Leben bringen, wenn schon sonst nichts.
Nachdem er Starretts Kameraden in Augenschein genommen hatte – Soames, ein hagerer, finsterer Yankee, und Dancret, ein zynischer, unterhaltsamer Franzose –, hatten sie gemeinsam einen Vertrag aufgesetzt und unterschrieben.
Auf dem Schienenweg erreichten sie Cerro de Pasco, wo sie sich für die Expedition ausrüsteten, denn das war die letzte Stadt, durch die sie vor ihrem Aufbruch in die Wildnis kommen würden. Eine Woche später befanden sie sich mit acht Eseln und sechs arrieros, Packmännern, in den hohen Bergen, durch die nach Starretts Karte ihr Weg führte.
Die Karte hatte Graydon überzeugt. Sie war nicht aus Pergament, sondern aus einem dünnen Blatt Gold, das so geschmeidig wie Leder war. Starrett hatte sie aus einer kleinen Goldröhre gezogen – die, nach ihrer handwerklichen Arbeit zu schließen, uralt sein musste – und aufgerollt.
Graydon betrachtete sie, sah jedoch nichts weiter als ein dünnes leeres Blatt Gold. Erst als Starrett sie in einem ganz bestimmten Winkel hielt, wurden die Zeichen darauf sichtbar.
Es war eine bemerkenswerte Art von Kartographie. Tatsächlich war es weniger eine Karte, als ein Bild. Da und dort befanden sich seltsame Symbole, die, wie Starrett erklärte, unterwegs in die Felsen gehauen waren, um den Angehörigen der alten Rasse als Wegweiser zum Schatz zu dienen, sobald die Spanier aus dem Land vertrieben waren.
Ob die Karte nun tatsächlich ein Hinweis auf das Lösegeld für Atahualpa war oder etwas anderes, konnte Graydon natürlich nicht beurteilen. Starrett war sicher, dass die Karte zum Schatz führen würde. Graydon glaubte nicht, dass das goldene Blatt auf die Weise in seine Hand gelangt war, wie er es behauptete. Wie dem auch war, man hatte die Karte zu einem bestimmten Zweck hergestellt, und nach der Sorgfalt ihrer Ausarbeitung und der »Wegweiser« musste sie zumindest zu etwas Interessantem führen.
Sie fanden die in die Felsen gehauenen Zeichen genau wie auf dem Goldblatt dargestellt. In froher Erwartung folgten sie diesen Wegweisern, und Starrett, Soames und Dancret machten sich bereits jetzt Gedanken darüber, was sie mit ihrem Anteil tun würden. Und so kamen sie immer weiter in die Wildnis, die noch kein Kartograph erfasst hatte.
Schließlich steckten die arrieros die Köpfe zusammen.
Sie näherten sich einem Gebiet, sagten sie, in dem Dämonen hausten. Cordillera de Carabaya wurde es genannt. Versprechen, mehr Geld zu bezahlen, Drohungen und Bitten trugen dazu bei, dass sie noch ein Stück weiter mitkamen, aber eines Morgens waren die arrieros verschwunden und mit ihnen die Hälfte der Packesel und der größte Teil des Proviants.
Allein zogen die vier Weißen weiter. Dann ließen die Wegweiser sie im Stich. Entweder waren die vier vom Pfad abgekommen, oder die Karte, die bisher so genau gewesen war, hatte sie in die Irre geführt.
Sie hatten ein ungewöhnlich einsames Gebiet erreicht.
Seit sie vor etwa vierzehn Tagen in einem Quijo-Dorf haltgemacht hatten, wo Starrett sich mit dem selbstgebrannten Schnaps der Quijo einen furchtbaren Rausch angesoffen hatte, waren sie keinem Indianer mehr begegnet. Es war schwierig, in dieser Gegend etwas Essbares zu finden. Vierbeiner gab es nur wenige, und Vögel waren noch rarer.
Am Schlimmsten war der Stimmungsumschlag von Graydons Kameraden. So himmelhoch sie die Gewissheit ihres bevorstehenden Erfolgs hatte jauchzen lassen, so zutiefst niedergeschlagen waren sie jetzt. Starrett bemühte sich, überhaupt nicht mehr nüchtern zu werden, und war in seiner Betrunkenheit abwechselnd streitsüchtig laut und verbissen schweigsam.
Dancret wirkte gereizt und verkniffen. Soames war offenbar zu dem Ergebnis gekommen, dass die anderen drei sich gegen ihn verschworen hatten und absichtlich in die Irre gelaufen waren oder die Zeichen verwischt hatten. Nur wenn die beiden sich Starrett beim Saufen des Schnapses anschlossen, mit dem sie die Packesel beladen hatten, entspannten die drei sich ein wenig, doch dann hatte Graydon immer das beunruhigende Gefühl, dass sie ihn für ihr Versagen verantwortlich machten und sein Leben vielleicht an einem dünnen Faden hing.
Graydons großes Abenteuer begann jedoch erst wirklich, als er eines Tages von der Jagd zu ihrem Lager zurückkehrte. Dancret und Soames waren miteinander zu einer neuerlichen Suche nach den Markierungszeichen unterwegs.
Ein plötzlich abgewürgter Schrei eines Mädchens erschien Graydon wie die Antwort auf alle seine Befürchtungen, die Materialisierung der Drohung, die seine vagen Ängste erahnt hatten, seit er Starrett vor Stunden allein im Lager zurückgelassen hatte. Ja, er hatte gespürt, dass etwas sehr Unerfreuliches bevorstand – und da war es! Graydon begann zu laufen und stolperte den Hang zu der Gruppe graugrüner algarrobas hinauf, wo das Zelt aufgeschlagen war, und brach sich einen Weg durch das Unterholz zur Lichtung.
Warum schrie das Mädchen nicht mehr? Ein hässliches, raues Lachen drang an seine Ohren.
Halb zusammengekauert hatte Starrett das Mädchen über ein Knie gelegt. Ein Arm presste ihre Handgelenke zusammen, während er ihre Knie im Schraubstock seines abgewinkelten rechten Beines hielt.
Graydon packte ihn am Haar, legte ihm den Arm unter das Kinn, und zog ihm den Kopf scharf zurück.
»Lass sie los!«, befahl er.
»Was hast du dich einzumischen?«, knurrte Starrett. Eine Hand flog zu seiner Pistole. Graydon versetzte ihm einen Kinnhaken. Die halbgezogene Waffe fiel auf den Boden, und Starrett sackte zusammen.
Das Mädchen sprang auf und rannte davon.
Graydon schaute ihr nicht nach. Zweifellos holte sie ihre Leute – einen Stamm der wilden Aymarä, die selbst die alten Inkas nie hatten ganz unterwerfen können –, um sich auf eine Weise zu rächen, die Graydon sich lieber gar nicht erst ausmalte.
Er beugte sich über Starrett. Kinnhaken und Rausch würden dafür sorgen, dass der Bursche so schnell nicht zu sich kam.
Graydon hob die Pistole auf. Er wollte, Dancret und Soames würden möglichst bald zurückkommen. Zu dritt hatten sie eine größere Chance gegen die Indianer, oder vielleicht konnten sie sogar noch fliehen, ehe die Rächer kamen. Bestimmt berichtete ihnen das Mädchen gerade. Er drehte sich um …
Sie stand da und schaute ihn an.
Graydon sah nur noch sie und ihren Liebreiz. Er vergaß den Mann zu seinen Füßen, vergaß alles.
Ihre Haut war von hellstem Elfenbein. Sie schimmerte durch die Risse des weichen bernsteinfarbigen Stoffes, in den sie gehüllt war. Ihre Augen waren oval, ein ganz klein wenig schräg, nahezu ägyptisch mit den mitternachtsdunklen Pupillen, und die geraden, schwarzen Brauen darüber trafen sich fast über der Nasenwurzel. Ihre Nase war zierlich. Ein schmaler Goldreif über der hohen Stirn hielt ihr pechschwarzes Haar zusammen. In dem Goldreif steckten ineinander verschlungen eine schwarze und eine silberne Feder des caraquenque – jenes Vogels, der in alter Zeit als den Inkaprinzessinnen geweiht gegolten hatte.
Über ihren Ellbogen trug sie goldene Armbänder, die bis fast zu ihren Schultern reichten. Ihre Füße steckten in halbhohen Stiefeln aus weichem Wildleder.
Nein, das war keine Indianerin – keine Tochter der alten Inkas, aber auch spanischer Abstammung war sie nicht. Sie war von keiner Rasse, die er kannte.
Ihre Wangen wiesen die Abdrücke von Starretts groben Fingern auf. Ihre langen, schmalen Hände fuhren darüber.
Sie sprach – in der Zunge der Aymarä. »Ist er tot?«
»Nein«, erwiderte Graydon.
Tief in ihren Augen loderte eine heiße Flamme auf. Er hätte schwören können, dass es Freude war.
»Das ist gut. Ich wollte nicht, dass er stirbt …« Ihre Stimme klang überlegend. »Zumindest nicht – so.« Starrett stöhnte. Wieder berührte das Mädchen die Blutergüsse auf ihren Wangen. »Er ist sehr stark«, murmelte sie.
Graydon glaubte Bewunderung aus ihrem Flüstern zu hören, und er fragte sich, ob ihre Schönheit nur die Maske einer primitiven Frau war, die von der brutalen Kraft eines Mannes beeindruckt war.
»Wer bist du?«, fragte er.
Sie schaute ihn lange schweigend an, ehe sie antwortete: »Ich bin Suarra.«
»Aber woher kommst du? Was bist du?« Sie ging nicht auf seine Frage ein. »Bist du sein Feind?«, wollte sie stattdessen wissen.
»Nein«, erwiderte er. »Wir sind zusammen unterwegs.«
»Warum hast du ihn dann geschlagen? Weshalb hast du nicht zugelassen, dass er seinen Spaß mit mir hatte?« Graydon errötete. »Wofür hältst du mich?«, fuhr er auf.
»Kein Mann darf so etwas zulassen!«
Sie schaute ihn interessiert an. Ihre Miene wurde weicher.
Sie trat einen Schritt näher, und wieder strich sie über ihre Wangen. »Wunderst du dich nicht, dass ich nicht meine – Leute rief, um mit ihm zu verfahren, wie er es verdient hat?«
»Ich wundere mich wirklich«, gestand Graydon verwirrt.
»Warum rufst du sie nicht, wenn sie nahe genug sind, dass sie dich hören könnten?«
»Was würdest du tun, wenn sie kämen?«
»Ich würde nicht zulassen, dass sie ihn mitnehmen – lebend«, erwiderte Graydon. »Genauso wenig wie mich.«
»Vielleicht«, sagte sie bedächtig, »vielleicht rufe ich sie deshalb nicht.« Plötzlich lächelte sie ihn an.
Er machte einen Schritt auf sie zu. Sie hob warnend die Hand.
»Ich bin – Suarra«, sagte sie. »Und ich bringe den – Tod!« Ein Schauder überlief Graydon. Wieder wurde ihm ihre fremdartige Schönheit bewusst. Konnte tatsächlich etwas Wahres an den Legenden über die Kordilleren sein? Er hatte nie daran gezweifelt, dass die Angst der Indianer nicht aus der Luft gegriffen war, dass es einen Grund für den heimlichen Aufbruch der arrieros gab. War sie ein Geist – Eine Dämonin? Doch da kehrte die Vernunft zurück. Dieses Mädchen eine Dämonin! Er lachte.
»Lach nicht!«, sagte sie. »Der Tod, den ich meine, ist nicht von der Art, wie du ihn kennst, der du jenseits des hohen Randes unseres Verborgenen Landes zu Hause bist. Dein Körper lebt weiter – und doch ist es Tod und mehr als Tod, da er auf schreckliche Weise verändert ist. Und das, was deinen Körper bewohnt, was durch deine Lippen spricht, ist verändert – auf noch schrecklichere Weise! Ich möchte nicht, dass dieser Tod zu dir kommt.«
So seltsam auch ihre Worte waren, hörte Graydon sie kaum; ganz gewiss wurde er sich jedenfalls in diesem Moment ihrer Bedeutung nicht klar, dazu war er viel zu sehr in die Bewunderung ihrer Schönheit vertieft.
»Wie ihr an den Wächtern vorbeigekommen seid, weiß ich nicht, noch wie ihr so weit in dieses Verborgene Land gelangen konntet. Sag mir, weshalb seid ihr überhaupt hierhergekommen?«
»Wir folgten von weit her den Spuren eines großen Schatzes aus Gold und Edelsteinen, dem Schatz Atahualpas, des Inkas. Es gab Zeichen, die uns den Weg wiesen, und dann fanden wir die nächsten nicht mehr und mussten feststellen, dass wir uns verirrt hatten. Wir suchten immer weiter nach ihnen, und nun sind wir hier.«
»Von Atahualpa oder Inkas weiß ich nichts«, sagte das Mädchen. »Wer immer sie auch waren, hierher hätten sie nie kommen können. Und ihr Schatz, wie groß er auch sein mochte, würde uns nichts bedeuten – uns von Yu-Atlanchi, wo es Schätze wie Steine im See gibt. Er wäre für uns nicht mehr als ein weiteres Körnchen in einem Sandhaufen gewesen.« Sie hielt inne und fuhr nach einer Weile verwirrt fort, als äußere sie nur ihre Gedanken laut: »Aber weshalb die Wächter euch nicht sahen, kann ich einfach nicht verstehen … Die Mutter muss es erfahren … Ich muss schnell zu ihr …«
»Die Mutter?«, fragte Graydon.
»Die Schlangenmutter!« Sie schaute ihn an, während sie ein Armband an ihrem Handgelenk drehte. Graydon, der etwas näher kam, sah, dass sich an diesem Band eine kleine Scheibe befand, auf die in Basrelief eine Schlange mit Kopf, Busen und Armen einer Frau eingeprägt war. Sie lag zusammengerollt auf einer riesigen Schale, die von vier Tieren hochgehalten wurde. Die Gestalt dieser Tiere wurde ihm nicht gleich bewusst. Er interessierte sich im Augenblick nur für das zusammengerollte Wesen. Ganz nah betrachtete er es – noch näher. Und jetzt erst erkannte er, dass der Kopf nicht wirklich der einer Frau war. Nein! Er war der eines Reptils.
Er war schlangengleich, doch der Künstler hatte ihm so stark den Ausdruck der Weiblichkeit verliehen, dass man ihn als den einer Frau sehen musste, und alles, was Schlange war, vergaß.
Die Augen waren aus einem intensiv glitzernden, purpurfarbigen Stein. Graydon hatte das Gefühl, dass diese Augen lebten, dass irgendwo, weit, weit entfernt jemand ihn durch sie musterte.
Das Mädchen tupfte auf eines der Tiere, die die Schale hielten. »Die Xinli«, sagte sie.
Graydons Verwirrung wuchs. Er wusste, was diese Tiere waren, und weil er es wusste, wurde ihm klar, dass er auf etwas Unglaubliches blickte.
Es waren Dinosaurier, wie sie vor Jahrmillionen über die Erde gestapft waren, und ohne deren Aussterben – so hatte man es ihn gelehrt – der Mensch sich nicht hätte entwickeln können.
Wer in dieser Wildnis der Anden konnte die Dinosaurier kennen oder gekannt haben? Wer war dazu imstande gewesen, diese Ungeheuer in solcher Eindringlichkeit und Lebensechtheit darzustellen?
Wer war dieses Volk, zu dem das Mädchen gehörte? Wie hatte sie gesagt? Yu-Atlanchi?
»Suarra, wo ist Yu-Atlanchi?«, fragte er. »Ist das hier Yu-Atlanchi?«
»Das hier?« Sie lachte. »Nein, Yu-Atlanchi ist das Alte Land! Das Verborgene Land, wo dereinst die sechs Lords, die Lords der Lords regierten, und wo jetzt nur die Schlangenmutter herrscht – und noch jemand.« Wieder lachte sie.
»Nein, hier ist es nicht. Ich jage hier nur hin und wieder mit – mit …« Sie zögerte und widmete ihm einen seltsamen Blick.
»So kam es, dass er mich gefangen nahm. Ich jagte. Ich hatte mich von den – anderen heimlich getrennt, denn manchmal jage ich lieber allein. Ich kam durch diese Bäume und sah euer tetuane, und da stand der Mann plötzlich vor mir. Ich war so verwundert, dass ich gar nicht daran dachte, damit zuzustoßen …« Sie deutete auf einen niedrigen Hügel, nur ein paar Schritt entfernt. »Ehe ich meine Verwirrung überwand, hatte er mich schon überwältigt. Dann kamst du.« Graydon schaute nach, worauf sie gedeutet hatte. Auf dem Boden lagen drei glänzende Speere. Ihre schlanken Schäfte waren aus Gold, die Spitzen von Zweien aus feinem Opal. Die Spitze des dritten – war aus einem makellosen Smaragd, gut fünfzehn Zentimeter lang und an seiner weitesten Stelle fünf breit, zur schärfsten Schneide geschliffen.
Plötzliche Panik erfüllte Graydon. Er hatte Soames und Dancret vergessen. Angenommen, sie kehrten zurück, während das Mädchen noch hier war, dieses Mädchen mit ihrem Goldschmuck, den goldenen Speeren mit den Juwelenspitzen – und ihrer Schönheit!
»Suarra«, sagte er drängend. »Du musst weg von hier, schnell! Der Mann dort und ich sind nicht allein, wir haben noch zwei Begleiter. Sie sind vielleicht schon ganz nah.
Nimm deine Speere und lauf fort. Ich weiß nicht, ob ich dich retten könnte, wenn …«
»Du glaubst, ich bin …«
»Ich bitte dich, zu gehen«, unterbrach er sie. »Wer immer und was immer du bist, geh jetzt und komm nicht so schnell wieder hierher. Ich werde versuchen, sie morgen von hier wegzuführen. Wenn du Leute hast, die für dich kämpfen – nun, lass sie kommen, falls das dein Wunsch ist. Aber bitte nimm jetzt deine Speere und bring dich in Sicherheit!« Sie trat an den niedrigen Hügel und hob ihre Jagdwaffen auf. Einen Speer streckte sie Graydon entgegen, den mit der Smaragdspitze.
»Nimm ihn«, bat sie. »Als Andenken an Suarra.«
»Nein«, wehrte er ab. »Bitte geh!« Wenn die anderen dieses unbezahlbare Juwel sehen, würde er sie nie dazu bringen können, den Rückweg anzutreten – falls sie ihn fanden.
Das Mädchen musterte ihn mit noch größerem Interesse.
Sie schlüpfte aus den Armbändern und streckte sie ihm mit den Speeren entgegen. »Nimmst du sie – und verlässt deine Kameraden?«, fragte sie. »Hier hast du Gold und Edelsteine – das hast du doch gesucht, nicht wahr? Nimm sie und lass diesen Mann hier, dann zeige ich dir einen Weg aus diesem Verborgenen Land.«
Graydon zögerte. Der Smaragd allein war schon ein Vermögen wert. Er schuldete den anderen nichts, und Starrett hatte es sich selbst zuzuschreiben. Aber trotzdem – sie waren seine Kameraden. Er sah sich mit diesem Reichtum in die Sicherheit schleichen und die drei anderen ihrem ungewissen Schicksal überlassen. Das Bild gefiel ihm nicht.
»Nein«, antwortete er. »Sie sind meine Kameraden. Was immer uns auch bevorsteht, ich werde es mit ihnen tragen.«
»Und doch hättest du um meinetwillen gegen sie gekämpft – hast es sogar getan. Weshalb bleibst du ihretwegen, wo du doch frei und reich sein könntest? Und wenn du schon glaubst, bleiben zu müssen, warum lässt du dann mich gehen, obgleich du weißt, dass ich meine – Leute auf euch hetzen kann?«
Graydon lachte. »Ich könnte natürlich nicht zulassen, dass sie dir etwas antun. Gehen lasse ich dich, weil ich vielleicht nicht imstande wäre, dich gegen sie zu schützen. Und ich laufe nicht davon. Also sprechen wir nicht mehr darüber. Doch bitte, geh jetzt – geh!«
Sie stieß die glitzernden Speere in den Boden und streifte sich die Armbänder wieder über. »Bei der Weisheit der Mutter werde ich dich retten – wenn ich es vermag«, flüsterte sie.
Aus der Ferne erklang weicher Hörnerschall in seltsamem Rhythmus. »Meine Begleiter kommen«, sagte Suarra. »Zünde heut Nacht ein Feuer an und schlafe ohne Furcht, doch verlasse den Schutz dieser Bäume nicht. Und verhalte dich jetzt ruhig, bis ich fort bin.«
Der sanfte Hörnerschall klang nun näher. Sie sprang von seiner Seite und huschte durch die Bäume. Er hörte ihre Stimme und gleich darauf einen erschreckenden Vielklang der Hörner. Dann Schweigen. Graydon lauschte. Er wagte kaum zu atmen. Und schon klangen die Hörner entfernter, süß und elfenhaft.
Die Sonne ließ die Ränder der schneeigen Gipfel, hinter denen sie unterging, wie eine brillantenbesetzte Borte auf glitzern, bis die Dämmerung sich auf die Berge herabsenkte und auch die algarrobas einhüllte.
Erst jetzt wurde Graydon mit plötzlichem Schauder bewusst, dass außer dem Hörnerklang und der Stimme des Mädchens keinerlei andere Geräusche zu vernehmen gewesen waren, weder von Menschen noch Tieren.
2. Die unsichtbaren Baeobachter
Die Betäubung Starretts durch den Kinnhaken war in die Benebeltheit des Rausches übergegangen. Graydon zerrte den Riesen zum Zelt und warf ihm eine Decke über, ehe er Feuer machte. Soames und Dancret kamen gerade aus dem Unterholz.
»Habt ihr die Markierungen gefunden?«, fragte er sie.
»Nein, zum Teufel«, knurrte der Yankee. »Sag, Graydon, hast du die Hörner gehört? Verdammt seltsamer Klang!« Graydon nickte. Er würde den Männern berichten müssen, was geschehen war, damit sie sich auf eine Verteidigung vorbereiten konnten. Aber wie viel durfte er ihnen sagen? Besser nichts von Suarras Schönheit, den goldenen Speeren und den Schätzen, verglichen mit denen Atahualpas Schatz kaum von Bedeutung war, wenn man dem Mädchen glauben durfte, denn sonst würden sie vor Habgier den Verstand verlieren.
Dancret kam aus dem Zelt gestürzt. »He, was ist mit Starrett passiert?«, rief er. »Zuerst hielt ich ihn nur für besoffen, doch dann sah ich, dass er zerkratzt ist wie von einer Wildkatze und eine orangengroße Beule am Kinn hat.«
»Dancret«, sagte Graydon. »Soames – wir sitzen in der Tinte. Vor etwa einer Stunde kam ich von der Jagd zurück und sah Starrett mit einem Mädchen raufen. Das ist böse Medizin hier – dass wisst ihr zwei ja auch. Ich musste Starrett k. o. schlagen, um dem Mädchen zu helfen. Ihre Leute werden vermutlich gegen Morgen hier sein. Es wäre sinnlos, die Flucht ergreifen zu wollen. Wir kennen uns in der Wildnis nicht aus. Also ist es das Beste, hierzubleiben und uns auf eine Verteidigung einzustellen.«
»Ein Mädchen, eh?«, sagte Dancret. »Wie sieht sie aus? Woher kommt sie? Wie ist sie wieder fort?« Graydon beantwortete die letzte Frage. »Ich ließ sie laufen.«
»Du hast sie einfach laufen lassen!«, brauste Soames auf.
»Warum hast du sie nicht als Geisel hierbehalten, dann hätten wir wenigstens eine Verhandlungsbasis gehabt, wenn die verdammten Indianer kommen.«
»Sie war keine Indianerin, Soames«, sagte Graydon stockend.
»Eine Spanierin?«, warf Dancret ungläubig ein.
»Nein, auch nicht. Sie war weiß wie wir. Aber was sie war, weiß ich nicht.«
Die beiden starrten ihn, dann einander an. »Klingt verdammt komisch«, brummte Soames. »Aber ich möchte jetzt wissen, warum du sie hast gehen lassen – was immer sie auch war.«
»Weil ich dachte, dass wir dadurch eine bessere Chance haben!« Ärger stieg in Graydon auf. »Ich sage euch, wir stehen hier etwas gegenüber, von dem wir nicht das Geringste wissen. Und wir haben nur eine einzige Chance, mit heiler Haut davonzukommen, und das ist durch sie.« Dancret bückte sich und hob etwas vom Boden auf.
»Schau dir das an, Soames!« Er streckte ihm ein goldenes Armband entgegen, in dem Smaragde glitzerten. Offenbar war es Suarra bei ihrem Kampf mit Starrett vom Arm gerissen worden.
»Was hat das Mädchen dir gegeben, dass du sie hast laufen lassen? Eh, Graydon? Was hat sie dir gesagt?« Soames Hand legte sich um seine Automatik.
»Sie hat mir nichts gegeben. Ich nahm nichts«, antwortete Graydon.
»Ich glaub’, du bist ein ganz verdammter Lügner!«, sagte Dancret heftig. »Wir wecken Starrett auf.« Er drehte sich zu Soames um. »Ich glaub’, er wird uns mehr sagen, oui. Ein Mädchen, das Zeug wie das da trägt – und er lässt sie laufen!
Aber erst, nachdem er von ihr erfahren hat, wo noch mehr davon zu holen ist!«
Graydon sah ihnen nach, als sie ins Zelt stapften. Sollte Starrett ihnen doch sagen, was er wusste. Heute Nacht würden sie ihn sicher nicht töten, weil sie dachten, von ihm vielleicht noch etwas erfahren zu können. Und wer wusste schon, was der Morgen bringen würde?
Graydon zweifelte nicht daran, dass sie schon jetzt, in diesem Augenblick Gefangene waren. Suarras Warnung, das Lager nicht zu verlassen, war eindeutig gewesen. Seit dem gespenstischen Hörnerschall bezweifelte er nicht mehr, dass sie sich in den Bereich einer Macht verirrt hatten, die so ungeheuerlich wie geheimnisvoll war.
Das Schweigen? Auch jetzt waren keinerlei Geräusche zu hören, wie sie in einem nächtlichen Wald üblich waren. Eine unnatürliche Stille hüllte ihr Lager ein.
Er schritt durch die algarrobas. Es waren etwa zwanzig, die wie eine kleine, belaubte Inselkuppe aus der buschbewachsenen Savanne herausragten. Jeder einzelne Baum war ein Riese, in so exaktem Abstand vom nächsten, als hätte nicht die Natur sie so wachsen lassen, sondern als wären sie sorgfältig gepflanzt worden.
Graydon erreichte den letzten. Er drückte die Hand auf seinen Stamm und schaute hinaus. Der Hang vor ihm war in Mondschein getaucht und die gelben Blüten der chiica-Büsche, die sich bis zu den Bäumen drängten, leuchteten in der Silberflut. Doch nirgends war eine Spur von tierischem Leben.
Und doch – er spürte, dass er nicht allein war. Er fühlte Blicke auf sich und wusste, dass das Lager von versteckten Beobachtern umzingelt war. Sein scharfer Blick wanderte von Busch zu Busch – aber es war nichts zu sehen. Trotzdem fühlte er, dass er nicht aus den Augen gelassen wurde.
Es reizte ihn. Er würde sie – wer oder was immer sie waren – zwingen, sich zu zeigen.
Furchtlos trat er hinaus in den hellen Mondschein.
Sofort vertiefte sich die Stille. Sie schien erwartungsvoll, gespannt zu werden, wie ein zum Sprung bereites Raubtier.
Eine plötzliche Kälte war um ihn. Er erschauderte und zog sich hastig in die Schatten der Bäume zurück, wo er mit heftig pochendem Herzen stehenblieb. Es war, als zöge sich auch die Stille wieder abwartend zurück.
Was hatte ihn nur so verängstigt? Was war in der Spannung der Stille gewesen, das ihn mit den eisigen Fingern der Furcht berührt hatte? Er wagte es nicht, dem schrecklichen Schweigen den Rücken zuzuwenden und so kehrte er vorsichtigen Schrittes, rückwärtsgehend zum Feuer zurück. Und kaum befand er sich in seiner Nähe, fiel die Angst von ihm ab, und er lachte laut in seiner Erleichterung.
Soames, der um Wasser zu holen aus dem Zelt trat, hörte ihn. »Lach nur«, sagte er, »solange du es noch kannst. Wenn wir Starrett erst wachbekommen haben, hast du vielleicht nichts mehr zu lachen!«
»Ich habe ihm wohl zu einem ziemlich tiefen Schlaf verholfen?«, spottete Graydon.
»Es gibt einen noch tieferen. Vergiss das nicht!«, rief Dancret mit kalter Drohung aus dem Zelt.
Graydon drehte dem Zelt den Rücken zu und schaute mit voller Absicht hinein in das Schweigen, von dem er eben geflohen war. Er setzte sich in die Nähe des Feuers und nickte nach einer Weile ein.
Abrupt erwachte er und schaute hoch. Starrett stürmte wie ein wildgewordener Stier brüllend auf ihn zu. Er sprang hoch, doch ehe er dazu kam, sich zu verteidigen, hatte der andere ihn mit seinem Gewicht wieder zu Boden geworfen.
Der kräftige Abenteurer stieß ihm ein Knie in die Armbeuge und packte ihn an der Kehle.
»Laufen lassen hast du sie!«, donnerte er. »Mich k. o. geschlagen und sie laufen lassen! Das werd’ ich dir heimzahlen!«
Graydon versuchte verzweifelt, die Hände um seinen Hals zu lösen. Er bekam kaum noch Luft. In seinen Ohren dröhnte es, und rote Punkte tanzten vor seinen Augen.
Durch dichte Schleier hindurch sah er zwei schwarze Schatten am Feuer vorbeispringen und spürte, wie man ihn aus dem Würgegriff befreite.
Graydon taumelte hoch. Starrett stand ein Dutzend Schritt entfernt. Dancret hatte die Arme um den viel Größeren geklammert und hing wie ein Terrier an ihm, während Soames Starrett die Pistole in den Bauch drückte.
»Warum lasst ihr mich ihn nicht umbringen!«, tobte Starrett. »Hab’ ich euch nicht gesagt, dass das Mädchen genug Klunkern trug, um uns alle zu reichen Männern zu machen? Und es gibt noch mehr dort, von woher sie kommt. Da lässt er sie gehen! Lässt sie gehen, dieser …«
»Verdammt, sei endlich vernünftig, oder ich muss dich fertigmachen!«, drohte Soames. »Dancret und ich wollen uns die Chance nicht entgehen lassen. Wir sind da auf etwas Großes gestoßen, und wir haben nicht die Absicht, mit leeren Händen zurückzukehren. Wir werden uns jetzt alle friedlich zusammensetzen, und Graydon wird uns erzählen, was geschehen ist, nachdem er dich k. o. geschlagen hat, und was er mit dem Mädchen gemacht hat. Wenn er es uns nicht freiwillig verraten will, haben wir allerhand mit ihm vor, dass er noch gern mit der Sprache herausrücken wird. Von jetzt an bin ich der Boss hier – ich und Dane. Kapiert, Starrett?«
Graydons Hand glitt verstohlen zur Halfter. Sie war leer.
Soames grinste höhnisch. »Wir haben sie, Graydon. Und Starretts ebenfalls. So und jetzt setzt euch.« Er ließ sich neben das Feuer fallen, richtete jedoch weiter die Pistole auf Starrett, der sich schließlich brummend ebenfalls setzte.
Dancret tat es ihnen gleich.
»Komm her, Graydon!«, befahl Soames. »Spuck es aus! Was hast du uns verheimlicht? Hast du mit ihr ausgemacht, dass du sie triffst, nachdem du uns los bist? Wo habt ihr euer Stelldichein? Los, ’raus mit der Sprache! Wir werden dich nämlich dorthin begleiten!«
»Wo hast du die goldenen Speere versteckt?«, knurrte Starrett. »Ganz bestimmt hast du sie sie nicht mitnehmen lassen!«
»Halt’s Maul, Starrett«, sagte Soames grob. »Ich stelle hier die Fragen! Also, Graydon, wie ist es? Hat sie dir den Schmuck und die Speere gegeben, damit du sie gehen lässt?«
»Ich habe es euch gesagt«, antwortete Graydon. »Ich bat um nichts und nahm nichts. Starretts Unüberlegtheit in seinem Suff hat uns alle in größte Gefahr gebracht. Das Mädchen gehen zu lassen, war der erste lebenswichtige Schritt für unsere eigene Sicherheit. Ich hielt es für das einzig Richtige, und das tue ich auch jetzt noch.«
»O ja?«, höhnte der hagere Yankee. »Wenn sie eine Indianerin gewesen wäre, müsste ich dir vielleicht recht geben.
Aber nicht, wenn sie etwas Besseres war, wie Starrett behauptet. Steckte nichts dahinter, hättest du sie zumindest solange festgehalten, bis Dane und ich zurück waren. Dann hätten wir uns zusammensetzen und gemeinsam überlegen können, was das Beste wäre: sie gefangen zu halten, bis ihre Leute Lösegeld für sie blechten, oder ihr gehörig mitzuspielen, bis sie damit herausrückte, woher das Gold und die Klunkern kamen. Ja, das hättest du getan, Graydon, wenn du nicht ein verdammt falscher Hund wärst.«
Graydon platzte der Kragen. »Was ich gesagt habe, ist wahr. Ich gab sie unserer Sicherheit wegen frei. Aber davon abgesehen hätte ich eher ein Kind einer Meute Hyänen anvertraut, als das Mädchen euch dreien. Ich ließ sie mehr noch um ihrer Sicherheit willen gehen als um unsere. Bist du jetzt zufrieden?«
»Aha!«, höhnte Dancret. »Jetzt verstehe ich. Hier ist diese seltsame Dame von großer Schönheit und noch größerem Reichtum. Sie ist zu rein und fein, als dass wir sie auch nur bewundern dürften. Das sagt er ihr und rät ihr, schnell zu fliehen. ›Mein Held!‹, sagt sie. ›Nimm alles, was mein, und verlasse diese schlechten Männer.‹ ›Nein, nein‹, wehrt er ab, weil er denkt, wenn er seine Karten richtig ausspielt und uns aus dem Weg schafft, bekommt er viel mehr und braucht nicht zu teilen. Also sagt er: ›Nein, nein. Doch solange diese bösen Männer hier sind, wirst du nicht sicher sein.‹ ›Mein Held‹, sagte sie, ›ich werde meine Familie holen, und sie wird dich von dieser schlechten Gesellschaft erlösen. Du aber wirst deine Belohnung bekommen, mein Held!‹ Qui, so war es sicher.«
Graydon errötete. Die boshafte Darstellung des Franzosen war der Wahrheit ziemlich nahegekommen. Selbst wenn er ihnen versicherte, dass er ihr gesagt hatte, er würde das Schicksal seiner Kameraden teilen, würden sie ihm nicht glauben.
Soames hatte ihn aufmerksam beobachtet. »Bei Gott, Dane«, brummte Soames. »Ich glaub’, du hast ins Schwarze getroffen. Er hat uns verraten!« Er hob die Automatik und richtete sie auf Graydon. Doch dann senkte er sie. »Nein!«, sagte er entschlossen. »Die Sache ist zu groß, als dass wir sie uns durch einen voreiligen Schuss entgehen lassen dürften.
Wenn deine Vermutung also stimmt, Dane, dürfte die Dame sehr dankbar sein. Wir haben zwar nicht sie, wohl aber ihn.
Und weil sie ihm dankbar ist, wird sie nicht wollen, dass ihm etwas zustößt. Sie wird zurückkommen. Dann handeln wir ihn für das ein, was sie hat und wir wollen. Verschnür ihn schön!«
Er richtete die Pistole wieder auf Graydon. Der wehrte sich nicht, als Starrett und Dancret ihm die Hände fesselten und ihn dann sitzend mit dem Rücken an einen Baumstamm banden.
»Wenn ihre Bande am Morgen auftaucht, werden wir ja sehen, wie viel du ihr wert bist«, sagte Soames. »Überfallen werden sie uns sicher nicht, und es wird bestimmt zum Palaver kommen. Können wir uns nicht einigen, na, dann wird die erste Kugel eben deine Gedärme ein bisschen aufwühlen, Graydon. Da hast du wohl genug Zeit, mitanzusehen, was wir mit ihr machen, ehe du stirbst.«
Graydon schwieg. Nichts, was er sagen könnte, würde sie von ihrem Vorhaben abbringen. Er machte es sich so bequem es eben in seiner Lage ging und schloss die Augen. Als er ein paarmal aus seinem unruhigen Schlaf hochschreckte, saßen die drei immer noch am Feuer, steckten die Köpfe zusammen und flüsterten, und ihre Augen glänzten fiebrig in ihrer Gier nach Gold und Edelsteinen.
3. Das weiße Lama
Der Morgen graute, als Graydon erwachte. Jemand hatte ihm während der Nacht eine Decke übergeworfen, aber er war trotzdem durchfroren und steif. Schmerzvoll bewegte er die Beine, um das Blut zum Zirkulieren zu bringen. Er hörte, wie die anderen sich im Zelt rührten, und fragte sich, wer wohl an die Decke gedacht hatte und was ihn zu dieser menschenfreundlichen Tat bewogen hatte.
Starrett kam aus dem Zelt. Wortlos ging er an ihm vorbei zur Quelle. Als er zurückkehrte, beschäftigte er sich mit dem Feuer. Hin und wieder warf er einen Blick auf den Gefangenen, doch ohne Ärger oder Hass. Schließlich schlich er zum Zelt und lauschte, dann kam er zu Graydon.
»Tut mir leid«, murmelte er. »Aber Soames und Daueret lassen sich nichts sagen. Hatte meine Mühe, sie zu überzeugen, dass du eine Decke brauchst. Komm, trink einen Schluck.« Er drückte Graydon eine Flasche an die Lippen.
Der Alkohol wärmte ihn auf.
»Psst«, warnte ihn Starrett. »Ich trag’ dir nichts nach, war viel zu besoffen gestern. Ich helf’ dir, wenn …« Er hielt abrupt inne, dann wandte er sich hastig dem brennenden Feuer zu und legte Äste nach. Soames kam aus dem Zelt.
»Ich geb’ dir eine letzte Chance, Graydon«, sagte er.
»Rück ehrlich heraus, was du mit dem Mädchen ausgemacht hast, dann nehmen wir dich mit uns zurück. Wir arbeiten zusammen und teilen alles. Du hast uns ganz schön kribbelig gemacht, gestern. Na ja, ich kann es dir nicht mal übelnehmen. Aber wir sind drei gegen dich, und du kannst uns nicht hereinlegen. Also, sei vernünftig.«
»Was hat es denn für einen Sinn, das Ganze nochmal durchzukauen, Soames«, murmelte Graydon müde. »Ich habe euch alles gesagt. Wenn ihr klug seid, dann bindet ihr mich jetzt los, gebt mir meine Waffen, und ich kämpfe mit euch, wenn es zu Schwierigkeiten kommt.«
»Ah, du willst uns wohl Angst machen? Ich kenne einen hübschen kleinen Trick mit Keilen, die man unter die Fingernägel klemmt und dann immer weiter eindrückt. Das hat noch so gut wie jeden zum Singen gebracht. Falls das aber bei dir nicht helfen sollte, stecken wir deine Zehen ins Feuer, immer ein bisschen weiter.« Plötzlich beugte er sich über Graydon und roch an seinen Lippen.
»So ist das!« Er wirbelte zu Starrett herum und richtete die Pistole auf ihn. »Hast ihm Schnaps gegeben, eh? Mit ihm geredet! Und das, obwohl wir ausgemacht hatten, dass das mir überlassen bleibt! Das reicht! Dancret, komm her!«, brüllte er. »Schnell!«
Der Franzose stürzte aus dem Zelt.
»Verschnür ihn!« Soames deutete mit dem Kopf auf Starrett. »Noch so ein verdammter Verräter im Lager. Hat ihm Schnaps gegeben. Steckten die Köpfe zusammen, während wir drin waren.«
»Aber, Soames«, protestierte Dancret. »Falls wir kämpfen müssen, ist es nicht gut, wenn die Hälfte hilflos ist, non. Vielleicht hat Starrett gar nicht …«
»Wenn wir kämpfen müssen, leisten zwei so viel wie drei. Ich hab’ nicht die Absicht, mir die Sache durch die Finger schlüpfen zu lassen, Dane. Ich glaub’ auch nicht, dass es zum Kampf kommen wird. Wenn sie auftauchen, wird es ein Tauschhandel.
Starrett hat uns hintergangen, also bind ihn schon!«
»Ich finde es nicht rich…«, begann Dancret, aber Soames Pistole ließ ihn zum Zelt laufen und mit einem Strick zurückkehren.
»Nimm die Hände hoch!«, befahl Soames. Starrett riss sie nach oben, doch mitten im Schwung schlossen sie sich um Dancret und hoben ihn wie eine Puppe zwischen sich und den Yankee.
»Jetzt schieß, verdammt!«, brüllte er und kam auf Soames zu, mit Dancret wie einen Schild vor sich. Gleichzeitig zog er die Pistole aus dem Gürtel des Franzosen und richtete sie über die Schulter des sich Wehrenden auf Soames.
»Lass die Waffe fallen, Yankee«, befahl Starrett triumphierend. »Oder drücke ruhig ab, wenn du willst, aber ehe deine Kugel Dancret halb durchschlagen hat, mach’ ich ein Sieb aus dir!«
Einen Augenblick herrschte unheildrohendes Schweigen, das plötzlich vom Klingeln goldener Glöckchen gebrochen wurde. Ihr helles Läuten löste die finstere Wolke über dem Lager auf wie Sonnenschein.
Soames ließ die Pistole fallen. Starretts eiserner Griff um Dancret lockerte sich.
Keine hundert Meter entfernt schritt Suarra durch die Bäume. Ein grüner Umhang umhüllte das Mädchen vom Hals bis fast zu den Füßen. Eine Smaragdschnur schmückte ihr Haar, mit Smaragden besetzte Goldreifen klingelten an ihren Armen und Beinen. Hinter ihr her stapfte gemächlich ein schneeweißes Lama. Es trug ein goldenes Halsband, von dem mehrere Stränge goldener Glocken baumelten, während von seinem Rücken zu beiden Seiten Körbe hingen, die aus goldfarbigen Binsen geflochten waren.
Sie hatte keinen Kriegertrupp bei sich, weder Rächer noch Henker hatte sie mitgebracht. Ein einziger Begleiter schritt neben dem Lama her. Die Kapuze seines wallenden rot-gelben gescheckten Gewandes verbarg sein Gesicht. Als Waffe, wenn es eine war, trug er lediglich einen langen roten Stab. Er ging gebückt und tänzelte und flatterte mit kleinen Schritten vor und zurück, so dass es den Anschein erweckte, sein dichtes Gewand verhülle eher einen riesigen Vogel als einen Menschen. Als sie näher heran waren, fiel Graydon auf, dass die Hand, die den Stab hielt, dünn und durchsichtig war, was hohes Alter verriet.
Er stemmte sich gegen seine Bande. Sein Herz verkrampfte sich. Weshalb war sie zurückgekommen – auf diese Weise? Ohne Bewaffnete, die sie beschützen konnten, nur mit diesem einen greisen Begleiter. Und so mit Schmuck beladen! Er hatte sie gewarnt, sie musste doch jetzt wissen, welche Gefahren ihr drohten. Es sah fast so aus, als täte sie es mit Absicht – um die Begierden jener anzustacheln, von denen sie am meisten zu befürchten hatte.
»Diable«, wisperte Dancret. »Die Smaragde!«
»Gott! Was für ein Mädchen«, murmelte Starrett bewundernd.
Soames sagte keinen Ton. Verwirrung und Argwohn lösten das Staunen ab, mit dem er dem Mädchen zuerst entgegengeschaut hatte. Er schwieg auch noch, als Suarra und ihr Begleiter dicht neben ihm anhielten. Aber das Misstrauen in seinen Augen wuchs, und sein Blick versuchte, jeden Baum und jeden Busch entlang des Pfades zu durchdringen, den sie gekommen waren.
»Suarra!«, rief Graydon voll Verzweiflung. »Weshalb bist du zurückgekommen?«
Sie trat neben ihn, zog einen Dolch aus ihrem Umhang und befreite ihn von seinen Banden. Er taumelte auf die Beine.
»War es nicht gut für dich, dass ich kam?«, fragte sie mit süßer Stimme.
Ehe er antworten konnte, kam Soames herbei. Er verbeugte sich spöttisch vor dem Mädchen, dann wandte er sich an Graydon: »Also gut, du kannst frei bleiben – solange du tust, was ich sage. Das Mädchen ist zurück, das ist die Hauptsache. Sie scheint einen Narren an dir gefressen zu haben, Graydon. Damit dürften wir einen Weg gefunden haben, sie zu überreden, unsere Fragen zu beantworten. Ja, und du bist ganz offensichtlich in sie verschossen. Auch das hilft uns. Ich nehme an, du legst keinen Wert darauf, gefesselt zu sein und hilflos zuzusehen, wenn – eh – bestimmte Dinge mit ihr passieren. Aber du brauchst nur eines tun, wenn du willst, dass alles ruhig und friedlich verläuft. Rede nicht mit ihr, wenn ich nicht dabei bin!« Er drehte sich zu Suarra um. »Dein Besuch, schönes Kind«, sagte er in der Sprache der Aymarä, »bringt uns große Freude. Er wird nicht kurz sein, wenn es nach uns geht – und ich glaube, es wird nach uns gehen …« Eine versteckte Drohung sprach aus seinen Worten. Falls sie sie bemerkte, ließ sie es sich nicht anmerken. »Du bist uns fremd, so wie wir es dir sein müssen. Es gibt viel, das wir voneinander lernen können.«
»Das stimmt«, sagte sie ruhig. »Ich glaube nur, dass euer Wunsch von mir zu lernen, größer ist, als meiner, von euch, da ich, wie du sicher weißt, bereits eine nicht sehr angenehme Unterrichtsstunde hinter mir habe.« Sie schaute bedeutungsvoll auf Starrett.
»Ob der Unterricht angenehm oder unangenehm sein wird, liegt ganz bei dir«, versicherte ihr Soames.
Diesmal war die Drohung unüberhörbar, und Suarra überging sie auch nicht. Ihre Augen funkelten gefährlich.
»Versuche nicht, mir zu drohen!«, warnte sie Soames. »Ich, Suarra, bin Drohungen nicht gewöhnt. Zu deinem eigenen Besten rate ich dir, sie zu unterlassen!«
»O ja?«, Soames trat ganz dicht an sie heran. Sein Gesicht war verzerrt. Ein trockenes Kichern drang aus der Kapuze der vermummten Gestalt.