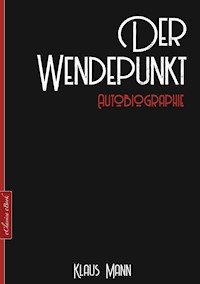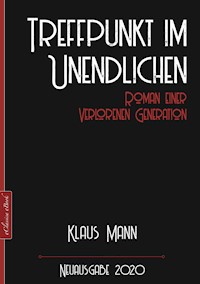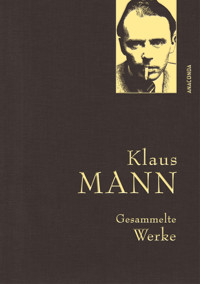2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Große Klassiker zum kleinen Preis
- Sprache: Deutsch
Die junge Johanna, Sympathisantin der Kommunisten, flieht vor den Nationalsozialisten nach Finnland. Dort begegnet sie dem Gutsbesitzer Ragnar, den sie ebenso leidenschaftlich zu lieben beginnt wie die Schönheit der nordischen Landschaft. Doch schon bald wird sie aufgefordert, ihren kämpfenden Genossen in Paris beizustehen. Liebe oder Widerstand? Johanna muss sich entscheiden. In der Emigration schrieb Klaus Mann diesen bedeutenden Exilroman, eines seiner Hauptwerke.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Klaus Mann
Flucht in den Norden
Roman
Anaconda
Der Roman erschien zuerst 1934 im Querido Verlag in Amsterdam. Der Text folgt hier der Ausgabe Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag 1981. Orthografie und Interpunktion wurden unter Wahrung von Lautstand und grammatischen Eigenheiten auf neue Rechtschreibung umgestellt.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2020 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen
der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: Wilfred Gabriel de Glehn (1870–1951), »Portrait of
Jane Austen in Beige, Autumn« (1930er-Jahre), Private Collection /
Photo © Philip Mould Ltd, London / Bridgeman Images
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus
ISBN 978-3-641-28760-3V002
www.anacondaverlag.de
Dem Andenken von
Wolfgang Hellmert
Gestorben in der Emigration
Paris, Mai 1934
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
I
Das Schiff hielt schon seit einigen Minuten. Den schmalen Landungssteg hinunter drängten sich die Leute; unten, auf dem Kai, wurden sie in Empfang genommen mit viel Hallo, Kuss und Umarmung. Die Ankommenden vermischten sich schnell mit denen, die gewartet hatten, man fand sich unter Winken und Geschrei, es herrschte Stimmengewirr und großes Gelächter, auch Freudentränen wurden vergossen, denn mancher war eine lange Zeit in fernen Landen gewesen, nun hatte die nordische Heimat ihn wieder. Zu dem allgemeinen, beinah rauschhaften Vergnügen, das die Ankunft eines Dampfers immer hervorruft, kam die Freude an einem strahlenden Sommertag. Himmel und Wasser waren gleich blau, zum Entzücken schön der Flug der Möwen, auf deren bewegtem Gefieder das Licht schimmernd blendete.
Das junge Mädchen, das Johanna heißt, zögerte noch, das Schiff zu verlassen. Sie stand auf dem oberen Deck und suchte mit den Augen in der Menge drunten nach ihrer Freundin, ohne sie zu finden. ›Wahrscheinlich ist Karin überhaupt nicht gekommen‹, dachte sie, und es enttäuschte sie so sehr, dass sie keine Lust mehr hatte, sich von der Stelle zu rühren. Aber da entdeckte sie Karin zwischen den Winkenden. Ruhig, ernst und anmutig stand sie inmitten des schwatzenden Gedränges, vielleicht hatte sie ihrerseits Johanna schon seit längerem unter den Passagieren auf dem Deck herausgefunden, aber jetzt erst, da der Blick Johannas sie traf, lächelte sie. Dieses sanfte und ernste Lächeln war Johanna sehr wohl vertraut, sie erkannte es aus der Ferne, es wurde ihr gut und gerührt davon ums Herz.
Sie ging rasch über das Deck, die Treppe hinunter zum Zwischendeck, gab bei dem Beamten, der an der Sperre stand, ihr Billett ab, lief den ziemlich steilen Steg, der zum Lande führte, so schnell hinunter, dass sie stolperte und fast gefallen wäre. Sie rannte wie ein Junge, der endlich, endlich aus der Schule darf. Ihr Haar, das ihr jetzt in die Stirn wehte, war geschnitten wie das Haar eines Jungen. Man hätte sie, aus einiger Entfernung, für einen Gymnasiasten halten können. Unter dem kurzen Leinenrock hatte sie nackte Knie. Kolossal froh war sie, aus diesem Schiff herauszukommen. Und es war ja nicht nur das Schiff, was sie hinter sich ließ, als sie da so enthusiastisch den Steg hinunterstolperte. In die heftige Freude mischte sich ein wenig Angst, was begann nun?
Karin fing die Laufende auf. »Da bist du!«, sagte sie mit ihrer etwas belegten, sanften und tiefen Stimme. Johanna schlang beide Arme um Karin und küsste sie. »Wie schrecklich lieb, dass du gekommen bist!«, redete sie, noch in der Umarmung. Dann, leicht beschämt über einen Anfall von Zärtlichkeit, der zwischen den beiden nicht üblich war: »Ich hätte doch auch mit dem Zug zu euch hinausfahren können, ich hatte mir die Verbindung schon notiert.«
Karin fragte nach Johannas Gepäck. Man fand den Träger nicht gleich. Die zwei bescheidenen Handkoffer mussten zur Zollkontrolle geschafft werden; Johanna war recht ratlos und benommen, es blieb Karin überlassen, alles in die Hand zu nehmen und die Formalitäten zu leiten. Sie war energisch und geschickt bei aller Sanftmut und Lässigkeit. Mit den Zollbeamten sprach sie in dem wildfremden, konfusen Idiom, von dem Johanna sich nicht vorstellen konnte, dass sie es jemals verstehen oder sich gar selber in ihm ausdrücken würde. Ungeschickt und verlegen stand Johanna neben der zielbewusst und ruhig agierenden Karin. Schließlich waren die Koffer frei, Karin zeigte dem Träger, in welchen Wagen er sie schaffen sollte. Es war dasselbe Auto, mit dem Karin voriges Jahr in Deutschland gewesen war: eine unscheinbare, viersitzige Limousine, grünlich gestrichen, mit Kotspritzern und Staub bedeckt.
»Immer noch das alte brave Ding«, sagte Johanna anerkennend, während sie einstieg. Es war herrlich, Karin wieder einmal neben sich am Steuer zu haben. Niemand fuhr sicherer und zuverlässiger als sie. Johanna schaute sie vergnügt und bewundernd von der Seite an; wie imponierte ihr diese lässige und zusammengenommene Haltung, wie liebte sie dieses bräunliche, zugleich empfindliche und entschlossene Gesicht mit den guten Augen von unbestimmbarer Farbe. (Waren sie dunkelgrau mit einem Stich ins Bräunliche? Oder waren sie hellbraun, manchmal ins Dunkelblaue spielend?) – Johanna spürte gar nicht mehr, dass sie übermüdet, sehr aus der Fassung und recht fertig mit den Nerven war. Karins Nähe erfrischte und stärkte sie, deshalb ließ sie auch die Augen nicht von ihr und achtete nicht viel auf die fremde Stadt, durch die sie gefahren wurde.
»Wohin geht’s?«, fragte sie. »Ins Hotel?« Karin, am Steuer, schüttelte den Kopf. »Wir haben doch eine Wohnung hier«, sagte sie.
Johanna hatte das gar nicht gewusst. »Eine Stadtwohnung? Aber ihr seid doch das ganze Jahr auf dem Gut.« Karin lachte, immer ohne Johanna dabei anzusehen, die Augen geradeaus auf die Straße gerichtet. »Ja«, sagte sie, »beinahe das ganze Jahr sind wir draußen. Die Wohnung ist auch meistens abgesperrt, aber ein paar Wochen im Winter benutzen wir sie doch. – Außerdem kommt irgendjemand von uns ja fast regelmäßig einmal in der Woche hierher«, fügte sie, etwas nachdenklich, nach einer Pause hinzu. Johanna, die beinah ununterbrochen auf Karin sah, als sei dies das einzige Mittel für sie, um überhaupt halbwegs in Form zu bleiben, warf nun doch einen Blick auf die Straße. Es war ein breiter und heller Boulevard, eben kamen sie an einer Kirche vorbei, deren nüchtern kalkweißer Anstrich merkwürdig zu den byzantinischen Formen ihrer Kuppeln wirkte. Übrigens fiel es Johanna jetzt erst auf, wie still die ganze Stadt war, trotz reichlichem Autoverkehr. Die Wagen glitten leise aneinander vorbei. Irgendetwas fehlte. Johanna fragte Karin, was es war. »Hier ist das Hupen verboten«, erklärte ihr Karin. »Ja, hier darf kein Signal gegeben werden. Das ist ganz vernünftig, man muss dann vorsichtiger fahren.« Sie ihrerseits fuhr trotzdem ziemlich schnell. Jetzt hielt sie mit einem Ruck; sie waren in einer eleganten und stillen Straße. Gegenüber einer Front von Villen und gediegenen Mietshäusern lag ein Park.
Karin hatte den Wagen sehr geschickt, gleich beim ersten Anfahren, ganz parallel zum Randstein des Trottoirs geparkt. »Ausgezeichnet habe ich das gemacht«, sagte sie und lächelte zufrieden. Sie stiegen aus und gingen über das Trottoir. Die Straße war menschenleer; nur vor der Haustür, an der sie stehen blieben, sprang ein kleines Mädchen mit schwarzen und geschlitzten Mäuseaugen im mattgelben Gesichtchen hurtig über ein Seil. Sie trug ein grellgelbes Kittelchen und hellbraune Sandalen, die beim Springen angenehm auf dem Pflaster klapperten. Johanna lächelte ihr zu, aber das kleine Mädchen erwiderte nur ernst und spröd ihren Blick. »Komisch, wie die Menschen hier mongolisch aussehen«, sagte Johanna zu Karin, die inzwischen ihren Hausschlüssel gefunden hatte. »Die Kleine da könnte doch glatt eine Chinesin sein.« – »Ich bin aber eine Japanerin«, ließ sich die Kleine in einem reinen Berlinerisch vernehmen, übrigens trotzig und beinah böse, mit einem schmollend vorgeschobenen Flunsch. Johanna erschrak, als hätte ein Vögelchen zu sprechen begonnen, noch dazu auf berlinerisch, was in Johanna keine guten Erinnerungen erwecken konnte. Karin lachte. »Das ist die Tochter des japanischen Generalkonsuls«, sagte sie – das Kind nickte ernsthaft dazu. »Er ist aus Berlin hierher versetzt worden. Komm jetzt.« Karin ging schon die ersten Stufen hinauf; Johanna schaute noch einen Moment der kleinen Springenden zu.
Es war ein pompöses Treppenhaus und angenehm kühl, nach der Wärme draußen. Erst als sie die frische Luft drinnen dankbar empfand, merkte Johanna, wie drückend es auf der Straße gewesen war. »Es ist heiß bei euch im Norden«, rief sie Karin zu, die rasch, aber nicht laufend, sondern mit gleichmäßig behänden Schritten die Treppe hinaufging. »Ja – im Sommer«, rief Karin, den Kopf gewendet, lachend zurück, während sie weiter nach oben stieg. Johanna, die sich plötzlich ermüdet fühlte, warf noch einen bewundernd zärtlichen Blick auf den elastisch beschwingten Gang der Freundin, ehe sie sich selbst ans Treppensteigen machte. Sie nahm eine Art von kleinem Anlauf und sprang dann in großen Sätzen, wobei sie immer zwei Stufen auf einmal nahm. Darauf, dass ihre Schritte so hallen würden, war sie nicht vorbereitet gewesen; (Karins Schritte waren viel leiser). Es fehlte der Teppich auf den steinernen Stufen; das war es auch, was dem weiträumigen und prunkvollen Treppenhaus den Charakter einer gewissen kahlen Ödheit, ja, einer zwar noch noblen, aber doch schon bedenklichen Verwahrlosung gab: Der Aufgang war wie der zu einem Schloss, das von seiner Herrschaft nicht mehr standesgemäß gehalten werden kann, es bleibt stattlich, aber ein nicht zu übersehender Mangel an Komfort und Gemütlichkeit verrät schon unheimlich das Nahen des Abstiegs.
Es war eine recht große Wohnung, die von der Familie als gelegentliches Absteigequartier in der Hauptstadt benutzt wurde. Karin führte Johanna in eine Diele und durch mehrere weite Stuben, in denen Lehnsessel, runde Teetische, Kanapees und Kronleuchter mit weißen Tüchern zugedeckt und verhangen waren, »das ist der Salon«, erklärte Karin, indes sie voranging. »Das ist das Speisezimmer. Das hier ist Papas Arbeitszimmer gewesen.« In den kühlen, halbdunklen Räumen roch es nach Mottenpulver und Staub, die Jalousien waren heruntergelassen. In einem Zimmer – dem, das Karin als Papas früheres Arbeitszimmer bezeichnet hatte – ließ der Spalt des angelehnten Fensterladens einen breiten Sonnenstrahl ein, der wie ein gelber Scheinwerfer schräg durchs Zimmer fiel. In seiner zitternden Helligkeit tanzten Staubfaden wie Insekten. An der Wand, die dem Fenster gegenüberlag, traf dies Licht auf ein Bild, dessen Landschaft es überraschend belebte. Eine mäßig gemalte Wiese – ein Mädchen im roten Kleid hütete darauf einige Schafe – wurden zum einzig lebendigen Fleck, zur einzigen Wirklichkeit in diesem abgestorbenen, traumhaft verödeten Ort.
Karin öffnete eine breite, weiße Flügeltür; sie traten in ein kleineres Zimmer, das hell war. »Hier wohne ich«, sagte sie und fügte hinzu: »Ja, ich hatte meine Stube gleich neben dem Arbeitszimmer von Papa.«
Karins Zimmer war sehr einfach eingerichtet: ein Bett, die weiße Kommode, der Spiegelschrank, ein paar schmale Stühle. Karin setzte sich aufs Bett und zündete sich eine Zigarette an. »Willst Du Tee haben?«, fragte sie und lächelte Johanna zu. »Ich kann schnell welchen machen.«
Johanna setzte sich, ohne zu antworten, neben sie. »Ich bin furchtbar müde«, sagte sie und schloss die Augen. »Von der Reise?«, erkundigte Karin sich. Johanna, die nicht gleich antwortete, riss nach ein paar Sekunden die Augen auf, erschrocken, als sei sie in Gefahr gewesen, gleich hier, auf der Stelle einzuschlafen oder doch das Bewusstsein zu verlieren. »Nicht nur von der Reise«, sagte sie schließlich in einem Ton, als koste es sie Überwindung, das zuzugeben. »Ich weiß«, sagte mit ihrer tiefen, zärtlichen Stimme Karin. Sie fuhr mit ihrer Hand leicht über die traurig und überanstrengt nach vorne hängenden Schultern Johannas. Johanna stand auf. Ich werde gleich weinen, dachte sie und ging rasch zum Fenster, wo sie stehen blieb. Sie hatte den Blick über die friedlich elegante Straße in dem Park. Mit allen Kräften versuchte sie ihre Gedanken auf diesen angenehmen Blick zu konzentrieren. Aber es hing ihr etwas andres vor den Augen. Sie krampfte die Hände zusammen.
»War es sehr schlimm?«, fragte Karin vom Bett her. »Reden wir nicht davon«, antwortete Johanna fast zornig.
Sie hatten sich ziemlich genau ein Jahr lang nicht gesehen und sich nur wenige Briefe geschrieben in dieser Zeit, die für Johanna eine sehr bewegte gewesen war. In ihnen war aber die Erinnerung an eine große und festgegründete Freundschaft, obwohl diese Freundschaft nur sechs Monate gehabt hatte, sich zu entfalten und solid zu werden. Das waren die sechs Monate, die Karin zum Studium in Berlin gewesen war. Sie hatte Johanna in der Universität kennengelernt, Johanna studierte Nationalökonomie, Karin hatte Kunstgeschichte belegt. Sie trafen sich in einem philosophischen Kolleg und hatten erst mehrere Male – halb durch Zufall, halb absichtlich – nebeneinander gesessen, ehe sie miteinander sprachen. Dann kam die Zeit des täglichen Zusammenseins, bis Karin plötzlich, auf ein Telegramm hin, in den Norden zurück musste. Es war die Nachricht von dem tödlichen Unglücksfall ihres Vaters, die alles änderte. Johanna hatte die zuerst im Schmerz Erstarrte, dann wimmernd Zusammengebrochene nach der norddeutschen Hafenstadt begleitet, von wo das Schiff in ihre Heimat ging. Damals, im Zuge, hatte Karin das erste Mal von ihrer Familie erzählt: von dem Gute, auf dem sie lebten, von ihren Brüdern und von ihrer Mutter. Bis dahin hatte sie von alldem niemals geredet, höchstens einmal, allgemeiner, von der weiten, menschenarmen Landschaft ihrer Heimat oder über ihren Vater ein paar zärtliche Worte. Der Schmerz über diesen Verlust war furchtbar für sie; er klang das folgende Jahr aus ihren seltenen und kurzen Briefen.
Als Karin und Johanna sich damals trennten, wussten sie selbst noch nicht, dass die Verbundenheit zwischen ihnen eine so feste geworden war. Sie merkten es, als sie sich nicht mehr sahen. Sie dachten viel aneinander, obwohl beide abgelenkt und bitter beansprucht durch Ereignisse in ihrem eignen Leben. Johanna entwickelte, in den Monaten nach Karins Abreise, eine immer entschlossenere, mutigere und radikalere Aktivität auf einem Gebiete, an dem sie bis dahin nur aufs Allgemeinste und durchaus dilettantisch interessiert gewesen war: auf dem politischen. Sie trat in eine kommunistische Studentengruppe ein, arbeitete propagandistisch, redete in Versammlungen. Das hing nicht nur mit inneren Entwicklungen und intellektuellen Erkenntnissen zusammen, sondern vor allem mit der neuen und heftigen Beziehung, die sie einem der Freunde ihres älteren Bruders Georg verband.
Sie hatte sich dem radikalen und unduldsamen Kreise, der um ihren Bruder, philosophischen Schriftsteller und aktiven Sozialisten, gruppiert war, bis dahin ferngehalten. Dem Reporter, Versammlungsredner und Sportsmann Bruno war sie zunächst außerhalb dieses politischen Zirkels begegnet. Ihre Freundschaft mit ihm brachte sie auch seinen Genossen und dadurch ihrem Bruder näher. Nach einigen Wochen gehörte sie ganz zu diesen. Sie nahm energisch, von Tag zu Tag hingebungsvoller, Anteil an ihrer Arbeit.
So wurde sie von der Katastrophe, die in den ersten Monaten des nächsten Jahres über ihr Vaterland kam, aufs Persönlichste und Einschneidenste betroffen. Ihr Bruder und einige seiner Freunde, darunter Bruno, konnten ins Ausland fliehen; andere wurden verhaftet, andere getötet. Sie selbst musste sich versteckt halten, wurde gefunden, wieder freigelassen, wollte nicht abreisen, ihren Platz keinesfalls räumen, aber die nächste Verhaftung stand schon bevor; sie wurde gewarnt, musste sich entschließen, falsche Papiere zu benutzen, die ihr zur Verfügung standen; sie verließ Deutschland. Durch einen Kameraden hatte sie den Brief, der sie bei Karin anmeldete, aus Stockholm befördern lassen.
»Reden wir nicht davon«, sagte Johanna. »Nicht jetzt, später.« – Karin fragte nicht weiter. Sie berührte von hinten mit beiden Händen sanft Johannas Schulter. »Leg dich jetzt hin!«
Johanna musste sich auf dem Bett ausstrecken; sie bekam eine Decke über die Füße gebreitet und noch ein Kissen unter den Kopf geschoben. Karin saß bei ihr. »Mein Bruder Jens ist heute in der Stadt«, erzählte sie. »Das ist mein jüngerer Bruder, ja, der auf dem Gut Landwirtschaft lernt. Einer muss es doch schließlich können. Ragnar lernt’s nie.« Sie lachte ein bisschen, aber es klang nicht sehr freundlich. »Wo ist Ragnar?«, fragte schläfrig Johanna, sie hatte die Augen geschlossen. Karin erklärte: »Er wollte auch in die Stadt kommen, aber er hatte gestern mal wieder mit seinem Wagen Pech. Ja, er ist ein bisschen in den Graben kutschiert, das kommt gelegentlich vor. Furchtbar komisch ist er, wenn er Auto fährt.« Sie lachte, Johanna lachte mit ihr. »Warum fährt er dann nicht mit dir, in deinem Wagen?«, fragte sie noch, immer ohne die Augen aufzumachen. Karin antwortete nicht, sondern zuckte die Achseln.
Sie stand auf und machte sich erst im Zimmer, dann in anderen Räumen der Wohnung – wahrscheinlich in der Küche – zu schaffen. Johanna hörte sie klappern und rumoren; sie erriet aus den Geräuschen, dass Karin Tee zubereitete, Gebäck auf einer Schüssel sortierte. Während Karin leise summend hin und wider ging, dort ein Schränkchen öffnete, hier ein Tuch breitete, hielt Johanna ihre Augen so gern geschlossen. Sie schlief nicht ein, aber das Gefühl war schön, wie das vor einem guten Einschlafen. Sie fühlte sich wunderbar geborgen in Karins Nähe. Es war eine fast geheimnisvolle Sicherheit in allen Worten und Bewegungen Karins, eine sanfte, freundlich entschiedene Gefasstheit, so als könne ihr nichts im Ernst etwas anhaben und sie sei gefeit durch einen besonderen, still und mächtig wirkenden Talisman vor jeder Verwirrung.
Während sie Tee tranken, klingelte es draußen. Karin stand auf. »Das wird Jens sein«, stellte sie fest. »Ja, er wollte uns abholen kommen.« Sie ging hinaus, um ihrem Bruder die Tür zu öffnen. Man hörte, kaum dass er eingetreten war, seine laute, lustig schallende Stimme. Er sprach schwedisch mit Karin. Johanna, die immer noch auf dem Bett lag – Karin hatte ihr die Teetasse und das Tellerchen mit Gebäck auf ein Tischchen gleich neben das Kopfkissen gestellt –, richtete sich halb auf, um Karins Bruder doch nicht wie eine Kranke zu empfangen. Er kam lachend und redend herein, hatte einen hellen Flauschanzug an, war breitschultrig, stattlich und groß. Johanna bemerkte als Erstes an ihm, dass er ein kleines, hellblondes, englisch gestutztes Schnurrbärtchen trug. Er bewegte sich in einer legeren Haltung, die Eitelkeit verriet, und nahm erst zur Begrüßung die Hände aus den Hosentaschen. »Das ist meine Freundin Johanna«, sagte Karin und strich der Freundin dabei mit den Fingerspitzen über das Haar. »Freut mich, habe viel von Ihnen gehört«, sagte Jens und verneigte sich fröhlich. Sein Deutsch hatte einen leicht amerikanischen Akzent. In diesem Augenblick fiel es Johanna zum ersten Mal als etwas peinlich auf, dass man sich ihretwegen hier einer fremden Sprache bedienen musste. Bei der Unterhaltung mit Karin war es ihr stets natürlich vorgekommen, sie hatte sie kaum jemals anders sprechen hören als deutsch. Sie selbst konnte nicht schwedisch und erst recht nicht die fantastische, magyarisch klingende Landessprache, die übrigens nicht die eigentliche Muttersprache Karins und ihrer ursprünglich schwedischen Familie war.
Jens ließ sich von Karin Tee einschenken und setzte sich, nachdem er kurz und lachend um Erlaubnis gefragt hatte, neben Johanna aufs Bett Er war ein hübscher Mensch und hätte Johanna gefallen, wäre seine laute Art nicht ein wenig irritierend für sie gewesen. Außerdem stellte er zu viele direkte, etwas taktlose Fragen.
»Das ist also keine Vergnügungsreise, die Sie unternehmen, sondern Sie sind aus Deutschland geflohen?«, erkundigte er sich munter. Erstaunt betrachtete ihn Johanna; sie fand den Ausdruck seines Gesichtes von einer entwaffnenden Naivität. Er hatte große, etwas vorspringende hellblaue Augen, über denen die Brauen spärlich und weizenblond waren. Nicht sehr angenehm war, dass er sein von Natur wahrscheinlich hübsches und lockeres helles Haar zu einer festen und adretten Scheitelfrisur gebürstet trug; seitlich und im Nacken war es mit der Maschine kurz geschoren; (eigentlich eine deutsche Frisur, dachte Johanna). Sein Gesicht war leicht gerötet, kräftig und männlich wohlgebildet, mit einer geraden Nase, einem sehr roten Mund und einem energischen, etwas zu schweren Kinn. Als er seine Teetasse auf das Tischchen zurückstellte, fiel Johanna auf, dass er zu lange Arme hatte. Johanna antwortete ihm.
»Ja«, sagte sie, »so war es, ich musste weg.«
»Hatten Sie denn einen Pass?«, fragte Jens.
»Ich bin mit einem falschen Pass gekommen.«
»Sind Sie Jüdin?« Jens fragte es mit einem misstrauischen Ausdruck. Karin, die das Teegeschirr abräumte, kicherte. Johanna aber blieb ernst.
»Ich bin vielleicht Nichtarierin.«
»Was ist das?«, fragte Jens, nicht ironisch, sondern wissbegierig.
»Das weiß man nicht so genau«, erklärte ihm Johanna. »Es kann jedem passieren.«
»Sie sind aber doch christlich erzogen?«, forschte Jens mit einer gewissen Strenge. Johanna musste es zugeben.
»Aber dann sind Sie doch Christin«, behauptete Jens.
Johanna sagte, wobei sie plötzlich den Blick müde und etwas angeekelt abschweifen ließ: »Es kommt auf die Rasse an; auf das Blut.«
Jens machte eine respektvolle kleine Pause, während der er nachzudenken schien. Schließlich sagte er hartnäckig: »Sie sind aber blond.«
Nun musste Johanna lachen. »Ja, wenn es darauf ankäme –«
»Ich war früher einmal in Deutschland«, erklärte Jens langsam und ernst. »Vor zwei Jahren. Ich war in Berlin, Heidelberg und Nürnberg. Ein sehr schönes Land, sehr achtenswert; romantisch und dabei sehr achtenswert Ja, ich bin sehr für Deutschland. Ragnar ist ja immer gegen Deutschland gewesen«, sagte er und zuckte dabei die Achseln. »Jedenfalls«, meinte er abschließend, »alles, was in Deutschland geschieht, muss doch einen gewissen Sinn haben. In Deutschland geschieht doch sicher nichts ohne Sinn und Verstand.«
Johanna wusste nicht, was sie erwidern sollte; sie war bestürzt und etwas ärgerlich; andrerseits widerstand es ihr, sich mit diesem auf eine Diskussion einzulassen. Karin war es, welche die Situation rettete. Sie sagte schnell auf Schwedisch ein paar Sätze zu ihrem Bruder, der etwas betreten dazu lächelte. Dann erklärte sie, es sei wohl Zeit aufzubrechen und einen kleinen Bummel durch die Stadt zu machen. Jens wurde äußerst liebenswürdig, ja galant. Er sagte: »Ich habe deutsche Damen immer reizend gefunden; Sie sind auch reizend, Fräulein Johanna. So darf ich Sie doch nennen?«, bat er sie mit Wärme, wobei er ihr in die Jacke half. Er hatte ein gewinnendes, beinah rührendes Lächeln. Seine gutmütigen Augen strahlten.
Auf der Treppe fragte er, wie lange Johanna sich in diesem Lande aufzuhalten denke. Sie zuckte zusammen; die Antwort, die sie gab, war vage. »Ich weiß nicht genau«, sagte sie, »nicht sehr lange wahrscheinlich – wohl nicht länger als eine Woche. Meine Freunde sind in Paris«, fügte sie mit einer flüchtigen Hastigkeit hinzu.
Unten auf der Straße stand ein offener, ziemlich strapazierter, aber tüchtiger Ford hinter der Limousine, in der sie gekommen waren. Karin erklärte, dass sie keine Lust zum Chauffieren habe, man entschied sich also für den Ford, der Jens gehörte. »Hat denn jeder von euch seinen Wagen?«, fragte Johanna, während sie einstiegen. Jens und Karin lächelten; Jens stolz, Karin etwas beschämt. »Es würde sonst doch nur immer Streit geben«, meinte sie. »Jeder von uns führt sein eigenes Leben«, fügte Jens würdig hinzu. »Ich arbeite doch auf dem fremden Gut, damit ich unseres später wieder in Ordnung bringen kann. – Nun will ich Ihnen aber die Stadt zeigen, es ist eine schöne Stadt«, erklärte er stolz.
Karin nahm hinten in der Klappe Platz, Johanna saß vorn neben Jens, damit er ihr die Sehenswürdigkeiten zeigen könne. Sie fuhren ziemlich schnell durch den leisen, aber dichten Verkehr, ein paar breite, helle Boulevards hinunter, an einigen byzantinischen Kuppelkirchen und an einem sehr modernen Regierungsgebäude vorbei. Jens zeigte Johanna ein Warenhaus, ein neues Postgebäude in amerikanischem Stil, ein Reiterdenkmal und eine Buchhandlung, von der er behauptete, sie sei die größte Europas. Johanna betrachtete sich diese Stadt, die fremde Hauptstadt eines fremden Landes, ohne ein eben leidenschaftliches Interesse. So ähnlich wie diesen Ort mit seinen zu geräumigen Plätzen, seinen offiziellen Repräsentationsgebäuden, hatte sie sich immer die entlegenen Verwaltungszentren des zaristischen Russlands vorgestellt: mit einem Gouverneur in Pelzmütze, der in seinem Salon französisch spricht, aber täglich Knutenhiebe verteilen lässt. Johanna sagte etwas darüber zu Jens, der das aber nicht gerne zu hören schien. »Ja, wir haben ja die Russen einmal hier gehabt«, sagte er nur. »Die Deutschen haben uns dann gegen sie geholfen. Die Deutschen sind die besten Soldaten der Welt.«
Sie verließen allmählich die Stadt und kamen ins Freie. Die Straße, die durch niedriges Gehölz führte, blieb breit und glatt. Eine gute Straße, Johanna lobte sie – woraufhin Jens verächtlich, beinahe bitter sagte: »So in der Umgebung der Stadt, da sind die Straßen noch ganz anständig; aber weiter draußen auf dem Lande, puh – In Deutschland«, fügte er nach einer kurzen Pause hinzu, »ja, da gibt es überall gute Straßen!«
Er fing plötzlich an, über deutsche Musik zu reden.
»Oh, das liebe ich!«, rief er begeistert – ›Er könnte eigentlich Amerikaner sein‹, dachte Johanna plötzlich. ›Er hat ganz die enervierende und dabei entwaffnende Naivität mancher jungen Amerikaner.‹ Jens inzwischen bemühte sich, einige deutsche Melodien zum Vortrag zu bringen, was ihm jedoch nur mangelhaft glückte. »Nie sollst du mich befragen!«, sang er schallend. »Ja, ich habe den ›Lohengrin‹ gehört, in München, bei den Festspielen. Ich habe vergessen zu erzählen, dass ich auch in München war. Aber ich kenne auch noch etwas anderes, warten Sie mal: ›Das ist der Frühling, das ist der Frühling, das ist der Frühling von Berlin‹. – Ja, das ist er wirklich!«, rief er, etwas sinnlos, und lachte laut.
»Ich bin zwei Jahre in Amerika gewesen«, erklärte er, »und nur zehn Tage in Deutschland. Trotzdem finde ich Deutschland viel schöner. Ich habe damals so viel in Deutschland gesehen und erlebt. Zum Beispiel auch noch eine ganz verrückte Sache, in Berlin, wie hieß das doch, die ›Dreipfennigoper‹, das war ein bisschen zynisch, aber auch ganz schön, und es kam vor: Ja, da muss man sich doch einfach hinlegen …« Er sang wieder mit großem Ton, die Stimme zitternd, in einem halb parodierten, halb echten Gefühl. Er missfiel Johanna nicht, obwohl sie ihn etwas lächerlich fand. Aber sein naives Temperament machte ihr Spaß und hatte die Kraft, sie lustig abzulenken.
Karin, die die ganze Zeit geschwiegen hatte, rief plötzlich von hinten: »Ich glaube, wir sollten umkehren. Johanna wird Hunger haben. Wir wollen essen gehen.« – »O. K.«, sagte Jens; man fuhr zurück.
Das Hotel, in dessen Restaurant sie das Essen bestellten, hatte wieder ganz den zaristischen Stil. Es war verstaubt und prunkvoll, mit breiten, etwas grauen Palmen in bunten Kübeln, mächtigen Renaissancesesseln, barocken Säulen, Gipsputten, die vom Plafond zu stürzen drohten, und einem gravitätischen Portier mit steifem, eckigem weißem Backenbart, der wie umgehängt wirkte. – Jens stellte das Menü zusammen; er beriet sich ausführlich mit dem Kellner, sein Gesicht ward dabei fast sorgenvoll vor gesammeltem Ernst. Johanna betrachtete während dieses zeremoniellen Vorgangs einen Gobelin, der ihr gegenüber eine breite Wand bedeckte. Höchst farbenprächtig und anschaulich war auf ihm eine muntre Tafelrunde abgebildet, die sich augenscheinlich in der allerköstlichsten Laune befand. Die Kostüme der Damen und Herren deuteten darauf hin, dass die Szene sich um das Jahr 1890 abspielte. Den Vordergrund hielt eine jüngere Frauensperson mit hoher Frisur, enormen Puffärmeln und üppigem Busenansatz, die ein Sektglas hob, in dem es perlte; (sogar der Champagnerschaum war in den Bildteppich eingewirkt). Sie zeigte dem Beschauer ein übermütiges, dabei edles Profil: die Nase griechisch, die Stirn sehr wohlgeformt unter der raffinierten Frisur – der strahlende Mund aber beinah anstößig in seiner Lebenslust; (hier hatte der webende Künstler seinen stärksten, leuchtendsten roten Faden benutzt). Neben ihr stand ein Herr in den besten Jahren; er trug langen schwarzen Bratenrock und braune Koteletten und schien im Begriff, eine Tischrede zu halten, die sowohl sinnig als launig war. Alle lachten, leichtsinnig und gerührt. – Johanna schaute gebannt auf diesen erstaunlichen Teppich wie in eine fremde, ganz unerklärliche Welt hinein – halb Götterreigen, halb Menagerie. Sie war so leidenschaftlich interessiert an jeder seiner Einzelheiten, dass sie sogar vergaß, über seine Komik zu lachen. – »Ja, es ist drollig hier«, sagte Karin schließlich. Johanna schreckte auf.
Die vielen Schüsseln des Vorgerichts wurden gebracht: Fischchen, Wurst, Käse, russische Eier; Jens hatte einen scharfen Schnaps dazu bestellt. Man hob die kleinen Gläser und stieß an. Jens sagte etwas über Münchener Bier, das es hier freilich nicht gäbe. Johanna erklärte, dass sie Bier nicht gerne trinke. Man sprach weiter über Weinsorten; dann über die Zubereitung von Speisen in verschiedenen Ländern. Jens schwärmte wieder etwas von Berlin, Nürnberg und den Festspielen in München. Die Unterhaltung ging aufs Theater im Allgemeinen über, Jens erinnerte sich an verschiedene Aufführungen, denen er im Berliner Deutschen Theater und in anderen Schauhäusern beigewohnt hatte. Johanna erwähnte, dass der berühmte Regisseur, der der Leiter dieses Theaters gewesen war, nicht mehr in Deutschland arbeiten könne; ebenso wenig wie verschiedene andre Künstler, deren Jens im Laufe der Unterhaltung verehrungsvoll gedacht hatte. Das nahm Jens mit einem leichten Erstaunen zur Kenntnis, ohne sich aber lange dabei aufzuhalten. Karin sagte auf Schwedisch ein paar Sätze zu ihm, die ihn zu verstimmen, ja wütend zu machen schienen. Er erwiderte mit erhobener Stimme, wobei sein Gesicht, schon vom Genuss der Speisen und des Schnapses erhitzt, noch röter anlief. Es entspann sich eine kurze, heftige und für Johanna unverständliche Unterhaltung zwischen den Geschwistern. Schließlich erklärte Jens, so ergrimmt, dass er mit der Faust auf den Tisch schlug – nicht sehr heftig, aber immerhin stark genug, dass die Gläser klirrten und man sich an einigen Nebentischen umsah –: »Du bist schon beinah wie Ragnar!« Dieser Satz, auf deutsch gesprochen, war der erste, den Johanna wieder verstand. Karin lachte. »Das hat mit Ragnar wirklich nichts zu tun«, sagte sie. Dann zu Johanna, erklärend: »Es gibt nämlich auch in unserem Lande politische Streitigkeiten, musst Du wissen: eine rechtsradikale nationalistische Partei spielt hier eine gewisse Rolle, und für die hat Jens Sympathien. Zu Hause darf davon gar nicht gesprochen werden, weil es sonst immer mit Streit endet Ich wollte auch jetzt nicht davon anfangen. Was ich zu Jens gesagt habe, war nur, dass diese Leute es bei uns nicht anders machen würden als diese – anderen es bei euch gemacht haben.«
»Man kann nichts vergleichen!«, behauptete Jens heftig. »Ich weiß auch nicht, ob in Deutschland die Gefahr des Bolschewismus so nah war wie hier. Wir sind hier nur ein paar Stunden von Petersburg entfernt – von Leningrad, wie sie es jetzt nennen. Wir haben den Feind an der Grenze.« Er sprach mit Erbitterung. Johanna musste lächeln. Merkwürdigerweise empfand sie wieder keine Lust, sich auf eine Diskussion einzulassen, obwohl das Thema ungeheuer interessant für sie war und obwohl sie über die politische Bewegung, um die es ging, besser Bescheid wusste, als die Geschwister voraussetzten. Sie spürte aber, dass ein solches Gespräch weit führen würde und keine Resultate haben könnte. Übrigens merkte sie auch schon etwas von der Wirkung des Alkohols. Ihr war ein wenig benommen im Kopf.
Karin war es, die vorschlug, man solle das Lokal wechseln. Jens zog sich diskret mit dem backenbärtigen Oberkellner zurück, um die Rechnung zu begleichen, was Johanna als etwas altväterisch, dabei als drollig und ganz nett empfand. Man trat auf die Straße, der Abend war warm und hell. Johanna wunderte sich, als sie mit einem Blick auf die Uhr feststellte, dass es schon ein halb zehn Uhr war; sie hätte, dem Licht nach, geglaubt, es sei nachmittags. Man stieg wieder ins Auto.
Es war ein großes volkstümliches Gartenlokal, in das Jens sie führte. Von der Straße aus ging man erst durch ein hallenartig weites Café, in dem jetzt wenige Menschen saßen, nur einige Schach- oder Kartenspieler und alte Leute. Durch die weit geöffnete Glastüre trat man auf eine breite Terrasse, wo die Tische dicht beieinander standen und beinah alle besetzt waren. Von der Terrasse führten ein paar Stufen in den Garten hinunter, wo es auch Tische gab; weiter hinten im Garten war ein Theater aufgebaut, vor einem Parkett von lehnenlosen Bänken. Von dorther kam Musik; es wurde ein Singspiel oder eine Operette aufgeführt. Man sah einige bunt gekleidete Personen, hüpfend und eifrig wie Marionetten, sich auf der entfernten Bühne bewegen. Eine Tenorstimme rief schmachtende Töne herüber. Johanna war sehr bereit, ihnen zuzuhören; aber plötzlich wurden sie von der Musik der Tanzkapelle zugedeckt, die auf der Terrasse zu spielen begann.
Jens hatte einen Tisch gefunden, er stand in der Nähe des lärmenden kleinen Orchesters, aber man hatte von dort einen angenehmen Blick, sowohl über die Terrasse als auch über den von Menschen wimmelnden Garten, bis zur entfernten Bühne hinüber. Jens bestellte zu trinken. Es wurde getanzt. Da auf der überfüllten Terrasse das Gedränge störend war, tanzte man auch unten im Garten, auf dem Kies zwischen den Tischen und Stühlen, obwohl man dort die Musik von der Terrasse und die von der Bühne verwirrend gleichzeitig hörte. Jens fragte Johanna, ob sie Lust habe, mit ihm zu tanzen. Sie sagte: »Ich tanze eigentlich beinah nie –«, stand aber gleichzeitig auf und ließ sich von ihm, über die Terrasse, in den Garten hinunterführen. Die Melodie, die gerade gespielt wurde, hatte marschartigen Rhythmus. Jens bewegte sich danach mit energischen, großen Schritten; zwischen den Zähnen summte er leise die Melodie mit. Er tanzte gut und war ausgezeichneter Laune. »Das sind die hellen Nächte!«, sagte er aufgeräumt. Johanna antwortete nicht, ihr wurde etwas schwindelig beim Tanzen. Sie hatte kein ganz klares Bewusstsein mehr, wo sie sich befand und warum sie hergekommen war. Was hinter ihr lag, verschwamm, aber ganz deutlich war auch die Gegenwart nicht. Hier war ein Garten, sehr viele Menschen bewegten sich und hielten einander umschlungen. Man tanzte auf eine ziemlich leidenschaftliche, beinah anstößige Art – so schien es der verwirrten Johanna. Man war in einem sehr entfernten Lande, irgendwo hoch im Norden. Gewisse schauerliche und einschneidende Ereignisse, die einen ungeheuer stark angingen und betrafen, lagen weit weg. Die meisten Menschen hier waren blond, aber sie hatten hochsitzende, starke, fast mongolische Backenknochen; das gab ihnen ein recht eigenartiges Aussehen. ›Ei, das ist doch etwas für Rasseforscher‹, dachte Johanna und musste kichern. In diesem Augenblick drückte Jens sie etwas stärker an sich; seine große warme Hand bewegte sich auf ihrem Rücken. Die Musik hörte auf.
Sie gingen wieder die Stufen zur Terrasse hinauf. Karin empfing Johanna mit einem sanften, übrigens ein ganz klein wenig gekränkten Lächeln. Jens wollte noch einmal zu trinken bestellen, aber Karin sagte: Nein, Johanna könne nichts mehr vertragen. Johanna nickte: Es sei wirklich genug. Jens schaute die beiden Mädchen an und lachte. Lachend sagte er: »Eigentlich seht ihr euch ähnlich. Ja, ihr habt entschieden eine gewisse Ähnlichkeit. Ihr könntet Schwestern sein, wisst ihr das?« Er lachte lauter. Karin und Johanna wurden gleichzeitig rot; bei Johanna lief die Röte als eine heftige Wärme über die Stirn, bei Karin flog sie als ein zartes, fleckiges Rosa über die Wangen. »Ja«, sagte Johanna. »Das hat man in Berlin auch schon einmal behauptet …« Karin und Johanna sahen sich eine Sekunde lang in die Augen, ganz ernst, prüfend, als suche jede ihr eigenes Spiegelbild im Blick und im Antlitz der andren.
Sie hatten gemeinsam das empfindliche und schmale Oval des Gesichtes; ähnlich war sich auch der schöne Schnitt ihrer großen, traurigen Augen. Das schmale Gesicht Karins, über dem das braune Haar glatt, in der Mitte gescheitelt, lag, erinnerte an die Bilder sanfter und gescheiter Madonnen. Das Gesicht Johannas war frischer und knabenhafter; ihr mattblondes, kurz geschnittenes, locker gescheiteltes Haar konnte einen sehr hellen Schimmer haben – es hing nicht nur davon ab, wie das Licht darauf fiel; ihr Haar hatte die Eigenschaft, dass es, von sich aus, die Farbe wechseln konnte, sich gleichsam belebte und abstarb. – Karin hatte einen schmalen und blassen Mund; von einer kostbaren Schönheit war die Zeichnung der Oberlippe. Johannas Mund war breiter, kindlicher und schwerer; die Lippen waren ein wenig rau und hatten eine Neigung, aufzuspringen, was diesem jungen Mund etwas Ungeschicktes, Rührendes, Schulbubenhaftes gab. Die schlechteste Partie in Johannas schönem und klarem Gesicht war die weiche Linie der Unterlippe, die zu einem nicht sehr gut modellierten, nicht sehr willensstarken Kinn führte. Sehr liebenswert war die helle Stirn, und herrlich die Formung des Hinterkopfes, der, weit und edel ausladend, einem kühnen und begabten Knaben zu gehören schien. – »Komisch«, sagte Jens, »Ihr seid euch zugleich entgegengesetzt und verwandt; eine Art umgedrehter Verwandtschaft …«
»Wollen wir noch mal tanzen?«, fragte er dann, und Johanna stand auf. Sie tanzten erst wieder im Gedränge zwischen den Stühlen, aber dann strebte Jens in einen stilleren Teil des Gartens. Hier standen keine Tische mehr; der Rhythmus der Musik wurde undeutlicher. Jens hielt Johanna fester an sich gedrückt; sie ließ es sich, die Augen geschlossen, gefallen. Dabei wunderte sie sich, ja, sie erschrak darüber, dass ihr seine Zudringlichkeit nicht unangenehm war. ›Ich bin wirklich ganz durcheinander‹, dachte sie, ›total durcheinander – das machen die neuen Eindrücke – schwindlig ist mir übrigens auch …‹ Sie öffnete die Augen erst wieder, als Jens zu tanzen aufhörte und mit ihr stehen blieb. Er behielt den rechten Arm um ihre Hüfte geschlungen, während er mit der linken Hand ihr Gesicht an sich zu ziehen versuchte. Sie spürte seinen Geruch von Alkohol, Nikotin und Schweiß, sie spürte schon seinen Atem. ›Das geht aber doch zu weit!‹, dachte sie, gab sich einen Ruck und machte sich heftig los. Stumm, zornig, beschämt ging sie rasch durch den Garten, die Stufen zur Terrasse hinauf. Jens lief hinterher. Sie kamen gleichzeitig bei Karin an.
Johanna erklärte, dass sie noch etwas von der Operette sehen wolle, die unten im Garten aufgeführt wurde. Sie gingen alle drei in den Garten, an den Tischen vorbei, und setzten sich auf die hinterste der lehnenlosen Holzbänke. Einige Minuten lang sahen Karin, Jens und Johanna der Handlung zu, die sich auf dem strahlend erleuchteten Brettergerüst abspielte; die Musik hatte ausgesetzt, man kam eben zurecht, um dem Dialog zwischen einem jungen Offizier in fantastischer Marineuniform und einer üppigen Dame in orientalischem Schleiergewand zu lauschen. Das Zwiegespräch hatte pathetische Akzente; vor allem die Dame schien erregt, sie kniete in einer demütig verführerischen Haltung vor dem Seeoffizier, der herrschsüchtig und verächtlich zu ihr sprach; unter zusammengezogenen Brauen schaute er dabei über sie weg, streng ins Publikum. Die kniende Haremsdame trug mit einer Koketterie, die angesichts so dramatischer Umstände deplatziert wirkte, zwischen den Lippen eine dunkelrote Rose, die sie immer herausnahm, wenn sie dem ergrimmten Gentleman Antwort stand, jedoch, kaum hatte sie ausgeredet, mit einer gewissen Pedanterie wieder hineinsteckte und weiter baumeln ließ. Während der Herrschsüchtige noch drohend auf sie einredete, trat unvermutet, in strammer Reihe, von hinten der Chor auf. Er bestand aus zahlreichen Mädchen, die dasselbe fließende Gewand wie die Kniende trugen, die Häupter mit turbanartig arrangierten Schleiern umwickelt Alle hoben sie die rechte Hand, in der jede von ihnen eine rote Rose schwenkte, ganz ähnlich der, die ihrer gedemütigten Kollegin im Munde hing. Dabei begannen sie schallend zu singen, was überraschend und ein wenig erschreckend wirkte. Der Seeoffizier, Mann der stählernen Nerven, nahm von diesem plötzlichen Lärm gar nicht weiter Notiz; er drehte sich nicht einmal um nach den Damen, aus deren weit geöffneten Mündern Wohllaut gellte.
Johanna, Karin und Jens fingen alle drei gleichzeitig zu lachen an. Ein Matrose, der vor ihnen saß, wandte sich beleidigt nach ihnen um. Die drei beschlossen, dass sie nun genug von diesem schönen Schauspiel genossen hätten.
Auf der Straße meinte Jens, man dürfe keinesfalls schon nach Hause gehen, »jetzt soll es erst richtig nett werden!«, verlangte er beinah drohend; man müsse eine Bar finden, die die ganze Nacht geöffnet sei, um dort mit Muße weiterzutrinken. Seine vorstehenden blauen Augen hatten ein flackerndes Leuchten. »Weil wir doch so jung nie mehr zusammenkommen – wie man im Münchener Hofbräuhaus sagt!«, erklärte er mit einer groß und umfassend geplanten, doch etwas tapsig missglückenden Armbewegung. Aber Johanna wollte nicht mehr, »ich bin wirklich todmüde«, sagte sie; Jens musste verzichten.
Er setzte die beiden Mädchen vor der Wohnung ab. Er selbst behauptete, noch keine Lust zum Schlafen zu haben. Er wolle lieber schon morgen früh wieder auf dem Gut sein, wo er arbeitete; außerdem sei die Autofahrt durch die helle Nacht ein Vergnügen. »Nächstens besuche ich euch einmal, um nach dem Rechten zu sehen!«, verhieß er zum Abschied. Dann sprach er noch ein paar schwedische Sätze mit Karin. Er küsste Johanna die Hand, aber ohne besondere Leidenschaft und ohne ihr dabei in die Augen zu sehen.
Als Johanna hinter Karin durch die dunklen Räume der verhangenen Wohnung ging, merkte sie, dass es ihr schwerfiel, einen Schritt gerade vor den anderen zu setzen. Sie verspürte so stark eine Neigung, im Zickzack zu spazieren, dass sie nicht anders konnte, als ihr nachzugeben. Übrigens schritt sie hocherhobenen Hauptes, wenngleich schwankend, durch die öden Gemächer.
In Karins Zimmer entledigte sie sich geschwind ihrer Kleider. Sie schleuderte die Strümpfe in eine Ecke und lachte etwas darüber. Dann saß sie auf Karins Bett und stierte aus glasigen Augen vor sich hin. Karin indessen war dabei, ihr ein Lager zurechtzumachen; leise summend und ohne sich viel um die reglos sitzende Johanna zu kümmern, schob sie ein Sofa aus dem Herrenzimmer in das Schlafzimmer hinüber. Sie holte Bettbezüge aus einem Schrank, breitete das Leintuch aus und bezog ein Kissen. Als alles fertig war, setzte sie sich zu Johanna »Hast du zu viel getrunken, mein Armes?«, fragte sie und legte ihr die Hand auf die Stirne.
»Ein bisschen zu viel«, gestand schuldbewusst Johanna. Die kühle Berührung von Karins Hand und der ruhige Klang ihrer Stimme hatten die Kraft, sie beinah zu ernüchtern. Sie legte ihren Kopf gegen Karins Schulter und schloss die Augen. Ihr wurde schwindlig, da sie die Augen schloss; aber nicht so sehr, wie sie gefürchtet hatte. Karin und Johanna saßen einige Minuten, ohne zu reden.
»War Jens aufdringlich?«, fragte Karin schließlich. »Er benimmt sich oft gegen Mädchen nicht ganz geschmackvoll. Sonst ist er ein guter Junge.«
Für Johanna wurde plötzlich die Erinnerung daran, dass sie sich von Jens beinahe hätte küssen lassen, verwirrend und peinlich. Sie sagte aber nur: »Aufdringlich? Nein … Wieso?« Und fügte, da Karin nicht antwortete, hinzu: »Er ist wirklich ein netter Junge.« Sie drückte ihren Kopf fester an Karins Schulter, während sie mit ziemlich schwerer Zunge redete.
»Du musst mir noch viel erzählen«, sagte Karin. »Später, so mit der Zeit.« Sie hatte angefangen, Johannas Haar zu streicheln. Sie streichelte auch ihre Stirne und ihre Ohren; dann blieb ihre Hand auf Johannas Hinterkopf liegen.
»Ja«, antwortete Johanna, die Augen geschlossen – sie sprach jetzt beinah wie aus dem Schlaf –, »man sollte eigentlich von nichts anderem reden. Immer nur davon. Aber ich kann nicht, Karin – ich kann nicht. Es ist ja so furchtbar schwer.« Sie seufzte tief. »Für meine Eltern ist es auch so furchtbar schwer«, fuhr sie fort mit der schläfrigen Stimme. »Und für den armen Georg. Bruno ist in Paris, Gott sei Dank. Du solltest ihn kennen …« Karin wusste gar nicht, wer Bruno war. Sie streichelte weiter das schöne Haar Johannas.
Die schlang ihre Arme fester um Karins Hals. »Es gibt jetzt Augenblicke«, flüsterte sie, »Augenblicke gibt es jetzt, wo mir alles so sinnlos vorkommt – so irrsinnig sinnlos … Ich denke dann: Warum bist du eigentlich hier? Du könntest doch auch genauso gut woanders sein. Warum hat man dich nicht in Deutschland behalten? – denke ich dann. Man hätte dich doch in Deutschland umbringen können, das wäre vielleicht das Beste gewesen. Ich habe dann ein Gefühl, als stürzte ich – als stürzte ich ununterbrochen. Es ist grauenhaft, weißt du … Und, pass auf!«, keuchte sie, von großer Angst wie von Eiseskälte geschüttelt, »pass auf, jetzt passiert bald etwas ganz ganz Fürchterliches – für uns alle. Wir sind ihm ausgeliefert – es kommt!« Sie hob das entsetzte Gesicht und starrte zu Karin hinauf mit Augen, die das Fürchterliche, was nahte, schon zu sehen schienen: Sie waren wie erblindet vor seinem grässlichen Anblick.
»Ach Karin, liebe Karin!«, sagte die arme Johanna.
Karins Gesicht aber blieb übergossen vom unbegreiflichen Frieden. Ihr sanftes, kühles Gesicht legte Karin an Johannas Gesicht, über das Tränen liefen. »Mein armer Liebling«, sagte sie. »Wir müssen es tragen.« Sie berührte mit ihren Lippen die feuchte und heiße Wange Johannas; sie berührte mit ihren Lippen Johannas Mund. Sie zog sie inniger an sich. Ihre Umarmung war nicht mehr die sanfte Geste der Freundinnen, die abends im vertrauten Gespräche sitzen. Sie hielten sich anders umschlungen.
Von diesem anderen war früher nichts in ihrer Kameradschaft gewesen. Da es nun da war und solche Macht hatte, ließ Johanna, die weinende, es geschehen – schluchzend dankbar für die unendliche Zärtlichkeit, mit der Karin ihren Kopf auf das Kissen bettete.
II
Sie schliefen bis gegen zehn Uhr vormittags. Karin war es, die zuerst aufwachte und die Johanna dann weckte. Johanna konnte sich noch ein paar Minuten lang nicht vom Bett trennen; sie war sehr verschlafen. Karin machte den Tee. Sie frühstückten in der Küche an einem Tisch, der mit Wachstuch bespannt war. Johanna wurde durch den Geruch des Wachstuchs an Kinderwindeln erinnert, was ihr unangenehm war. Keine von beiden hatte Lust, viel zu reden. Erst genierten sie sich ein wenig voreinander, weil jede ihre eigne Schweigsamkeit als eine Unhöflichkeit gegenüber der andren empfand. Als sie dann aber bemerkt hatten, dass eine so wenig zum Plaudern aufgelegt war wie die andre, zwang sich keine mehr zum Gespräch.
Sie verließen die Wohnung. Karin hatte das Auto nicht in der Garage eingestellt; es stand auf der Straße. Sie stiegen ein. Johanna hatte sich schon ge