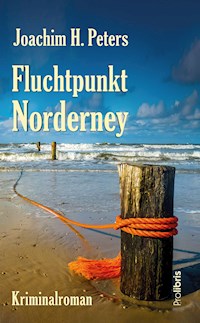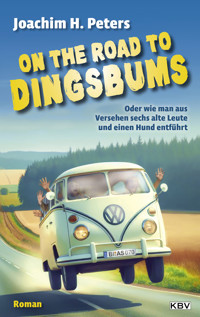Kapitel 1
13. März 1944
Heinz Peters atmete tief durch, als er vor das Haus Münzstraße 24b trat, in dem er als Lehrling der Allgemeinen Ortskrankenkasse seine
Ausbildung absolvierte. Die Luft in seiner Heimatstadt Königsberg hatte in den letzten Tagen einen ganz besonderen Geschmack bekommen.
Sie schmeckte nach Angst.
Angst vor den Russen, die immer schneller vorrückten und die deutschen Truppen in der Ukraine vor sich hertrieben. Angst, ob
die Bomben der Engländer nicht auch sie erreichen würden. Aber auch Angst vor den fanatischen Anhängern des Dritten Reiches, die immer noch an solche Dinge wie Endsieg und totale
Weltherrschaft glaubten.
Heinz Peters wusste nicht, was er glauben sollte. Er war nie so begeistert vom
Krieg gewesen wie sein Bruder. Der hätte vor zwei Wochen einen kurzen Heimaturlaub gehabt und sie wollten die
gemeinsame Zeit genießen. Aber er hatte diese Tage einsam und traurig verbringen müssen, denn Reinhard war gefallen.
Gefallen! Was für ein verharmlosender Ausdruck dafür, dass er eine Kugel in seinem Kopf abbekommen hatte. Reinhard war nicht
gefallen, Reinhard war getötet worden. Der Verlust schmerzte ihn noch mehr, wenn er darüber nachdachte, wofür der geliebte ältere Bruder sein Leben gelassen hatte. »Gefallen für Führer, Volk und Vaterland.« So hatte es in dem Schreiben gestanden, das er und seine Mutter erhalten
hatten.
Resigniert schüttelte Heinz Peters den Kopf, als er daran dachte, wie stolz Reinhard 1940 in
seiner neuen Wehrmachtsuniform in die Kamera des Fotografen geblickt hatte.
Drei Abzüge ließ er von dem Bild machen. Einen für den Bruder, einen für die Mutter und einen als Erinnerung für sich selbst. »Das Bild kommt in mein Fotoalbum, wenn der Krieg mal vorbei ist«, sagte er und trug das Foto, eingewickelt in Seidenpapier, immer in seinem
Soldbuch mit sich herum.
Reinhard war sicher, als er einrücken musste, dass der Krieg nicht lange dauern würde, eine kurze Angelegenheit. Aber er hatte sich getäuscht und seine letzte Begegnung mit dem Feld der Ehre war die russische Front im Frühjahr 1944 und sein letzter Gegner ein unbekannter russischer Soldat. Dessen
Kugel aus einem Mosin-Nagant-Repetierer, der Standardwaffe der sowjetischen
Infanterie, beendete Reinhards Traum von einem friedlichen Leben nach dem Krieg
schlagartig.
Und was hatten sich die Brüder nicht alles zusammen vorgenommen? »Wenn wieder Frieden ist, dann werden wir beide Berlin besuchen und ich werde dir
dort die hübschesten Mädchen des ganzen Reiches zeigen.« Der zwanzigjährige Reinhard hatte im Frühjahr 1941, im Rahmen seiner Verlegung an die russische Front, für zwei Tage zwangsweise Halt in der Reichshauptstadt machen müssen. Seitdem schwärmte er in jedem Brief an seinen Bruder über das Berliner Nachtleben und dessen Damenwelt. »In Berlin spürst du oft gar nicht, dass Krieg ist«, hatte er geschrieben, »hier pulsiert noch das Leben. Das müsstest du mal sehen.«
Immer wieder hatte Heinz den Brief in letzter Zeit hervorgeholt und gelesen.
Mittlerweile hatte er das dünne und billige Feldpostpapier schon so oft auf- und zu gefaltet, dass es an den
Kanten bereits ganz brüchig geworden war. Der Brief, in dem der Familie der Tod des Bruders mitgeteilt
worden war, war hingegen in gutem Zustand. Den hatte er nur ein einziges Mal
gelesen, gefaltet und dann weggelegt.
Seine Mutter hatte ihn zuvor minutenlang auf dem Küchentisch ihrer Königsberger Wohnung liegen lassen, bevor sie die Kraft gefunden hatte, ihn mit
zittrigen Händen zu öffnen. »Das ist nichts Gutes. Das ist nichts Gutes!«, flüsterte sie immer wieder vor sich hin und starrte den Brief lange an, als wäre er giftig. Nachdem sie ihn endlich geöffnet hatte, wurde ihr Gesicht aschfahl. Mühsam erhob sich Elna Peters und schlich wortlos und mit gebeugtem Rücken aus der Küche.
Heinz traute sich nicht, sie anzusprechen. Erst nachdem sich die Tür zum Schlafzimmer leise hinter ihr geschlossen hatte und er sie dort weinen hörte, brachte er den Mut auf, den Brief vom Küchentisch zu nehmen und ebenfalls zu lesen.
»Ich bedauere sehr… in tiefer Trauer … treuer Kamerad … für den Führer … heldenhaft …« Leere Worte, die nur eines aussagten: Reinhard war tot! Erschossen!
Nun würden sie niemals gemeinsam durch Berlin schlendern, schoss es ihm seltsamerweise
als Erstes durch den Kopf. Sie würden nicht mehr die Musik aus den unzähligen Kneipen und Spelunken hören, an denen sie hatten vorbeibummeln wollen. Sie würden nicht gemeinsam mit schönen Mädchen auf dem Ku’damm spazieren oder mit ihnen tanzen gehen. Doch dann schrak er plötzlich zusammen. Was für ein dummes Zeug dachte er denn da gerade? Sein Bruder lag steif und kalt in
einem Erdloch und er dachte an die Mädchen in Berlin? War er jetzt schon ganz von Sinnen? Musste er jetzt nicht für die Seele seines Bruders beten? Musste er nicht seine Mutter trösten?
Ohne dass er sich dagegen wehren konnte, kamen ihm trotzdem wieder die Mädchen auf dem Ku’damm in den Sinn. Es war, als wollten sie das Bild des toten Bruders mit aller
Macht verdrängen. Doch dann erschienen plötzlich zwei Worte, die sie aus seinem Kopf fegten und sich dort einbrannten.
Aus! Vorbei!
Und die Brandflecke, die sie hinterließen, wurden noch dunkler, als drei Wochen später seine Mutter vollkommen unerwartet starb. Der Arzt hatte ihm nicht genau
sagen können, woran, aber vermutete, dass es ihr gebrochenes Herz gewesen war.
Nun war er ganz allein.
Der Vater vermisst, der Bruder erschossen und die Mutter gestorben. Von seinem
Verdienst und dem bisschen Geld, das nach ihrer Beerdigung noch übrig war, kam er zwar so gerade über die Runden, aber es wurde aufgrund der schlechten Versorgungslage immer
schwieriger. Essen, trinken, schlafen, arbeiten. Und grübeln. Manchmal versank er komplett darin, dann wurden sogar Essen und Trinken überflüssig.
»Die Russen sind nicht mehr aufzuhalten!« Diese Aussage hörte man in Königsberg Anfang März immer öfter. Aber nur hinter vorgehaltener Hand, denn niemand traute sich, laut
auszusprechen, dass die Wehrmacht dem russischen Ansturm nicht mehr lange würde standhalten können. Wer so eine Meinung laut äußerte, der musste mit einer Anklage wegen Hochverrats rechnen und wurde schnell
das Opfer einer Kugel oder eines Stricks.
Heinz hatte nicht viele Freunde, den meisten Kontakt hatte er zu seinem
Arbeitskollegen Franz Willert, der bereits im dritten Lehrjahr war und auf
dessen Meinung Heinz sehr viel gab. »Der Führer hat versagt«, hatte er Heinz zugeflüstert, als sie in der Herrentoilette der Krankenkasse nebeneinander an den
Pissoirs gestanden hatten. »Mein Bruder ist gestern nach Hause gekommen. Die Ostfront ist nicht mehr zu
halten, hat er gesagt.«
»Wieso ist dein Bruder denn nicht mehr an der Front?« Heinz hatte ihn ungläubig angesehen. »Da wird doch momentan jeder Soldat gebraucht.«
»Kämpf mal mit nur einem Bein!« Franz Willert lachte verbittert auf. »Sie mussten ihm das Bein abnehmen, nachdem er sich einen Granatsplitter
eingefangen hat.« Er erzählte, sein Bruder habe mitanhören müssen, wie der Stabsarzt seinen Assistenten aufgefordert habe, das Bein
abzunehmen, weil für eine Operation weder Zeit noch Material vorhanden sei. »Zügig amputieren, verbinden, nach Hause schicken!«, so sein Befehl.
»Aber es heißt doch, der Führer …«, wandte Heinz leise ein.
»Ach was, der Führer!« Willert schlug wütend mit der flachen Hand gegen die Fliesen. »Der erzählt uns doch nur noch Lügen. Der Russe ist nicht mehr zu stoppen. Der überrennt uns einfach, der hat doch viel mehr Material und Menschen als wir.«
Heinz hörte ihm mit offenem Mund zu.
»Viel zu wenig Munition, viel zu wenig Panzer, sagt mein Bruder. Ein
aussichtsloser Kampf. Er ist froh, dass er nur sein Bein und nicht sein Leben
verloren hat.« Willert schnaufte verdrossen, dann hielt er plötzlich inne. Er sah Heinz mit ernstem Gesicht an. »Alles, was ich dir gerade gesagt habe, muss aber unter uns bleiben!« Erschrocken drehte er sich zu den Türen der Toilettenkabinen um. Zum Glück standen alle offen.
»Du weißt ja, wie solche Sachen geahndet werden, wenn dich einer anscheißt, oder?« Willert bildete aus Daumen und Zeigefinger eine Pistole und hielt sie sich an
die Schläfe. »Wehrkraftzersetzung! Hochverrat! Peng!«
Heinz Peters lief es eiskalt den Rücken hinunter. Allein schon dieses Gespräch hier war lebensgefährlich. Vor seinem inneren Auge sah er sich bereits neben anderen Verrätern in einem Massengrab liegen. »Aber was können wir denn jetzt machen?« Panik stieg in ihm auf.
Franz schnaufte verächtlich. »Was wir machen können? Nichts können wir machen. Nur abwarten. Aber ich sage dir eines, wenn es mir hier zu
brenzlig wird, dann bin ich weg. Mich kriegen die Russen nicht in die Finger.«
Der Schreck, der Heinz bei diesen Worten in die Glieder fuhr, ließ ihn erneut frösteln. Wenn Franz abhaute, dann gab es keinen Menschen mehr, mit dem er reden
konnte. Aber das würde ja vielleicht gar nicht geschehen. Vielleicht gelang es der Wehrmacht ja
doch noch, den russischen Vormarsch zu stoppen und sie wieder zurückzudrängen. Oder sollte Reinhard ganz umsonst gefallen sein?
»Ich glaube, ich würde mich nicht trauen abzuhauen. Ich bin doch noch in der Ausbildung und meine
Stelle …«
»Scheiß auf die Stelle, sieh zu, dass du am Leben bleibst. Ich habe …«
Er brach mitten im Satz ab, weil ein älterer Abteilungsleiter den Raum betrat. »Heil Hitler!«, grüßte er die beiden Jungen. Doch sein zum deutschen Gruß ausgestreckter Arm hatte nicht mehr die Höhe wie noch vor ein paar Monaten erreicht.
All diese Erinnerungen kamen Heinz in den Sinn, als er soeben den Münzplatz erreichte und auf das Denkmal von Friedrich I. zusteuerte, das vor dem
Schloss stand, solange er sich erinnern konnte. Daran musste er vorbei, dann über die Dominsel und weiter in Richtung Ost-Bahnhof bis zu seiner Wohnung in der
Schleusenstraße.
Was Franz ihm über die Ostfront erzählt hatte, hatte ihn nachdenklich werden lassen. War die deutsche Wehrmacht
wirklich nicht mehr imstande, sich dem Feind entgegenzustellen? Würden die Russen irgendwann tatsächlich mal Königsberg erreichen?
»Hey, du da!« Ein brüsker Anruf riss ihn aus seinen Gedanken. Er sah sich um und entdeckte im runden
Torbogen, dem Eingang des Schlosses, einen Mann in Uniform.
»Ja, dich meine ich, Bürschchen.« Der Soldat winkte herrisch mit dem Arm. »Jetzt guck nicht so blöd, sondern komm her!«
Etwas unentschlossen ging Heinz auf den Mann zu. Der trug die Uniform eines
Hauptmanns und wirkte sehr ungeduldig.
»Los, mitkommen!«
Der Mann war fast einen Meter neunzig groß und seine linke Wange war von einer Narbe verunstaltet, die vermutlich durch
einen Schmiss entstanden war. Der Direktor seiner Schule hatte auch so eine und
die stammte aus seiner Zeit in einer schlagenden studentischen Verbindung, wie
er ihnen immer wieder und voller Stolz erzählt hatte.
Als der Offizier sah, dass Heinz sich anschickte, seiner Aufforderung
nachzukommen, drehte er sich hastig um und marschierte auf den Eingang des
Schlosses zu. Er schien sehr selbstsicher zu sein und erwartete anscheinend
weder einen Widerspruch, noch schien er zu befürchten, dass der junge Mann hinter seinem Rücken abhaute.
Verunsichert trabte Heinz gehorsam hinter dem Hauptmann her. Erst auf dem
Schlosshof blieb er wieder stehen, vor einem Stapel großer Kisten. Sie standen kreuz und quer neben einer der Treppen, die in die
Kellerräume des Gebäudes führten.
»Verdammte Ostpreußen!«, knurrte der Hauptmann mit einem deutlichen Berliner Dialekt. »Kaum lässt man das Pack mal kurz aus den Augen, machen sie sich aus dem Staub.« Verdrossen nahm er die Schirmmütze ab und wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. »Das verdammte Drecksvolk sollte die alle längst in den Keller getragen haben.« Mit einer fahrigen Handbewegung wies er auf den Kistenstapel.
Genau in diesem Moment erschienen zwei Soldaten im Eingang des Schlosses, die
sich mit einer weiteren Kiste abmühten. Die Männer waren Mannschaftsdienstgrade, wie Heinz unschwer an ihren Rangabzeichen
erkennen konnte.
»Nummer zwölf, Herr Hauptmann«, rief der blonde der beiden Männer keuchend seinem Vorgesetzten zu und deutete auf die Zahl, die mit weißer Kreide auf die große Kiste gemalt worden war. Davor stand die Buchstabenfolge BSZ.
Der Hauptmann nahm daraufhin eine Kladde zur Hand, die er aus seiner Brusttasche
gezogen hatte, zückte einen Bleistift, leckte kurz die Mine an und machte einen Eintrag. »Wo ist Eichberg?«, wollte er dann von seinen beiden Untergebenen wissen.
»Der ist oben und nagelt die anderen Kisten zu, Herr Hauptmann.« Der schwarzhaarige Soldat hatte sich erschöpft auf einer der anderen Kisten niedergelassen.
»Gehen Sie wieder rauf und nehmen Sie den hier mit, der kann mit anpacken.« Er drehte sich halb um und deutete auf Heinz. »Du wirst meinen Leuten beim Heruntertragen der restlichen Kisten helfen!
Verstanden, Bürschchen?«
Heinz Peters starrte den Offizier erschrocken an. »Aber ich muss doch nach Hause«, versuchte er sich diesem Auftrag zu entziehen, »bin ganz alleine und muss alles selber machen, Essen kochen und so!«
»Alleine?« Der Hauptmann grinste gehässig. »Umso besser, dann wird dich ja keiner vermissen. Und nun macht, dass ihr wieder
nach oben kommt. Erst alle Kisten runter auf den Hof, dann ab in den Keller!« Er setzte die Mütze wieder auf und kontrollierte ihren korrekten Sitz, dann öffnete er einen Knopf seines Uniformrocks und steckte die Kladde halb hinein.
Die beiden Soldaten trotteten ergeben wieder zurück ins Schloss und der junge kaufmännische Angestellte folgte ihnen widerstrebend. Auf der Treppe drehte sich der
Blonde zu ihm um. »Na, Jungchen, hast dich nicht rechtzeitig aus dem Staub machen können, was?« Sein masurischer Dialekt war Heinz sofort aufgefallen. »Nun, dann wirst jetzt wohl schwitzen müssen.« Er boxte seinem dunkelhaarigen Kameraden verschwörerisch in die Seite. »Siehst, Johannes, es werden doch jeden Tag noch neue Helden geboren.«
Misslaunig und wortlos trottete Heinz hinter ihnen her. Dem Befehl des
Hauptmanns nicht Folge zu leisten, das traute er sich nicht. Der Mann sah aus,
als sei ihm alles zuzutrauen. Als sie im nächsten Stockwerk ankamen, sah er am Ende eines langen hohen Gangs, in den sie
einbogen, bereits die gestapelten großen Kisten, die der Hauptmann gemeint hatte. Es waren sicherlich noch ein
Dutzend.
In diesem Moment hallte ihnen ein Fluch entgegen. »Verdammte Scheiße!« Wütend warf ein anderer Soldat einen Hammer auf die vor ihm stehende Holzkiste und
steckte sich den Daumen in den Mund. »Verdammte polnische Nägel! Jeder von diesen Dreckdingern geht krumm. So können wir den Krieg ja nicht gewinnen.« Er hatte die schwere Holzkiste zunageln wollen, als der Schlag danebengegangen
war.
»Na, Eichberg, bist sogar zu blöd zum Nageln?«, frotzelte sein blonder Kamerad.
»Da ist die nächste!«, verkündete besagter Eichberg, immer noch mit dem Daumen im Mund und schmerzverzerrtem
Gesicht. Er deutete auf die Kiste mit der Aufschrift BSZ 13.
»Wahrscheinlich wieder so schweineschwer wie die anderen«, stöhnte der Blonde, dann drehte er sich grinsend zu Heinz um. »Na, woll’n mal sehen, was du so in den Armen hast, Jungchen.« Er spuckte in die Hände und marschierte auf die große Kiste zu. »Los, pack schon mit an!« Gleichzeitig bückte er sich und schob die Hände unter den Holzboden.
Widerstrebend griff Heinz ebenfalls zu und dachte beim Anheben, ihm würde der Rücken brechen. Stöhnend setzte er die Kiste sofort wieder ab. »Wie schwer ist die denn. Was ist da bloß drin?«
Der Soldat lachte hämisch auf. Er schien sich über den untrainierten jungen Mann zu amüsieren. Endlich einer, der noch mehr zu leiden hatte als er und auf den er
herabsehen konnte wie die Offiziere auf ihn. Doch er wurde schnell wieder
ernst. »Nun komm schon, pack endlich an, wir woll’n so schnell wie möglich fertig werden und dann wieder zurück zu unserem Haufen.«
»Welcher Haufen?«, fragte Heinz verständnislos.
»Na, zu unserer Einheit. Wir sind nur abkommandiert worden, um dem Herrn
Hauptmann zu helfen.« Sein Gesicht hatte bei der Nennung des Dienstgrades einen zynischen Ausdruck
angenommen. »Und jetzt fass endlich mit an!«, schnauzte er.
Mühsam hoben sie die große Kiste hoch und schwankten unter ihrem Gewicht den langen Korridor entlang.
Kurz bevor sie an der Treppe ankamen, blieben sie noch einmal stehen, damit
Heinz nachfassen konnte.
Heinz stolperte plötzlich und konnte sich nur mühsam aufrecht halten. Mit einem gotteslästerlichen Fluch auf den Lippen wankte der Blonde hilflos hinter ihm her. Nur
mit viel Mühe konnten sie die schwere Kiste wieder ausbalancieren und atmeten erleichtert
auf, als sie wohlbehalten auf dem nächsten Treppenabsatz ankamen.
»Setz ab!«, schnauzte der Soldat und Heinz ließ die Kiste sofort erleichtert zu Boden sinken.
»Also, was ist da drin?«, wollte er erneut wissen, während er zusah, wie der Blonde ein riesiges Taschentuch aus der Uniformhose zog
und sich den Schweiß vom Gesicht wischte.
»Na, was glaubst?« Mit der freien Hand tippte der Soldat auf die Beschriftung BSZ.
Heinz zuckte ahnungslos mit den Achseln.
»Mannchen, Mannchen, die Jugend von heute. Habt ihr denn keinen
Heimatkundeunterricht gehabt?« Er ließ sich mit einer Gesäßhälfte auf der Kiste nieder. »Was war das Kostbarste, das es hier im Schloss zu besichtigen gab?«
Heinz überlegte. Er war nur einmal im Schloss gewesen. Aber das war nun auch schon
wieder zwei Jahre her und dieser Besuch hatte im Rahmen eines Schulausfluges
stattgefunden. Er erinnerte sich, dass er viele schöne Dinge gesehen hatte. Gemälde, Wandteppiche, kostbare Vasen, goldene Statuen. Jetzt aber waren die Gänge leer und die Wände kahl. Sollte das alles in den Kisten sein? Aber dafür war der Stapel eindeutig zu klein und Gemälde wären auch nicht so schwer. Doch was konnte da sonst noch Wertvolles drin sein? Er
gab auf und zuckte mit den Achseln.
Der Blonde grinste ihn mitleidig an. »Na, überleg noch mal! Was hat dich hier im Schloss besonders begeistert?«
In dem Moment wurde es ihm alles klar. »Das Bernsteinzimmer!« Heinz erinnerte sich plötzlich wieder an das goldgelbe Licht, das den Raum erfüllt hatte, in dem Teile des Zimmers der Bevölkerung vorgestellt worden waren, das war wohl der Anlass für den Ausflug mit seiner Klasse gewesen. Wände waren mit Tafeln aus Bernstein, dem Gold der Ostsee, verkleidet gewesen.
Wunderschöne Mosaike waren darin eingelassen. In dem Raum hatten die schönsten Kommoden und Möbel gestanden, die er je gesehen hatte. Dazu gab es noch jede Menge an goldenen
Figuren und Gemälde in goldenen Rahmen. Über allem hatten goldene Leuchter gehangen und die vielen Spiegel hatten diesen
außergewöhnlichen Prunk noch vervielfacht. Es schien nichts zu geben, was nicht aus Gold
oder dem kostbaren Schmuckstein der Ostsee bestand. Der sanfte bräunlich-beige Ton des Bernsteins schien den Raum komplett zu beherrschen und
strahlte eine beruhigende Wärme aus.
Heinz konnte sich nicht daran erinnern, jemals etwas so Schönes und Kostbares gesehen zu haben. Ihm fiel wieder ein, dass ihr Lehrer ihnen
erzählt hatte, dass Friedrich I. einst den Bau dieses sagenhaften Zimmers für das Berliner Stadtschloss in Auftrag gegeben hatte. Im Jahre 1716 war es von
seinem Sohn, Friedrich Wilhelm I., den man später auch den Soldatenkönig nannte, an den russischen Zaren, Peter den Großen, verschenkt worden. Fast zwei Jahrhunderte blieb es im Katharinenpalast in
der Nähe von Sankt Petersburg. Im Jahre 1941, nach dem Einmarsch der Wehrmacht, wurde
es als Kriegsbeute ab- und im Königsberger Schloss wieder aufgebaut.
»Aber das war ein ganzer Raum!« Ungläubig starrte Heinz auf die Kiste. Man sah ihm die Ratlosigkeit an. »Heißt das, ihr habt das ganze Bernsteinzimmer abgebaut und in Kisten …?«
Der Blonde lachte auf. »Wir sind doch nur dumme Landser und zum Schleppen da, Jungchen.« Er stopfte sein Taschentuch zurück in die Hosentasche. »Ne, das haben andere gemacht. Wir sind hier nur für die Drecksarbeit zuständig.« Widerwillig stand er auf. »Und nun pack endlich an, ich will hier nicht rumstehen, wenn der Hauptmann
wieder auftaucht.«
Als die beiden mit der schweren Kiste den Hof erreichten, stürmte soeben ein anderer Soldat aus dem Kellerraum. Im Lauf warf er seinen
Stahlhelm weg und rannte in seinen schweren Wehrmachtstiefeln über den Hof auf das Schlosstor zu. Der Lärm, den seine genagelten Sohlen machten, hallte von den Wänden wider. Der will tatsächlich abhauen, schoss es Heinz siedend heiß durch den Kopf, als er die wilde Entschlossenheit im Gesicht des Soldaten sah.
Einen Augenblick später stürmte auch der Hauptmann aus dem Keller. Sein Gesicht war zornesrot und die
Schirmmütze fehlte. Noch während er die Treppenstufen hinaufrannte, hantierte er am Verschluss seiner
Pistolentasche herum, und als er den Schlosshof erreichte, hatte er die Waffe
bereits gezogen. »Bleib stehen, du Schweinehund!«, schrie er und richtete den Lauf seiner Luger auf den fliehenden Soldaten. Der
Arm des Offiziers hob und senkte sich im Takt seiner heftigen Atemzüge. Doch der Soldat ignorierte den Befehl und lief einfach weiter. Er hatte das
Schlosstor fast erreicht und machte noch immer keine Anstalten, stehen zu
bleiben.
Nur noch wenige Meter, dann ist er in Sicherheit, dachte Heinz, der dem
Geschehen mit offenem Mund zusah und seltsamerweise hoffte, dass es der Soldat
bis nach draußen schaffen würde. Doch noch bevor er diesen Gedanken zu Ende gedacht hatte, hallte ein Schuss
über den Schlosshof.
Das abgefeuerte Geschoss traf den Mann in den Rücken und gab dem Laufenden damit noch mehr Schub nach vorne. Heinz hatte sogar
den Eindruck, als würde der Soldat von einem Seil nach vorne gerissen. Er sah, wie der Kopf nach
hinten ruckte und der Mann die Arme in die Höhe reckte, wie er strauchelte und vornüber mit dem Gesicht auf das Pflaster fiel.
Heinz kam es vor, als habe sich das alles in Zeitlupe abgespielt. Ihm war, als säße er in einem Kinosessel und wäre nur ein unbeteiligter Zuschauer. Doch als der Mann sich nicht mehr rührte und plötzlich Blut unter seinem Körper hervorlief, wurde ihm klar, dass das hier die brutale Realität war. Was da vor ihm auf dem Schlosshof lag, war ein Toter, kein Schauspieler.
Erschossen! Aber nicht vom Feind im ehrenvollen Kampf, sondern hinterrücks von seinem vorgesetzten Offizier. Heinz brachte kein Wort heraus, sein Mund
war wie ausgetrocknet und auch der Blonde hatte nur sprachlos zusehen können.
Der Hauptmann ging zu dem Mann hinüber, hob dessen Schulter nur kurz mit dem Fuß an, dann richtete er die Waffe auf dessen Hinterkopf. Ein weiterer Schuss
hallte wie ein Peitschenschlag über den Schlosshof. Heinz zuckte zusammen, als hätte er ihn abbekommen. Gleichzeitig sah er, dass der Blonde seine Hand in
Richtung Pistolentasche bewegte, dann aber innehielt und die Finger so fest zur
Faust ballte, dass die Knöchel weiß hervortraten.
In diesem Augenblick drehte sich der Hauptmann mit der noch rauchenden Pistole
in der Hand zu ihnen um und starrte den Blonden an. Es schien fast so, als habe
er geahnt, welchen Gedanken der Mann hinter ihm soeben gehegt hatte. »Als ich in den Keller gekommen bin, war eine der Kisten aufgebrochen und der da
hat sich drübergebeugt.« Mit dem Kopf deutete er achtlos auf den Toten. »Als ich ihn zur Rede stellen wollte, hat mich dieses Schwein da angegriffen!« Immer noch schnaufte er. Dann hob er erneut die Waffe und zielte damit in ihre
Richtung. Sein ganzer Körper bebte. »Soweit kommt es noch, dass hier jemand die Hand gegen mich erhebt.«
Erst jetzt bemerkte Heinz den dünnen Blutfaden, der dem Hauptmann aus der Nase lief. Der blickte sich auf dem
Schlosshof um und stellte fest, dass Heinz und der blonde Soldat die einzigen
Zeugen des Vorfalls gewesen waren. Bedrohlich langsam und ohne sie aus den
Augen zu lassen, kam er auf sie zu, die Waffe weiterhin auf sie gerichtet.
»Los, ihr zwei! Schafft ihn weg und seht zu, dass ihr wieder an die Arbeit kommt,
oder wollt ihr etwa aufmucken?« Fahrig putzte er sich mit dem Jackenärmel das Blut von der Oberlippe.
Als sie zögerten, seinem Befehl nachzukommen, hob der Offizier die Waffe auf Augenhöhe an, und da sie sich daraufhin immer noch nicht rührten, richtete er sie auf den Blonden und spannte den Hahn. »Los, wird’s bald? Nun macht schon, ihr Gesindel!«, schrie er mit sich überschlagender Stimme.
Einen Augenblick lang schien die Zeit stillzustehen und Heinz glaubte, die
eisige Atmosphäre auf dem Schlosshof fast mit den Händen greifen zu können. Atemlos wartete er auf den nächsten Schuss … und auf den übernächsten.
Der Blonde hielt dem Blick des Hauptmanns nur noch eine weitere Sekunde stand,
dann senkte er ihn endlich. »Jawohl, Herr Hauptmann!«
Der Offizier sah noch einmal von einem zum anderen, anschließend ließ er langsam die Waffe sinken. Eine Sekunde später drehte er sich um und rannte zurück in den Keller.
Heinz hatte wie erstarrt zugeschaut. Erst als der Blonde sich wieder rührte, kam auch er zur Besinnung. Erleichtert atmete er auf. »Was machen wir denn jetzt?«, fragte er den Soldaten mit zittriger Stimme.
Der jedoch schien ihm nicht zuzuhören. Er stand immer noch mit geballten Fäusten da, atmete jetzt keuchend und hielt die Augen geschlossen. »Dieses Schwein«, presste er zwischen den Zähnen hindurch, »dieses verdammte Schwein! Er hat Fritz einfach hinterrücks abgeknallt.« Fassungslos blickte er zu seinem toten Kameraden hinüber. Dann ging er wie in Trance zu der Leiche und ließ sich neben ihr auf die Knie nieder. Vorsichtig fasste er den Toten an der
Schulter an und drehte ihn herum. Durch den Schuss in den Hinterkopf fehlte
fast das ganze Gesicht des Toten.
Als Heinz näherkam, sah er, dass an der Jacke des Toten drei Knöpfe geöffnet waren und etwas Gelblich-Braunes daraus hervorschaute. Noch bevor er
erkennen konnte, was es war, hatte der Soldat es auch schon herausgezogen und
hastig in seiner Jacke verschwinden lassen. Dann drehte er den Toten zurück auf sein zerschossenes Gesicht, richtete sich auf und starrte Heinz mit einem
bedrohlichen Blick an.
»Du hast nichts gesehen, hörst? Halt bloß deine Schnauze, sonst …« Er ließ den Rest der Drohung offen und winkte ihn stattdessen zu sich heran. Als er
bemerkte, dass der Junge nicht reagierte, machte er einen schnellen Schritt auf
ihn zu. »Was stehst da rum? Los, komm mit und fass an!«, schnauzte er. Als Heinz sich nicht rührte, kam er zurück, ergriff ihn an der Jacke und zog ihn mit sich zu dem Toten.
Dort angekommen fasste der Blonde seinen erschossenen Kameraden an den Händen und wartete darauf, dass Heinz dessen Stiefel in die Hand nahm. Doch der
stand wie gelähmt vor der Leiche. Er hatte noch nie einen Toten gesehen, geschweige denn einen
angefasst.
»Nun mach schon oder willst auch von diesem Irren erschossen werden?«
Widerstrebend ergriff Heinz die Beine des Toten und gemeinsam hoben sie ihn
hoch. Da sie seine Position nicht veränderten, der Kopf also weiter nach unten zeigte, musste Heinz das zerschossene
Gesicht nicht sehen. Mühsam schafften sie es, ihn im Tordurchgang des Schlosshofes ein Stück zur Seite zu tragen und legten ihn dann sanft an der Mauer ab.
Der blonde Soldat blickte sich verschwörerisch um. Dann packte er Heinz an den Rockaufschlägen und zog ihn nah zu sich heran. Ihre Gesichter waren nur noch ein paar
Zentimeter voneinander entfernt, seine Stimme nur noch ein Flüstern. »Jungchen, ich weiß ja nicht, was du jetzt machst, aber ich haue ab, bevor mich dieser Irre auch
noch abknallt.« Mit dem Kopf deutete er durch das Tor in Richtung Schlossplatz und hielt die Hände schützend über das, was er unter seiner Jacke verborgen hielt, dann ließ er ihn los und entfernte sich langsam rückwärts in Richtung Freiheit.
»Aber was wird denn jetzt aus den Kisten? Aus dem Bernsteinzimmer?«, rief ihm Heinz leise hinterher. »Die kann man doch hier nicht so einfach stehen lassen.« In dem Augenblick, in dem er diesen Satz aussprach, wurde ihm bewusst, welch
sinnlose Gedanken wieder mal durch seinen Kopf geisterten.
»Scheiß auf das Bernsteinzimmer!«, raunte der Blonde zurück und schob sich langsam immer weiter rückwärts in Richtung Schlosstor. »Kannst ja gerne hierbleiben und mithelfen, den ganzen Plunder in den Keller zu
schleppen. Vielleicht kommst du dann ja lebend davon, aber es kann auch sein,
dass du zum Dank dafür als Mitwisser erschossen wirst.«
Ohne ein weiteres Wort warf er sich plötzlich herum, rannte die letzten paar Meter bis zum Tor, passierte es und
verschwand sofort um die Ecke. Augenblicklich war er nicht nur außer Sicht, sondern auch außer Reichweite der Waffe des Offiziers.
Heinz blieb noch einen Atemzug lang unschlüssig stehen. Dann fiel sein Blick wieder auf den erschossenen Landser. Im
Bruchteil einer Sekunde traf er seine Entscheidung. Nein, er wollte nicht
erschossen werden wie der. Nein, er wollte leben!
So schnell er konnte, rannte auch er nun durch das Tor auf den Schlossplatz
hinaus und bog sofort nach rechts in Richtung Dominsel ab. Der Blonde war
bereits wie vom Erdboden verschluckt. Heinz hielt das hohe Tempo solange
aufrecht, bis er außer Sicht des Schlosses war, dann fiel er in einen Trab und hoffte, sein Zuhause
so schnell wie möglich zu erreichen.
Während er lief, überlegte er, dass der Offizier nicht wissen konnte, wo er wohnte, denn er hatte
ihn weder nach seinem Namen noch nach seiner Adresse gefragt. Also würde er zu Hause in Sicherheit sein.
Als er über die Schmiede Brücke hastete, fiel ihm ein, dass der Offizier ihn erst auf dem Münzplatz angesprochen hatte, also weit entfernt von seinem Arbeitsplatz, auch
dort würde er also nicht damit rechnen müssen, dass der Hauptmann auftauchte. Aber auf jeden Fall würde er die Gegend um das Schloss in den nächsten Tagen meiden müssen. Solange bis die Soldaten wieder weg waren. Das würde zwar einen erheblichen Umweg bedeuten, aber sicher war sicher.
Als er die Dominsel schon ein ganzes Stück hinter sich gelassen hatte, musste er wieder an das gelblich-braune Etwas
denken, das der Soldat dem Toten abgenommen und in seiner Uniformjacke
versteckt hatte. War das wirklich ein Stück vom Bernsteinzimmer gewesen? War der Mann ein ganz gewöhnlicher Dieb? Was war denn mit seiner Soldatenehre? Er sollte doch das
Vaterland schützen und es nicht beklauen. Insgeheim hoffte Heinz, dass man den Mann zu fassen
bekam und das gestohlene Stück wieder zu den anderen kam. Und wenn die Kisten dann komplett im Keller des
Schlosses lagerten, dann war das Bernsteinzimmer endlich in Sicherheit.
Und dann fiel ihm noch etwas anderes ein. Das Datum. Heute war der 13. März 1944. Es war sein 16. Geburtstag.
Kapitel 2
März 2020
Der Wind hatte mittlerweile eine Stärke von sechs Beaufort erreicht und fegte aus westlicher Richtung, von Juist
kommend, über Norderney hinweg. Im Hafen, dessen sichelförmige Einfahrt für ruhiges Wasser sorgte, sang er sein Lied in den Masten der dort festgemachten
Segelyachten. Immer wenn eine neue Böe die senkrechten Stahlseile erfasste und sie gegen deren moderne
Leichtmetallmasten schlug, entstand eine Art maritimes Glockenspiel, wie man es
aus vielen Häfen kannte.
Die Fähre, die von der Insel zum Festland zurücklief, stampfte gegen immer größer werdende Wellen mit brechenden Köpfen an. Überall auf dem dunklen Wasser sah man weiße Schaumflecken und der ein oder andere Urlauber, der die Insel verließ, kämpfte entweder unter Deck oder aber bereits über die Reling gebeugt gegen seine aufkommende Seekrankheit an.
Aber nicht nur der Sturm hatte das Meer und die Insel in festem Griff, sondern
auch die Angst. Ein neu entdecktes und äußerst gefährliches Virus begann sich von China kommend über die ganze Welt zu verbreiten und hatte bereits viele Tote gefordert. Zusätzlich zu seiner Gefährlichkeit, vor allem für ältere Menschen, kam noch seine hohe Infektionsrate. Viele Epidemiologen fragten
sich, ob man es jemals in den Griff bekommen würde, denn ein Serum dagegen gab es noch nicht. Doch die Wissenschaftler gaben
nicht auf und forschten Tag und Nacht.
Mehr und mehr kam der Tourismus an vielen Orten der Welt zum Erliegen. Das galt
auch für Norderney. Man merkte zwar langsam überall, dass die Mehrzahl der Menschen immer vorsichtiger wurde, aber einige
Unentwegte und Unverbesserliche ignorierten die Gefahr einfach, andere
negierten sie komplett und hingen lieber ihren eigenen Verschwörungstheorien nach, als sich an wissenschaftlichen Fakten zu orientieren.
Daher wunderte es Koslowski auch nicht, dass am Anleger immer noch vereinzelte
Besucher von den Fähren stiegen. Aufgrund der Umstände zwar deutlich weniger, aber sie kamen immer noch. Soeben verließ eine Gruppe von zehn jungen Männern die Frisia IV. Suchend sahen sie sich an Land um. Dann deutete einer von
ihnen auf den wartenden Inselbus und die Gruppe setzte sich langsam dorthin in
Bewegung.
Seltsam, dachte Koslowski, normalerweise ist doch eher der Herbst die Zeit für Fahrten von Kegelclubs, Sportvereinen oder anderen Grüppchen. Aber wer weiß, worum es sich bei dieser Gruppe handelte, denn im Gegensatz zu Party– oder Feriengästen waren die jungen Männer nicht ausgelassen, sondern verhielten sich eher ruhig und schweigsam. Als
er genauer hinsah, fiel ihm auf, dass jeder von ihnen eine größere Reisetasche mitführte. Vielleicht waren es ja auch Surfer? War es schon zu stürmisch oder waren die Windverhältnisse für sie noch verlockend? Aber wo war dann ihre Ausrüstung? Ob die bereits auf der Insel war?
Plötzlich durchlief ein Schauer seinen Körper. Was für Gedanken machte er sich denn da? Was interessierten ihn die Angelegenheiten
und Absichten anderer Leute? Er hatte weiß Gott doch genug eigene Probleme, die ihn beschäftigten. Oder, treffender ausgedrückt, die ihn fest im Griff hatten.
Wenn er ehrlich war, wusste er noch nicht einmal genau zu sagen, warum er überhaupt zum Hafen gegangen war. Wenn ihn die Ruhelosigkeit packte, lief er los,
ohne nachzudenken. Vielleicht war ihm seine eigentlich recht geräumige Ferienwohnung plötzlich zu eng geworden. Vielleicht hatte er seinen Gedanken entkommen wollen,
die um die schlimmen Erlebnisse der letzten Wochen kreisten. Vergeblich, er war
in ihnen gefangen, nahm kaum wahr, was um ihn herum geschah. Die Erinnerung an
die schrecklichen Ereignisse hatten dafür gesorgt, dass er aus seiner Wahlheimat Ostwestfalen-Lippe geradezu nach
Norderney geflüchtet war. Er wollte räumlichen und in der Folge hoffentlich gedanklichen Abstand gewinnen. Bislang war
es ihm nicht gelungen. Was er erlebt hatte, war zu grausam gewesen.
Er sah sie wieder vor sich: die alte Grube, die vor vielen Jahren als Kühlkeller in einem Hang in der Nähe des Detmolder Freilichtmuseums ausgehoben und ausgemauert worden war. Später, nachdem er von seinen Erbauern nicht mehr benutzt und seine Decke eingestürzt war, geriet er in Vergessenheit, bis er erst zu einem Verlies und im Laufe
weniger Tage zu einem Grab wurde.
Seine Gedanken führten ihn zurück zu der Grube, die von Scheinwerfern gnadenlos grell ausgeleuchtet war. Alle
ausgerichtet auf die Leiche, die in zusammengekrümmter Haltung auf dem Boden lag und deren Verwesung bereits eingesetzt hatte.
Selbst jetzt, bei hellem Tageslicht, hatte er dieses Verlies ebenso wieder vor
Augen wie den Dunst, der zwischen den umstehenden Bäumen umhergewabert war und der Szene zusätzlich noch etwas Gespenstisches verliehen hatte.
Er sah sich selbst wieder vor diesem Grab stehen und auf die Leiche des Mannes
blicken, den er als seinen Freund bezeichnete und der, obwohl schon länger pensioniert, letztendlich doch noch das Opfer seines Berufes geworden war.
Denn Eugelink hatte seinen Mörder während seiner Dienstzeit als Polizist wegen eines Angriffs auf einen Geistlichen
verhaftet. Und damit hatte er in dem Täter einen heftigen Funken der Rache angefacht, der so lange geschwelt hatte, bis
er bei seiner Haftentlassung zu einem vernichtenden Feuer geworden war.
Sein Mörder hatte sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Etwas Grausames und Brutales.
Ein langsamer und qualvoller Tod durch Verhungern und Verdursten in einem
unterirdischen Verlies, in das er sein Opfer eingesperrt hatte. Dabei ließ er sich von den Geschichten, Fantasien und den Ängsten des amerikanischen Dichters Edgar Allan Poe inspirieren und bezeichnete
sich selbst nach dessen berühmtem Gedicht als Der Rabe.
Frierend zog Koslowski seine Jacke enger um sich, doch das nutzte ihm nicht
viel, denn die Kälte kam aus seinem Inneren, war nicht vom Wind und dem einsetzenden Regen
erzeugt. Sie nährte sich auch aus seinen Erinnerungen. Neben dieser Kälte überfiel ihn in letzter Zeit immer öfter ein Zittern seiner Hände, das er nur schwer verbergen konnte. Sobald die schrecklichen Erinnerungen
zurückkamen und der Film vor seinem inneren Auge wieder und wieder ablief, begann
es. Dann konnte er die Hände kaum stillhalten und musste, um es zu verbergen, die Finger ineinander
verschränken und so fest zusammenpressen, dass die Knöchel weiß hervortraten. Wie ein Alkoholiker, der unbedingt nüchtern erscheinen wollte, bemühte er sich krampfhaft darum, dass andere diese Schwäche nicht bemerkten.
Derjenige, der Eugelink entführt hatte, war erschossen worden, bevor man den ehemaligen Polizeibeamten
gefunden hatte. Und so nahm er sein Geheimnis, wo er ihn versteckt hatte, mit
ins Grab. Koslowski konnte der jungen Polizeibeamtin, die den Schuss abgegeben
hatte, keinen Vorwurf machen. Sie hatte ihm selbst damit das Leben gerettet.
Aber wofür? Er verzweifelte daran, dass er den Freund nicht hatte retten können.
Mit hochgeschlagenem Kragen und tief in die Jackentaschen versenkten Händen drehte Koslowski dem Hafenterminal den Rücken zu und begann am Hafenbecken entlangzulaufen.
Die ganze Geschichte ging natürlich durch die Presse und eine Menge Klugscheißer, die kaum etwas über den Fall wussten, fragten großspurig, wie so etwas hatte passieren können. Ob man den Täter nicht durch Karate oder Judo hätte ausschalten können? Warum hatte man keinen Psychologen hinzugezogen, um den Täter zur Aufgabe zu bewegen?
Noch schlimmer waren einige Kommentare in den sozialen Netzwerken. Zwar gab es
jede Menge Beileidsbekundungen, aber auch einige Kommentare wie »Das war doch nur ein Bulle, der da gestorben ist« oder »Wer weiß, ob der das nicht sogar verdient hat.« Manch einer postete aber auch nur vier Buchstaben: ACAB – All cops are bastards. Koslowski hatte nur einmal kurz in diese Medien
hineingeschaut und dann angewidert sein Smartphone auf den Tisch geschleudert.
Was waren das für Menschen, die solche Kommentare schrieben?
Erst dieser sinnlose Tod und dann auch noch dieser unbändige Hass. Koslowski spürte, wie bei diesen Gedanken plötzlich auch wieder Wut in ihm hochkochte. Wurden die Menschen immer gefühlloser? Dachten sie dabei nicht an den Mann, der sein Leben auf grausame Art
und Weise verloren hatte? Oder an dessen Familie, insbesondere an seine beiden
Söhne?
Er hatte darauf bestanden, dabei zu sein, als man ihnen die Nachricht vom
gewaltsamen Tod ihres Vaters überbrachte. Sie klammerten sich an ihre Mutter, die kaum in der Lage war, ihnen
Trost zu schenken, weil sie selbst von der Trauer übermannt wurde. Nach dem ersten Schock versuchte Koslowski, ihnen zu erläutern, wie es zu der Tragödie gekommen war. Und auch wenn Eugelinks Frau ihm versicherte, dass er keine
Schuld trug, so ließen die Blicke der beiden Jungen keinen Zweifel daran aufkommen, was sie darüber dachten.
Ihm war klar, dass sie die Umstände und Zusammenhänge noch nicht richtig begreifen konnten, aber sie kannten ihn schon länger und hatten des Öfteren erlebt, in welchen Schwierigkeiten er und sein Vater bisweilen gesteckt
hatten. Doch trotz aller Widrigkeiten waren sie dabei immer wieder mit dem
sprichwörtlich blauen Auge davongekommen. Diesmal hatte einen von ihnen das Glück verlassen, und Koslowski war sich klar, dass er den Jungen nicht erklären konnte, warum es ihm nicht gelungen war, ihren Vater zu beschützen. Wie auch ihre Mutter machten sie ihm niemals offen Vorhaltungen, doch ihr
unausgesprochener Schuldvorwurf, als er ihnen am noch offenen Grab seines
Vaters sein Beileid aussprach, stand seitdem wie eine unsichtbare Mauer
zwischen ihnen.
Einige Tage später besuchte er sie noch einmal, doch die Atmosphäre blieb kalt und er kam ihnen nicht wieder nahe. Als er noch einmal versuchte,
ihnen alles zu erklären, standen die beiden Jungen auf und verließen wortlos den Raum. Ihre Mutter hinderte sie nicht daran, sondern bat ihn, nie
mehr mit ihnen darüber zu sprechen, und forderte ihn auf, zu gehen. Er konnte verstehen, dass der
Schmerz immer noch zu tief und zu frisch für einen objektiven Blick gewesen war. Würde es ihm jemals gelingen, diese Kluft noch einmal zu überwinden?
Als er den Windschatten des Tonnenhofes passierte, schlug ihm der einsetzende
Regen mit voller Wucht ins Gesicht und holte ihn für einen Moment aus der düsteren Vergangenheit zurück in eine stürmische Gegenwart. Doch auch diese feuchte Ablenkung hielt nicht lange vor.
Koslowski musste an die Untersuchung des Falles denken und daran, wie man sich
mehr mit möglichen Fehlern der Ermittlungsgruppe beschäftigt hatte, als sich um die Angehörigen des Opfers zu kümmern, der doch ein Kollege gewesen war. Ihm taten auch die am Einsatz
beteiligten Polizeibeamten leid, die nun möglicherweise sogar mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen mussten. Es schien fast so, als wollte man ihnen und nicht dem Täter die Schuld zuschreiben. Politik und Behördenleitung distanzierten sich in dem Moment, in dem sie nicht den gewünschten Erfolg erzielt, sondern diese Niederlage erlitten hatten. Solidarität gab es eben nur bei Erfolg.
Er hingegen hatte Glück, denn er war nur als privater Berater hinzugezogen worden. Der Shitstorm zog
zwar auch über ihn hinweg, aber er konnte ihm wenigstens aus dem Weg gehen. Er musste nur
sein Smartphone ausschalten und es in diesem Zustand lassen.
Glaubte denn wirklich irgendjemand, dass den Ermittlern der Tod von einem aus
ihren Reihen gleichgültig war? Dass sie sich nichts sehnlicher gewünscht hätten, als ihn zu verhindern? Koslowski war sich sicher, dass auch sie nächtelang wach lagen und sich Vorwürfe machten.
Nach Abschluss der Untersuchung betrat er das Gebäude der Kreispolizeibehörde in Lippe nicht mehr und auf Anrufe von dort reagierte er nicht. Er merkte,
wie ihn dieser Fall immer mehr herunterzog, sodass er nach wenigen Wochen die
Notbremse zog. Quasi über Nacht packte er hastig einige Dinge zusammen, bestellte sich ein Taxi und
ließ sich zum Bahnhof in Bielefeld fahren. Die Taxifahrerin fragte ihn, ob er in
Urlaub wolle, und als er statt einer Antwort nur nickte, sah sie ihn länger und etwas mitleidig an. »So, wie Sie aussehen, haben Sie den auch wirklich nötig.« Von Bielefeld aus transportierte ihn die Deutsche Bahn bis nach Norddeich, von
wo aus ihn dann die Frisia Reederei nach Norderney übergesetzt hatte.
Koslowski kannte Norderney bereits von einigen Aufenthalten in der Vergangenheit
und vor vier Jahren hatte er schon einmal versucht, sich hierhin zurückzuziehen. Es war fast ein Hohn, dass es damals ausgerechnet Eugelink gewesen
war, der ihn zurückgeholt hatte, weil man in Ostwestfalen seine Hilfe gebraucht hatte.
Der Wind war mittlerweile so kräftig geworden, dass er Koslowski entlang des sichelförmigen Hafenbeckens vor sich herschob. Er ließ es geschehen, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein. Sein Blick fiel auf
die Masten der Schiffe, die im Sportboothafen lagen und von Wind und Wasser wie
stehende Pendel in Bewegung gehalten wurden.
Einen Augenblick lang blieb er stehen und stemmte sich gegen die Kraft des
Windes. Er dachte darüber nach, ob alles anders gekommen wäre, wenn er damals die Insel nicht verlassen hätte. Ob Eugelink dann noch leben würde?
Das sind müßige Spekulationen, rief er sich selbst zur Ordnung, das zu beantworten war
genauso unmöglich, wie den Zeitpunkt seines eigenen Todes vorauszusagen. Es sei denn, man
pfuschte dem Schicksal selbst ins Handwerk. Auch darüber hatte er schon öfter nachgedacht. Endgültig Schluss machen. Sich umbringen. Endlich Ruhe finden. Aber das würde bedeuten, vor den Problemen wegzulaufen. Dafür war er nicht der Typ. Es gab niemanden, für den er sorgen müsste. Er war also frei. Und Angst hatte er vor dem Tod nicht, er hatte ihm so
oft bereits ins eiskalte Auge blicken müssen, dass er ihm manchmal schon wie ein alter Bekannter vorkam. Doch Freunde waren sie deswegen keine
geworden und würden das auch jetzt nicht.
Wie viele gefährliche Situationen hatte er oft nur mit viel Glück überstanden? Wie viele Schicksalsschläge hatte er schon einstecken müssen? Einen hatte es gegeben, der ihn sogar noch heftiger getroffen hatte als
Eugelinks Tod. An ihm wäre er fast zerbrochen, aber er hatte sich wieder zurück ins Leben gekämpft.
Plötzlich kam ihm ein alter Spruch seines verstorbenen Großvaters in den Sinn. »Komm ich über’n Hund, komm ich über’n Schwanz!« Mit dieser Weisheit hatte sich der alte Mann in schwierigen Lebenssituationen
selbst Mut zugesprochen.