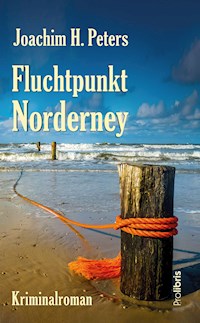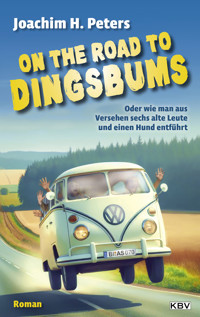
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: KBV Krimi
- Sprache: Deutsch
Gauner, Rentner und ein Hund … Ein mordsmäßig abgefahrener Road-Trip Ü70 Für Mischa wird es eng, denn der Boss einer Spielhallenkette hat ihm zwei Geldeintreiber auf den Hals gehetzt. Ein alter VW-Bus, der mit laufendem Motor vor dem Seniorenheim in Bielefeld steht, ist seine einzige Chance. Mischa rast los … … und merkt zu spät, dass die Altenpflegerin Alina sowie sechs Senioren mit an Bord sind, die zu einer Reise nach Brandenburg aufbrechen wollten: ein Buchhändler, eine Ärztin, ein Oberfinanzsekretär, eine Autohausbesitzerin, ein Amtsrichter und die Schauspielerin Lucy, die sich für einen internationalen Filmstar hält und am liebsten Sterbeszenen spielt. Mischa gibt sich als Fahrer aus, und seine Passagiere ahnen nichts von den Verfolgern. Und auch nicht, dass der Betreiber des Seniorenheims bankrott ist und sie in Wirklichkeit nach Polen abschieben will. Als wäre das alles nicht schon kompliziert genug, schleppt Lucy auch noch einen ausgesetzten Hund an. Unterwegs lauern Gefahren und Glücksmomente, Autopannen und Abschiede. Für alle wird es die abenteuerlichste Reise ihres langen Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joachim H. Peters
On the Road to Dingsbums
Joachim H. Peters
Geboren? Ja, im Jahre 1958 in Gladbeck am Rande des Ruhrgebietes.
Ab 1975 Polizeibeamter und dabei auch schon mal real Mörder festgenommen (also in Wirklichkeit nicht bei REAL). Fünfundvierzig Jahre lang im Dienste der Gerechtigkeit unterwegs und seit 2008 als Krimiautor für die Gegenseite.
Der zweiundzwanzigste Krimi ist gerade in Arbeit. Dazu kommen noch etliche Kurzgeschichten, weit über 150 Bühnenauftritte, u. a. demnächst das fünfte Kabarettprogramm. Zwischendurch auch als Moderator und Schauspieler auf der Bühne, oder aber als Leser anderer Texte, u. a. für Bestsellerautor Martin Walker.
www.koslowski-krimis.de
Joachim H. Peters
oder:
Wie man aus Versehen
sechs alte Leute
und einen Hund entführt
Roman
Originalausgabe
© 2024 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp
Lektorat: Volker Maria Neumann, Köln
Druck: CPI books, Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Printed in Germany
Print-ISBN 978-3-95441-698-1
E-Book-ISBN 978-3-95441-709-4
Für Jörg, Martina und Pelle
Vielen Dank für eure langjährige Unterstützung
PROLOGDie Abendsonne am Morgen
In Bielefeld herrschte ein derart gutes Wetter, dass man daraus getrost zwei hätte machen können. Nach einer verregneten Woche schien endlich mal wieder die Sonne aus einem wolkenlosen Himmel auf die ostwestfälische Stadt herunter, die es trotz einiger gegenteiliger Behauptungen doch gab. Dieser ehemalige Gag trieb selbst dem humorvollsten Bielefelder mittlerweile einen gequälten Gesichtsausdruck aufs Antlitz.
Allerdings sorgte die Sonne gleich wieder dafür, dass das Thermometer auf Temperaturen stieg, bei denen ein bisschen Wind nicht nur den schlapp herunterhängenden Fahnen auf der Sparrenburg, sondern auch deren Besuchern gutgetan hätte. Wenn man hier oben – hoch über der »kleinen Großstadt« – auf der alten Festungsanlage stand, mit der Hand die Augen vor der Sonne abschirmte und sich etwas nach links wandte, dann konnte man das Dach der Seniorenresidenz Abendsonne sehen. Allerdings nur, wenn man wusste, wo man danach zu suchen hatte.
Und wer sie schon einmal von innen gesehen hatte, der musste zugeben, dass der etwas einfallslose Name ganz im Gegensatz zu dem Konzept dieser Einrichtung stand. Der Träger, ein Privatmann, hatte beim Bau der Residenz bewusst nicht gespart, sondern ganz im Gegenteil großen Wert auf eine luxuriöse Ausstattung und eine überdurchschnittliche Größe der einzelnen Zimmer gelegt. Oh, Pardon, es muss natürlich »Appartements« heißen. Denn dadurch, dass man sich dieser Wortwahl bedient hatte, wollte man den Besuchern und Interessenten gleich von Anfang an deutlich machen, dass sie es hier mit einem gehobenen Standard zu tun bekamen. Die Abendsonne sah sich als Einrichtung für die Art älterer Menschen, die sich einen gewissen Luxus leisten konnten. Nicht umsonst verfügte sie über eine Sauna, ein Schwimmbad, einen Fitnessraum sowie einen kleinen Park und eine große Bibliothek, die man auch gleichzeitig als Vortragsraum benutzen konnte.
Doch im Rahmen der Errichtung hatte der Bauherr plötzlich feststellen müssen, dass er sich verkalkuliert hatte. Denn plötzlich überstiegen die tatsächlichen Kosten, zugegebenermaßen von einigen Leuten nicht ganz unerwartet, die geplanten Kosten. Und so mussten einige Teile der Einrichtung warten. Die Sauna blieb kalt, dem Schwimmbad fehlte noch das Wasser, und auch der Park war noch nicht ganz fertiggestellt. Aus diesem Grund fand die Eröffnung auch erst statt, nachdem sich genügend Seniorinnen und Senioren bereitgefunden hatten, eigenes Kapital als Einlage zur Verfügung zu stellen, damit diese letzten Arbeiten abgeschlossen werden konnten. Aber Qualität hat nun mal ihren Preis.
Nehmen wir zum Beispiel die Mahlzeiten. Sie wurden in der hochmodernen Residenzküche zubereitet und entweder im Speisesaal oder wahlweise auch in den einzelnen Appartements serviert. Die Qualität der Speisen wetteiferte dabei ständig mit der Art der Zubereitung, denn nicht nur das Betreuungspersonal, sondern auch der Küchenchef war handverlesen, um der Bewohnerschaft nur das Beste bieten zu können. Was allerdings auch seinen Preis hatte.
Aber kein Geld zu haben, war ja schon immer ein Problem. Und das nicht nur für die Bewohner …
KAPITEL 1Ein böses Vorspiel
»Wie blöd muss man eigentlich sein, um so einen Idioten nicht in die Finger zu kriegen? Chertovo dermo!«
Oleg Paschkurin blickte betreten auf den teuren Teppich zu seinen Füßen und zählte dabei die Karos im Muster, während sein Partner Gregori Usalenko die Stuckarbeiten der Decke so interessiert bewunderte, als hätte er sie noch nie zuvor gesehen. Die beiden waren zwar schon des Öfteren zum Rapport bei ihrem Boss Iwan Iwanowitsch Kuttin bestellt worden, allerdings hatte der dabei noch nie so verärgert, ja geradezu bösartig ausgesehen wie heute. Wobei sie ihn nur zu gut verstehen konnten, denn es war ja auch wirklich eine chertovo dermo, eine verdammte Scheiße, dass ihnen ihr Opfer wieder einmal durch die Lappen gegangen war.
Seit mehr als drei Wochen versuchten sie seiner nun schon habhaft zu werden, um das Geld aus ihm herauszuprügeln, das er ihrem Boss noch schuldete. Aber mit einer Regelmäßigkeit, die sonst nur die Jahreszeiten aufwiesen, entzog sich ihr Schuldner immer wieder dem Zugriff. Wie viele Tage und Nächte hatten sie nun schon vor seiner Wohnung zugebracht? Wie oft hatten sie ihm an seinen diversen Stammkneipen aufgelauert und jede Spielhallenaufsicht, unter Androhung von schmerzhaften Arm- und Beinbrüchen, aufgefordert, sie sofort anzurufen, sollte dieses Schwein bei ihnen auftauchen.
Aber all das war bisher vergebliche Liebesmüh gewesen. Es war, als hätte sich in Bielefeld die Erde aufgetan und Mike Michalak, der von seinen Freunden nur Mischa genannt wurde, verschluckt. Wobei Oleg sich sicher war, dass die Erde ihn irgendwann wieder ausspucken würde, denn dieser Typ war garantiert unverdaulich. Er log, er war unzuverlässig, und er arbeitete nur unregelmäßig. Aber was für sie und ihren Boss am schlimmsten war: Er zahlte seine Schulden nicht. Schulden, die als Spielschulden aufgelaufen waren und bei denen es sich bekanntlich um Ehrenschulden handelte. Und auf die Herstellung der Ehre, besonders seiner eigenen, legte ihr Boss Iwan Iwanowitsch Kuttin sehr viel Wert. Immerhin handelte es sich um stolze zehntausend Euro. Eine Summe, für die eine alte Frau sehr lange stricken oder ein junger Dealer sehr viele Drogen verkaufen musste. Iwan Iwanowitsch Kuttin war zwar alt, aber er verkaufte weder Drogen, noch strickte er. Er hatte sich voll und ganz auf das Glücksspielgewerbe konzentriert, und seine einzige Handarbeitstätigkeit, wenn man sie denn so nennen wollte, war das Knoten eines Seils. Des Seils, mit dem er sie beide in Kürze an seiner stuckverzierten Decke aufhängen würde, wenn sie nicht bald Erfolg hatten. Zumindest befürchtete Oleg das.
»Ihr beide seid mit Abstand die dümmsten Kretins, die je bei mir in Lohn und Brot gestanden haben. Ich weiß nicht, ob ich euch noch lange beschäftigen werde. Im guten alten Russland wärt ihr schon in irgendeinem Gulag verschwunden, aber hier …?« Ohne zu überlegen, spuckte er auf den kostbaren Teppich unter seinen Füßen.
Seine beiden Handlanger wussten, dass ihr Boss kein Freund der Demokratie war und seinen Laden lieber diktatorisch führte.
Oleg sah sich schon, mit dem Gesicht nach unten auf einem Förderband liegend, auf eine der Ofenklappen der Müllverbrennungsanlage zufahren. Der einzige Trost dabei würde sein, dass die vorher in seinen Hinterkopf geschossene Kugel dafür Sorge trüge, dass er die Entstehung von Brandblasen nicht mehr spüren würde. Er musste sich schütteln, um diese pessimistische Vision seiner näheren Zukunft wieder loszuwerden, und wandte dann seinem Partner Gregori den Kopf zu, der bisher noch kein Wort gesagt hatte.
Iwan Iwanowitsch Kuttin stand auf und kam aufreizend langsam um den Schreibtisch herum. Oleg fand, es sehe aus, als würde sich die Queen Mary II langsam in das Hafenbecken von New York schieben. Ihr Boss war fast zwei Meter groß und seine Unterarme dicker als Olegs Oberschenkel. Sein Brustkorb besaß die Ausmaße eines Ölfasses, und darauf saß vollkommen ansatzlos ein Kopf, der an eine Riesenschildkröte von den Galapagosinseln erinnerte. Das Einzige, was wenigstens entfernt an einen Hals erinnerte, waren die drei Speckrollen im Nacken.
Oleg musste sich mit aller Macht zusammenreißen, um nicht zurückzuweichen, als sich dieser Fleischberg nun auf ihn zuschob. Er sah seinen eigenen Hals schon wie ein Streichholz zwischen Kuttins dicken Wurstfingern zerbrechen, und seine gehässige Fantasie gaukelte ihm dazu das passende knackende Geräusch vor. Aus den Augenwinkeln sah er, dass sein Partner Gregori zitterte wie Espenlaub. Denn auch der war garantiert nicht scharf auf eine Fahrt auf dem Fließband der Müllverbrennungsanlage.
Kuttin baute sich vor den beiden auf und fixierte sie mit einem Blick aus seinen kalten Augen, die allerdings mehr an eine hochgiftige, schwarze Mamba als an eine gutmütige Schildkröte erinnerten. »Ich gebe euch beiden Blödmännern jetzt noch genau eine Woche Zeit, um mir nicht nur mein Geld, sondern auch diesen Typen zu bringen. Sobald er hier ist, werde ich ein Examen an ihm stationieren.«
Oleg wunderte sich noch, woher sein Boss diese Fremdwörter kannte, als der bereits fortfuhr.
»Die Konkurrenz lacht ja schon über mich, und das ist etwas, das ich gar nicht leiden kann.« Dabei zog er dermaßen an den Gelenken seiner Wurstfinger, dass es nur so krachte. »Ich werde diesem Schwein sämtliche Knochen im Leib brechen und ihn dann zur Abschreckung eine Woche lang am Fahnenmast der Sparrenburg aufhängen. Anschließend werfe ich ihn meinen beiden Rottweilern zum Fraß vor!«
Was aber wahrscheinlich nicht passieren würde, vermutete Oleg, denn eine Leiche am Fahnenmast der Sparrenburg würde dermaßen schnell die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich ziehen, dass Kuttins Hunden garantiert ein Fastentag bevorstand. Er hütete sich jedoch, diese Vermutung laut auszusprechen, weil er sich nicht selber als Futterersatz ins Spiel bringen wollte.
»Sollte bis zum Ablauf der Frist dieser Typ das Geld nicht auf meinem Schreibtisch abgeliefert haben, werdet ihr beiden Arschlöcher den Appetit meiner Hunde kennenlernen.«
Sein eiskalter Blick wechselte vom einen zum anderen und jagte den beiden Todesangst ein. Das war genau der Moment, in dem Oleg Paschkurin bedauerte, den Rat seines Vaters nicht befolgt und sich als Lokführer bei der transsibirischen Eisenbahn beworben zu haben. Ein Bick zur Seite zeigte ihm, dass sein Partner an gar nichts zu denken schien, weil er sich ganz auf sein ängstliches Schlottern konzentrieren musste.
Kuttin trat einen Schritt zurück und senkte dadurch die Spannung im Raum um etwa 5000 Volt. Oleg war sich darüber im Klaren, dass sie soeben die letzte Chance bekommen hatten, noch ein paar schöne Lebensjahre zu ergattern.
Ohne sie eines weiteren Blickes zu würdigen, kehrte Iwan Iwanowitsch Kuttin hinter seinen Schreibtisch zurück, der die Größe einer Tischtennisplatte besaß, und deutete dabei mit der Hand auf die doppelflügelige Ausgangstür. »Jetzt macht, dass ihr rauskommt, und tretet mir nicht mehr unter die Augen, bis ihr diese kinderleichte Aufgabe erledigt habt. Und denkt dabei immer an den Hunger meiner Hunde, das wird euch motivieren! Los jetzt, bringt mir endlich diesen Mischulak oder wie dieses Schwein heißt!«
KAPITEL 2Eine Flucht mit Folgen
Zwei Tage später stand dieses Schwein, das nicht Mischulak, sondern wie bereits erwähnt Mike Michalakhieß und von seinen Freunden nur Mischa genannt wurde, schwitzend in einer Hauseinfahrt an der Detmolder Straße. Der Schweiß war aber nicht durch die hohen Temperaturen erzeugt worden, sondern gehörte zur Kategorie Angstschweiß.
Der dringend gesuchte Mischa wischte sich mit der Hand über die Stirn und spähte erst dann vorsichtig um die Ecke. Wäre er nicht todesmutig aus dem Fenster im ersten Stock gesprungen, dann hätte er vermutlich jetzt schon ausgesehen wie eine Gliederpuppe. Ihm war klar, dass seine beiden Verfolger zunächst ihren gesamten Frust an ihm auslassen würden, bevor sie ihn zum großen Boss schleppten. In gewisser Weise hatte er sogar Verständnis für sie. Befanden sie sich doch, ebenso wie er, in einer sehr unangenehmen Zwickmühle. Und Grund dafür war einmal mehr das verdammte Geld. Er schuldete es ihrem Boss, und sie sollten es eintreiben. Bevor die zehntausend Euro nicht bezahlt waren – wobei er sicher war, dass es im wahrsten Sinne des Wortes noch einen Nachschlag geben würde –, würde er keine ruhige Minute mehr haben. Aber die beiden auch nicht, dafür kannte er Kuttin nur zu gut.
Seine Spielsucht war aber auch wirklich zum Kotzen. Er konnte seine Finger einfach nicht von diesen verdammten Automaten lassen. Es hatte schon im Alter von vierzehn Jahren angefangen, nun war er Ende zwanzig. Wie lange sollte das noch so weitergehen? Aber es war, wie es war: Sobald ihm die blinkenden Lichter ins Gesicht schienen, war das für ihn wie der Klang der Sirenen in Homers Sage. Sie lockten ihn zu sich, und der Einzugsschlitz für Geldscheine wirkte dabei wie ein schwarzes Loch, welches ihn magisch anzog. Bei jedem Einschieben eines Scheines hatte er jetzt gedacht. Jetzt muss es klappen, jetzt würde er den Jackpot knacken, jetzt würden endlich alle Lampen an diesem Scheißautomaten aufblinken und der ganzen Spielhalle verkünden, dass er, Mike Michalak, endlich auf die Siegerstraße eingebogen war.
Aber stattdessen musste er jedes Mal wieder neues Futter für die gefräßigen Monster besorgen. Und weil sein Kontoauszug bereits nach kurzer Zeit wie ein Inferno in Rot aussah, blieb ihm zur Befriedigung seiner Sucht nichts übrig, als sich woanders Geld zu leihen. Praktischerweise direkt in einer dieser Automatenhöhlen, doch leider auch zu einem sehr unanständigen Zinssatz. Und was er erst später erfuhr, war, dass dieses Geld Iwan Iwanowitsch Kuttin gehörte. Aber schon bald erfuhr er auch, dass es der Besitzer dieser Kohlen mit der Rückzahlung terminlich sehr genau nahm. Inklusive der astronomischen Zinsen.
Fahrig wischte er sich erneut mit der Hand über das Gesicht und drückte seinen schweißnassen Rücken an die kühle Hauswand. Was für eine Scheißsituation. Kein Geld in der Tasche, dafür aber jede Menge Angst im Nacken. Bisher war es ihm zum Glück immer noch gelungen, seinen Häschern zu entwischen. Die kannten sich vielleicht gut in der Taiga aus, aber er sich dafür besser hier in seiner Heimatstadt Bielefeld. Hier war er groß geworden, hier kannte er fast jeden Winkel und jede Ecke. Gerade hatte er sogar noch eine neue Hauseinfahrt kennengelernt, die ihm aber nur kurz etwas Schutz bieten konnte. Er musste weiter. Sich woanders in Sicherheit bringen.
Aber wohin?
Er hatte bereits alle Freunde abgeklappert. Ergebnislos. Und was noch schlimmer war: An der letzten Adresse hatten diese beiden russischen Kopfgeldjäger doch tatsächlich schon auf ihn gewartet. Woher hatten sie nur gewusst, dass er dort auftauchen würde? Da hatte garantiert einer geplaudert. Vermutlich jemand mit einem frisch gebrochenen Nasenbein.
Immerhin hatte er die beiden noch rechtzeitig bemerkt und war aus dem Flurfenster auf den Hof hinuntergesprungen. Dabei war er prompt in einem kleinen Gartenteich gelandet, der zum Glück nicht sehr tief war, ihm jedoch nasse Schuhe beschert hatte. Aber die waren zu verkraften. Sofort hatte er mit nassen Füßen wieder Fersengeld gegeben und war nach etlichen Hundert Metern, völlig außer Atem, in die Hauseinfahrt eingebogen, in der er sich gerade an die Mauer drückte.
Während sich sein Puls nur langsam wieder senkte, musste er an Rudi denken. Er hoffte, dass der nicht zu sehr für seine Flucht hatte büßen müssen. Bei Rudi war er aufgetaucht, weil er gehofft hatte, sich etwas Geld von ihm borgen zu können. Natürlich nicht die kompletten zehntausend Euronen. Als Mitarbeiter bei der Security von Arminia Bielefeld hatte es Rudi ganz sicher nicht geschafft, große Reichtümer anzuhäufen. Doch er hatte gehofft, dass der ihm wenigstens so viel würde leihen können, dass er für eine Weile aus der Stadt verschwinden konnte. Egal wohin. Hauptsache weg. Denn er wusste, dass er dringend von der Bildfläche verschwinden musste, wenn ihm sein Leben und seine Knochen lieb waren.
Ein Klappern ließ ihn herumfahren, doch das war nicht von seinen Verfolgern erzeugt worden, sondern von einer Katze, die in einem Müllsack eine leere Fischkonserve entdeckt hatte. Noch mit diesem Schreck in den Gliedern spähte er erneut vorsichtig um die Ecke, zuckte aber sofort zurück, als er Gregori erkannte, der zum Glück gerade in die andere Richtung schaute. Verdammt, warum waren die ihm schon wieder so dicht auf den Fersen?
Was nun? Losrennen, die Detmolder Straße überqueren und versuchen, sich auf der anderen Straßenseite in Sicherheit zu bringen? Sich irgendwo an der Sparrenburg in die Büsche schlagen? Nein, dabei würden ihn die beiden garantiert bemerken und die Verfolgung aufnehmen.
Er durfte sie jetzt auf keinen Fall auf sich aufmerksam machen, sondern musste den Vorteil ausnutzen, dass die beiden Schergen momentan anscheinend nicht wussten, wo sie ihn suchen sollten. Langsam drückte er sich, immer noch mit dem Rücken an die Hauswand gepresst, weiter auf das Grundstück. Hinten befand sich ein Garten, er konnte dessen üppiges Grün sehen. Gab es dort eine Möglichkeit, sich zu verstecken? Oder konnte er durch diesen Garten nach hinten, auf die nächste Querstraße abhauen? Wie hieß die noch mal? Egal!
Langsam schlich er weiter auf das Grundstück, die Hauseinfahrt dabei im Blick behaltend und jede Sekunde damit rechnend, dass die beiden russischen Geldeintreiber darin auftauchten. Als er endlich um die hintere Ecke des mehrgeschossigen Hauses biegen konnte, fiel ihm ein Stein vom Herzen. Erst jetzt merkte er, dass er die ganze Zeit unbewusst die Luft angehalten hatte, und atmete japsend ein.
So eng wie dieses Mal war es noch nie gewesen. Und im Gegensatz zu früher, wenn er in Kuttins Spielhallen auf den Hauptgewinn gehofft hatte, war er sich jetzt sicher, dass seine augenblickliche Glückssträhne jederzeit reißen konnte.
Hektisch blickte er sich um und sah, dass ein schmaler, zugewachsener Weg in die Tiefe des verwilderten Gartens führte. Geduckt schlich er ihn entlang und war für einen kurzen Augenblick erleichtert, als er die niedrige Mauer am Ende dieses Urwaldes sah. Doch dieser Augenblick währte nur so lange, bis russische Worte an sein Ohr drangen, die aus der Hauseinfahrt kamen. Er sah an sich hinunter und stellte fest, dass er seine nassen Schuhe ganz vergessen hatte. Garantiert hatten ihn deren Abdrücke auf dem Gehweg verraten. So blöd waren selbst die beiden nicht.
Ohne weiter zu überlegen, rannte er los und war mit ein paar Sätzen an der Mauer. Er sprang an ihr hoch, und schon war er über sie hinweg. Allerdings hatte er die Rechnung ohne den Grundstückseigentümer gemacht, der zur Sicherung seines Besitzes Glasscherben in die Mauerkrone einbetoniert hatte.
Erst als er ein paar Schritte gelaufen war, merkte er, dass ihm etwas Warmes an den Fingern der linken Hand herunterlief. Verdammt, erst die nassen Schuhspuren, jetzt auch noch Blutstropfen. Im Laufen suchte er in der Hosentasche nach einem Papiertaschentuch und drückte es auf die Wunde. Wohin jetzt?
Panisch wanderte sein Blick hin und her. Er befand sich auf einem Freigelände, das von wilden Büschen und Sträuchern überwuchert war. Am anderen Ende sah er die Rückseiten weiterer Häuser. Viele davon aber durch hohe Mauern und Zäune geschützt. Dann fiel ihm zur Linken ein Grundstück mit einem größeren Gebäude auf. Dessen Rückseite schien fast komplett aus Balkonen und Terrassen mit bodentiefen Glastüren und Fenstern zu bestehen. Aber es war nicht die architektonische Schönheit des Gebäudes, welche ihn in Aufregung versetzte, sondern die Tatsache, dass es mitten im Gebäude eine Art Durchfahrt gab, durch die man bereits die nächste Straße sehen konnte. Glück gehabt! Da würde er durchkommen, also änderte er umgehend seine Richtung und spurtete darauf zu. Als er näher kam, bemerkte er in der Durchfahrt einen VW-Bus, der dort nicht nur mit offener Fahrertür stand, sondern dessen Motor auch lief. War das ein Wink des Schicksals?
Eigentlich hatte er nur die nächste Parallelstraße erreichen wollen, doch die Blutspur, die er bei seiner Flucht hinterließ, würde diesen Vorteil sofort wieder zunichtemachen. Also änderte er spontan die Richtung und lief auf den Bus zu. Vielleicht konnte er den Fahrer dazu bringen, ihn mitzunehmen. Er würde ihn bitten, ihn ins Krankenhaus zu fahren, und an der nächsten Ampel einfach wieder aus dem Wagen springen.
Doch dieser Plan ging nicht auf, denn als er am Bus eintraf, musste er feststellen, dass der Fahrersitz leer war. Okay, dann würde er sich den Bus kurz ausleihen, um mehr Abstand zwischen sich und seine Verfolger zu bringen, die soeben über das Brachgelände gehastet kamen.
Mit einem Satz sprang er auf den Fahrersitz und zog die Tür hinter sich zu. Gerade in dem Moment, als er losfahren wollte, stürzte eine junge Frau aus dem Haus und sprang mit ausgebreiteten Armen vor das Fahrzeug.
Er hatte kaum erschrocken auf die Bremse getreten, als sie auch schon um den Bus herumgelaufen kam, die Tür aufriss und auf den Beifahrersitz kletterte. Hastig ließ Mischa die Kupplung kommen, und der VW-Bus machte einen regelrechten Satz nach vorne. Und zwar gerade noch rechtzeitig, bevor seine Verfolger ihn erwischen konnten. Es war so knapp, dass Oleg die Heckklappe nur um Zentimeter verfehlte. Mischa atmete erleichtert auf und sah ihn im Rückspiegel drohend die Faust schütteln. Doch dann bemerkte er im Rückspiegel noch etwas anderes.
Nämlich die Gesichter von sechs erschrockenen Seniorinnen und Senioren.
KAPITEL 3Lügen, bis der Arzt kommt
»Sind Sie wahnsinnig?« Genauso verwundert wie atemlos sah ihn die junge Frau an, die es soeben noch in den Bus geschafft hatte. »Sie können doch nicht einfach ohne mich losfahren!«
Mischa schluckte erschrocken. In was für ein Gefährt war er denn hier geraten? Egal. Auf jeden Fall war er seinen Verfolgern erst mal entkommen. »Ich … äh … also …«, stotterte er hilflos.
»Wer sind Sie überhaupt, und wo ist Waldemar?«, wollte seine Beifahrerin wissen, die ihn anscheinend für den Ersatzfahrer hielt.
Bevor er wusste, was er antworten sollte, fiel sein Blick zur Windschutzscheibe und blieb an dem dort angebrachten Navigationsgerät hängen. So wie es aussah, war die Route bereits eingeben worden, denn das Gerät erwartete, dass er demnächst nach rechts abbiegen würde. Vermutlich hatte der reguläre Fahrer es bereits vorher programmiert. Was der wohl sagte, wenn er sah, dass sein Bus weg war? Der würde garantiert sofort die Polizei anrufen, und dann hätte er nicht nur Probleme wegen seiner Spielschulden, sondern würde möglicherweise auch noch als Autodieb gesucht oder, noch schlimmer, als Entführer. Er sah sich schon in Handschellen auf dem Rücksitz eines Streifenwagens hocken.
Seine etwas zögerliche Fahrweise rief die junge Frau wieder auf den Plan. »Was ist nun? Kennen Sie den Weg oder nicht?«
Ihre leicht verärgert klingende Stimme holte ihn abrupt in die Wirklichkeit zurück. »Äh, ja … na klar«, dabei deutete er auf das Navi. »Habe ich doch vorhin schon eingegeben«, log er mit hochrotem Kopf.
»Na gut, dann wäre das ja geklärt. Aber warum fährt denn Waldemar nicht?«
Mischa bemerkte mit einem schnellen Seitenblick, dass sie ihn dabei argwöhnisch anblickte. »Ach, der … ja der … der hat gerade einen Anruf bekommen, dass er Opa geworden ist«, versuchte er den Vorfall zu begründen, »und da bin ich natürlich sofort für ihn eingesprungen.« Gleichzeitig schickte er ein entschuldigendes und hoffentlich auch entwaffnendes Lächeln hinterher.
»Waldemar ist Opa geworden? Aber der war doch nie verheiratet, und soweit ich weiß, hat er auch keine Kinder«, wandte die junge Frau ein.
Mischa brach der Schweiß aus. »Das Baby ist von seiner Freundin«, versuchte er sich geistesgegenwärtig herauszureden.
»Ich wusste gar nicht, dass Waldemars Freundin schwanger war«, sie überlegte einen Moment, dann korrigierte sie sich. »Eigentlich wusste ich noch nicht mal, dass Waldemar eine Freundin hat.«
Mischa lachte gespielt auf. »Jaja, so sind die jungen Leute von heute, die posten alles nur noch in den sozialen Netzwerken. Wenn sie zusammen sind, schauen sie nur auf ihre Handys und keiner spricht mehr. Da erfährt man bei Facebook, dass jemand geheiratet hat, oder eben, dass ein Baby zur Welt gekommen ist.«
Hoffentlich war dieses Thema damit jetzt abgehakt. Was sich aber als ein klarer Fall von denkste herausstellte. Auf was für ein schmales Brett hatte er sich da nur begeben?
»Wie alt ist Waldemars Freundin denn?«, bohrte die junge Frau nach.
»Ich habe sie nur einmal gesehen«, log Mischa konsequent weiter, »aber ich schätze mal, genauso alt wie er?«
Auf dem Gesicht seiner Beifahrerin war grenzenloses Erstaunen zu sehen. »Und die hat ein Baby bekommen?«
»Ja, warum denn nicht?«, wollte Mischa überrascht wissen, »das ist doch die natürlichste Sache der Welt.« Er ließ ein Lachen folgen, welches selbst für ihn sehr gekünstelt klang.
»Weil Waldemar schon Ende sechzig ist«, kam die niederschmetternde Antwort.
Mischa merkte, dass seine Ohren genauso rot wurden wie die Ampel, vor der er soeben anhalten musste.
»Also ich … also ich glaube … also ich meine … ich habe mich da falsch ausgedrückt«, versuchte er sich rauszureden, »es ist natürlich die Tochter von Waldemars Freundin, die das Baby bekommen hat.«
»Aha, und wie alt ist die? Wenn Waldemars Freundin nämlich auch schon fast siebzig ist, wie Sie sagen, und sie ihre Tochter mit, na, sagen wir mal, fünfundzwanzig bekommen hat, dann dürfte die auch schon fünfundvierzig sein, oder? Ist das nicht ein bisschen alt zum Kinderkriegen?«
Mischa fuhr wieder an und bog, der Anweisung des Navis folgend, nun nach links ab. »Ach, ich bin aber heute auch ein Schussel«, entschuldigte er sich. »Es ist natürlich die Enkelin von Waldemars Freundin. Heute schmeiße ich aber wirklich alles durcheinander …«
Noch bevor die Beifahrerin dazu etwas sagen konnte, kam eine Vermutung von der ersten der beiden hinteren Sitzbänke.
»Vielleicht hat das mit Ihrem Blutverlust zu tun?«
Erschrocken blickte Mischa zuerst in den Rückspiegel und dann auf seine rechte Hand. Von der tropfte das Blut mittlerweile auf den Wagenboden, weil es das Papiertaschentuch bereits völlig durchnässt hatte.
Die Stimme, die ihn darauf aufmerksam gemacht hatte, gehörte einer älteren Dame, und die meldete sich nun erneut. »Ich würde vorschlagen, Sie fahren da vorne in die Haltebucht, und ich schaue mir Ihre Verletzung mal an.«
Mischa wurde von dieser Aufforderung zwar überrascht, aber er hatte ja mittlerweile schon so viel Abstand zwischen sich und seine Verfolger gebracht, dass er es sich erlauben konnte, kurz anzuhalten. Außerdem war diese Inaugenscheinnahme seiner Verletzung vielleicht eine gute Möglichkeit, etwas zu suchen. Nämlich das Weite.
Er lenkte den VW-Bus in die Haltebucht und schaltete den Motor ab. Jetzt nur noch ein kurzer Blick in den Rückspiegel, und schon wäre er draußen. Bis eines dieser Klappergestelle aus dem Bus war, würde er schon hinter dem Horizont verschwunden sein, und die Frau auf dem Beifahrersitz würde die alten Fahrgäste ja wohl kaum im Stich lassen.
Er hatte bereits die Hand auf dem Türöffner, als ein lauter Ausruf aus dem Heck des Wagens ihn daran hinderte, diesen zu betätigen. Diesmal war es eine Männerstimme, die mit erstaunlich gleichgültigem Ton verkündete: »Lucy ist soeben gestorben!«
KAPITEL 4Schweigen ist Trumpf
»Waldemar, halt bitte mal für eine Sekunde die Luft an, ich muss nachdenken«, herrschte Hartmut Drescher sein Mädchen für alles an. Wie konnte es denn sein, dass ein ganzer Bus voller Senioren verschwand? Wobei er sich eher Sorgen um den Bus als um die Fahrgäste machte. Genau genommen gehörte der Bus ihm gar nicht mehr. Nur wussten das die neuen Besitzer noch nicht.
»Aber wir müssen doch die Polizei anrufen!«, schlug Waldemar händeringend vor, während er im Büro seines Chefs nervös auf und ab tigerte. »Wer weiß, was der Entführer mit den alten Leutchen vorhat?«
Die Polizei hatte ihm gerade noch gefehlt. Wenn die erst mal begannen, ihre Nasen in alle möglichen Dinge zu stecken, dann konnte es für ihn und die Abendsonne sehr ungemütlich werden. Dann kamen wohlmöglich Dinge auf den Tisch, die besser darunter aufgehoben waren. »Nein, keine Polizei!«, ordnete er barsch an und sah, dass Waldemar ihn erschrocken anblickte.
»Aber die Alten im Bus …«, versuchte der erneut zu intervenieren, wurde aber durch eine unwirsche Handbewegung Dreschers abgewürgt.
»Wir warten erst mal ab! Wir wissen nicht mal genau, was da vorgefallen ist.« Drescher hatte sich in den Sessel hinter seinem Schreibtisch fallen lassen. »Wer entführt denn schon sechs Senioren auf einmal? Da kann doch auch was ganz anderes dahinterstecken.«
»Und was ist mit Alina?«, gab Waldemar zu bedenken.
»Wieso? Was ist denn mit Alina, ist die etwa auch verschwunden?«
Waldemar nickte. »Wir könnten sie doch mal anrufen und fragen, was los ist.«
Dreschers Gesichtsfarbe veränderte sich von Tomatenrot zu Aubergine. Jetzt kam es darauf an, den Ball schön flach zu halten und möglichst kein Aufsehen zu erregen. So weit kam es noch, dass dadurch schlafende Hunde geweckt wurden. »Das werden wir auf keinen Fall machen!«, ordnete Drescher an. »Wer weiß, ob wir sie mit diesem Anruf nicht in Gefahr bringen. Und außerdem wissen wir ja auch nicht, ob sie mit dem Entführer unter einer Decke steckt.«
»Aber doch nicht Alina«, widersprach Waldemar vehement dieser Vermutung. »Die macht so was nicht.«
Drescher blickte Waldemar eindringlich an. »Egal, wir warten ab, ob der oder die Entführer sich melden und was sie wollen. Dann entscheiden wir, wie wir weiter vorgehen. Aber zunächst mal gilt: Zu keinem ein Wort! Hast du mich verstanden?«
Waldemar nickte, trat dabei von einem Fuß auf den anderen und faltete die Hände. »Heiliger Florian, bitte mach, dass die alten Leute wieder sicher nach Hause kommen«, bat er den Schutzpatron seines Heimatlandes Polen und hoffte, dass dieser für die Erfüllung seiner Bitte Zeit hatte – musste er sich im Rahmen einer Nebentätigkeit doch auch noch um Feuerwehrleute, Schornsteinfeger, Bäcker, Bierbrauer und etliche andere Berufsgruppen kümmern.
Dieser komische Heilige kann mir gestohlen bleiben, dachte Drescher. Der konnte ihm jetzt auch nicht weiterhelfen, wenn das wirklich eine Entführung war. Denn kein Heiliger wäre in der Lage gewesen, das Geld zu beschaffen, das der Entführer möglicherweise von ihm forderte. Denn egal, wie hoch es war, er würde auf keinen Fall zahlen, was aber nicht daran lag, dass er dazu nicht willens wäre, sondern schlicht und einfach daran, dass die von ihm geleitete Seniorenresidenz Abendsonne komplett pleite war. Aber das durfte niemand wissen, nicht einmal Waldemar. Und auch nicht der heilige Sankt Florian.
Es war zwar überaus riskant, die Sache nicht der Polizei zu melden, aber ihm blieb nichts anders übrig, als zu pokern. Denn wenn die Entführung publik würde, dann würde auch rauskommen, warum er diese Reise für die sechs Heimbewohner überhaupt organisiert und was er mit ihnen vorhatte. Und dann Gnade mir Gott, dachte Drescher und wunderte sich, wie viel Religiosität plötzlich im Spiel war.
KAPITEL 5Auferstehung als Hobby
Während Mischa noch erschreckt in den Rückspiegel schaute, öffnete sich bereits die Schiebetür und die ältere Frau, die ihn zuvor auf seine verletzte Hand angesprochen hatte, stieg aus. Aber nicht, um nach hinten zu klettern und sich um die Verstorbene zu kümmern, deren Kopf mit offenem Mund und geschlossenen Augen gegen die Seitenscheibe gesunken war. Stattdessen kam sie um den Bus herum, öffnete die Fahrertür und verlangte nach seiner Hand. Vollkommen konsterniert hielt er sie ihr hin, ohne seinen Blick von der Toten im Fond lösen zu können.
Neben der plötzlich Verstorbenen saß ein älterer Herr, der einen Anzug mit Krawatte trug und weiterhin, vollkommen unbeeindruckt von dem tragischen Vorfall, ein Kreuzworträtsel zu lösen schien. »Ägyptischer Totengott mit sechs Buchstaben, der erste ist ein U? Ich kenne nur Anubis«, sagte er.
Es trafen sich die Blicke aus einem Paar grauer Augen mit denen von Mischas Augen im Rückspiegel.
»Upuaut!« Der Vorschlag kam von einem älteren Herrn, der seinen Platz auf der mittleren Sitzbank hatte. Mit seinen schlohweißen, nach allen Seiten abstehenden Haaren, erinnerte er Mischa an eine Mischung aus Albert Einstein und Dieter Hallervorden.
»Prima, Jakob! Upuaut passt«, bedankte sich der Mann von der Rückbank und trug die Buchstaben in sein Rätselheft ein. »Dann ist der Schwarzmeeranrainer mit T der Türke.«
»In der Türkei habe ich auch schon mal gedreht«, meldete sich plötzlich die Leiche zu Wort. Ein Umstand, der Mischa so erschreckte, dass er seine linke Hand zurückzog, die gerade verbunden werden sollte.
»Halten Sie doch mal still!«, herrschte seine Ersthelferin ihn an und griff fester zu.
»Aber … aber … die Dame, die war doch gerade noch tot.« In was für einen Alptraum war er denn hier geraten? Saß er mit lauter Zombies im Bus?
»Ach, das dürfen Sie nicht so eng sehen«, informierte ihn die junge Frau auf dem Beifahrersitz, für die diese Wiederauferstehung anscheinend nichts Außergewöhnliches war. »Lucy stirbt öfter mal.«
Mischa sah sie entgeistert an, doch ihre prompt folgende Erklärung ließ ihn aufatmen.
»Lucy hat ein Faible für Sterbeszenen. Zu Anfang hat sie uns damit fürchterlich erschreckt, aber mittlerweile nimmt das kaum noch jemand ernst, und alle lassen ihr den Spaß an diesem seltsamen Hobby.«
Gott sei Dank, also doch keine lebenden Toten, dachte Mischa erleichtert. Dann sah er im Rückspiegel, dass die ehemalige Leiche sich gerade die Lippen anmalte. In einem feurigen Rot, welches in starkem Kontrast zu ihrem blassen Gesicht stand.
»Jaja, wir haben uns alle schon daran gewöhnt, sie kann es einfach nicht lassen. Was macht seine Hand, Christiane?«, wollte die junge Frau von der Dame wissen, die dabei war, Mischa zu verbinden.
»Der Schnitt ist zum Glück nicht sehr tief. Ich habe ihn desinfiziert und verbunden. So sollte es erst mal gehen. Aber wir müssen da öfter mal draufsehen, um festzustellen, ob es sich entzündet hat.« Dabei entstanden auf ihrer Stirn ein paar Sorgenfalten. »Und wenn dem so ist, dann muss er zu einem richtigen Arzt.«
»Aber du bist doch eine richtige Ärztin«, lachte die junge Frau.
»Ich war mal eine, mein Kind, aber das ist schon lange vorbei.«
»Menschen behandeln ist doch sicher so wie Fahrradfahren, das verlernt man doch nicht«, kam der Einstein von der hinteren Sitzbank Mischas Beifahrerin zuvor.
»Mein lieber Jakob, du wirst dich wahrscheinlich wundern, aber Fahrradfahren habe ich nie gelernt.«
»Oje, dann geht es dir damit ja genauso wie mir mit dem Schwimmen«, gab die junge Frau zu.
Mischa wunderte sich, wie locker sie dabei mit der Älteren sprach. Und was war das denn überhaupt für ein Verein, den er hier durch die Gegend kutschierte? Aber vor allen Dingen: Wohin sollte deren Reise überhaupt gehen? Ein Tagesausflug zu irgendeinem Spargelhof?
Die ehemalige Ärztin packte soeben das unbenutzte Verbandmaterial wieder in den Erste-Hilfe-Kasten, und seine Beifahrerin wischte mit einem Papiertuch das Blut vom Lenkrad.
Es war rührend, wie sich die beiden um ihn kümmerten, bemerkte Mischa, in dem sich ein wenig Scham breitmachte. Scham darüber, dass er gelogen hatte. Mal wieder. Lügen war ihm in den letzten Jahren zu einer Art zweiter Natur geworden. Er log, um sich Geld zu leihen. Er log, um nicht arbeiten zu müssen, und er hatte seine Mutter belogen, indem er ihr genau das Gegenteil erzählt hatte. Sie glaubte, dass er jeden Tag brav zur Arbeit ging, um in der großen Firma eines Bielefelder Akademikers Unmengen von Puddingpulver zusammenzumischen.
Früher, ja früher, da war das alles anders gewesen. Da hatte er Lügen gehasst und sie sofort erkannt, wenn ihm eine aufgetischt wurde. Wenn seine Freunde sich rausredeten, weil sie lieber mit ihrer neuen Freundin abhingen, als mit ihm zum Schwimmen zu gehen. Wenn sein Vater mal wieder für ein paar Tage verschwand, weil er angeblich auf Montage war, aber stattdessen mit einem leeren Portemonnaie und einer Schnapsfahne zurückkehrte.
Sein Vater, der Quartalssäufer. Dessen Lügen hatten dann die seiner Mutter nach sich gezogen, die immer versucht hatte, die Krankheit ihres Mannes zu vertuschen oder mindestens herunterzuspielen. »Was sollen denn die Nachbarn denken?«
Er hatte begonnen, seinen Vater zu hassen, der sich nicht im Griff hatte. Dass Alkoholsucht eine Krankheit war, hatte Mischa erst begriffen, als es mit seinem Vater zu Ende ging und er beim Gespräch seiner Mutter mit dem Arzt dabei war. Da war er zwar erst dreizehn gewesen, hatte aber dennoch genau verstanden, was der Arzt ihnen vollkommen sachlich prophezeit hatte. Und bis auf eine Woche sollte er recht behalten. Sein Vater schaffte es genau sieben Tage länger zu leben, als der Mediziner vorausgesagt hatte.
Viele Jahre später kam ihm sein Vater wieder in den Sinn. Als er sich schweren Herzens eingestehen musste, dass er selber süchtig geworden war. Spielsüchtig. Seine Mutter war nach dem Tod ihres Mannes wieder zurück ins Saarland gezogen. Es war kein herzlicher Abschied gewesen. Ganz im Gegenteil. Mischa hatte den Eindruck gehabt, sie war froh gewesen, hier alles hinter sich lassen zu können. Auch ihn. Damals hatte er …
»Und? Geht es jetzt endlich weiter?«, riss ihn das Kreuzworträtsel von der hinteren Bank aus seinen Grübeleien.
Die Ärztin namens Christiane drückte die Fahrertür zu und kam um den Bus herum. Kaum saß sie wieder auf ihrem Sitz und hatte die Schiebetür geschlossen, folgte auch schon ein aufforderndes Nicken vom Beifahrersitz.
»Na, dann wollen wir mal weiter, oder? Ich heiße übrigens Alina.«
Dem Namen folgte ein derartig hübsches Lächeln, dass Mischa sofort den Motor startete. Sein Vorhaben, den Bus fluchtartig zu verlassen, war wie weggeblasen. Das Lächeln erwidernd, steuerte er auf die Fahrbahn und erntete dafür ein wütendes Hupen, weil er weder einen Schulterblick machte noch einen Blick in den Rückspiegel warf.
KAPITEL 6Nur Verwandtenbesuche sind schlimmer
Während der VW-Bus in Richtung Autobahn rollte, saß Manfred Drescher im Büro der Abendsonne und kaute auf seinen Fingernägeln. Dabei fiel ihm der Spruch des Pessimisten ein, der da lautete »Schlimmer kann es nicht mehr kommen!«, und die Antwort des Optimisten, der mit »Doch, doch!« dagegenhält.
Genauso fühlte er sich jetzt. Noch gestern hatte er gedacht, dass er sich mit dem Frisieren der Geschäftsbücher und der unerlaubten Verwendung der Einlagen seiner Bewohner über Wasser halten konnte. Aber heute Morgen hatte ihm seine Bank unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass er den Kopf nicht hängen lassen sollte, weil ihm das Wasser finanziell nicht nur bis zum Hals stand, sondern schon an seine Unterlippe schwappte. Die Herren Bänker bestanden sogar auf sofortiger Tilgung der fälligen Kreditraten, ansonsten … Drescher wusste, dass die Drohung einer Bank gefährlicher war als die eines Gangsters mit einer Pistole in der Hand.
Aber woher sollte er das Geld nehmen? Er hatte doch regelmäßig neue Löcher aufgerissen, um ältere zu stopfen. Als letzte Möglichkeit waren ihm nur noch die Einlagen der Bewohner geblieben, und um zu verhindern, dass die dahinterkamen, was er mit ihrem Geld trieb, hatte er die Busreise nach Würzewitz organisiert. Angeblich, um sie vor dem Lärm der noch zu tätigenden Arbeiten zu bewahren, hatte er ihnen eine Woche Urlaub in einem Luxushotel mit großem Wellnessbereich im wunderschönen Spreewald spendiert.
»Natürlich alles auf Kosten der Geschäftsleitung«, hatte er sie vollmundig und lächelnd angelogen.
Manfred Drescher war es bei dieser dreisten Lüge zwar siedend heiß den Rücken heruntergelaufen, aber einen anderen Ausweg hatte er nicht gesehen. Allerdings gab es keinen Wellnessbereich, was daran lag, dass es in Würzewitz auch kein Luxushotel gab. Lediglich einen Gasthof, der seine besten Jahre allerdings schon lange hinter sich hatte. Ein Laden mit Drei-Bettzimmern und einer Gemeinschaftsdusche für die gesamte Etage.
Aber all das spielte eigentlich keine Rolle, denn diese Absteige sollte ja nur als eine Art Zwischenlager fungieren. Von hier aus wollte er die lästigen Senioren dann weiter nach Polen verfrachten lassen. Dort gab es ein anderes Altersheim, schön nah an der Grenze zu Tschechien. Das würden sie im Rahmen einer angeblichen Tagestour erreichen. Damit wären sie schön weit weg, getreu dem Grundsatz: aus den Augen, aus dem Sinn.
So war es zumindest geplant gewesen. Tja, und nun war dieses Malheur mit dem entführten Bus passiert. Was hätte er denn der Polizei sagen sollen, wenn er die Entführung gemeldet hätte? Dass er sechs alte Menschen loswerden wollte, weil er deren Geld veruntreut hatte? Im selben Moment wurde er rot, weil er sich dabei ertappte, dass er sich vorstellte, wie ein bulliger Massenmörder im Brandenburger Morgennebel sechs Gräber aushob. Und obwohl das die optimale Lösung seiner Probleme bedeuten würde, schüttelte er diese Gedanken schnell wieder ab.
Nein, er musste jetzt hier dringend aufräumen, alles Belastende verschwinden lassen und sich aus dem Staub machen, bevor die ganze Sache aufflog. Doch in dem Moment, als die Bürotür krachend aufgestoßen wurde, wusste er, dass es dafür zu spät war.
Die beiden Männer sahen weder aus wie vereidigte Buchprüfer noch wie Qualitätskontrolleure. Sie sahen aus wie Leute, die sich das, von dem sie glaubten, es stehe ihnen zu, mit den Fäusten oder anderen Körperteilen holten. Drescher begann zu zittern und suchte mit den Augen verzweifelt nach einem Fluchtweg. Doch den gab es nicht.
Einer der beiden Männer hatte sich demonstrativ vor der Bürotür aufgebaut, der andere kam langsam, wie eine Raubkatze vor dem Sprung, auf ihn zu. Am Schreibtisch angekommen, stützte er seine behaarten Fäuste darauf und starrte Manfred Drescher an, als überlegte er, ob er ihn auffressen oder nur zerreißen sollte. Selbst dessen moderner und ergonomisch geformter Bürostuhl schaffte es nicht mehr, ihn aufrecht zu halten, so sehr war er in sich zusammengesunken.
Was wollten denn diese beiden Gorillas von ihm? Die sahen eher nach Inkasso Moskau