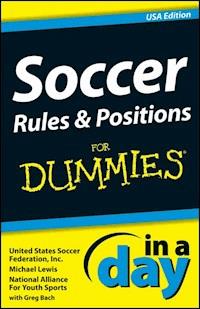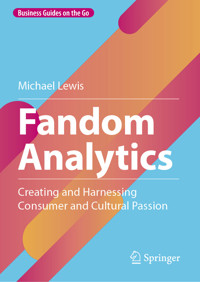5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
17 turbulente Geschichten – neue Storys von Stephen King und Joe Hill nebst im Deutschen Unveröffentlichtem von Richard Matheson, John Varley u.a., dazu Klassiker von Dan Simmons, Arthur Conan Doyle, Ray Bradbury ...
Nichts ist Stephen King ein größerer Gräuel, als fliegen zu müssen. Zusammen mit Mitherausgeber Bev Vincent teilt er nun seine Flugangst mit seinen Lesern. Die Anthologie versammelt alles, was gründlich schiefgehen kann, wenn man sich auf 30.000 Fuß Höhe mit 500 Knoten in einem Metallgefährt (einem Sarg?) durch die Lüfte bewegt. Flugreisen verwandeln sich hier schnell in Albträume, auf die man nie im Leben gekommen wäre. Da überlegt man es sich lieber zweimal, ob der Weg zum Ziel nicht in einer letzten Reise mündet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Die Herausgeber
Stephen King, 1947 in Portland, Maine, geboren, ist einer der erfolgreichsten amerikanischen Schriftsteller. 2018 erhielt er den PEN America Literary Service Award für sein Wirken, gegen jedwede Art von Unterdrückung aufzubegehren und die hohen Werte der Humanität zu verteidigen. Seine Werke erscheinen im Heyne-Verlag.
Bev Vincent ist vor allem für seine Sachbücher zum Werk von Stephen King bekannt. Daneben schrieb er unzählige Kurzgeschichten, die u. a. für den Edgar Award nominiert wurden. Er lebt in Texas.
FLUGUNDANGST
HERAUSGEGEBEN VON
STEPHEN KING
UND
BEV VINCENT
Aus dem Englischenvon Kathrin Bielfeldt, Jürgen Bürger,Gisbert Haefs, Julian Haefs, Marcel Häußler,Bernhard Kleinschmidt, Kristof Kurz,Gunnar Kwisinski, Friedrich Mader, Alfred Scholz,Friedrich Sommersberg, Violeta Topalovaund Sven-Eric Wehmeyer
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
FLIGHT OR FRIGHT
bei Cemetery Dance Publications, Baltimore
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 by Stephen King und Bev Vincent
Copyrightvermerk der Einzelbeiträge siehe Quellenverzeichnis.
Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe byWilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,unter Verwendung eines Fotos von © plainpicture / Cavan Images
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-24033-2V002
Die Anthologie ist all jenen Piloten – wirklichen und erdichteten – gewidmet, die ihre Flugzeuge und ihre Passagiere nach schlimmen Flügen sicher gelandet und nach Hause gebracht haben. Unter anderem:
Wilbur Wright
Chesley Sullenberger
Tammie Jo Shults
Vernon Demerest
Robert Pearson
Eric Gennotte
Tim Lancaster
Min-Yuan Ho
Eric Moody
Peter Burkill
Bryce McCormick
Robert Schornstheimer
Richard Champion de Crespigny
Robert Piché
Brian Engle
Ted Striker
Inhalt
Einleitung – Stephen King
Cargo – E. Michael Lewis
Das Grauen der Höhe – Arthur Conan Doyle
Albtraum auf 20000 Fuß – Richard Matheson
Die Flugmaschine – Ambrose Bierce
Luzifer! – E. C. TUBB
Die fünfte Kategorie – Tom Bissell
Zwei Minuten fünfundvierzig Sekunden – Dan Simmons
Diablitos – Cody Goodfellow
Luftangriff – John Varley
Freigabe erteilt – Joe Hill
Kriegsvögel – David J. Schow
Die Flugmaschine – Ray Bradbury
Zombies im Flugzeug – Bev Vincent
Alt werden sie nicht – Roald Dahl
Mord im Himmel – Peter Tremayne
Ein Fachmann für Turbulenzen – Stephen King
Im Fall – James Dickey
Nachwort: Eine wichtige Durchsage aus dem Cockpit – Bev Vincent
Autoren
Quellenverzeichnis
Einleitung
Stephen King
Gibt es in dieser modernen, technikhörigen Welt Leute, die gern fliegen? Schwer zu glauben, aber die gibt es bestimmt. Piloten fliegen gern, ebenso wie die meisten Kinder (Babys hingegen nicht, die Luftdruckschwankungen bringen sie durcheinander) und allerlei Luftfahrt-Enthusiasten, aber damit hat es sich. Für die Übrigen ist die kommerzielle Luftfahrt so reizvoll und spannend wie eine Kolorektaluntersuchung. Heutige Flughäfen ähneln meist einem überfüllten Zoo, in dem Geduld und ganz normale Höflichkeit bis zur Belastungsgrenze auf die Probe gestellt werden. Flüge sind verspätet, Flüge werden storniert, Gepäckstücke werden wie Sofakissen durch die Gegend geworfen und kommen häufig nicht zusammen mit den Passagieren an, die dringend saubere Hemden oder wenigstens eine einzige Garnitur frische Unterwäsche brauchten.
Wer am frühen Morgen fliegt, ist ganz und gar verratzt. Dann muss man sich um vier Uhr nachts aus dem Bett wälzen, um einen Eincheck- und Boarding-Prozess über sich ergehen zu lassen, der so unübersichtlich und aufreibend ist wie die Prozedur, im Jahre 1954 aus einem kleinen, korrupten südamerikanischen Land auszureisen. Haben Sie einen Lichtbildausweis? Haben Sie daran gedacht, Shampoo und Haarspülung in kleine, durchsichtige Plastikfläschchen abzufüllen? Sind Sie darauf vorbereitet, Ihre Schuhe auszuziehen und Ihre verschiedenen elektronischen Geräte durchleuchten zu lassen? Sind Sie sicher, dass niemand außer Ihnen Ihr Gepäck gepackt hat oder Zugang dazu hatte? Sind Sie bereit, sich in einen Ganzkörperscanner zu stellen und eventuell auch noch die Weichteile abtasten zu lassen? Ja? Gut. Aber dann stellt man womöglich trotzdem fest, dass der Flug überbucht, aus mechanischen oder wetterbedingten Gründen verspätet oder aufgrund eines Computerabsturzes ganz abgesagt worden ist. Wer übrigens Stand-by fliegt, dem helfe der Himmel; da hat man wahrscheinlich mehr Glück, wenn man ein Rubbellos kauft.
Diese Hürden überwindet man, um ein Ding zu besteigen, das in einem Beitrag dieser Anthologie als »heulender Schrein des Todes« bezeichnet wird. Man könnte fragen, ob das nicht doch ein bisschen übertrieben ist oder gar den Fakten zuwiderläuft. Zugegeben! Verkehrsflugzeuge gehen nur selten in Flammen auf (wenngleich wir alle beunruhigende Handyvideos von Düsentriebwerken gesehen haben, die in dreißigtausend Fuß Höhe Flammen spuckten), und man kommt im Luftverkehr nur selten zu Tode (statistisch gesehen ist es wahrscheinlicher, dass das beim Überqueren einer Straße passiert, vor allem dann, wenn man so dämlich ist, dabei aufs Handy zu schauen). Dennoch betritt man im Grunde eine mit Sauerstoff gefüllte Röhre und sitzt auf mehreren Tonnen leicht entzündlichem Düsentreibstoff.
Sobald diese Röhre aus Metall und Kunststoff verschlossen worden ist (wie – schluck! – ein Sarg) und die Startbahn verlässt, ihren schrumpfenden Schatten hinter sich, ist nur eines gewiss, und zwar so eindeutig, dass es keine Statistik braucht: Man wird wieder herunterkommen. Das verlangt die Schwerkraft. Die einzige Frage ist, wo und weshalb und in wie vielen Stücken, idealerweise in einem. Findet die Wiedervereinigung mit Mutter Erde auf mehreren Kilometern Beton statt (hoffentlich am erwünschten Ziel, im Notfall tun es auch einige gepflasterte Kilometer anderswo), ist alles bestens. Falls nicht, sinken die Überlebenschancen erheblich. Auch das ist eine statistische Tatsache, die selbst routinierte Flugreisende in Betracht ziehen müssen, wenn ihre Maschine in dreißigtausend Fuß in eine Clear-Air-Turbulenz gerät.
In solchen Momenten hat man keinerlei Kontrolle. Man kann nichts Konstruktives tun, außer zum wiederholten Mal den Sicherheitsgurt zu überprüfen, während in der Bordküche die Teller und Flaschen klappern, die Türen von Gepäckfächern aufspringen, Babys heulen, das Deo aufgibt und aus den Lautsprechern über einem die Stimme einer Flugbegleiterin ertönt: »Der Kapitän bittet Sie, sitzen zu bleiben.« Während die überfüllte Röhre schaukelt, schwankt, rattert und ächzt, hat man Zeit, über die Zerbrechlichkeit des eigenen Körpers nachzudenken und über jene eine unwiderlegbare Tatsache: Man wird mit Sicherheit herunterkommen.
Nachdem ich euch nun mit allerhand Denkanstößen für eure nächste Reise durch den Himmel versorgt habe, möchte ich eine folgerichtige Frage stellen: Gibt es eine menschliche Aktivität, irgendeine, die besser für eine Anthologie von Horror- und Thrillergeschichten geeignet wäre wie für jene, die ihr gerade in Händen haltet? Ich glaube nicht, meine Damen und Herren. Da ist nämlich alles enthalten: Klaustrophobie, Höhenangst, Willensverlust. Zwar hängt unser Leben immer an einem seidenen Faden, aber das ist nie eindeutiger, als wenn man durch dichte Wolken und starken Regen hindurch auf den LaGuardia Airport zufliegt.
Aus persönlicher Perspektive kann ich euch verraten, dass euer Herausgeber heute ein wesentlich besserer Fluggast ist als früher. Dank meiner schriftstellerischen Karriere bin ich im Lauf der vergangenen vierzig Jahre viel geflogen, und bis etwa 1985 hatte ich dabei gewaltige Angst. Die Theorie des Fliegens hat mir zwar ebenso eingeleuchtet wie die ganzen Sicherheitsstatistiken, aber das half überhaupt nichts. Teilweise lag mein Problem an dem Wunsch (den ich immer noch habe), über jede Situation die Kontrolle zu behalten. Am Lenkrad eines Autos fühle ich mich sicher, weil ich mir vertraue. Wenn jemand von euch am Lenkrad sitzen sollte, habe ich weniger Vertrauen (so leid mir das tut). Und wenn man ein Flugzeug besteigt und sich auf seinen Platz setzt, überlässt man die Kontrolle Leuten, die man nicht kennt und wahrscheinlich nicht einmal zu Gesicht bekommen wird.
Noch schlimmer für mich ist die Tatsache, dass ich meine Fantasie im Lauf der Zeit bis aufs Äußerste geschliffen habe. Solange ich an meinem Schreibtisch sitze und Geschichten ersinne, in denen sehr netten Leuten schreckliche Dinge zustoßen können, ist das prima. Weniger prima ist es, wenn ich in einem Flugzeug eingesperrt bin, das auf die Startbahn einbiegt, zögert und dann mit einer Geschwindigkeit vorwärtsschießt, die man bei jeder Familienkutsche für selbstmörderisch halten würde.
Fantasie ist eine zweischneidige Sache, und in jenen frühen Tagen, wo ich aus beruflichen Gründen viel zu fliegen begann, habe ich mich nur allzu leicht damit geschnitten. Zum Beispiel lag allzu nahe, über die ganzen beweglichen Teile in dem Triebwerk vor meinem Fenster nachzugrübeln. So viele Teile waren das, dass sie beinahe zwangsläufig in Disharmonie geraten mussten. Leicht – ja geradezu unvermeidlich – war es zudem, sich zu fragen, was jede kleine Veränderung im Geräusch dieses Triebwerks bedeuten mochte oder weshalb das Flugzeug sich urplötzlich in eine neue Richtung neigte, wodurch die Oberfläche der Pepsi in dem kleinen Plastikbecher ebenfalls eine bedrohliche Neigung bekam.
Wenn der Pilot nach hinten kam, um ein bisschen mit den Passagieren zu plaudern, überlegte ich, ob der Kopilot wohl wirklich qualifiziert war (so richtig qualifiziert konnte er bestimmt nicht sein, sonst hätte er nicht als Ersatz gedient). Vielleicht war aber auch der Autopilot eingeschaltet, und wenn der plötzlich den Geist aufgab, während der Pilot mit irgendjemand über die Siegchancen der Yankees diskutierte, und die Maschine unvermutet in einen Sturzflug überging? Was würde passieren, wenn sich die Verschlüsse des Gepäckraums öffneten? Wenn das Fahrwerk sich nicht ausfahren ließ? Wenn ein defektes Fenster platzte, das bei der Qualitätskontrolle übersehen worden war, weil der zuständige Bursche von seinem Schätzchen zu Hause träumte? Oder wenn wir von einem Meteor getroffen wurden und schlagartig der Kabinendruck absank?
Mitte der Achtzigerjahre ließen die meisten solcher Ängste nach, und zwar dank einer Nahtoderfahrung, die ich auf einem Flug nach Bangor, Maine, nach dem Start vom Flugplatz in Farmingdale bei New York hatte. Bestimmt gibt es massenhaft Leute – von denen manche gerade vielleicht dieses Buch lesen –, die beim Fliegen selbst einen Riesenschrecken bekommen haben, zum Beispiel weil das Bugfahrwerk zusammengebrochen oder die Maschine von der vereisten Landebahn gerutscht ist, aber damals bin ich dem Tod so nahe gekommen, wie es überhaupt möglich ist, wenn man nachher noch davon erzählen kann.
Es war am späten Nachmittag. Das Wetter war herrlich klar. Ich hatte einen Learjet 35 gechartert, in dem man sich beim Start so vorkam, als hätte man eine Rakete an den Arsch geschnallt. Mit der betreffenden Maschine war ich schon oft geflogen. Ich kannte die Piloten und vertraute ihnen, wofür es gute Gründe gab. Der auf dem linken Sitz hatte seinen ersten Düsenjet in Korea geflogen und dabei viele Kampfeinsätze überlebt. Inzwischen hatte er mehrere zehntausend Flugstunden auf dem Buckel. Daher holte ich meine Lektüre hervor, einen Roman in Taschenbuchform und ein Kreuzworträtselbuch, und erwartete einen störungsfreien Flug, gefolgt von einem freudigen Wiedersehen mit meiner Frau, meinen Kindern und unserem Hund.
Wir hatten eine Höhe von 7000 Fuß erreicht, und ich fragte mich gerade, ob ich meine Familie wohl dazu überreden könnte, abends mit mir ins Kino zu gehen, da verhielt der Learjet sich, als wäre er auf eine Mauer aufgeprallt. In diesem Augenblick war ich mir sicher, dass wir mit einer anderen Maschine zusammengestoßen waren und dass wir drei Insassen – beide Piloten und ich – sterben würden. Die Tür der kleinen Bordküche sprang auf, und der Inhalt ergoss sich in die Kabine. Die Kissen der freien Sitze flogen in die Luft. Der kleine Jet neigte sich … neigte sich stärker … und drehte sich dann ganz auf den Rücken. Das spürte ich, ohne es zu sehen. Ich hatte die Augen geschlossen. Mein Leben zog nicht blitzartig an mir vorüber. Ich dachte nicht: Aber ich wollte doch noch so viel tun. Da war kein Gefühl, mich zu fügen (oder nicht zu fügen). Da war nur die Gewissheit, dass meine Zeit gekommen war.
Dann fing sich die Maschine wieder. Im Cockpit brüllte der Kopilot: »Steve! Steve! Alles okay da hinten?«
Das bejahte ich. Ich beäugte den auf dem Gang verstreuten Kram, darunter mehrere Sandwiches, ein Salat und ein Stück Käsekuchen mit Erdbeergarnierung. Ich beäugte die gelben Sauerstoffmasken, die von der Decke hingen. Ich fragte – mit bewundernswert ruhiger Stimme –, was passiert sei. Das wussten meine beiden Piloten da noch nicht, wenngleich sie es ahnten und später bestätigten, dass wir um ein Haar mit einer 747 von Delta Airlines zusammengestoßen wären. Wir waren in den Strom der aus ihren Düsen austretenden Luft geraten und umhergeschleudert worden wie ein Papierflieger im Sturm.
In den fünfundzwanzig Jahren, die seither vergangen sind, habe ich Flugreisen wesentlich gelassener hingenommen. Schließlich hatte ich aus erster Hand erlebt, was ein modernes Flugzeug aushalten kann und wie ruhig und tüchtig gute Piloten (also die meisten) sein können, wenn es um die Wurst geht. Einer hat mir erklärt: »Du trainierst und trainierst, damit du dann, wenn aus sechs Stunden totaler Langeweile zwölf Sekunden höchster Gefahr werden, genau weißt, was zu tun ist.«
In den hier enthaltenen Geschichten werdet ihr einem Kobold begegnen, der auf dem Flügel einer 727 hockt, und durchsichtigen Monstern, die hoch über den Wolken leben. Ihr werdet auf Zeitreisen und Geisterflugzeuge stoßen. Vor allem jedoch werdet ihr jene zwölf Sekunden höchste Gefahr erleben, die eintreten, wenn das Schlimmste, was hoch oben in der Luft schieflaufen kann, tatsächlich schiefläuft. Ihr werden auf Klaustrophobie, Feigheit, Entsetzen und Momente der Tapferkeit stoßen. Falls ihr eine Reise mit Delta, American, Southwest oder einer anderen Fluggesellschaft vorhabt, seid ihr gut beraten, wenn ihr ein Buch von John Grisham oder Nora Roberts mitnehmt statt dieses. Aber selbst wenn ihr euch auf sicherem Boden befindet, solltet ihr euch gut anschnallen.
Es wird nämlich turbulent.
Stephen King
2. November 2017
Cargo
E. Michael Lewis
E. Michael Lewis, der Pilot unseres Jungfernflugs, studierte Kreatives Schreiben an der University of Puget Sound und lebt an der nördlichen Pazifikküste. Lassen Sie sich von seinem Lademeister an Bord einer Lockheed C-141A Starlifter begleiten (wie der im McChord Air Museum ausgestellten, der ein Fluch nachgesagt wird), die im Begriff steht, von Panama aus zu einem Transportflug in die Vereinigten Staaten abzuheben. Die StarLifter, ein wahrer Lastesel von einem Flugzeug, ist in der Lage, über kürzere Distanzen hinweg bis zu 32 Tonnen Zuladung zu transportieren. Sie kann einhundert Fallschirmspringer plus hundertfünfzig voll ausgerüstete Soldaten transportieren, Lkws und Jeeps, ja sogar Minuteman-Interkontinentalraketen. Oder eben kleinere Frachtstücke. Zum Beispiel Särge. Es gibt Geschichten darüber, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen; hier ist eine, die einem die Wirbelsäule hochkriecht, Zentimeter um Zentimeter, und anschließend lange, sehr lange im Gedächtnis haften bleibt.
Willkommen an Bord.
November 1978
Ich träumte von Fracht. Tausende Kisten füllten den Laderaum des Flugzeugs, alle aus unbehandeltem Weichholz von der Sorte, die Splitter durch Arbeitshandschuhe treibt. Sie waren mit unverständlichen Nummern und seltsamen Akronymen gekennzeichnet, die deutlich rot leuchteten. Es waren angeblich Reifen für Jeeps, aber manche waren so groß wie ein Haus, andere wiederum klein wie eine Zündkerze. Alle waren sie mit Gurten, die an die Riemen einer Zwangsjacke erinnerten, auf Paletten befestigt. Ich bemühte mich, alle zu überprüfen, aber es waren einfach zu viele. Ein leises Scharren war zu hören, die Kisten bewegten sich, und dann krachte die Ladung über mir zusammen. Weil ich nicht an die Gegensprechanlage herankam, konnte ich den Piloten nicht warnen. Die Ladung drückte mich mit tausend scharfen kleinen Fingern nieder, während das Flugzeug schlingerte, sie presste das Leben aus mir heraus, noch als wir uns im Sturzflug befanden, selbst als wir aufschlugen, und jetzt schrillte die Gegensprechanlage wie ein Schrei. Aber da war noch ein Geräusch, aus dem Inneren der Kiste direkt neben meinem Ohr. Etwas strampelte in der Kiste, etwas Durchweichtes und Besudeltes, etwas, was ich nicht sehen wollte, etwas, was herauswollte.
Es verwandelte sich in das Geräusch eines Klemmbretts, das gegen den Metallrahmen meiner Pritsche geschlagen wurde. Ich riss die Augen auf. Der Gefreite – dem Schweißsaum an seinem Kragen nach zu urteilen, war er offenbar erst neu dabei – ragte über mir auf, hielt das Klemmbrett zwischen uns und wollte sich offenbar darüber klar werden, ob ich einer von der Sorte war, die ihm den Kopf abriss, nur weil er seine Arbeit machte. »Tech Sergeant Davis«, sagte er. »Sie werden umgehend draußen gebraucht.«
Ich setzte mich auf und reckte mich. Er reichte mir das Klemmbrett mit dem darauf befestigten Ladungsverzeichnis: ein zerlegter HU-53samt Besatzung, Mechanikern und medizinischem Hilfspersonal auf dem Weg nach … irgendeinem neuen Ziel.
»Timehri Airport?«
»Das ist außerhalb von Georgetown, Guyana.« Weil ich ihn verdutzt ansah, fuhr er fort: »Das ist eine ehemalige britische Kolonie. Timehri hieß früher Atkinson Air Force Base.«
»Und wie sieht der Auftrag aus?«
»Es geht um so was wie die Evakuierung von Auslandsamerikanern aus einem Ort namens Jonestown.«
Amerikaner in Not. Ich hatte einen Gutteil meiner Zeit bei der Air Force damit verbracht, Amerikaner aus brenzligen Situationen auszufliegen. Abgesehen davon, war es erheblich befriedigender, Amerikaner aus Schwierigkeiten auszufliegen, als Jeepreifen zu befördern. Ich bedankte mich bei ihm und zog schnell einen frischen Overall an.
Ich freute mich auf ein weiteres panamaisches Thanksgiving auf der Howard Air Force Base – dreißig Grad, gefüllter Truthahn aus der Kantine, Football aus dem Armed Forces Radio und genug dienstfreie Zeit, dass ich mir ordentlich die Kante geben konnte. Der Flug von den Philippinen war reine Routine gewesen, und sowohl Passagiere als auch Fracht hatten keine Schwierigkeiten bereitet. Und jetzt das.
Als Lademeister gewöhnte man sich an Störungen. Die C-141 Starlifter war der größte Fracht- und Truppentransporter des Military Airlift Command, fasste gut dreißig Tonnen Fracht oder zweihundert kampfbereite Soldaten und konnte sie an jeden x-beliebigen Ort der Welt fliegen. Die nach hinten geschwungenen Tragflächen des Schulterdeckers – der insgesamt halb so lang wie ein Footballfeld war – hingen wie bei einer Fledermaus über dem Rollfeld. Mit dem hohen Leitwerk in T-Form, den Ausstiegstüren und der integrierten Laderampe war die Starlifter unübertroffen, soweit es um den Transport von Fracht ging. Teils Stewardess und teils Packer, bestand mein Job als Lademeister hauptsächlich darin, die Ladung so platzsparend und sicher wie möglich zu verstauen.
Nachdem alles an Bord war und meine Unterlagen über Gewicht und Verteilung der Fracht komplettiert waren, traf mich derselbe Gefreite dabei an, wie ich das panamaische Bodenpersonal dafür verfluchte, Schrammen an der Außenhaut der Maschine hinterlassen zu haben.
»Sergeant Davis!«, brüllte er gegen das Jaulen des Gabelstaplers an. »Planänderung!« Er gab mir ein weiteres Passagier- und Ladungsverzeichnis.
»Mehr Passagiere?«
»Andere Passagiere. Das medizinische Personal bleibt hier.« Er murmelte irgendwas Unverständliches über einen geänderten Einsatzplan.
»Wer sind die Leute?«
Wieder musste ich mich anstrengen, ihn zu verstehen. Oder vielleicht verstand ich ihn auch sehr gut und wollte angesichts des flauen Gefühls in meinem Bauch nur, dass er es noch einmal wiederholte. Ich wollte ihn falsch verstehen.
»Todesregister«, brüllte er.
Das war zumindest, was ich meinte gehört zu haben.
Timehri war ein typischer Dritte-Welt-Flughafen – groß genug für eine 747, aber überzogen mit Schlaglöchern und voller verrosteter Wellblechbaracken. Der den Landeplatz umgebende Dschungelsaum sah aus, als wäre er erst eine Stunde zuvor gestutzt worden. Überall das Dröhnen von Hubschraubern, und die Rollbahn wimmelte von amerikanischen Soldaten. Da wusste ich, dass es ziemlich übel sein musste.
Außerhalb des Vogels drohte mir die vom Asphalt aufsteigende Hitze die Sohlen von den Stiefeln zu schmelzen, noch bevor ich die Unterlegkeile an Ort und Stelle hatte. Ein aus amerikanischen GIs bestehendes Bodenpersonal rollte an und brannte förmlich darauf, den Hubschrauber zu entladen und zusammenzubauen. Einer mit nacktem Oberkörper, das Hemd um die Taille gebunden, reichte mir ein Ladungsverzeichnis.
»Mach’s dir nicht gemütlich«, sagte er. »Sobald der Hubschrauber klar ist, beladen wir dich.« Er deutete mit dem Kopf über seine Schulter.
Ich ließ den Blick über die flirrende Rollbahn wandern. Särge. Reihen um Reihen Bestattungskisten aus matt glänzendem Aluminium standen in der unerbittlichen tropischen Sonne. Ich erkannte sie von meinen Flügen aus Saigon sechs Jahre zuvor wieder, meinen ersten als Lademeister. Vielleicht schlugen meine Gedärme einen kleinen Salto, weil ich keine Pause gehabt hatte, vielleicht aber auch, weil ich seit Jahren keine Leiche mehr transportiert hatte. Jedenfalls schluckte ich heftig. Ich warf einen Blick auf den Bestimmungsort: Dover, Delaware.
Das Bodenpersonal verlud gerade eine neue Komfortkabine, als ich erfuhr, dass wir auf dem Flug zwei Passagiere haben würden.
Zunächst war da ein junger Mann, anscheinend frisch von der Highschool, mit kurzem, schwarzem Haar und einer zu großen, frisch gewaschenen und gestärkten Dschungeluniform mit den Abzeichen eines Obergefreiten der Luftwaffe. Ich begrüßte ihn an Bord und wollte ihm durch die Tür für die Besatzung helfen, aber er zuckte zurück und stieß sich dabei fast den Kopf an dem niedrigen Türrahmen. Ich glaube, ich hätte auch einen Satz zurück gemacht, wäre dafür Platz gewesen. Sein Geruch, intensiv medizinisch, erwischte mich voll – Wick Vaporub.
Hinter ihm stieg ebenfalls ohne Hilfe eine Krankenschwester ein, knackig und professionell in Gang, Bekleidung und Gebärden. Ich musterte sie eingehend und erkannte sie als eine von denen wieder, die ich in meiner Anfangszeit regelmäßig von Clark auf den Philippinen nach Da Nang und zurück geflogen hatte. Ein grauhaariger Lieutenant mit stählernem Blick. Sie hatte mir – mehr als nur einmal – deutlich zu verstehen gegeben, dass jeder Schwachkopf von Highschoolabbrecher meinen Job besser erledigen könne. Auf dem Namensschild an ihrer Uniform stand Pembry. Sie legte dem Jungen eine Hand auf die Schulter und schob ihn zu den Sitzplätzen. Ob sie mich wiedererkannte, ließ sie sich nicht anmerken.
»Freie Platzwahl«, sagte ich den beiden. »Ich bin Tech Sergeant Davis. Wir werden in einer knappen halben Stunde starten, also machen Sie es sich bequem.«
Der junge Mann blieb abrupt stehen. »Davon haben Sie nichts gesagt«, sagte er zur Krankenschwester.
Der Frachtraum einer Starlifter ähnelt mit all den im Unterschied zu einer Passagiermaschine unverkleidet geführten Rohren für Warm-, Kalt- und Druckluft stark an das Innere eines Heizungskellers. Die Särge standen mit einem freien Gang in der Mitte in zwei Reihen über die ganze Länge des Frachtraums. Jeweils vier übereinandergestapelt, waren es insgesamt einhundertsechzig Stück. Sie wurden von gelben Ladenetzen fixiert. Wir blickten an ihnen entlang und sahen auf das schwindende Sonnenlicht, während sich die Ladeklappe schloss und uns in ein unangenehmes Halbdunkel hüllte.
»Es ist die schnellste Möglichkeit, Sie nach Hause zu bekommen«, sagte sie mit ausdrucksloser Stimme zu ihm. »Sie wollen doch nach Hause, oder nicht?«
Seine Stimme strotzte vor ängstlicher Empörung. »Ich will sie nicht sehen. Ich will einen Sitzplatz, der nach vorn gerichtet ist.«
Hätte der junge Mann seinen Blick schweifen lassen, dann hätte er sehen können, dass es keine nach vorn gerichteten Sitzplätze gab.
»Ist schon okay«, sagte sie und zog an seinem Arm. »Die kehren auch nach Hause zurück.«
»Ich will sie nicht ansehen«, sagte er, während sie ihn zu einem Sitz in der Nähe eines der kleinen Fenster weiterschob. Weil er keine Anstalten machte, sich anzuschnallen, beugte Pembry sich vor und erledigte das für ihn. Er umklammerte unterdessen die Handläufe, als wär’s der O-Scheiße-Sicherheitsbügel eines Achterbahnwagens. »Ich will nicht an sie denken.«
»Alles klar.« Ich ging nach vorn und schaltete die Kabinenbeleuchtung aus. Jetzt fiel nur noch das rote Licht der Lampen neben den beiden Ausstiegen für die Fallschirmspringer auf die länglichen Metallbehälter. Auf dem Rückweg nahm ich ihm ein Kopfkissen mit.
Auf dem Namensschild an der weiten Jacke des Knaben stand Hernandez. Er bedankte sich, ließ aber keine Sekunde die Armlehnen los.
Pembry schnallte sich neben ihm an. Ich verstaute ihren Kram und ging meine letzte Checkliste durch.
Als wir in der Luft waren, brühte ich auf dem Elektroherd in der Komfortkabine einen Kaffee auf. Schwester Pembry lehnte dankend ab, aber Hernandez nahm an. Der Plastikbecher zitterte in seinen Händen.
»Flugangst?«, fragte ich. Das wäre selbst bei der Air Force nicht weiter ungewöhnlich. »Ich hab was gegen Reisekrankheit da …«
»Ich habe keine Flugangst«, presste er durch zusammengebissene Zähne. Dabei sah er die ganze Zeit an mir vorbei zu den Sargreihen im Frachtraum.
Dann zur Crew. Anders als früher hatte kein einziger Vogel mehr eine feste Crew. Das MAC war äußerst stolz darauf, untereinander so austauschbare Leute zu haben, dass das auf irgendeinem Flugplatz zusammengewürfelte Flugpersonal jeden Starlifter bis ans Ende der Welt fliegen konnte, ohne sich je zuvor begegnet zu sein. Jeder kannte meinen Job in- und auswendig, genau wie ich den jedes anderen.
Ich ging zum Cockpit und traf alle auf ihrem Platz an. Der zweite Ingenieur saß über seine Instrumente gebeugt am nächsten zur Cockpittür. »Die Vier läuft jetzt ruhig, das Gas gedrosselt halten«, sagte er. Ich erkannte seinen Hundeblick und den schleppenden Arkansas-Tonfall, konnte aber nicht sagen, woher. Nach sieben Jahren mit Starliftern war ich vermutlich zum einen oder anderen Zeitpunkt mit so ziemlich jedem geflogen. Er bedankte sich für den schwarzen Kaffee, den ich auf sein Tischchen stellte. Auf dem Namensschildchen an seinem Overall stand Hadley.
Der erste Ingenieur saß auf dem Mittelsitz, der normalerweise für einen »Black Hatter« vorbehalten war – Einsatzkontrolleure waren der Fluch aller MAC-Crews. Er bat um zwei Würfel Zucker, stand dann auf und sah aus der Kuppel des Navigators hinaus auf den vorbeirasenden blauen Himmel.
»Die Vier gedrosselt, alles klar«, antwortete der Pilot. Er war der ausgewiesene Flugzeugkommandant, aber sowohl er als auch der Kopilot waren so durch und durch Flieger, dass sie ein und dieselbe Person hätten sein können. Jeder nahm seinen Kaffee mit doppelter Sahne. »Wir versuchen, Turbulenzen im wolkenfreien Raum zu umfliegen, aber leicht wird das nicht. Sagen Sie Ihren Passagieren, dass sie mit heftigen Unruhen rechen sollen.«
»Werd ich tun, Sir. Sonst noch was?«
»Danke, Load Davis, das wäre alles.«
»Jawohl, Sir.«
Endlich Zeit zum Entspannen. Als ich mich im Ruheraum der Crew für einen Moment in die Horizontale zurückziehen wollte, sah ich Pembry in der Komfortkabine herumschnüffeln. »Kann ich Ihnen bei der Suche nach was behilflich sein?«
»Eine weitere Decke?«
Ich zog eine aus dem Lagerschrank zwischen Kochstation und Latrine und biss die Zähne zusammen. »Sonst noch was?«
»Nein«, sagte sie und klaubte einen imaginären Fussel von der Wolle. »Wir sind übrigens schon mal zusammen geflogen.«
»Tatsächlich?«
Sie lüpfte eine Augenbraue. »Wahrscheinlich sollte ich mich entschuldigen.«
»Nicht nötig, Ma’am«, sagte ich. Ich schob mich an ihr vorbei und öffnete den Kühlschrank. »Ich könnte später eine kleine Mahlzeit servieren, falls Sie …«
Sie legte mir eine Hand auf die Schulter, wie sie es zuvor schon bei Hernandez getan hatte, und das sicherte ihr meine Aufmerksamkeit. »Sie erinnern sich an mich.«
»Ja, Ma’am.«
»Ich war damals bei diesen Evakuierungsflügen ziemlich unfreundlich zu ihnen.«
Ich wünschte, sie wäre nicht so direkt. »Sie haben gesagt, was sie dachten, Ma’am. Mich hat’s zu einem besseren Lademeister gemacht.«
»Trotzdem …«
»Ma’am, es ist schon gut.« Warum kapieren Frauen nicht, dass Entschuldigungen alles nur noch schlimmer machen?
»Na schön.« Ihre harten Gesichtszüge entspannten sich, und mit einem Mal kam es mir vor, als wollte sie einfach nur mit jemand reden.
»Was macht Ihr Patient?«
»Er ruht.« Pembry gab sich sichtlich Mühe, ungezwungen zu wirken, aber ich wusste, dass sie mehr sagen wollte.
»Wo liegt das Problem?«
»Er war einer der Ersten, die ankamen«, sagte sie. »Und ist der Erste, der wieder geht.«
»Jonestown? War’s so schlimm?«
Flashback zu unseren früheren Evakuierungsflügen. Der alte Ausdruck, hart und abweisend, kehrte sofort zurück. »Wir sind auf Befehl des Weißen Hauses von Dover aus losgeflogen, fünf Stunden nachdem man den Anruf erhalten hatte. Er ist Spezialist für Krankenberichte, erst seit sechs Monaten im Dienst, war vorher noch nie irgendwo, hat in seinem bisherigen Leben noch kein Trauma erlebt. Und ehe er sich’s versieht, befindet er sich mit tausend Leichen in einem südamerikanischen Dschungel.«
»Tausend?«
»Die abschließenden Zahlen liegen noch nicht vor, aber es geht stark in diese Richtung.« Sie strich sich mit dem Handrücken über die Wange. »So viele Kinder.«
»Kinder?«
»Ganze Familien. Die haben alle Gift getrunken. So etwas wie eine Sekte, heißt es. Irgendwer hat mir erzählt, die Eltern hätten zuerst ihre Kinder umgebracht. Ich weiß nicht, was einen Menschen dazu bringen kann, der eigenen Familie so etwas anzutun.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich bin in Timehri geblieben, um alles Nötige zu organisieren. Hernandez meint, der Geruch sei unvorstellbar gewesen. Sie mussten die Leichen mit Insektiziden einsprühen und gegen hungrige Riesenratten verteidigen. Er sagt, er hätte die Leichen bajonettieren müssen, um Druck entweichen zu lassen. Er hat seine Uniform verbrannt.« Weil unser Vogel plötzlich durchsackte, machte sie einen schnellen Ausfallschritt.
Bei dem Versuch, mir nicht plastisch vorzustellen, was sie da erzählte, stieg mir etwas Unangenehmes im Hals hoch. Ich gab mir die größte Mühe, keine Miene zu verziehen. »Der Kommandant hat gesagt, es könnte ein bisschen unruhig werden. Schnallen Sie sich lieber an.« Ich begleitete sie zurück an ihren Platz. Hernandez lümmelte mit offenem Mund auf seinem Sitz und sah aus, als hätte er bei einer Kneipenschlägerei auf übelste Art den Kürzeren gezogen. Dann ging ich zu meiner Koje und schlief ein.
Man kann jeden Lademeister fragen: Wenn man so lange in der Luft ist, hört man irgendwann das Dröhnen der Triebwerke nicht mehr. Man stellt fest, dass man praktisch unter allen Bedingungen schlafen kann. Trotzdem bleibt der Verstand immer geschärft, und man wacht bei jedem ungewöhnlichen Geräusch sofort auf, wie zum Beispiel auf dem Flug von Yokota nach Elmendorf, wo sich ein Jeep aus der Verankerung gelöst hatte und gegen eine Kiste mit Feldrationen gerollt war. Überall geschnetzeltes Rindfleisch. Man kann Gift darauf nehmen, dass ich dem Bodenpersonal deshalb ordentlich die Hölle heißgemacht habe. Also sollte es nicht weiter verwundern, dass ich bei dem Geräusch eines Schreis aufschreckte.
Ohne großes Nachdenken auf den Beinen, aus der Koje, vorbei an der Komfortkabine. Dann sah ich Pembry. Sie saß nicht mehr an ihrem Platz, sondern stand vor Hernandez, wich seinen wild um sich schlagenden Armen aus und sprach ruhig und leiser als der Lärm der Turbinen auf ihn ein. Er jedoch nicht.
»Ich hab sie gehört! Ich hab sie gehört! Sie sind da drinnen! All die Kinder! All die Kinder!«
Ich legte ihm eine Hand auf die Schulter – mit Nachdruck. »Ganz ruhig!«
Er hörte auf, um sich zu schlagen. Ein beschämter Ausdruck trat in sein Gesicht. Er fixierte mich. »Ich hab sie singen hören.«
»Wen?«
»Die Kinder! All die …« Er gestikulierte hilflos zu den unbeleuchteten Särgen.
»Sie haben nur geträumt«, sagte Pembry. Ihre Stimme bebte leicht. »Ich war die ganze Zeit bei Ihnen. Sie haben fest geschlafen. Sie können überhaupt nichts gehört haben.«
»Alle Kinder sind tot«, sagte er. »Alle. Sie wussten es nicht. Woher sollten sie auch wissen, dass sie Gift trinken? Wer würde dem eigenen Kind Gift zu trinken geben?« Ich ließ seinen Arm los, und er sah mich an. »Haben Sie Kinder?«
»Nein«, erwiderte ich.
»Meine Tochter ist anderthalb Jahre alt, mein Sohn drei Monate«, sagte er. »Man muss sehr behutsam mit ihnen umgehen, muss geduldig mit ihnen sein. Also, meine Frau kann das wirklich sehr gut.« Ich bemerkte zum ersten Mal die Schweißperlen auf seiner Stirn, auf seinen Handrücken. »Aber ich stell mich auch ganz passabel an. Ich meine, ich weiß eigentlich gar nicht wirklich, was zum Teufel ich tue, aber ich würde ihnen niemals wehtun. Ich halte sie und singe ihnen was vor – und falls einer versuchen sollte, ihnen was anzutun …« Er umklammerte meinen Arm. »Wer würde seinem Kind Gift geben?«
»Es ist nicht Ihre Schuld«, sagte ich zu ihm.
»Sie wussten nicht, dass es Gift ist. Sie wissen es immer noch nicht.« Er zog mich näher zu sich heran und sprach mir ins Ohr. »Ich hab sie singen hören.«
Ich will verdammt sein, aber bei seinen Worten lief es mir eiskalt über den Rücken.
»Ich geh mal nachsehen«, sagte ich zu ihm, schnappte eine Taschenlampe von der Wand und ging den Mittelgang hinunter.
Es gab einen sehr praktischen Grund, dem Lärm auf den Grund zu gehen. Als Lademeister wusste ich, dass jedes ungewöhnliche Geräusch Ärger bedeuten konnte. Ich habe mal die Geschichte einer Besatzung gehört, die immer wieder irgendwo im Frachtraum eine Katze miauen hörte. Der Lademeister konnte sie nicht finden, vermutete aber, dass sie schon auftauchen würde, wenn sie die Ladung löschten. Stellte sich heraus, dass das »Miauen« von einem altersschwachen Ladebalken rührte. Als das Fahrwerk auf der Landebahn aufsetzte, gab der Balken komplett nach, wodurch drei Tonnen hochexplosiver Kampfmittel gelöst wurden, was die Landung ausgesprochen interessant gestaltete. Merkwürdige Geräusche bedeuteten Probleme, und ich wäre ein Idiot gewesen, der Sache nicht nachzugehen.
Ich kontrollierte beim Gehen sämtliche Zurrgurte, Sperrbalken und Sicherungsnetze, blieb immer wieder stehen und lauschte, achtete auf Anzeichen von verrutschter Ladung, ausfasernden Riemen, einfach alles, was außergewöhnlich sein könnte. Ich ging auf der einen Seite hinauf und auf der anderen herunter, überprüfte sogar die Ladetüren. Nichts. Alles tadellos, Ergebnis meiner gewohnt hervorragenden Arbeit.
Ich ging den Gang hinauf zu ihnen. Hernandez hatte den Kopf in den Händen vergraben und weinte. Pembry saß neben ihm und streichelte ihm den Rücken, wie meine Mutter es auch immer bei mir gemacht hatte.
»Alles in Ordnung, Hernandez.« Ich befestigte die Taschenlampe wieder an der Wand.
»Danke«, antwortete Pembry für ihn und fügte für mich hinzu: »Ich habe ihm eine Valium gegeben. Er müsste sich jetzt beruhigen.«
»War nur ein Sicherheitscheck«, sagte ich. »So, und jetzt ruhen Sie sich beide ein bisschen aus.«
Ich kehrte zurück zu meiner Koje, wo ich allerdings Hadley vorfand, unseren zweiten Ingenieur. Ich nahm die unter ihm, konnte aber nicht sofort einschlafen. Ich versuchte an etwas völlig anderes zu denken als an den Grund, warum sich die Särge überhaupt in meinem Vogel befanden.
Fracht lautete der Euphemismus. Von Blutplasma über Sprengstoffe und Limousinen des Secret Service bis zu Goldbarren: Man verstaute und transportierte die Dinge, weil der Job das halt verlangte, nichts weiter, und alles, was getan werden konnte, damit es schneller ging, war wichtig.
Nur Fracht, dachte ich. Aber ganze Familien, die sich umbrachten … Ich war froh, sie aus dem Dschungel herauszubekommen, zurück nach Hause zu ihren Familien – aber die Sanitäter, die als Erste dort eintrafen, das ganze Bodenpersonal, selbst meine Crew, wir alle kamen zu spät, als dass wir mehr hätten tun können. Ich war auf eine unbestimmte, ungefähre Art durchaus an eigenen Kindern interessiert, und es machte mich total sauer zu hören, dass jemand Kindern ein Leid antat. Aber diese Eltern hatten es vorsätzlich getan, richtig?
Ich konnte nicht entspannen. Ich fand eine zusammengefaltete alte Ausgabe der New York Times in meiner Koje. Frieden im Nahen Osten zu unseren Lebzeiten stand da. Neben dem Artikel ein Foto der Präsidenten Carter und Sadat beim Händeschütteln. Ich war gerade dabei wegzunicken, da meinte ich, Hernandez wieder aufheulen zu hören.
Ich wuchtete meinen Arsch hoch. Pembry stand mit den Händen vor dem Mund da. Ich dachte, dass Hernandez sie geschlagen hatte, also ging ich zu ihr und zog ihre Hände fort, um nach Verletzungen zu sehen.
Es gab keine. Als ich einen Blick über ihre Schulter warf, sah ich Hernandez wie festgenagelt auf seinem Platz. Die Augen klebten in der Dunkelheit wie auf einem Fernsehbild mit invertierten Farben.
»Was ist passiert? Hat er Sie geschlagen?«
»Er … er hat es wieder gehört«, stammelte sie, während sie wieder eine Hand zu ihrem Gesicht hob. »Sie … Sie sollten vielleicht noch mal nachsehen. Sie sollten noch mal kontrollieren …«
Das Flugzeug veränderte seine Lage, und sie stolperte mir ein Stück entgegen. Beim Versuch, das Gleichgewicht zu halten, indem ich ihren Ellbogen ergriff, sackte sie gegen mich. Ich erwiderte ihren Blick nüchtern. Sie schaute fort. »Was ist passiert?«, fragte ich wieder.
»Ich hab’s auch gehört«, sagte Pembry.
Ich ließ den Blick zu dem im Schatten liegenden Gang wandern. »Gerade eben?«
»Ja.«
»War es so, wie er behauptet? Singende Kinder?« Ich merkte, dass ich kurz davor stand, sie zu schütteln. Drehten jetzt beide durch?
»Spielende Kinder«, sagte sie. »Also – irgendwie so Spielplatzgeräusche. Spielende Kinder.«
Ich zermarterte mir das Hirn, welcher Gegenstand oder welche Sammlung von Gegenständen nach Verladung in eine C-141 Starlifter in neununddreißigtausend Fuß über der Karibik ein Geräusch wie spielende Kinder machen könnte.
Hernandez veränderte seine Haltung, und wir richteten beide wieder unsere Aufmerksamkeit auf ihn. Er lächelte geschlagen und sagte zu uns: »Ich hab’s ja gesagt.«
»Ich werd noch mal nachsehen«, sagte ich.
»Lasst sie spielen«, sagte Hernandez. »Sie wollen doch nur spielen. Haben Sie das als Kind nicht auch gewollt?«
Ich erinnerte mich schlagartig an meine Kindheit, an endlose Sommer und Radtouren und aufgeschürfte Knie, an meine Mutter, die mich rügte, wenn ich in der Dämmerung nach Hause kam: »Sieh nur, wir schmutzig du wieder bist.« Ich fragte mich, ob die Bergungsmannschaften die Leichen wohl wuschen, bevor die in Särge gelegt wurden.
»Ich werde herausfinden, was das ist«, sagte ich. Ich nahm wieder die Taschenlampe und ging. »Rührt euch nicht vom Fleck.«
Ich nutzte die Dunkelheit, um mich weniger auf mein Sehvermögen zu verlassen und mehr aufs Hören zu konzentrieren. Die Turbulenzen hatten sich inzwischen gelegt, und ich verwendete die Taschenlampe nur, um nicht über die Ladungsnetze zu stolpern. Ich lauschte auf alles, was irgendwie fremd oder ungewöhnlich war. Es war nicht nur eine Sache – es musste eine Mischung sein –, solche Geräusche hörten nicht einfach auf und fingen wieder an. Ein Treibstoffleck? Ein blinder Passagier? Der Gedanke an eine Schlange oder eine in diesen Metallkisten lauernde Dschungelbestie schärfte all meine Sinne und brachte meinen Traum zurück.
In der Nähe der Frachttür schaltete ich meine Lampe aus und lauschte. Druckluft. Vier Pratt-&-Whitney-Mantelstromtriebwerke. Geklapper. Flatternde Spannriemen.
Und dann … etwas. Nach einem Moment deutlich hörbar, zunächst dumpf und undifferenziert, wie ein Geräusch aus den Tiefen einer Höhle, aber dann klar und unaufgefordert, wie etwas, was ein überraschter heimlicher Lauscher vernimmt.
Kinder. Lachen. Wie bei einer Pause in der Grundschule.
Ich öffnete die Augen und ließ den Strahl der Taschenlampe über die silbernen Kisten wandern. Ich fand sie wartend, an mich gedrängt, beinahe erwartungsvoll.
Kinder, dachte ich, bloß Kinder.
Ich rannte an Hernandez und Pembry vorbei zur Komfortkabine. Ich kann nicht sagen, was sie in meinem Gesicht sahen, aber falls es nur annähernd so etwas wie das war, was ich in dem kleinen Spiegel über dem Waschbecken der Latrine sah, hätte ich es schlagartig mit der Angst bekommen.
Mein Blick wanderte vom Spiegel zur Gegensprechanlage. Jedes Problem mit der Ladung sollte umgehend gemeldet werden – das war Vorschrift –, aber was sollte ich dem Kommandanten sagen? Ich verspürte den Drang, alles abzuwerfen, die Särge aus dem Flugzeug zu katapultieren, und Feierabend. Wenn ich ihnen etwa Feuer im Frachtraum durchgäbe, dann würden wir sofort auf unter zehntausend Fuß sinken, damit ich die Bolzen lösen und die gesamte Ladung auf den Grund des Golfs von Mexiko schicken konnte, ohne großes Hin und Her.
An diesem Punkt bremste ich mich, richtete mich auf, dachte nach. Kinder, dachte ich. Keine Monster, keine Dämonen, nur die Geräusche spielender Kinder. Nichts, was dich drankriegen wird. Nichts, was dich drankriegen kann. Ich schüttelte den kalten Schauer ab, der mich durchfuhr, und beschloss, Hilfe zu holen.
Vor den Kojen fand ich Hadley immer noch schlafend vor. Ein abgegriffenes Taschenbuch, auf dessen Umschlag sich zwei Frauen leidenschaftlich umarmten, lag wie ein Zelt auf seiner Brust. Ich schüttelte ihn am Arm, und er richtete sich auf. Einen Moment lang sagte keiner von uns ein Wort. Er rieb sich mit einer Hand das Gesicht und gähnte.
Dann sah er mich an, und ich beobachtete, wie sich Besorgnis auf seinem Gesicht ausbreitete. Als Nächstes schnappte er sich seine Sauerstoffmaske. Sofort war sein gewohntes Pokerface zurück. »Was gibt’s, Davis?«
Ich rang nach Worten. »Die Fracht«, sagte ich. »Da ist … Die Fracht hat sich möglicherweise verschoben. Ich brauche etwas Hilfe, Sir.«
Seine Besorgnis verwandelte sich schlagartig in Verärgerung. »Haben Sie’s schon dem Kommandanten gemeldet?«
»Nein, Sir«, erwiderte ich. »Ich … ich will ihn im Moment noch nicht beunruhigen. Vielleicht ist es ja auch nichts.«
Sein Gesicht verzog sich zu etwas Unerfreulichem, und ich dachte schon, er würde mich zurechtstauchen, aber er ließ mich einfach nach achtern vorausgehen. Allein seine Gegenwart genügte, meine Zweifel wieder aufleben zu lassen, meine Professionalität. Mein Schritt wurde energischer, mein Blick fest, und mein Magen kehrte an seinen angestammten Platz im Bauch zurück.
Als wir sie erreichten, saß Pembry neben Hernandez, beide in gespielter Gleichgültigkeit. Hadley warf ihnen einen desinteressierten Blick zu und folgte mir weiter den Gang zwischen den Särgen hinunter.
»Was ist mit der Beleuchtung los?«, fragte er.
»Hilft uns nichts«, sagte ich. »Hier.« Ich gab ihm die Taschenlampe und fragte: »Hören Sie es?«
»Was soll ich hören?«
»Hören Sie einfach hin.«
Wieder nur die Turbinen und der Düsenstrahl. »Ich höre ni…«
»Pst! Hören Sie!«
Er öffnete den Mund und ließ ihn kurz offen stehen, dann schloss er ihn wieder. Die Triebwerke wurden leiser, und die Geräusche kamen, rieselten über uns wie Wasserdampf, ein feiner Geräuschnebel hüllte uns ein. Ich bekam nicht mit, wie kalt es mir war, bis ich das Zittern meiner Hände bemerkte.
»Was zum Teufel ist das?«, sagte Hadley. »Das hört sich an wie …«
»Sagen Sie’s nicht«, fiel ich ihm ins Wort. »Das kann nicht sein.« Ich deutete mit dem Kopf auf die Metallkisten. »Sie wissen, was sich in diesen Särgen befindet, oder?«
Er sagte nichts. Das Geräusch schien einen Moment um uns herumzuwandern, war einmal ganz nahe, dann wieder weiter entfernt. Er versuchte, dem Geräusch mit der Taschenlampe zu folgen. »Können Sie sagen, woher es kommt?«
»Nein. Ich bin nur froh, dass Sie’s auch hören, Sir.«
Der Ingenieur kratzte sich am Kopf; er verzog das Gesicht, als hätte er etwas Verdorbenes geschluckt und könnte nun den üblen Nachgeschmack nicht loswerden. »Mich laust der Affe«, sagte er gedehnt.
Genau wie zuvor hörte das Geräusch dann urplötzlich auf, und das Röhren der Triebwerke füllte wieder unsere Ohren.
»Ich mach jetzt das Licht an.« Zögernd ging ich ein paar Schritte. »Ich werde den Kommandanten nicht verständigen.«
Sein Schweigen war verschwörerisch. Als ich zurückkehrte, war er damit beschäftigt, eine bestimmte Reihe Särge durch das Sicherungsnetz hindurch zu untersuchen.
»Sie müssen eine Überprüfung durchführen«, sagte er matt.
Ich erwiderte nichts. Ich hatte schon während Flügen Ladungen durchsucht, aber noch nie so etwas wie das hier vorgenommen, nicht mal Leibesvisitationen von Soldaten. Falls alles der Wahrheit entsprach, was Pembry sagte, konnte ich mir nichts Schlimmeres vorstellen, als einen der Särge zu öffnen.
Beim nächsten Geräusch zuckten wir beide zusammen. Man stelle sich einen nassen Tennisball vor. Und jetzt das Geräusch, das ein nasser Tennisball machte, wenn er auf dem Spielfeld aufschlug – so ein dumpfes Klatschen, wie ein Vogel, der gegen einen Flugzeugrumpf prallte. Da war es wieder, und diesmal kam es unmissverständlich aus dem Inneren des Frachtraums. Dann, nach weiteren Turbulenzen, wieder dieses dumpfe Klatschen. Es kam ganz eindeutig aus einem der Särge direkt vor Hadley.
Nichts Ernstes, schien sein Gesicht zu artikulieren. Alles nur Einbildung.Wegen einem Geräusch aus einem Sarg stürzt kein Flugzeug ab, sagte sein Gesicht. So was wie Geister gibt es nicht.
»Sir?«
»Wir müssen nachsehen«, sagte er.
Wieder sammelte sich das Blut in meinem Magen. Nachsehen, hatte er gesagt. Ich will nichts sehen.
»Geben Sie dem Kommandanten durch, er soll den Vogel ruhig halten«, sagte er. In diesem Moment wusste ich, dass er mir helfen würde. Er wollte nicht, aber er würde es trotzdem tun.
»Was machen Sie da?«, fragte Pembry. Sie gesellte sich zu uns, als ich das Sicherungsnetz von der Sargreihe zog, während der Ingenieur die einzelnen Riemen um diesen einen gewissen Sarg löste. Hernandez schlief mit nach vorn gebeugtem Kopf, das Beruhigungsmittel wirkte endlich.
»Wir müssen die Ladung untersuchen«, sagte ich nüchtern. »Gut möglich, dass die Fracht durch den unruhigen Flug aus dem Gleichgewicht gekommen ist.«
Sie ergriff meinen Arm. »War das alles? Die Ladung hat sich nur verschoben?«
In ihrer Frage lag ein Hauch von Verzweiflung. Sag mir, dass ich es mir nur eingebildet habe, buchstabierte ihr Gesichtsausdruck. Sag es mir, dann glaube ich dir und lege mich schlafen.
»Wir denken schon, ja«, bestätigte ich nickend.
Sie ließ die Schultern sinken, und auf ihrem Gesicht breitete sich ein Lächeln aus, das viel zu groß war, als dass es echt sein konnte. »Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich werde verrückt.«
Ich klopfte ihr auf die Schulter. »Schnallen Sie sich an, und ruhen Sie sich aus«, sagte ich. Was sie dann auch machte.
Meine Aufgabe war klar. Als Lademeister konnte ich diesem Unsinn ein Ende bereiten. Also machte ich mich an die Arbeit. Ich löste die Riemen, stieg auf die übrigen Särge, schob den obersten beiseite, trug ihn weg, sicherte ihn, entfernte den nächsten, trug ihn weg, sicherte ihn, und dann noch einmal. Die Freude einfacher, sich wiederholender Handlungen.
Erst als wir den untersten erreichten – aus dem das Geräusch kam –, hielt Hadley inne. Er stand da und schaute zu, wie ich den Sarg weit von seinem Platz nach vorn zog, um ihn untersuchen zu können. Hadley gab sich ruhig, aber dennoch war ihm sein Widerwillen deutlich anzusehen. Er mochte das bei einem Bier gegenüber schwadronierenden Air-Force-Veteranen kaschieren können, aber nicht jetzt, nicht mir gegenüber.
Ich untersuchte flüchtig den Boden an der Stelle, wo der Sarg zuvor gestanden hatte, die Särge direkt daneben, fand aber keinerlei Beschädigung oder offensichtliche Mängel.
Ein Geräusch ertönte, ein feuchtes, dumpfes Klatschen. Von innen. Wir zuckten gleichzeitig zusammen. Der blanke Ekel stand dem Ingenieur im Gesicht. Ich unterdrückte ein Zittern.
»Wir müssen ihn öffnen«, sagte ich.
Der Ingenieur widersprach nicht, aber genau wie ich bewegte er sich nur sehr zögerlich. Er ging in die Hocke und löste, eine Hand fest auf den Sargdeckel gestützt, die Verschlussspangen auf seiner Seite. Ich machte das Gleiche auf meiner Seite und spürte, wie meine Finger über das kalte Metall glitschten und leicht zitterten. Ich zog sie zurück und stützte meine Hand auf dem Deckel ab. Wir blickten uns an, und in unseren Blicken lag unsere gesamte restliche Entschlossenheit. Gemeinsam öffneten wir den Sarg.
Zuerst der Geruch: ein Brei aus verfaulten Früchten, Desinfektionsmittel und Formaldehyd, eingewickelt in Plastikfolie mit Kot und Schwefel. Er stach in die Nase und breitete sich im Frachtraum aus. Das Deckenlicht fiel auf zwei glänzende schwarze Leichensäcke, schlüpfrig von Kondenswasser und Verwesungsflüssigkeit. Ich wusste, dass es Kinderleichen waren, aber das Ganze flößte mir eine tiefe Ehrfurcht ein, schmerzte mich. Ein Sack lag schräg und verdeckte den anderen, und ich erkannte sofort, dass sich mehr als nur ein Kind darin befand. Meine Blicke flogen förmlich über das feuchte Plastikmaterial, erkannten die Umrisse eines Arms, die Konturen eines Profils. Eine zusammengerollte Gestalt am unteren Saum, etwas abseits vom Rest. Es hatte die Größe eines Babys.
Das Flugzeug erzitterte auf einmal wie ein verängstigtes Pony. Der obere Leichensack rutschte seitlich weg und brachte ein junges, höchstens acht oder neun Jahre altes Mädchen zum Vorschein, das nur zur Hälfte in dem Sack steckte. In der Ecke verkantet wie ein irrwitziger Schlangenmensch, war der geschwollene Bauch, übersät mit Stichwunden von den Bajonetten, wieder aufgebläht, und ihre verdrehten Gliedmaßen waren nun so dick wie die Äste eines Baums. Die pigmentierte Haut hatte sich überall abgelöst, nur nicht auf dem Gesicht, das so rein und unschuldig war wie das jedes Engels im Himmel.
Ihr Gesicht war es, das es unmissverständlich klarmachte, was mir wirklich wehtat. Ihr süßes Gesicht.
Meine Hand verkrampfte sich um die Kante des Sarges, wurde schmerzhaft weiß, aber ich wagte nicht, sie zurückzuziehen. Etwas steckte mir im Hals, und ich zwang es mit Mühe wieder hinunter.
Eine einsame Fliege, fett und glitzernd, kroch aus dem Sack heraus und brummte träge auf Hadley zu. Er erhob sich langsam und wappnete sich wie gegen einen Körperschlag. Er beobachtete, wie sie sich erhob und unbeholfen durch die Luft sauste. Dann brach er den Bann, indem er einen Schritt zurücktrat, wild um sich schlug und sie erwischte – ich hörte das Klatschen seiner Hand – und einen ekelhaften Laut zwischen seinen Lippen entweichen ließ.
Als ich mich ebenfalls aufrichtete, pochten meine Schläfen, und meine Knie waren ganz weich. Ich stützte mich an einem Sarg in der Nähe ab. Etwas Widerliches stieg in meinem Hals auf.
»Mach’s wieder zu«, sagte er wie jemand mit vollem Mund. »Mach ihn zu.«
Meine Arme waren wie Gummi. Nachdem ich die Schultern gereckt hatte, hob ich ein Bein und trat gegen den Deckel. Es schallte wie ein Artilleriegeschoss. Wie bei einem rasanten Sinkflug baute sich Druck in meinen Ohren auf.
Hadley legte die Hände an die Seiten, senkte den Kopf und atmete tief durch den Mund ein und aus. »Mein Gott«, krächzte er.
Ich sah eine Bewegung. Pembry stand neben der Sargreihe, das Gesicht in säuerlicher Abscheu verzogen. »Was – ist – das – für – ein – Geruch?«
»Schon okay.« Ich stellte fest, dass ich den Arm bewegen konnte, und versuchte es mit einer, wie ich hoffte, wegwerfenden Geste. »Haben das Problem gefunden. Mussten ihn aber öffnen. Gehen Sie, setzen Sie sich wieder.«
Pembry schlang die Arme um die Brust und kehrte zu ihrem Platz zurück.
Ich merkte, wie sich der Geruch nach ein paar tiefen Atemzügen genug verdünnte, dass man wieder zu Sinnen kam. »Wir müssen ihn wieder sichern«, sagte ich zu Hadley.
Er blickte vom Boden auf, und ich sah seine Augen als schmale Schlitze. Die Hände hatte er zu Fäusten geballt, und sein breiter Rumpf wirkte unerschüttert und aufrecht. In den Augenwinkeln glitzerte es feucht. Er sagte nichts.
Als ich die Verschlüsse einrasten ließ, wurde alles wieder zu Ladung und sonst nichts. Wir mühten uns ab, den Sarg an seinen alten Platz zurückzuschieben. Wenige Minuten später waren auch die übrigen Särge verstaut, die äußeren Gurte wieder an Ort und Stelle, das Frachtnetz darübergelegt und gesichert.
Hadley wartete, bis ich fertig war, dann ging er mit mir zusammen nach vorn. »Ich werde dem Kommandanten sagen, dass Sie das Problem gelöst haben«, sagte er. »Und dass er den Flug wie normal fortsetzen soll.«
Ich nickte.
»Eine Sache noch«, sagte er. »Wenn Sie die Fliege sehen, schlagen Sie sie tot.«
»Haben Sie nicht …«
»Nein.«
Ich wusste nicht, was ich sonst sagen sollte, also antwortete ich: »Jawohl, Sir.«
Pembry saß mit gerümpfter Nase an ihrem Platz und täuschte vor zu schlafen. Hernandez saß aufrecht da, die Augenlider auf Halbmast. Er bedeutete mir, näher zu kommen, mich zu ihm zu beugen.
»Haben Sie sie zum Spielen rausgelassen?«, fragte er.
Ich ragte über ihm und sagte nichts. In meinem Herzen verspürte ich denselben stechenden Schmerz wie damals als Kind, wenn der Sommer vorbei war.
Als wir in Dover landeten, entlud ein Beisetzungskommando in Paradeuniform jeden einzelnen Sarg, gewährte jeder einzelnen Person das komplette große Bestattungsritual. Wie ich hörte, wurden die Förmlichkeiten deutlich zurückgefahren, als später weitere Leichen eingeflogen wurden, und die Maschinen wurden nur noch von einem einzelnen Kaplan der Air Force in Empfang genommen. Am Ende der Woche war ich zurück in Panama, hatte den Bauch voll Truthahn und billigem Rum. Dann ging’s auch schon weiter zu den Marshall-Inseln, wohin Nachschub für den dortigen Raketenstützpunkt geliefert werden musste. Beim Military Air Command herrscht kein Mangel an Ladung.
Deutsch von Jürgen Bürger
Das Grauen der Höhe
Arthur Conan Doyle
Neben seinen Sherlock-Holmes-Geschichten schrieb Doyle weit über hundert andere Erzählungen, darunter einige Dutzend mit »übernatürlichen« Themen. Einigen von ihnen fehlt dies dynamische »Was passiert wohl als Nächstes«, eine der Qualitäten der Holmes-Geschichten; die meisten handeln von aufrechten jungen Engländern, die sich einem übernatürlichen Grauen stellen und durch Schneid und Einfallsreichtum triumphieren, aber einige sind wirklich erschreckend. »Lot No. 249« gehört dazu; hier ist eine weitere. Wie seinen Zeitgenossen Bram Stoker faszinierten Doyle neue Erfindungen (1911 kaufte er sich ein Auto, ohne vorher eines gefahren zu haben), und Flugzeuge gehörten dazu. Wenn man »Das Grauen der Höhe« liest, sollte man bedenken, dass die Geschichte 1913 erschien, nur zehn Jahre nachdem die Flyer der Brüder Wright in Kitty Hawk für 59 Sekunden abhob, mit Orville an den rudimentären Kontrollen und Wilbur am Boden. Als Doyles Geschichte in The Strand veröffentlicht wurde, dürfte die gewöhnliche Flughöhe der meisten Maschinen bei 12000 bis 18000 Fuß gelegen haben. Doyle stellte sich vor, was noch weiter oben existieren könnte, weit jenseits der Wolken, und schuf so seine schrecklichste Geschichte.
Die Annahme, dass die außerordentliche Geschichte, die man das Joyce-Armstrong-Fragment genannt hat, ein aufwendiger Streich gewesen sei, ausgetüftelt von einer mit einem perversen und unheimlichen Sinn für Humor geschlagenen Person, ist nun von allen aufgegeben worden, die die Sache untersucht haben. Der makaberste und einfallsreichste Aushecker von Streichen würde zögern, ehe er seine morbide Fantasie mit den unbestrittenen und tragischen Tatsachen verbände, welche diese Feststellung bekräftigen. Die darin enthaltenen Behauptungen sind zwar verblüffend und sogar monströs, dennoch konnte man allgemein nicht umhin, die Erkenntnis zu akzeptieren, dass sie wahr sind und dass wir unsere Vorstellungen der neuen Situation anpassen müssen. Diese unsere Welt scheint nur durch einen dünnen, zerbrechlichen Streifen Sicherheit von einer ganz einzigartigen und unerwarteten Gefahr getrennt zu sein. In diesem Bericht, der das Originaldokument in seiner zwangsläufig etwas fragmentarischen Form wiedergibt, will ich versuchen, dem Leser die Gesamtheit der bisher bekannten Fakten darzulegen, wobei ich meiner Arbeit noch die Bemerkung voranstellen möchte, dass es, falls jemand die Geschichte von Joyce-Armstrong bezweifelt, doch überhaupt keinen Zweifel an den Fakten geben kann, die Leutnant Myrtle von der Royal Navy und Mr Hay Connor betreffen, welche ohne Zweifel in der dargestellten Art den Tod fanden.
Das Joyce-Armstrong-Fragment wurde auf dem Lower Haycock genannten Feld gefunden, das eine Meile westlich des Dorfes Withyham an der Grenze zwischen Kent und Sussex liegt. Am vergangenen 15. September bemerkte ein Landarbeiter namens James Flynn, in Diensten des Bauern Mathew Dodd von der Chauntry-Farm, Withyham, eine Bruyère-Pfeife, die neben dem Feldweg lag, der entlang der Hecke von Lower Haycock verläuft. Ein paar Schritte weiter las er eine zerbrochene Brille auf. Zuletzt erblickte er zwischen einigen Nesseln im Graben ein dünnes, in Segeltuch eingeschlagenes Buch, das sich als Notizheft mit herausnehmbaren Blättern erwies, von denen einige sich gelöst hatten und an den Fuß der Hecke geweht worden waren. Diese sammelte er ein, doch wurden einige, darunter die ersten, nie gefunden, was eine beklagenswerte Lücke in diesem überaus bedeutenden Bericht hinterlässt. Der Arbeiter brachte das Notizheft seinem Herrn, der es seinerseits Dr J. H. Atherton aus Hartfield zeigte. Dieser Gentleman erkannte sofort die Notwendigkeit einer Untersuchung durch Experten, und das Manuskript wurde an den Aero-Club in London weitergeleitet, wo es heute liegt.
Die beiden ersten Seiten des Manuskripts fehlen; ferner ist am Ende des Berichts eine abgerissen, was allerdings insgesamt die Plausibilität der Geschichte nicht beeinflusst. Man nimmt an, dass sich der fehlende Anfang auf die Qualifikationen von Mr Joyce-Armstrong als Aeronaut bezieht, die aus anderen Quellen erschlossen werden können und als unübertroffen unter Englands Luftpiloten gelten. Seit vielen Jahren wird er als einer der kühnsten und intelligentesten Flieger betrachtet, eine Kombination, die es ihm ermöglicht hat, mehrere neue Geräte sowohl zu erfinden als auch zu testen, darunter das verbreitete gyroskopische Zusatzgerät, das seinen Namen trägt. Der größte Teil des Manuskripts wurde säuberlich mit Tinte geschrieben, die letzten Zeilen jedoch mit Bleistift, und zwar so krakelig, dass sie kaum zu lesen sind – tatsächlich genau so, wie man es erwarten könnte, wenn sie hastig auf dem Sitz eines fliegenden Aeroplans gekritzelt worden wären. Es gibt, darf man hinzufügen, mehrere Flecken, sowohl auf der letzten Seite als auch auf dem Umschlag, bei denen es sich nach Meinung der Experten des Innenministeriums um Blut handelt – wahrscheinlich von einem Menschen und sicherlich von einem Säugetier. Die Tatsache, dass in diesem Blut etwas entdeckt wurde, was große Ähnlichkeit mit dem Malariaerreger aufweist, und dass Joyce-Armstrong bekanntlich an Rückfallfieber gelitten hat, ist ein bemerkenswertes Beispiel für die neuen Waffen, welche die moderne Wissenschaft unseren Kriminalisten in die Hand gegeben hat.
Und nun ein Wort zur Persönlichkeit des Autors dieses epochemachenden Berichts. Joyce-Armstrong war laut den wenigen Freunden, die wirklich etwas über den Mann wussten, ein Dichter und Träumer ebenso wie ein Ingenieur und Erfinder. Er war ein Mann beträchtlichen Wohlstands, von dem er einen großen Teil für die Verfolgung seines aeronautischen Hobbys ausgegeben hatte. In seinen Hangars nahe Devizes hatte er vier private Flugzeuge stehen, und er soll im Lauf des vorigen Jahres nicht weniger als einhundertsiebzig Flüge unternommen haben. Er war ein zurückhaltender Mann mit Anfällen von Melancholie, in denen er die Gesellschaft von seinesgleichen mied. Hauptmann Dangerfield, der ihn besser als jeder andere kannte, sagt, manchmal habe sich seine Exzentrik zu etwas weit Ernsterem zu entwickeln gedroht. Seine Gewohnheit, immer eine Schrotflinte ins Flugzeug mitzunehmen, war ein Hinweis darauf.
Ein weiterer war die morbide Wirkung, die der Sturz von Leutnant Myrtle auf sein Gemüt ausübte. Beim Versuch, den Höhenrekord zu brechen, fiel Myrtle aus etwas über dreißigtausend Fuß herab. Entsetzlicherweise wurde sein Kopf völlig ausgelöscht, wiewohl Rumpf und Glieder erhalten blieben. Bei jedem Fliegertreffen fragte Joyce-Armstrong Dangerfield zufolge mit einem rätselhaften Lächeln: »Und wo, bitte, ist Myrtles Kopf?«
Bei einer anderen Gelegenheit, nach einem Essen in der Messe der Flugschule auf der Ebene von Salisbury, löste er eine Debatte darüber aus, was die dauerhafteste Gefahr sein werde, der sich Flieger gegenübersähen. Nachdem er verschiedenen Meinungsäußerungen über Luftlöcher, Konstruktionsfehler und Überladung gelauscht hatte, zuckte er schließlich mit den Schultern und weigerte sich, seine eigenen Ansichten vorzubringen, wenn er auch den Eindruck vermittelte, diese wichen von allen ab, die seine Gefährten geäußert hatten.
Man sollte anmerken, dass sich nach seinem Verschwinden herausstellte, dass er seine privaten Angelegenheiten sehr eingehend geregelt hatte, was wohl darauf hinweist, dass er eine deutliche Vorahnung von Unheil hatte. Nach diesen wesentlichen Erläuterungen will ich nun den Bericht genau so wiedergeben, wie er auf Seite 3 des blutgetränkten Notizhefts beginnt:
»Bei meinem Essen in Reims mit Coselli und Gustav Raymond fand ich jedoch, dass keiner von beiden sich einer besonderen Gefahr in den höheren Schichten der Atmosphäre bewusst war. Ich sprach nicht wirklich aus, was mir durch den Kopf ging, näherte mich dem jedoch so weit, dass sie, falls sie etwas Ähnliches gedacht hätten, dies zweifellos würden ausgedrückt haben. Andererseits sind sie nur zwei hohle, ruhmsüchtige Kerle, einzig darauf bedacht, ihre albernen Namen in der Zeitung zu sehen. Es ist interessant zu bemerken, dass keiner von ihnen je weit über zwanzigtausend Fuß gestiegen ist. Natürlich sind Menschen sowohl in Ballons als auch beim Bergsteigen höher hinausgekommen. Das Flugzeug muss also wohl weit über dieser Höhe die Gefahrenzone erreichen – immer vorausgesetzt, dass meine Ahnungen zutreffen.
Wir haben nun mehr als zwanzig Jahre des Fliegens hinter uns, und man könnte durchaus fragen: Warum sollte diese Gefahr sich erst in unseren Tagen zeigen? Die Antwort liegt auf der Hand. In den alten Tagen der schwachen Motoren, da ein Gnome oder Green mit hundert PS für jedes Bedürfnis als ausreichend angesehen wurde, waren die Flüge sehr beschränkt. Nun, da dreihundert PS eher die Regel als die Ausnahme sind, wurden Vorstöße in die höheren Schichten einfacher und gewöhnlicher. Einige von uns können sich noch erinnern, wie in unserer Jugend Garros weltweiten Ruhm dadurch errang, dass er neunzehntausend Fuß erreichte, und ein Flug über die Alpen galt als bemerkenswerte Leistung. Unser Standard ist inzwischen ungeheuer viel höher, und es gibt zwanzigmal mehr hohe Flüge als in früheren Jahren. Viele sind ohne schädliche Folgen unternommen worden. Die Höhe von dreißigtausend Fuß wurde ein ums andere Mal ohne Beschwerden jenseits von Erkältung und Asthma erreicht. Was beweist das? Ein Besucher könnte tausendmal auf diesem Planeten landen, ohne je einen Tiger zu sehen. Aber Tiger existieren, und wenn der Besucher zufällig in einem Dschungel landete, könnte er gefressen werden. Es gibt Dschungel in den oberen Luftschichten, und sie werden von schlimmeren Dingen als Tigern bewohnt. Ich glaube, dass man mit der Zeit diese Dschungel gründlich kartieren wird. Ich könnte jetzt schon zwei benennen. Einer liegt über dem Gebiet von Pau und Biarritz in Frankreich. Der andere ist nun, da ich dies hier in meinem Haus in Wiltshire schreibe, genau über meinem Kopf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen dritten über dem Bereich Homburg-Wiesbaden gibt.
Was mich zuerst ins Grübeln brachte, war das Verschwinden der Flieger. Natürlich sagten alle, sie seien ins Meer gefallen, aber das befriedigte mich keineswegs. Zuerst war da Verrier in Frankreich; seine Maschine fand sich in der Nähe von Bayonne, aber seine Leiche wurde nie gefunden. Dann war da auch der Fall von Baxter, der verschwand, wiewohl man seinen Motor und einige der Eisenstreben in einem Wald in Leicestershire fand. In diesem Fall erklärte Dr Middleton aus Amesbury, der den Flug mit einem Teleskop beobachtet hatte, kurz bevor Wolken ihm die