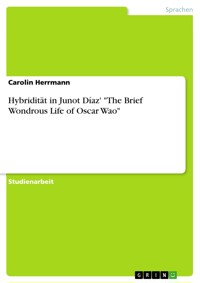Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Flügelschatten
- Sprache: Deutsch
"Wenn du Gefahr witterst – verstecke dich. Wenn du in die Enge getrieben wirst – sei bereit für den Angriff. Du brauchst keine Waffen, du bist schneller als sie. Stärker. Besser." Manchmal frage ich mich, wie es wäre, Erinnerungen zu haben. Nicht bloß diese Visionen, die mich überkommen und mir einen kurzen Blick in die Vergangenheit schenken. Wie es wäre, nicht von dieser Gier nach Blut angetrieben zu werden, oder wie es wäre, eine von ihnen zu sein – ohne die eingerissenen Flügel aus Haut und Knochen und ohne violette Augen voller Finsternis. Vor allem frage ich mich, wie es wäre, jemandem zu vertrauen. Celdon vielleicht. Aber genau er hat mir gesagt, dass es in Zeiten wie diesen niemanden gibt, dem man trauen kann. Die Mauern aus Eis, die ich um mich errichtet habe, er schlägt Risse in sie und ich weiß nicht, ob ich das zulassen darf. Was ist, wenn er hinter sie blickt und das Monster sieht, das in mir schlummert?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Flügelschatten
Augen aus Dunkelheit
Carolin Herrmann
Copyright © 2020 by
Lektorat: Nina Bellem
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Michelle N. Weber
Umschlagdesign: Jaqueline Kropmanns
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-553-3
Alle Rechte vorbehalten
Für meine
Fuchsschwestern
und meine
Süßmäuse.
Ich habe euch sehr lieb.
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
11. Händler
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
22. Händler
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Danksagung
Prolog
Es ist Winter und bitterkalt. Die Kälte streicht mit ihren eisigen Fingern an den Mauern entlang, der Wind fährt pfeifend durch die Ritzen und heult in den hohen, langen Gängen. Dafür ist es eine sternklare Nacht, nicht eine einzige Wolke verdeckt die glühenden Punkte am Himmelszelt. Mit einem Mal verdunkelt ein gewaltiger Schatten den Mond und schlagartig verblasst das Licht. Das Ungeheuer breitet seine riesigen Schwingen aus und landet erstaunlich anmutig auf den hohen Zinnen der Burg. Dort stößt es ein tiefes Grollen aus, sodass die Wände erzittern. Geschickt ist es dem Regen aus Pfeilen ausgewichen, es reißt sein Maul auf und speit eine so gewaltige Flammensäule aus, dass alle Wächter, die sich nicht schnell genug ducken, bei lebendigem Leib verbrennen.
Mit einem Hieb seines geschuppten Schwanzes stürzen die Männer über die Brüstung und in die endlose Tiefe. Es dauert, bis man den harten Aufprall ihrer Körper auf dem Wasser weit, weit unten vernehmen kann. Die messerscharfen Krallen des Untiers blitzen in der Nacht auf und zerreißen die Verbliebenen.
Jetzt hockt es auf dem Dach, den Kopf hoch erhoben, die Augen funkeln gefährlich und sein Schwanz peitscht ruhelos hin und her. Es wartet. Geduldig. Bis seine Herrin zurückkehrt.
Unterdessen fliegen die Flügeltüren im Innern der Burg auf und krachen gegen die Wände. Das laute Knallen hallt im ganzen Saal wider, sodass der König auf seinem Thron heftig zusammenfährt. Mit seinen Fingern umklammert er die Armlehnen des prächtigen Stuhles, ganz und gar aus schwarzem Marmor gehauen, düster und mächtig. Seine Rückenlehne ist beachtlich hoch und mit kunstvollen Schnitzereien verziert, dahinter kreuzen sich zwei blitzende Schwerter.
Die helfen ihm jetzt nichts mehr, das weiß er. Sie zum Kampf herauszufordern wäre töricht, dumm. Was hat er für eine Wahl? Kalter Schweiß tritt auf seine Stirn und er kann überdeutlich spüren, wie er über seine Wange läuft. Sie ist gekommen.
Er wusste, dass sie kommen würde.
Zwei in dunkle Umhänge gehüllte Gestalten betreten den beeindruckenden Thronsaal. Ihre Gesichter sind unter den Kapuzen verborgen, trotzdem glaubt er zu spüren, wie ihn silbrige Augen höhnisch anfunkeln, hasserfüllt, machtgierig. Die ganzen letzten Wochen schon hatte er kaum eine Nacht schlafen können, hatte sich unruhig in seinem Bett hin und her gewälzt und sich schließlich in seinem Thronsaal verborgen. Dieser Raum in seiner Festung war besser geschützt als jeder andere, trotzdem hatte er weitere Wachen vor der Tür positionieren lassen, hatte die Verteidigungslinien verstärkt und die schweren Eisentüren verriegeln lassen. Und dennoch wachte er weiterhin schweißgebadet aus seinen Träumen auf, klammerte sich an seinen Thron und versuchte krampfhaft, seinen rasselnden Atem zu beruhigen.
Nur ein Traum. Ihm kann nichts geschehen. Sie kann ihn nicht überlisten. Er hat sich so gut geschützt wie nur möglich.
Diesmal ist es kein Traum. Die vordere Gestalt durchquert den Raum zügigen Schritts, selbstbewusst, energisch. Die zweite verbirgt sich halb hinter ihr, sie ist kleiner und er hat schon von ihr gehört.
Schwer schluckt er, seine Kehle ist wie ausgetrocknet. Lange hat er standgehalten. Sehr lange. Doch dann tauchte etwas Neues auf. Eine neue Waffe, mit der er nicht gerechnet hat.
Ein paar wenige Schritte von dem prunkvollen Thron entfernt bleiben beide Gestalten stehen. Der König richtet sich auf und versucht, sein Gesicht hart werden zu lassen, aber seine Stimme zittert.
»Calypso.«
Der Klang des Namens ist eiskalt und fährt wie ein Messer durch den Raum. Sofort fällt die Temperatur weiter und ein frischer Wind bauscht die schweren Vorhänge vor den Fenstern auf. Die vordere Gestalt schlägt die Kapuze zurück. Haare wie aus flüssigem Silber, streng geflochten, kommen zum Vorschein. Auf ihnen sitzt eine Krone, gefertigt aus weißen Kristallen. Sie leuchtet kalt und doch wunderschön wie eine frisch geschliffene Klinge. Wie die Augen der Frau, die ihm gegenübersteht. Silbrig wie der Mond draußen am nachtschwarzen Himmel.
Sie lächelt frostig.
»Erraten.«
Dann dreht sie sich zu der Gestalt hinter sich um. Der König muss scharf die Luft einziehen, als deren Gesicht entblößt wird. Er hat es nicht glauben wollen: Es ist noch so jung, vielleicht neun Jahre alt, mit einem Blick, derart unheimlich, dass ihn ein Schauer überläuft. Er ist voller Gier und Vorfreude. Vorfreude auf das Töten.
Mit der Zunge fährt sich das Kind über die Zähne und grinst mordlustig. Die angriffslustige Art passt entsetzlich wenig zu dem Mädchen, das es noch ist.
Ein unruhiges Feuer flackert in ihren Augen auf und ihr Blick huscht herüber zu der stolzen Frau.
»Darf ich, Herrin?«
Diese dreht sich zu dem König um, legt den Kopf ein wenig schräg. Er hat das Gefühl, etwas sagen zu müssen, nach seinen Wachen rufen zu müssen, doch er weiß, dass das keinen Zweck hat. Calypso wäre nicht hier, wenn noch ein einziger seiner Männer dort draußen leben würde.
Das hier ist eine Sache zwischen ihm und ihr. Darauf lief es die ganze Zeit hinaus. Nun muss er sich ihr stellen. Das wissen sie beide.
Calypsos eisiges Grinsen wird breiter und lächelnd nickt sie dem Mädchen zu.
1
Ich schlage die Augen auf. Es ist, als würden alle Sinne gleichzeitig zurückkehren und mit solch einer Heftigkeit auf mich niederprasseln, dass mir schwindelig wird.
Es ist hell. So hell, dass ich blinzeln muss und mir Tränen in die Augen schießen. Wirbelnde Farben vermischen sich zu einem einzigen Strudel und sind kaum noch voneinander zu unterscheiden. Sie brennen sich in meine Lider und ich schaffe es kaum, einen Namen für sie alle zu finden.
Ein Summen und Piepen in meinen Ohren, das von einem Rauschen abgelöst wird – der Wind? Alle Geräusche sind entsetzlich laut und drücken auf mein Trommelfell, sodass ich das Gefühl habe, es müsse gleich zerreißen. Ein schwerer Geruch steigt mir in die Nase, kitzelt sie. Ich brauche eine Weile, bis ich ihn zuordnen kann … Es muss der Geruch von Erde und Tau sein … Jetzt spüre ich die angenehme Wärme auf der Haut, die von den gleißenden Sonnenstrahlen kommen muss. Sie löst ein leichtes Kribbeln in mir aus, das sich von meinen Fingerspitzen über meine Arme bis in meine Brust ausbreitet. Ich fühle, wie das Herz darin pocht. Rasch. Nervös.
Das Kribbeln wandert auch über meinen Rücken zu meinen Beinen und bis zu den Zehen, bis ich mir meines ganzen Körpers bewusst bin. Diese unglaubliche Fülle an Eindrücken überwältigt mich.
Wieder ein Blinzeln. Panisch huschen meine Blicke hin und her. Über mir breitet sich der Himmel aus, endlos und weit. Wolken sind dort oben verstreut, sie bewegen sich langsam über mich hinweg. Nervös drehe ich den Kopf ein Stück nach links. Grashalme stechen hervor, nehmen alles ein.
Ich spüre, wie mein Atem schneller geht. Das sanfte Kribbeln verschwindet. Angst. Kalte Finger, die nach mir greifen, und eine Gänsehaut, die mich am ganzen Körper überkommt.
Zögernd hebe ich eine Hand und halte sie in mein Blickfeld. Zarte, blasse Haut, fast durchsichtig, und feingliedrige Finger. Ich fasse nach meinen Haaren, wickle eine Strähne auf und betrachte auch sie. Sie ist … weiß. Weiß ist das Wort. Vorsichtig richte ich mich auf und erstarre. Blicke mich unsicher um.
Ich liege auf einer grünen Wiese und um mich herum blühen kleine blaue Blümchen. Sie recken ihre Köpfchen dem Sonnenlicht entgegen, das funkelnde Kreise auf das Gras malt. Rings um mich herum stehen Bäume, dicht zusammengedrängt bieten sie Schutz. Sie sind hoch und mächtig und an ihren Zweigen hängen saftig grüne Blätter. Das Gras unter meinen Händen ist warm und weich und ich fahre stockend darüber.
Es sieht schön aus. Ruhig. Die Geräusche klingen langsam ab, werden leiser, treten in den Hintergrund. Die Farben leuchten nicht mehr dermaßen entsetzlich, sodass ich sie endlich ansehen kann.
Und doch …
Ich habe das Gefühl, ich sollte mich wundern. Die eisige Angst sitzt in meinem Nacken und will nicht lockerlassen. Was will sie? Warum lässt sie mich nicht los?
Dieser Ort … oh. Mir fällt ein, warum ich erschrocken bin. Warum ich es sein muss. Denn ich kenne diesen Ort nicht. Die Farben, das Gras, die Bäume, diese Namen kommen mir in den Sinn. Ich habe sie schon einmal gesehen, nur nicht hier. Hier war ich noch nicht.
Krampfhaft versuche ich mich daran zu erinnern, wie ich hierhergekommen bin. Ich schließe die Augen, bemerke kaum, wie ich dabei die Finger ins Gras kralle und wie sich mein gesamter Körper anspannt. Wie macht man das? Sich erinnern … Fieberhaft durchforste ich mein Gehirn, ohne etwas zu finden. Alles ist schwarz, tiefe, undurchdringliche Schwärze. Sollte man nicht wissen, was man gemacht hat? Ich weiß es nicht … In meinem Kopf ist keine Erinnerung, kein schwaches Leuchten, ja nicht einmal ein Funken.
Ich reiße die Augen wieder auf und blicke mich erneut um. Bäume, Bäume, Bäume. Nichts sonst. Ein Wald. Warum bin ich hier? Auf wackligen Beinen richte ich mich auf, langsam, unsicher. Sie fühlen sich schrecklich zittrig an, die Knie beben und ich taumle einige hölzerne Schritte vorwärts, wobei meine Muskeln einstimmig protestieren und sich verkrampfen. Meine Beine geben unter mir nach und ich falle zu Boden.
Erschrocken stelle ich fest, dass meine Arme mit rötlichen Striemen versehen sind, die sich hinaufwinden wie das Geflecht einer Kletterpflanze. Ein Schauer läuft mir über den Rücken, denn ich weiß nicht, woher die Wunden kommen. Erst jetzt fällt mir ein, dass ich deshalb Schmerzen empfinden sollte und da beginnen sie auch zu brennen, die Kratzer. Jedoch nicht lange. Bald kann ich sehen, wie das Blut gerinnt und die Haut sich wieder schließt, bis sie weiß und makellos ist wie zuvor.
Nervös betrachte ich den Rest des Körpers, von dem ich nicht glauben kann, dass es mein eigener ist. Er sieht seltsam aus und ist mir fremd.
Müsste ich mich nicht an diese Beine erinnern, schlank und dennoch kräftig? An die nackten Füße oder die einfache Hose, die ich trage? Soll das tatsächlich zu mir gehören?
Unsicher ziehe ich die Schultern hoch, wodurch ich einen Schatten am Rande meines Bewusstseins wahrnehme. Als ich meinen Kopf ein Stück herumdrehe, erkenne ich zwei riesige dunkle Schwingen, die aus meinem Rücken hervorragen. Gezackt sind sie und laufen am oberen Ende spitz zu, derart scharf, dass ich, als ich mit dem Finger über sie fahre, ein scharfes Brennen verspüre und einen feinen Schnitt in meiner Haut entdecke, der sich schnell schließt wie die anderen Wunden.
Die Flügel sind dunkel und knöchern, ich spüre die feinen Muskeln, die sie durchziehen und die ich auch bewegen kann, so wie ich meine Finger bewege, dennoch hebe ich nicht vom Boden ab, als ich mit ihnen vorsichtig flattere. Die dünne Haut zwischen den Gelenken ist zart und an einer Stelle weit eingerissen, sodass ich erschrocken aufhöre, mit ihnen zu schlagen, aus Angst, die Haut könnte weiter einreißen. Sie fühlen sich seltsam unwirklich an und ich kann nicht glauben, dass sie echt sind. Es kommt mir vor, als wäre ich gerade eben geboren worden, als hätte es nur Dunkelheit gegeben, aus der ich aufgetaucht bin. Als hätte ich sie mit einem Blinzeln vertrieben und in dieses brennende Licht verwandelt. Da war nichts vorher, dessen bin ich mir sicher. Ein dunkler See, aus dem ich entstanden bin.
All das um mich herum … Ich weiß nicht genau, was ich zuerst ansehen, was ich zuerst berühren soll. Die vielen Namen dazu … nur wenn ich etwas genauer ansehe, fallen sie mir ein. Wie ein Wort, das ich zwar kenne, aber von dem ich nicht weiß, was es bedeutet. Ich muss es zuerst zu seinem Gegenstand bringen. Wie ein Puzzle, das auf die richtigen Teile wartet. Es fällt mir schwer, sie zusammenzufügen.
Knack.
Jegliches Denken setzt aus. Mein Körper verkrampft sich, ich wirbele herum und springe auf, angriffsbereit, wachsam. Ein Knurren dringt aus meiner Kehle.
Am Rande der Bäume reckt ein Hase seine zitternde Nase in die Luft und hoppelt auf meine Reaktion hin erschrocken davon. Ich verharre einige Augenblicke in dieser Haltung, jeden einzelnen Muskel angespannt, bereit … bereit wofür?
Angreifen oder weglaufen.
Wieder zucke ich zusammen. Da war diese Stimme in meinem Kopf. Sie spricht zu mir. Nervös sehe ich dem Tier hinterher. Es ist nicht wie ich. Wer bin ich?
Kein Hase, ein … ich bin … Sosehr ich mich auch anstrenge, mir fällt nichts ein. Nur meine Lippe platzt auf, weil ich heftig auf ihr herumbeiße.
Ein wütender Schrei entfährt mir, gellend und laut, und ein Schwarm Vögel flattert aufgeschreckt aus den Bäumen in die Höhe. Es sind so viele, wieso bin ich allein?
Erst jetzt löse ich meine verspannte Haltung. Es geschah alles so plötzlich, der Körper handelte wie von selbst. Der Körper. Mein Körper. Es fühlt sich an, als würde ich haltlos durch diese Ansammlung an Gliedmaßen taumeln. Als wären diese Gedanken aus dem Nichts aufgetaucht und man hätte sie in einen beliebigen Körper gepflanzt. Ich fühle mich ausgestoßen, nicht richtig.
Seufzend vergrabe das Gesicht in den Händen. Ein seltsames Kratzen im Hals lässt mich stocken. Mein Bauch gibt ein merkwürdiges Grummeln von sich. Erschrocken presse ich die Hand darauf, aber es lässt nicht nach.
Hunger. Du hast Hunger und Durst.
Zum Glück weiß ich, was das ist und was ich jetzt tun muss: etwas zu essen suchen und einen Fluss, aus dem ich trinken kann.
Vielleicht fällt mir gleich auch alles andere wieder ein! Da gibt es noch andere Dinge, oder? Mit neuem Mut rappele ich mich auf.
Schnell lässt das Zittern meiner Knie nach. Ja, diese Beine sind außerordentlich flink, sie lassen sich leicht bewegen und es fühlt sich gut an. Und sie sind schnell. Ich beschleunige, versuche sie rascher voreinander zu setzen und dann fährt mir der Wind durch das Gesicht und die Haare, presst die Luft aus meiner Lunge. Ein Stechen taucht in meiner Seite auf, als ich die Beine weiter ansporne, schneller, schneller. Es ist wie ein Rausch. Ich fliege dahin, die Bäume verblassen an meinen Seiten zu einem grünlichen Farbwirbel und der keuchende Atem in meinen Ohren ist alles, was ich hören kann.
Langsam ziehen sich meine Mundwinkel nach oben. Lächeln, ich lächele. Es gefällt mir. Ich fühle mich unglaublich, wie ich über die Wurzeln springe und dahinjage, unaufhaltsam, frei.
Übermütig springe ich einen Abhang hinab, breite die Flügel aus und hoffe, dass ich mich mit ihnen in die Luft schwingen kann, doch der Wind hebt mich nicht empor, sondern lacht mich aus und ich krache hart auf den Waldboden. Sofort sehe ich nach dem Riss im linken Flügel, besorgt, dass ich ihn schlimmer gemacht habe. Lang und breit ist er, er hat beinahe die Hälfte der Haut zerrissen, tiefer ist er offenbar nicht geworden – von selbst heilt er nicht und ich schaffe es kaum, mich weit genug zu verrenken, um ihn zu berühren und zu untersuchen. Frustriert wende ich mich ab und ignoriere die nutzlosen Dinger. Was bringen sie mir denn, wenn ich damit gar nicht durch die Lüfte gleiten kann? So ein Irrsinn!
Ich kann genauso gut laufen!
Kurze Zeit später jedoch weiß ich nicht mehr wohin mit mir. Ziellos irre ich umher, wobei das Kratzen in meiner Kehle unerträglich wird, und ständig greife ich mit der Hand an meinen Hals, in der Hoffnung, die Schmerzen zu lindern.
Trotzdem treibe ich meine Beine dazu an, weiterzugehen. Immer weiter. Irgendwann muss ich etwas finden … Jedes Mal, wenn nur das leiseste Knacken im Unterholz ertönt, kauere ich mich verschreckt hinter einen Baumstamm. Es geschieht ganz von selbst. Es fühlt sich richtig an, sicher. Unruhig schleiche ich weiter, geduckt und aufmerksam. Bald schon bin ich froh über die Geräusche, denn dann kann ich wenigstens für einen Moment innehalten. Die Erde unter meinen Füßen bewegt sich, alles verschwimmt irgendwie, der ganze Wald zittert vor meinen Augen und ich kann ihn nur schemenhaft wie durch einen Schleier aus Nebel wahrnehmen.
Als ich schon das Gefühl habe, vor Schmerzen umzukommen, vernehme ich endlich ein leises Plätschern. Nur noch von reiner Willenskraft angetrieben, schleppe ich mich vorwärts, bis ich das kühle Flussbett erreiche, wo ich erleichtert auf die Knie sinke und zum Rand krieche. Gierig strecke ich die Hände in das klare Wasser und spüre die Energie, die dadurch strömt. Es rinnt mir beinahe zwischen den Fingern hindurch, als ich etwas unbeholfen davon schöpfe und in großen Schlucken trinke. Schon bald lässt der Schmerz nach und ich seufze erleichtert. Wenngleich das Kratzen langsam verschwindet, fühlt sich mein Hals weiterhin rau an. Ich fühle mich nicht … gesättigt.
Als ich erneut die Finger in den Fluss tauche, starrt mich ein seltsames Gesicht an.
Verschreckt zucke ich zurück und ein Knurren dringt aus meiner Kehle. Panisch lege ich die Hand an den Hals und versuche, mich zu beruhigen. Dennoch muss ich schwer schlucken, bevor ich mich langsam wieder vorbeuge. Unsicher sehe ich mir das Gesicht genauer an. Mein Gesicht.
Ich strecke die Hand aus und berühre den ruhigen Wasserspiegel. Das Bild verschwimmt. Feine Ringe breiten sich von dem Punkt aus, wo ich es berührt habe, und das Gesicht zerfließt, um kurz darauf wiederaufzutauchen.
Zögernd betaste ich die makellose, fast schon farblose Haut, die mich umgibt, betrachte die aufgesprungenen dunkelroten Lippen, die geschwungenen Augenbrauen und die kantigen Kieferknochen. Doch all diese Dinge sind eigentlich nur nebensächlich. Trotzdem versuche ich krampfhaft meinen Blick auf sie zu lenken, um nicht auf das andere zu achten, was mir noch in meinem Gesicht auffällt.
Die Augen.
Groß und von solch einem kräftigen tiefvioletten Ton, dass es mir Angst macht, wenn ich sie ansehe. Wie kann man sich vor seinen eigenen Augen fürchten? Auch wenn ich mich an nichts erinnern kann, habe ich das Gefühl, dass diese Augen alles andere als gewöhnlich sind.
Ich wende den Blick ab und betrachte den restlichen Körper ein wenig genauer: Die Haut ist bleich, fast weiß, zumindest dort, wo sie nicht von Erde und Gras verdreckt ist. Nur unter dem Schulterblatt zeichnet sich eine dünne silbrige Linie ab, die nicht so recht dazugehören will. Sie schimmert blass, kaum zu erkennen, und in merkwürdigen verschnörkelten Symbolen, die mir rein gar nichts sagen.
Frustriert wende ich mich von dem Fluss und mir selbst ab. All das erinnert mich nur daran, dass ich mich an sonst nichts erinnere. Ein schmerzhaftes Ziehen in meinem Bauch lässt mich aufjaulen.
Hunger! Such dir etwas zu essen!
Noch eine dieser merkwürdigen Anweisungen, die ich nicht ganz verstehe, die ich jedoch befolge, weil sie mir offenbar das Leben retten. Zumindest weiß diese Stimme besser als ich, was in mir vorgeht und was ich zu tun habe. Außerdem klingt sie so gebieterisch, dass ich gar nicht anders kann, als mich aufzurichten und mich den Bäumen auf der anderen Seite zuzuwenden.
Dann blicke ich wieder zurück, dorthin, wo ich hergekommen bin. Soll ich dahin zurück? Warum? Mit einem Mal fühle ich mich schrecklich hilflos und verlassen, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich eigentlich tun soll.
Hunger!
Erleichtert über die Stimme in meinem Kopf verdränge ich diese Gedanken. Sie gibt mir einen Auftrag, etwas, was ich tun kann, anstatt zu grübeln. Nur, was kann ich essen? Auch diesmal rettet mich der Instinkt.
Such dir Kräuter und Wurzeln im Boden.
Erleichtert grabe ich mit den Händen im schlammigen Untergrund des Flussufers und befördere kleine Wurzeln von Wasserpflanzen zutage. Sie sind braun und knorrig, aber ich beschließe, mich darum nicht zu sorgen und mich gänzlich auf die Anweisungen zu verlassen. Zögernd betrachte ich sie und stecke mir dann mit zusammengekniffenen Augen blitzschnell eine in den Mund. Mit der Zunge fahre ich darüber. Schmeckt … nicht schlecht. Schon nach wenigen Bissen fühle ich mich viel besser, der dumpfe Schmerz lässt nach. Doch da ist noch immer ein gewisses Verlangen in mir, wie ich unzufrieden feststelle. Ein Teil meines Verstandes sagt mir, dass das genug gewesen ist, um den Hunger und den Durst zu stillen. Ein anderer Teil möchte mehr. Keine Wurzeln, kein Wasser. Ich weiß nicht was, nur dass ich nicht vollends gesättigt bin. Wütend schlage ich mit der Faust auf das Wasser und es spritzt zu allen Seiten auf, sodass ich einen Satz zurück mache. Es macht mich alles so zornig! Jeder Gedanke fühlt sich schwerfällig und träge an, als wäre er fast fertig geformt, doch dann fehlt ein letztes Wort, ein letztes Teil, um ihn zu vervollständigen und gänzlich zu denken.
Was nun? Die Sonne, inzwischen ein leuchtend roter Ball, taucht alles in ein unwirkliches oranges Licht, bevor sie langsam hinter den hohen Baumkronen verschwindet. Es wird kühler und ich schlinge fröstelnd die Arme um meinen Körper, um die Wärme zu speichern. Ruhelos huscht mein Blick hin und her.
Such dir einen Schlafplatz, er muss sicher sein.
Nachdenklich betrachte ich die leichte Strömung und überlege, ob ich den Fluss durchqueren soll. Andererseits muss er wohl recht tief sein und ich bin mir nicht sicher, ob ich schwimmen kann. Beim Anblick des plätschernden Wassers, das über die kleinen Felsen hüpft, fühle ich mich irgendwie unwohl …
Um eine andere Lösung bemüht, entdecke ich mehrere flache Felsen, an denen sich das Wasser bricht und schäumend weiterrauscht. Ermutigt laufe ich zu der Stelle und beginne, flink von Fels zu Fels zu hüpfen. Es ist viel einfacher, als ich dachte, mein Körper bewegt sich mit einer wunderbaren Leichtigkeit und schnell habe ich das andere Ufer erreicht, wo ich mich für einen hohen Baum entscheide. Ohne weiter darüber nachzudenken, strecke ich die Hände nach den unteren Ästen aus. Flink klettere ich an ihnen empor und mache es mir auf einem der oberen Äste bequem. Aus einem unbestimmten Grund weiß ich, dass ich im Schlaf nicht herunterfallen werde. Mit einem tiefen Seufzer strecke ich mich aus, aber meine Muskeln wollen sich einfach nicht entspannen, meine Sinne sind auf höchste Alarmbereitschaft gestellt und ich finde keine Ruhe. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Warum bin ich hier? Fragen über Fragen und die allergrößte: Was soll ich nur machen? Warten? Worauf?! Ich fühle mich schrecklich allein, wie das einzige Wesen hier zwischen den hohen Wipfeln, so …
Einsam, informiert mich mein Gehirn über das ungewohnte Gefühl. Einsam. Einsam, einsam, einsam. Ich denke es so lange, bis das Wort seine Bedeutung verliert und nur noch eine seltsame Aneinanderreihung von Buchstaben ist, die keinen Sinn ergeben. Traurig schlinge ich die Arme um mich und schließe die Augen.
Vielleicht ist das alles nur ein unwirklicher Traum, vielleicht muss ich mich nur wieder in diese dunkle Schwärze fallen lassen, und wenn ich die Augen aufschlage, bin ich wieder an einem völlig anderen Ort und weiß alles wieder.
Ich versuche, das unangenehme Gefühl in mir drin zu ignorieren, das Verlangen nach etwas anderem, was ich noch nicht gefunden habe. Stattdessen bemühe ich mich, in den Schlaf hinüberzugleiten, wenngleich meine Sinne kaum zur Ruhe kommen, meine Ohren nehmen jedes noch so kleine Geräusch wahr und die Gerüche der Nacht kitzeln meine Nase.
Warum?
2
Der nächste Tag ist anstrengend. Nach einem spärlichen Frühstück mache ich mich daran, meine Umgebung zu erkunden, denn mein Instinkt sagt mir, dass es wichtig ist, alle Winkel genau zu kennen, jeden Pfad und jeden Weg, um sich bei Gefahr augenblicklich in Sicherheit bringen zu können. Also streife ich umher, husche leise und flink durchs Unterholz, springe über Wurzeln und Gräben. Anfangs macht es mir Spaß, überall hinzulaufen, beinahe schwerelos durch den Wald zu rennen, verträumt auf einer Lichtung zu liegen … mit der Zeit macht es mich nur noch traurig. Alles ist irgendwie ohne rechten Sinn, ich streune lustlos durch die Gegend, esse etwas, wenn ich Hunger habe, trinke, wenn ich Durst habe, schlafe, wenn ich müde bin. Sie langweilen mich rasch, diese gleichen Tage. Wie lange wird das wohl noch so weitergehen?
Im Wald habe ich viele Tiere gesehen – keines ist wie ich. Ich habe versucht, wie sie zu laufen, trotzdem passe ich nicht in den Bau eines Fuchses, die Hasen verliere ich irgendwann im Unterholz und größer als einer dieser Vögel bin ich ohnehin. Es stimmt mich wehmütig, wie sie ihre Flügel ausbreiten und einfach davonfliegen, wenn ich sie von ihren Zweigen aufschrecke. Eine ganze Schar von ihnen steigt dann in den Himmel auf und verschwindet.
Wie gern würde ich ihnen folgen, von dort oben auf den Wald mit seinen hohen Baumwipfeln hinabblicken, um mich nicht darum sorgen zu müssen, was unten auf der Erde geschieht.
Traurig blicke ich auf meine Flügel zurück, die ich nun nicht mehr zu bewegen wage. Ich werde all das hier wohl zu Fuß erkunden müssen.
Schon bald finde ich mich viel besser im Wald zurecht, weiß, wo ich die schmackhaftesten Beeren finden kann und wie der Fluss das Gebiet durchzieht. Obwohl ich diese Stellen häufig aufsuche, lässt mich ein dumpfes Ziehen in meiner Magengegend nicht in Frieden. Ruhelos streife ich zwischen den dicht stehenden Bäumen umher, meine Schritte sind auf dem weichen Waldboden nicht zu vernehmen, der Wind streicht mir um die Nase und ich lasse mich von meinem Geruchssinn leiten.
Jeder noch so kleine Luftzug trägt die verschiedensten Gerüche zu mir und ich kenne sie alle.
Mit einem Mal versteift sich mein Körper. Die Muskeln verkrampfen sich und ich nehme einen neuen Duft wahr, so verführerisch, dass es mich vollkommen überrascht. Ich atme tief ein. Er ist neu und doch uralt. Er kommt mir bekannt vor. Mein Körper übernimmt die Kontrolle, noch ehe ich weiß, dass ich sie ihm überlassen habe.
Ich will zu diesem Geruch. Ich muss.
Was kann es nur sein, das so unglaublich gut riecht? Ich beginne zu zittern, überwältigt von diesem Eindruck. Ungewollt blecke ich die Zähne und verenge meine Augen. Das Kratzen in meiner Kehle ist plötzlich und überdeutlich wieder da, wenngleich es an den letzten Tagen nur ein störendes raues Gefühl im Hals war. Meinen Beinen muss ich nicht befehlen, was zu tun ist. Ich renne bereits durch den Wald, pfeilschnell rase ich zwischen den Bäumen hindurch, springe geschickt über Wurzeln, dem Duft nach, der meine Sinne gleichzeitig vernebelt und auf das Äußerste schärft. Es fühlt sich an, als würde ich mich in ein neues Wesen verwandeln, schneller, konzentrierter, zielstrebiger.
Der Geruch wird stärker und ich bemerke, wie Speichel in meinem Mund zusammenläuft, ignoriere die Zweige, die mir scharf ins Gesicht peitschen. Alles rückt in den Hintergrund, alles wird nebensächlich und verliert an Bedeutung.
Schließlich spüre ich, dass ich fast da bin. Geduckt und leise nähere ich mich, dann bleibe ich abrupt an einem hochgewachsenen Baum stehen, die Nasenflügel gebläht, die Hände zwischen den gebeugten Knien. Unter meinen Fingern spüre ich das weiche Moos.
Es ist ein verletztes Tier. Ein Fuchs. Ich sehe ihn am Boden, er windet sich, aus einer Wunde unterhalb der Schulterlinie fließt Blut und verfärbt das Gras unter ihm.
Der metallisch süßliche Geruch steigt mir in die Nase und bringt mich um den Verstand. Ein Rudel wilder Feuerraben hat sich um den Fuchs geschart. Ihr flammendes Gefieder sieht aus, als würden sie in Brand stehen und von lodernden Flammen umgeben werden, was mich den Bruchteil eines Augenblicks lang glauben lässt, ein Feuer breite sich im Wald aus. Mit ihren langen und gebogenen Schnäbeln hacken sie erbarmungslos auf den Fuchs ein, und obwohl das Tier verzweifelt versucht, sich zu wehren, droht es von der Schar übermannt zu werden. Verzweifelt und verwundet schleppt es sich vorwärts, doch die spitzen Schnäbel der Raben sind unerbittlich und zwingen ihn zu Boden.
Tiefe Wunden picken sie in das Fell des Fuchses, das inzwischen blutgetränkt ist, und ich verliere die Beherrschung. Dunkelrote Flecken überall und ihr Geruch … dieser Geruch!
Langsam gehe ich auf die Szene zu. Das Kreischen der Feuerraben ist laut und aufgebracht, der Fuchs jault gequält. Im Todeskampf wälzt er sich hin und her. Blut, überall Blut, es … riecht … so … gut. Es ist, als würde ich von einer anderen Macht gesteuert werden, einer, die die Muskeln bewegt, die mich dazu veranlasst, bestimmte Handgriffe blitzschnell auszuführen.
Ich spreize meine Finger und spüre das unbändige Bedürfnis, sie um die Kehle des Fuchses zu schließen und zuzudrücken. Ich will sehen, wie seine Augen nach oben rollen, bis nur noch das Weiße zu sehen ist. Ich will, dass er zuckt, ein letztes Mal, der ganze Körper verkrampft, bis die Bewegungen erschlaffen. Bis er sich nicht mehr regt. Ich spüre bereits, wie meine Zähne sich in das Fell graben, und bilde mir den metallischen Geschmack auf meiner Zunge ein, eine unglaubliche Explosion, endlich, endlich das, was mich satt macht. Warmes Blut, pulsierend, sprudelnd.
Allein der Gedanke daran lässt mich alles um mich herum vergessen. Ich muss nur … muss es nur tun.
In mir drin fühle ich nichts. Rein überhaupt gar nichts. Keine Reue, Abscheu, Ekel. Da ist nur der Geruch von dem Blut und der schrecklich schöne Wunsch, es endlich kosten zu können. Vor meinem inneren Auge sehe ich mich vorspringen, mit einem lauten Brüllen und Zähnefletschen die Feuerraben verscheuchen. Das ist meine Beute. Ich will diesen Fuchs! In meinen Ohren rauscht es, Schauer überkommen mich. Meine Gedanken werden lauter und lauter, bis sie mich anschreien und ich kaum zwischen den Stimmen unterscheiden kann.
Ich keuche auf. Blinzele. Einmal, zweimal, immer wieder.
Es ist so still geworden. Totenstill. Eben noch hat die ganze Welt sich in einem dunkelroten Licht gedreht und alles war schrill und verzerrt, und jetzt fühlt es sich an, als wäre sie angehalten worden. Verlangsamt. Ich spüre, wie ich meine Finger um etwas klammere. Verkrampft und fest. Was ist passiert? Ich starre nach unten und sehe den toten Fuchs in meinen Händen. Von den Feuerraben ist keine Spur zu sehen. Habe ich sie verjagt? Wann? Ich weiß nicht mehr genau, was tatsächlich geschehen ist und was ich mir nur eingebildet habe. Die Vorstellung, das verwundete Tier zu erwürgen … war sie Realität? Ich schüttele den Kopf, will aufstehen, aber kein Muskel gehorcht mir. Wie gebannt starre ich den toten Fuchs an, seine verdrehten Augen und die aus seinem Maul hängende Zunge. Die rote Flüssigkeit, die sich weiterhin auf seinem Fell ausbreitet. Ich berühre sie mit einem Finger, meine Bewegungen sind langsam, wie in Trance führe ich ihn zur Nase, atme ein.
Dieser Geruch ist wie eine andere Welt. Ich will nur probieren, nur einmal kosten. Ein einziger Tropfen, ein winzig … kleiner …
Das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich auf meinem Baum sitze, die Arme um die angezogenen Knie geschlungen, und einen Finger an meinen Mund lege. Verwirrt sehe ich ihn an. Er ist blutverkrustet. Angewidert und erschrocken halte ich ihn von mir weg. Ein Blick zum Fuße des Baumes und mein Magen dreht sich. Die völlig zerfetzten und grotesk entstellten Überreste des Fuchses liegen dort.
Scharf ziehe ich die Luft ein, während mir heiß und kalt zugleich wird. Ich muss die Augen schließen und mich an dem Baum festklammern, will ich nicht rückwärts hinunterfallen. Mein ganzer Körper kribbelt und in meinen Ohren ist ein schrilles Fiepen. Habe ich das getan?! Wieso kann ich mich dann kaum daran erinnern?! Ich denke daran, wie ich von diesem betörenden Duft angezogen durch den Wald gehetzt bin. Blut. Es war das Blut, das mich angelockt hat. Das mich zu dem Schauplatz des Kampfes laufen ließ. Dann verschwimmt alles. Ich weiß noch, wie ich das Tier töten wollte, wie ich sein Blut trinken wollte. Ist das falsch? Ich weiß es nicht … Es kommt mir vor, als müsste ich mich schlecht fühlen. Als sollte ich angewidert sein.
Blut trinken. Ein Tier derart zu zerfetzen, das kann nicht normal sein! Selbst die gierigen Feuerraben hätten es nicht auf diese Weise zugerichtet.
Wieder muss ich schlucken, und als ich aufstoße und der Geschmack von Blut sich erneut in meinem Mund ausbreitet, drohe ich tatsächlich das Bewusstsein zu verlieren. Ich muss mich mies fühlen. Mir ist klar, dass ich das muss. Trotzdem will sich das schlechte Gewissen nicht einstellen.
Denk daran, wie gut es geschmeckt hat …
Nein! Nein, das darf ich nicht, das kann nicht richtig sein! Ich muss es bereuen, ich muss angeekelt sein.
Oder solltest überlegen, ob ein Feuerrabe vielleicht besser geschmeckt hätte.
Ich presse mir die Hände auf die Ohren, als würde das etwas an der Stimme in meinem Kopf ändern. Als könnte ich sie auf diese Weise zum Schweigen bringen. Sie verhöhnt mich. Wann immer ich versuche, mich daran zu erinnern, wie sich Reue anfühlt, ruft sie mir diesen metallischen Geschmack ins Gedächtnis und das unglaubliche Gefühl der Befriedigung, als ich meine Zähne in das Fell grub. Die endlose Erleichterung, als ich endlich das Blut an meinen Lippen spürte und wusste, dass mein Hunger gestillt werden konnte.
Nein, Feuerraben haben zu viele Federn. Blöd.
Sei still! Sei still, sei still, sei still!
Ich brauche einige Momente mehr, um mich so weit zu beruhigen, um nach unten zu klettern und mit spitzen Fingern die Fellbüschel hochzuheben. Ich muss etwas tun. Nur wohin damit? Wieder muss ich die Luft anhalten und all meine Willenskraft aufbieten, um nicht den Verstand zu verlieren. Aber dieses Mal hat der Geruch des Blutes keine solche Wirkung wie vorhin. Ich habe nicht länger Durst, kann mich abwenden.
Ich spüre etwas an meinem Kinn, fahre mit dem Ärmel der meines Oberteils darüber und schließe sofort die Augen. Noch mehr Blut.
Mit meinen bloßen Händen wühle ich schließlich die Erde auf und der dunkle Sand frisst sich unter meine Nägel, sodass sie splittern. Ich grabe ein tiefes Loch und stoße die Überreste des Fuchses hinein, um anschließend die Erde wieder darüberzuschieben, bis nichts mehr von seinem zerfetzten Fell zu sehen ist. Dann mache ich mich sofort auf den Weg zu dem kleinen Fluss. Zuerst muss dieses ganze Blut runter! Es klebt überall, in meinem Gesicht, an meinen Händen, auf meiner Kleidung. Unheilvolle dunkelrote Flecken, die leuchten und mir ständig aufs Neue vor Augen führen, was ich getan habe. Sie schreien mich an: Mörder!
Unwirsch presse ich die Lippen zusammen.
Ich sehe das glitzernde Wasser zwischen den Zweigen auftauchen und habe kurz darauf den schmalen Fluss erreicht. An dieser Stelle ist das Wasser flacher und seichter, Seerosen schwimmen auf ihm, es reflektiert das Sonnenlicht und Blätter bilden kleine Kreise auf der Oberfläche. Ich knie mich an das Ufer und versuche es krampfhaft zu vermeiden, auf mein Spiegelbild im klaren Wasser zu achten.
Trotzdem sehe ich, wie die dunklen violetten Augen unheilvoll leuchten. Zu den weißen, kinnlangen Haaren, die mein Gesicht einrahmen, sieht es grotesk aus. Ich starre hinab auf meine zierlichen Hände, die so Schreckliches getan haben, tauche sie komplett ins Wasser und reibe das getrocknete Blut ab, schrubbe heftiger darüber, als könnte ich dadurch die Tat von mir abwaschen. Als könnte ich die grässliche Stimme wegspülen, die das alles genießt. Ungeachtet dessen habe ich das Gefühl, als habe sich das unheilvolle Zeug in meine Haut gebrannt, es will kaum verschwinden, und als es schließlich das Wasser des Flusses verfärbt und er es davonträgt, wird mir schlecht.
Zögernd spähe ich über das Ufer. Irgendwie habe ich Angst, gänzlich in den Fluss zu steigen. Was, wenn ich auch davongeschwemmt werde? Dabei ist die Strömung nicht stark.
Nervös sehe ich mich um, selbst wenn nichts zu hören ist außer dem Singen der Vögel und dem Rauschen des Wassers, wenn es sich an Felsen bricht. Langsam wate ich ins Wasser hinein, die Strömung umfließt meine blassen Knöchel bis zu den Fesseln und meine Zehen graben sich in den schlammigen Grund, die Fische kitzeln mich. Zögernd kneife ich die Augen zusammen und lasse mich mit einem spitzen Schrei hineinfallen. Das Wasser schlägt über meinem Kopf zusammen und ich sinke wie ein Stein. Panisch reiße ich die Augen auf, meine blonden Haare umtanzen mich. Prustend und keuche strampele ich mich an die Oberfläche.
Schwimmen!
Ich rudere unbeholfen mit den Armen und paddle dazu mit den Beinen, um mich irgendwie über Wasser zu halten und zurück an das Ufer zu kommen. Panisch strecke ich eine Hand nach einer Schilfpflanze aus und klammere mich erstickt daran.
Japsend und keuchend ziehe ich mich am Ufer entlang, bis der Fluss an einer Stelle niedrig genug ist, dass ich sitzen kann, ohne zu ertrinken. Vorsichtig streife ich zuerst mein Oberteil und dann meine Hose ab. Mit den Händen reibe ich den Stoff aneinander, um so die schrecklichen Flecken herauszuwaschen, und werfe sie dann auf das Gras. Behutsam rutsche ich weiter in das Wasser. Es ist eiskalt und genau das brauche ich. Mein Kopf wird klarer und ich fühle mich langsam sauberer, je länger es über mich fließt. Ich tauche unter, wasche die Erinnerungen an das tote Tier weg. Wasche den Mord von meiner Haut, den Geruch des Todes, der sich in meinen Poren eingenistet hatte. Ich wasche und reibe und trotzdem fühle ich mich in meinem Inneren nicht besser.
Die Spuren sind von Haut und Kleidung verschwunden, aber in meinem Gedächtnis sind sie weiterhin wie schwarze Brandflecke, die ich nicht ausblenden kann. Da ist das Monster, das mich wie eine zweite Haut bedeckt. Ich keuche auf und stoße wieder an die Oberfläche, reibe mir das Wasser aus den Augen und seufze auf.
Was ist denn nur los mit mir? Warum bin ich nicht wie die anderen Lebewesen hier im Wald? Gibt es noch mehr von denen, die wie ich aussehen? Gibt es da draußen mehr von dem, was ich bin? Noch mehr mit diesen Augen? Vielleicht können die mir ja Antworten darauf geben, warum ich mich an nichts erinnern kann.
Ich muss sie nur finden.
Doch mein neu gewonnener Mut erstickt augenblicklich noch im Keim. Wo soll ich denn nur suchen? Der Wald ist schier endlos.
Missmutig klettere ich nach draußen und streife meine Kleidung wieder über. Sie ist zwar nass und klebt an meinem Körper, bei der wärmenden Sonne trocknet sie jedoch sicher schnell. Ein Vogel stößt einen merkwürdigen Laut aus, der Wind fährt durch die Äste und den Rest des Tages verstecke ich mich auf meinem Baum aus Angst, wenn ich herumstreune, könnte ich irgendeinem anderen Tier begegnen und es möglicherweise angreifen.
In der Nacht träume ich schrecklich.
Ich sehe Füchse mit blutrotem Fell, die eine kleine Gestalt auf einem Felsvorsprung umkreisen. Ihre Bewegungen sind forschend und überlegt, langsam ziehen sie den Kreis enger und enger. Die Gestalt in ihrer Mitte ist leichenblass, ihre Haut leuchtet wie milchiges Mondlicht und als sie den Kopf hebt, erkenne ich mich selbst. Meine großen dunklen Augen verschlucken mich, sehen mich kalt und erbarmungslos an. Mit einem Mal ändert sich ihre Farbe, sie werden rot. Rot wie Blut. Es leuchtet auf meiner Kleidung, in meinen Haaren, an meinen Händen.
Die Gestalt bemerkt es kaum. Ihr Blick ist starr und fest auf mich gerichtet und ich fühle mich, als würde ich der körperlosen Stimme in meinem Kopf gegenüberstehen. Als wäre das die Frau, die sie aus mir machen möchte. Ich will zurückweichen, doch meine Beine sind wie festgewachsen, ich kann mich nicht rühren, kann mich nicht aus ihrem bannenden Blick befreien.
Die Frau bleckt angriffslustig die Zähne und die Füchse wenden sich ebenfalls mir zu. Ihre glänzenden Augen blicken mich vorwurfsvoll und rachsüchtig an.
3
Der Weg führt mich wie jeden Morgen zum Fluss, der sich in einem langen, glitzernden Band durch den gesamten Wald zieht. Ich finde ihn früher oder später und es belustigt mich, sein steiniges Ufer stets an einer anderen Stelle zu erreichen. Grüne Wasserpflanzen ragen aus den Einbuchtungen hervor und die Kiesel an seinem Grund blitzen im Sonnenlicht. Ich klettere flink von einem großen flachen Stein zum anderen, gebückt, wie ich es mir bei einigen Tieren abgeschaut habe. Meine nackten Zehen finden Halt in den Ritzen und ich bewege mich bis zur Mitte vor. Lächelnd beobachte ich die Fische, die durch das Wasser schießen. Ihre silbrigen Schuppen schimmern wie ein Kettenhemd.
Kurz stutze ich über meine eigenen Gedanken – Kettenhemd? Wo kommt dieser Begriff her? Ich kenne ihn und dennoch kann ich mir das Bild dazu kaum ins Gedächtnis rufen. Eine Weile betrachte ich sie, meine Blicke flackern unruhig hin und her, dann schnelle ich mit meinem Arm vor und erlege einen zarten Goldschwimmer. Nach wenigen Versuchen habe ich genug gefangen, dass es für einige Mahlzeiten reichen wird.
Ich habe versucht, mich dagegen zu wehren, doch seitdem ich erstmals vom Blut des Fuchses getrunken habe, reichen mir die Wurzeln im Uferschlick oder die Kräuter und Strauchbeeren nicht mehr. Sie schaffen es zwar für eine gewisse Zeit, die Leere in meinem Magen zu füllen, aber es vergehen nur wenige Tage, bis ich wieder spüre, dass mein Verlangen damit nicht gestillt ist. Als ich es das erste Mal nach dem Vorfall mit dem Fuchs zu ignorieren versuchte, konnte ich regelrecht fühlen, wie ich schwächer wurde, und aus Angst, wieder die Kontrolle über mich zu verlieren, begann ich, in regelmäßigen Abständen Tiere zu erlegen.
Das zweite Mal Blut zu trinken war nicht minder unglaublich, indes konnte ich mich besser beherrschen. Ich zerfleischte mein Opfer nicht völlig und ich konnte mich gänzlich an die Tat erinnern. Keine gute Tat, das spüre ich. Habe ich eine Wahl? Vielleicht sind alle Wesen wie ich so. Und schließlich wollten auch die Feuerraben den Fuchs fressen. Es fühlte sich besser an und nachdem ich von dem Blut gekostet hatte, spürte ich förmlich, wie Energie durch mich hindurchjagte, und meine Laune besserte sich augenblicklich, deshalb bleibe ich nun dabei.
Gerade als ich die Fische bis auf ihre Gräten abgenagt habe und mir mit dem Handrücken über den Mund wische, dringen mit einem Mal seltsame Geräusche an mein Ohr. Ich stutze.
Ein Getrappel wie von Hufen und das Rascheln von Kleidern, ein Klappern, ein Klopfen … Ich springe sofort auf und laufe darauf zu. Zu meiner Verwirrung muss ich ein ganzes Stück durch den Wald rennen, ehe ich Bewegungen zwischen den Bäumen erahnen kann, dabei waren die Laute klar und deutlich, als kämen sie aus nächster Nähe.
Blitzschnell erklimme ich einen Baum und erreiche seine höchsten Äste. Aufmerksam spähe ich über die hohen Kronen. Da, Gestalten, die zwischen den mächtigen Stämmen umherwandern. Sie haben Karren bei sich. Karren und Wagen, gezogen von Pferden.
Lauernd folge ich den Wandernden und sehe nach Westen. Dort erkenne ich in einiger Entfernung rote, riesige Mützen. Von ihnen dringt ein merkwürdiger Lärm zu mir herüber, den ich nicht so recht einordnen kann. Was mag dort wohl sein? Könnte es vielleicht sein … Ich verschwinde wieder im Geäst und springe von einem der niedrigeren Äste, lande leichtfüßig auf dem weichen Waldboden.
Neugierig folge ich den Geräuschen.
In ausreichendem Abstand schleiche ich hinter den Gestalten her, verberge mich im Unterholz und halte nach ihnen Ausschau, ehe ich ihnen weiter lautlos nachlaufe. Plötzlich stehen die schützenden Bäume weiter auseinander, das Gestrüpp lichtet sich und ich merke, wie es heller wird. Ich nähere mich einer Lichtung. Einer riesigen Lichtung.
Abrupt halte ich inne. Die Gestalten laufen unbeirrt weiter und verlassen das Dickicht des Waldes, treten hinaus in das Licht. Ich blicke mich nervös um, spähe zurück in die grüne Dunkelheit, die mir vertraut ist. Noch nie habe ich mich weit genug vorgewagt, dass ich diesen Ort entdecken konnte. Schüchtern trete ich an den leichten Abhang heran und kann von ihm aus auf die kleinen Gebäude weiter unten blicken.
Sie sind aus Stein und Holz gefertigt, mit strohgedeckten Dächern und Fenstern, durch die man hineinblicken kann, und sie sehen groß und massiv aus. Bunte Punkte bewegen sich zwischen ihnen hin und her, ein kreisrunder Platz in ihrer Mitte muss wohl etwas wie das Zentrum zu sein, nach dem sich alles richtet. Er fällt mir sofort auf, ein freier Fleck inmitten des Häusermeeres, und dorthin strömen alle Gestalten. Auch die, denen ich bis hierher gefolgt bin.
Vorsichtig schleiche ich näher und beginne, den Abhang hinunterzuklettern. Was mag das wohl sein?
Der seltsame Ort ist auf allen Seiten vom Wald umgeben, der im Norden und Osten längst nicht mehr so dicht und wild ist, wie ich es gewohnt bin. Er scheint in unmittelbarer Entfernung ein Ende zu nehmen. Das verunsichert mich. Ich habe den Wald noch nie verlassen …
Deshalb fühle ich mich auch seltsam nackt, als ich mich den Gebäuden nähere. Wo kann ich mich verstecken?
Im Schutze eines Hauses wage ich mich weiter heran, drücke mich eng an die Wand hinter mir. Meine Blicke huschen wachsam hin und her, so viele Geräusche umgeben mich, so viele neue Sinneseindrücke, dass ich scharf Luft holen muss. Gedanken rasen mit einer fast schon schmerzhaften Geschwindigkeit durch meinen Kopf, alles ist mir ein wenig zu laut, ein wenig zu grell. Farben brennen in meinen Augen, merkwürdige Stimmen und Laute, die ich nie zuvor gehört habe, erfüllen die Luft.
Mein Herz setzt für einen Moment aus, als ich die Wesen, die über die gepflasterten Straßen wandeln und sich dabei fröhlich unterhalten, entgeistert anstarre. Sie sehen ja aus wie … ich!
Sie haben Beine und zwei Arme und einen Kopf mit langen Haaren. Und diese seidige, schrecklich dünne Haut, die auch mich umgibt. Mir klappt der Mund auf. Andererseits bewegen sie sich ganz anders! Ihr Rücken ist durchgedrückt, sie gehen kerzengerade und aufrecht. Vor allem scheint sich keiner von ihnen durch irgendetwas bedroht zu fühlen, dabei sind es so viele. So viele auf einem Haufen. Wie können sie sich nicht einmal umsehen, wie können sie derartig sorglos dahinschreiten?
Ich drücke meinen Rücken durch und nehme die Schultern zurück, versuche mich ihrer steifen Art anzupassen, falle jedoch schnell wieder in die alte Haltung. Irgendwie fühle ich mich auf diese Weise sicherer.
Der Wald ist groß, unendlich. Es kam mir vor, als wäre er alles, was es auf dieser Welt gibt. Nichts anderes außer grüne Wiesen, Bäume und moosbedeckte Lichtungen. Offensichtlich habe ich mich gewaltig getäuscht.
Geh lieber wieder weg! Das ist nichts für dich! Das sind Menschen!
Menschen. Ich probiere das Wort in meinen Gedanken aus und es kommt mir flüchtig bekannt vor. Bin ich auch ein Mensch? Denn auch wenn sie mir auf den ersten Blick ähneln, entdecke ich beim näheren Hinsehen zahlreiche Unterschiede. Ihre Augen sind anders. Sie leuchten nicht kräftig und dunkel wie meine und auf keinen Fall sind sie violett. Die Menschen reden die ganze Zeit, ihr Gewirr aus Stimmen ist fast schon zu laut für meine sensiblen Ohren und ich nehme Gesprächsfetzen auf, denen ich keinen rechten Sinn entlocken kann.
»… müssen sicherlich ein Vermögen wert sein!«
»Um Himmels willen, bist du sicher? Ich wusste nicht …«
»Hast du schon gehört, dass die Tochter von …«
»Oh, guten Tag, ich hatte nicht mit Ihnen gerechnet! Wollen Sie …«
Ich schaffe es kaum, mich auf eine Sache zu konzentrieren, schon ist da etwas Neues, das mich ablenkt. Das Leben der Menschen ist bunt und hektisch, sie eilen gehetzt über das Pflaster, haben kaum Zeit. Alle sind in Aufruhr, alle sind in Bewegung.
Gleichzeitig faszinieren sie mich. Sie sind so … anders.
Ich schleiche um das Haus herum und finde mich auf einer belebten Straße wieder. Lachend laufen Kinder an mir vorbei, aus den Fenstern blicken Gesichter, an Leinen, die von Dachfirst zu Dachfirst gespannt sind, hängen bunte Kleidungsstücke. Karren werden an mir vorbeigerollt, laute Stimmen rufen einander etwas zu, die Menschen winken. Ich drehe mich im Kreis, versuche alles in mir aufzunehmen, all die neuen Dinge.
Ein Netz aus staubigen Straßen windet sich durch das Dorf, die kleinen Häuser aus Sandstein mit den hohen Schornsteinen und grünen Fensterläden stehen dicht gedrängt aneinander, Blumen blühen vor den Fenstern, ein verführerischer Duft dringt aus dem Inneren.
Für den Großteil der Dinge habe ich nicht einmal einen Namen! Das Dorf ist chaotisch und unruhig und das löst einerseits eine unglaubliche Furcht in mir aus, weil alle durcheinander rufen, gleichzeitig macht dies es mir leichter, mich am Rande im Schatten der Häuser unbemerkt weiter vorzuwagen.
Es fühlt sich an, als könnte ich für den Rest des Tages nichts anderes tun, als die merkwürdigen Wesen zu beobachten. Die Menschen sind alle verschieden, ihre Haare gibt es in den unterschiedlichsten Farben und Längen, ebenso ihre Haut und Augen. Aber sie entmutigen mich auch. Denn trotzdem entdecke ich niemanden, der so aussieht wie ich oder der sich auch nur annähernd so leise, flink und angriffsbereit bewegt.
Weil du nicht wie sie bist.
Warum nicht? Was bin ich dann?
Kaum gedacht, verwerfe ich den Gedanken gleich wieder, denn die Gebäude um mich herum verändern sich. Verschnörkelte Buchstaben in bunter Schrift, abblätternde Farbe auf Schildern, kunstvoll verzierte Zeichen über den Türen. Ich wundere mich selbst, warum ich es lesen kann, denn es fällt mir nicht allzu schwer, die seltsamen Symbole zu entschlüsseln und zu Worten zu formen. Ich gelange auf einen großen Platz mit einer mächtigen, imposanten Statue in der Mitte. Sie zeigt einen grimmig blickenden Mann mit gekreuzten Schwertern, zu dessen Füßen Wasser in einem Becken plätschert. Ein Junge spritzt ein Mädchen nass, das kreischend und kichernd vor ihm davonläuft. Überall sind Stände mit bunten Markisen aufgebaut, Händler rufen mit lauten Stimmen und preisen die Waren an. Neugierig nähere ich mich ihnen. Bunte Glasprismen an einer Schnur aufgereiht, wozu soll das gut sein? Interessiert nehme ich einen dieser Gegenstände in die Hand, betrachte ihn und lege ihn dann auf meinen Kopf. Dazu vielleicht? Unmöglich. Das Licht spiegelt sich auf wundersame Weise in den Steinen, es malt einen zarten Regenbogen auf meine Hand und ich drehe sie begeistert hin und her.
Ein entsetzter Aufschrei lässt mich zusammenfahren. Die Frau mir gegenüber starrt mich mit schreckgeweiteten Augen an, presst sich eine Hand auf den Mund. Mein Herz verkrampft sich. Hat sie Angst vor mir?!
»Krupferl, frischer Krupferl!«
Ich fahre zusammen und wirbele herum. Ein Mann am Stand gegenüber wirbt mit lauter Stimme die Leute an und entblößt eine breite Reihe von Zähnen, als sich zwei junge Mädchen mit Körben voller Blumen am Arm nähern.
»Krupferl für die jungen Damen?«
Ich wende mich ab und stolpere zurück.
»Halt! Die Kette!«, ruft die Frau mir nach, ich kann nicht auf sie hören. Das Dorf wird mit der Zeit beängstigender! Die Häuser sind groß und es ist, als wollten sie mich unter sich begraben, als erdrückten sie mich. Die ganzen Menschen machen mir Angst, ihre Masse bedrängt mich und jetzt, wo ich mich zwischen sie gewagt habe, werden rasch mehr und mehr von ihnen auf mich aufmerksam.
»Bleib gefälligst stehen!«
Ich springe verschreckt zur Seite, als die Händlerin mir nachkommt, und rempele dabei eine füllige Frau mit zwei kleinen Kindern am Rocksaum an. Besorgt klappe ich die riesigen Schwingen eng an meinen Körper, damit sie nicht im Weg sind oder schlimmstenfalls weiter einreißen können. Die Geräusche schwellen mehr und mehr zu einem einzigen, undurchdringlichen Summen und Brummen an, die Stimmen sind schrilles Kreischen in meinen Ohren und meine Knie beginnen zu zittern. Panisch wirbele ich herum.
Du gehörst nicht hierher. Sie sehen, dass du anders bist.
Ja, sie müssen es sehen! Ich merke, dass die Frau mich noch immer im Blick hat, sie deutet auf mich und die Leute drehen sich nach mir um, reißen entsetzt die Augen auf.
Töte sie. Wie den Fuchs. Wie wäre es, wenn du ihre Kehle aufreißt? Dann würden sie nicht mehr so unerträglich laut sein. Was? Oh nein, ich muss … ich kann … wohin?! Ich drehe mich um die eigene Achse, schneller und schneller. Überall sind Menschen, drängen sich dichter an mich, die wogende Masse spült mich davon, weiter auf den Brunnen zu, ich kann mich aus dem Strom nicht befreien. In meinen Ohren fiepst es und meine Augen brennen.
Es ist leicht. Du bist schnell, sie sind unaufmerksam. Sie könnten sich nicht wehren.
Mir ist schlecht, das ist alles zu viel. Ihr Lachen, es ist so laut, so breit, so beängstigend. Ihre Bewegungen, ausladend, wirr. Ihre Schritte unbeholfen und schwer, ihre Kleidung raschelt, sie riechen, die Gerüche brennen in meiner Nase. Stechendes Parfüm, viel zu süß. Gebäck, schwer und fettig. Schweiß, durchdringend und ätzend.
Sie starren dich an.
Bitte nicht! Sie sollen mich nicht sehen, sollen mich in Ruhe lassen! Weg, weg von mir! Meine anfängliche Begeisterung schlägt in wilde Panik um. Die Eindrücke, die ich vorhin aus sicherer Entfernung aufnehmen und verarbeiten konnte, brechen nun wie ein Sturzbach auf mich ein und mehr und mehr Wesen scharen sich auf dem Platz um mich, mustern mich, schrecken zurück. Schreie werden laut. Ich fühle mich, als hätte ich eben noch am Ufer gestanden und das rauschende Wasser betrachtet, doch ein falscher Schritt, ein übermütiger Satz und ich stürze in die reißenden Fluten, in denen ich zu ertrinken drohe. Wie soll ich hier wieder herauskommen?! Verzweifelt sehe ich mich um.
Die Statue! Erleichtert eile ich auf sie zu, weiche den Entgegenkommenden aus, schlage Haken und husche zwischen Ständen hindurch. Endlich habe ich sie erreicht. Sie ist aus hellem Sandstein gehauen und durch die Konturen des Mannes, den sie darstellen soll, gibt es genügend Vertiefungen, an denen ich mich emporziehen kann. Ich springe auf den Rand des Beckens und setze einen Fuß auf den viel größeren steinernen der Statue.
»Nicht! Bist du wahnsinnig? Jemand muss sie aufhalten!«, kreischt man hinter mir, ich halte nicht inne. Flink klettere ich hinauf, meine Füße finden rasch Halt, mit den Armen ziehe ich mich nach oben. Schon bald habe ich den großen Kopf erreicht und richte mich triumphierend auf. Auf diese Weise kann ich alles überblicken und für einen Moment das Menschenmeer unter mir lassen, der erdrückenden Enge entfliehen.
In Windeseile fahre ich mit meinen Blicken die Wege entlang, präge mir das Muster der Straßen ein und versuche, mir inmitten der gleich aussehenden Häuser Orientierung zu verschaffen.
Da, der rettende Waldrand. Er ist nicht so weit entfernt, wie ich dachte. Einige verwinkelte Gassen. Eine Querstraße. Um zwei Ecken. Mein rasender Gedankenstrom normalisiert sich ein wenig.
Ich kann das schaffen.
»Komm sofort zurück! Holt sie da runter!« Die Stimme der Händlerin erreicht mich und ich blicke unwillkürlich nach unten. Erstarre. Ein ganzes Knäuel aus Menschen hat sich um den Brunnen geschart und starrt zu mir empor. Sie können sich nicht entscheiden, ob sie entgeistert oder wütend sein sollen.
»Mama! Guck das mal an!«
Ein kleines Mädchen mit langen kastanienbraunen Haaren zupft am Rock seiner Mutter und deutet aufgeregt zu mir herauf. Ich unterdrücke einen Schrei, hier oben kann ich mich jedoch nirgends verstecken. Die Mutter starrt mich verwundert an.
»Allmächtiger! Oh nein, geh da weg!« Sie zieht ihre Tochter zurück, die neugierig zum Springbrunnen gelaufen ist und mit großen Augen zu mir aufsieht. Kalte Angst kriecht mir den Rücken hinab – ich sitze in der Falle! Die Menschen bleiben verwundert stehen, tuscheln aufgeregt.
»Sieh mal, diese Augen!«
»Wo kommt sie her?«
»Wie ist sie da raufgekommen?!«
Panisch beginne ich wieder nach unten zu klettern – wenn diese verflixten Flügel nur funktionieren würden! Dann könnte ich sie ausbreiten, davonfliegen und all die Menschen unter mir zurücklassen. Doch sie sind nicht zu gebrauchen, ich muss mich auf meine Beine verlassen. Sobald ich den sicheren Waldrand erreicht habe, können sie mir nichts mehr tun.
Das ist mein Gebiet.
Kurz bevor ich das Wasser im Brunnen erreiche, springe ich von der Statue hinunter, presse mich auf die Erde, sehe mich um und versuche, einen Fluchtweg zu finden.
Weg! Lauf weg!
Ein großer Mann mit Hut nähert sich mir. Besorgt ziehen Mütter ihre Kinder zurück, die mich anfassen wollen.
»Wer bist du denn?! Weißt du nicht, dass man nicht auf einer Statue herumklettern darf?« Er macht noch einen Schritt auf mich zu. Will er mich angreifen?! Seine Stimme ist streng und barsch, seine Augen blitzen alles andere als freundlich. Panisch stolpere ich zurück. Ich muss flüchten, sofort!
Sie sehen alle her! Sie schauen dich an! Du bist anders.
»Verstehst du, was ich sage? Hallo?!«
Mein Blick huscht hin und her, plötzlich packt mich der Mann an der Schulter und ich springe auf, aus meiner Kehle dringt unerwartet ein wütendes Knurren. Überrascht sieht er mich an und ich reiße mich los, drehe mich unter ihm weg und stürze davon. Die Menschen machen mir Platz und ich erklimme einen Baum, springe auf ein nahe gelegenes Dach, was Kreischen und Schreien hervorruft.
»Halt! Komm sofort zurück!«, brüllt der Mann.
Auf keinen Fall! Nichts und niemand kann mich aufhalten, um keinen Preis der Welt bleibe ich auch nur einen Wimpernschlag länger an diesem schrecklichen Ort!
Ich spüre, dass sie mir folgen, aber sie können mich nicht einholen, denn ich bin schnell. Viel schneller als sie. Ich tauche in das Gewirr der Straßen ein und verschwinde ungesehen im Wald, wo ich nicht eher anhalte, bis ich nichts mehr höre außer dem Wind. Dann lehne ich mich keuchend und vor Angst zitternd gegen einen Baum.
Ich spüre etwas Schweres in meiner Tasche und greife danach. Die Glasprismen! In der Aufregung habe ich ganz vergessen, sie zurückzulegen, und sie achtlos in meine Tasche gestopft. Verschreckt schleudere ich sie von mir.
Dann besinne ich mich jedoch und laufe zurück, um sie im Gras zu suchen. Wenngleich sie den Menschen gehören, sind sie wunderschön und ich will sie behalten, um mich daran zu erinnern, dass sie zwar aussehen wie ich, doch trotzdem anders sind. Sie sind gefährlich und das darf ich niemals vergessen. Ich wende dem Dorf den Rücken zu und laufe wieder tiefer in den Wald hinein, wo die Dunkelheit mich verschluckt und ich vor ihren entsetzten Blicken sicher bin.
4
Tief atme ich die frische Luft ein. Der Wind streicht mir in einer sanften Brise um die Nase, das Gras kitzelt an meinen Füßen und ich höre einige Vögel entfernt in den hohen Baumwipfeln zwitschern. Es ist einer dieser Tage, wie ich sie liebe. Ein wenig kühl, etwas frisch, trotzdem nicht kalt. Er sprüht nur so vor Leben. Das weiche Gras duftet leicht und ich seufze wohlig. Viel Zeit ist seit dem Tag vergangen, an dem ich orientierungslos hier aufgewacht bin, wie viel, das weiß ich gar nicht genau. Die Tage verschwimmen ineinander und ich kann sie nicht mehr voneinander unterscheiden, versinke in der Wildnis des Waldes.
Was ich weiß, ist, dass ich bisher meine Erinnerungen noch nicht wiedergefunden habe. Da ist diese gähnende Leere in meinem Kopf, tiefste Finsternis, die sich endlos weit erstreckt, und ich weiß nicht, ob ich in sie abgetaucht bin und alles, was vor ihr war, verloren habe, oder ob ich aus ihr entstanden bin und es vorher nichts gab.
Wie ich es auch drehe und wende, der Wald ist alles, was ich habe.
Ich krieche zu dem Abhang. Verdeckt von den hohen Gräsern kauere ich da und sehe hinunter auf die Häuser, die ich seither meide, auch wenn sie von hier ungefährlich wirken. Ich fühle mich sicherer, wenn ich sie beobachte, wenn ich sie im Auge behalte und nicht etwa überraschend von den Menschen angegriffen werden kann.
Von hier oben sind sie bloß kleine Punkte, die geschäftig hin und her eilen. Ich schüttle den Kopf und robbe wieder zurück. Menschen werde ich nie verstehen. Wenngleich ich mir geschworen habe, mich von ihnen fernzuhalten, habe ich dennoch einen entscheidenden Vorteil an ihnen entdeckt. Etwas, das ich mir durchaus zunutze machen kann. Wenn ich weiß wie.
Die Glocken beginnen zu läuten.
Neun Mal.
Es ist Zeit, sich um ein Frühstück zu kümmern.
Mit einem feinen Lächeln springe ich auf und folge meinem Weg durch den Wald. Gespannt spähe ich um den Baumstamm herum, hinter dem ich mich versteckt habe. Entschlossen umklammere ich meine provisorische Waffe, einen kurzen Ast, an den ich einen scharf geschliffenen Stein gebunden habe, fester. Ich trage sie bei diesen Ausflügen stets bei mir, trotz dass ich nicht gern mit ihr kämpfe. Meine Hände sind mir viel lieber als dieses seltsame Gewicht.
Doch für das, was ich vorhabe, ist ihre Nützlichkeit nicht zu leugnen.
Wieder blicke ich um den Stamm herum und beobachte den kleinen, schmalen Trampelpfad, der durch den Wald führt.