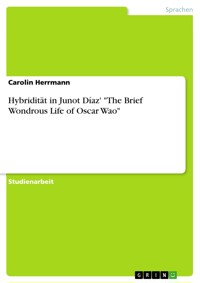Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Westworgh-Stories
- Sprache: Deutsch
Seit meine Zwillingsschwester gestorben ist, liegt meine Welt in Scherben. Einen Neuanfang. Dafür haben mich meine Eltern nach Caras Tod zu meiner Grandma geschickt. Doch wie soll ich die Vergangenheit hinter mir lassen, wenn jeder hier über meine Narben tuschelt und mich obendrein ein Hexenjäger angreift? Er mag genauso gefährlich wie gut aussehend sein, aber ich bin keine Hexe! … Oder? Ich kann ihm weder trauen noch die verdammten Funken zwischen uns gebrauchen. Selbst wenn er der Einzige ist, der mir Antworten geben kann: Denn als Zwilling bin ich Verwechslungen gewohnt. Doch diese würde bedeuten, dass Cara eine Hexe ist – und alles andere als tot … "Das Mädchen, das durch Welten springt" ist ein in sich abgeschlossener und unabhängiger Folgeband zu "Das Mädchen, das die Träume webt" und "Das Mädchen, das dem Meer gehört"; gleiches Setting, aber andere Charaktere.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Mädchen, das durch Welten springt
CAROLIN HERRMANN
Copyright © 2024 by
Lektorat: Julia Adrian
Korrektorat: Lillith Korn
Layout Ebook: Stephan Bellem
Umschlagdesign: Alexander Kopainski
www.kopainski.com
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-546-5
Alle Rechte vorbehalten
Liebe/r Lesende/r,
wie schön, dass du zu diesem Buch gegriffen hast!
In ihm werden sensible Themen angesprochen, die für manche Menschen schwierig sind und daher potentiell triggern können. Ich möchte, dass du das bestmögliche Leseerlebnis hast. Wenn du dich also mit diesen Inhalten unwohl fühlen solltest, überlege dir bitte, ob du weiterlesen möchtest. Diese Themen sind
Tod, Trauer, Erbrechen, selbstverletztendes Verhalten.
Pass auf dich auf :)
Inhalt
Playlist
Raven
1. Raven
2. Raven
3. Raven
4. Raven
5. Raven
Er
6. Raven
7. Raven
8. Er
9. Raven
10. Raven
11. Raven
12. Er
13. Raven
14. Raven
15. Raven
16. Casmaron
17. Casmaron
18. Raven
19. Raven
20. Raven
21. Raven
22. Casmaron
23. Raven
24. Raven
25. Casmaron
26. Raven
27. Raven
28. Raven
29. Raven
30. Casmaron
31. Raven
32. Raven
33. Casmaron
34. Raven
35. Raven
36. Raven
37. Casmaron
38. Casmaron
39. Raven
40. Raven
41. Raven
42. Raven
43. Casmaron
44. Raven
45. Raven
Raven
Danksagung
Drachenpost
Für meine Schwestern,
die mir mehr bedeuten,
als alles andere auf dieser Welt.
Playlist
The Rose – Bette Midler
Dark paradise – Lana Del Rey
When we were young – Adele
I hate it here – Taylor Swift
Memories – Dean Lewis
Centuries – Fall Out Boy
Zombie(bass boosted) – Ran-D
Pretty Woman – Roy Orbison
I hate the way – Sofia Carson
Let it all go – Birdie, RHODES
WOW – Zara Larsson
Say something – Christina Aguilera, A Great Big World
Moral of the story – Ashe
Drag me down – One Direction
How does a moment last forever? – Céline Dion
Hold my hand – Lady Gaga
Home – Edward Sharpe & The Magnetic Zeros
Corazón – Salvatore Scire
And in the end,
we’re all like the moon.
one side is never seen.
Raven
PROLOG
Hier ist es!«, verkündet Cara aufgeregt. Ihre Stimme wird vom heulenden Wind zerfetzt.
Mühsam schleppe ich mich den Hang hinauf und beäuge den Platz skeptisch. »Sieht nicht gerade nach dem idealen Ort zum Campen aus.«
»Ich hatte auch nicht vor, hier Halt zu machen.«
»Du willst noch weiter?« Ich zerre meinen Rucksack herunter und lasse ihn demonstrativ auf den Boden krachen. »Ohne mich! Ich gehe kein Stück mehr.«
»Komm schon, Raven.« In Caras Augen flackert etwas auf, das ich sonst nie dort sehe: Nervosität. »Es dämmert schon, bald können wir nichts mehr sehen.«
»Eben. Zum wievielten tollen Aussichtspunkt du auch willst – ich kann nicht mehr. Wir sind den ganzen Tag im mörderischen Tempo die Wanderwege hoch, die du rausgesucht hast.« Ich zerre das Band aus meinem zerfledderten Zopf. »Das sollte ein entspannter Campingausflug werden – wir sind doch nicht auf der Flucht!«
Cara lacht kurz auf. »Nein, natürlich nicht.«
»Dann lass uns hierbleiben und morgen weiterziehen.«
Sie sieht sich zweifelnd um, so wie auch die letzten Tage.
»Cara«, seufze ich. »Ich weiß, du hast diesen Trip bis ins Detail geplant, und ich liebe dich dafür. Aber es wird uns nicht umbringen, nur weil wir uns nicht genau an den Plan halten. Es ist okay, mal spontan zu sein.«
»Ich mag spontan nicht.«
»Dafür hast du ja mich.« Ich grinse. »Außerdem wird es langsam ziemlich ungemütlich.« Vielsagend deute ich um uns.
Eine zerklüftete Felsenwand schützt uns einigermaßen vor dem Wind, der die Baumwipfel auf dem Hang unter uns mächtig ins Schwanken bringt. Tintenschwarze Wolken haben sich am Himmel zusammengebraut und ich bin mehr als froh, noch ein weiteres Langarmshirt und meine Kuschelsocken angezogen zu haben.
»Okay, okay, aber morgen gehen wir früh weiter«, bittet Cara. Sie zieht die akkurat gefaltete Zeltplane aus ihrem Rucksack und ist vermutlich der einzige Mensch dieser Welt, der ein Zelt so sauber zusammenlegen kann.
»Sobald wir wach sind.«
Nach einigen Minuten gemeinsamer Arbeit steht unsere Unterkunft vor der Felswand und passt sich mit seiner Farbe hervorragend an die Tristesse an.
»Jetzt haben wir auch länger etwas von diesem Ausblick«, versuche ich Cara aufzumuntern, die immer noch angespannt wirkt. »Wie sagtest du noch? Er ist das Highlight unserer Tour.«
Caras Nasenflügel vibriert. »Findest du es etwa nicht schön?«
Ich lasse den Blick betont langsam über die Wälder und den Fluss weit unter uns schweifen. »Ist ganz nett.«
»Es ist wunderschön!«, schnaubt Cara.
Ich grinse. »Natürlich ist es das.«
Natürlich.
Cara hat die Karten mit den Wanderwegen, die Packliste und Fotos aus dem Internet schon seit Jahren an ihrer Pinnwand hängen. Immer nur als vage Idee, als vielleicht machen wir das mal.
Vor einer Woche wurde sie plötzlich ganz kribbelig und sprach davon, den Trip unbedingt in den Ferien machen zu wollen. Sie war ganz aufgedreht.
Nur zwei Tage hat es gedauert, dann wurde aus Vielleicht eine seitenlange To-do-Liste, die sie komplett abgehakt hat, bevor ich den einzigen Punkt erledigen konnte, die sie mir zugedacht hat.
Streichhölzer besorgen.
Sie hat großes Vertrauen in mein Organisationstalent.
Cara kramt die schmalen Hölzer hervor und müht sich damit ab, trotz des Windes ein kleines Lagerfeuer zu entzünden. Das hat sie auch an den letzten Abenden gemacht, während ich die Isomatten ausrollte und Schlafsäcke bereitlegte. Notdürftig hänge ich unsere Kleidung, die vom Baden im See heute Nachmittag noch nass ist, über die Zeltplane.
Cara atmet erleichtert auf, als die ersten Flämmchen emporzüngeln. Ich reibe mir die Hände, um die Kälte aus den Fingerspitzen zu vertreiben. Mein Atem dampft.
Während ich mich an das Feuer setze, bleibt Cara stehen.
»Hey.« Ich knuffe sie gegen das Bein. »Im Gegensatz zu dir habe ich daran gedacht, die Heringe richtig in die Erde zu stecken. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, dass uns das Ding wieder um die Ohren fliegt.«
»Wie? Oh, das ist es nicht, nur …«
»Nur was?«
Cara lässt sich neben mich sinken und reibt sich über die Arme, obwohl ich sofort Grannys karierte Decken eng um uns gewickelt habe. »Nichts. Ich meine …« Sie bricht ab, ich verdrehe die Augen.
»Mann, Cara, erst kann es dir mit dem Wandern nicht schnell genug gehen und jetzt bist du total angespannt. Nach den stressigen Wochen soll dir dieser Ausflug einfach mal guttun. Dich runterbringen.« Ein verschlagenes Grinsen zupft an meinen Mundwinkeln. »Vielleicht müssen wir da etwas nachhelfen.«
Caras Brauen schießen alarmiert in die Höhe. »Was soll das heißen?«
»Nur, dass ich eine kleine Überraschung dabeihabe.«
»O nein!« Cara verschränkt die Arme. »Wenn du schon so klingst, kann das nichts Gutes bedeuten.«
»Reg dich nicht auf.«
»Werde ich nicht, wenn du mir eine Frage beantworten kannst: Weiß Mom davon?«
»Himmel, nein«, ahme ich die Stimme unserer Mutter nach und ziehe eine Flasche aus meinem Rucksack hervor, in der eine klare, goldbraune Flüssigkeit schwappt. »Habe ich aus dem Keller. Ich weiß nicht genau, was das für Alkohol ist, aber er sieht sehr cool aus.«
Cara schüttelt vehement den Kopf, der flackernde Feuerschein malt zuckende Schatten auf ihr hübsches Gesicht. »Du bist wohl verrückt geworden, Raven!«
»Sie war total eingestaubt und stand ganz hinten im Vorratsregal, die wird niemand vermissen.«
»Wir dürfen überhaupt keinen Alkohol trinken!«
»Wir probieren ja auch nur mal. Vielleicht kannst du dich dann endlich entspannen. Außerdem sagt Dad, das würde wärmen. Von innen. Und mir ist ehrlich gesagt immer noch schweinekalt.«
Cara presst die Lippen aufeinander. Das hier stand weder auf ihrem Packzettel noch findet es sich auf der To-do-Liste, die wir feinsäuberlich abarbeiten.
»Komm schon! Lass mich das Ding nicht umsonst den ganzen Weg mitgeschleppt haben.«
»Tja, selbst schuld«, murrt Cara, aber ihr Widerstand bröckelt. Sie schielt zur Flasche.
»Ich kann sie auch allein leeren, dann ist sie für den Rückweg schön leicht.« Da die beste Verteidigung bei Cara schon immer der Angriff war, drehe ich den Deckel ab.
Sie reagiert sofort. »Kommt nicht infrage!« Bestimmt nimmt sie mir die Flasche ab. Ihr Blick huscht über das Etikett und unerwartet wird ihr Griff fester. »Ich mache mit. Aber jede von uns nimmt nur einen Schluck. Einverstanden?« Sie mustert mich streng und wartet mein Nicken ab, bevor sie sich die Flasche an die Lippen setzt und trinkt. Dann reicht sie den Alkohol an mich weiter.
Die Flüssigkeit brennt in meiner Kehle, aber sie verbreitet auch eine wunderbare Wärme in meinem Körper.
»Schmeckt gar nicht mal schlecht«, stellt Cara fest.
»Na also! Gib dir einen Ruck! Du darfst auch mal loslassen.«
Cara lächelt leicht und irgendwie wehmütig. Sie sieht hinauf in den sich verdunkelnden Himmel. Ich bemerke, wie sie mit ihren Gedanken abdriftet und sich zwischen den regenschweren Wolken verliert. Wider Erwarten halten sie dicht. Cara und ich sitzen an unserem Feuer, lachen, trinken noch einen Schluck – oder auch zwei, drei, vier – und erzählen uns Gruselgeschichten. Cara blickt auf die Flasche.
»Ich muss dir noch eine Geschichte erzählen, Raven.«
»Nicht mehr heute, ich kann kaum noch die Augen offen halten.« Ich gähne. »Außerdem bist du diejenige, die sich sonst viel zu sehr gruselt, um noch schlafen zu können.«
Cara weicht meinem Blick aus. Sie bleibt länger still als gewöhnlich. »Du hast recht. Ich spare sie mir für morgen auf.«
»Kann es kaum erwarten, sie zu hören.«
Wir schweigen einträchtig. Als Cara sich ins Zelt zurückzieht, ist in der Flasche nur noch ein kleiner Rest und ich verspüre eine angenehm träge Leichtigkeit. Halbherzig trete ich das heruntergebrannte Holz aus, das nur noch leicht vor sich hin glüht, bevor ich zu Cara ins Zelt krieche. Sie hat sich bereits in ihren Schlafsack gekuschelt, die kleine Lampe zwischen unseren Matten spendet sanftes Licht.
Mit dem wohlig warmen Gefühl des Alkohols im Bauch rutsche ich ebenfalls in meinen Schlafsack und schließe die Augen. Das Brausen des Windes kann uns hier drin nichts anhaben, genauso wenig wie die Kälte der Nacht.
»Gute Nacht, Raven. Ich habe dich lieb«, nuschelt Cara neben mir.
Ich höre es kaum noch.
Später, viel später, wünschte ich, ich hätte geantwortet.
Doch das habe ich nicht.
Knack.
Ich fahre auf. Wie lange habe ich geschlafen? Mein Kopf dröhnt und alles um mich herum dreht sich unangenehm. Farben und Konturen verlaufen, sodass mir schwindelig wird. Mein Schlafsack klebt an meiner verschwitzten Haut und ich blinzele schwerfällig.
So viel können wir unmöglich getrunken haben!
Oder doch?
»Cara?«, krächze ich. Mein Hals kratzt, meine Augen brennen und ich muss husten. Die Zeltplane zerfließt in dem orangeroten Schein, der die Dunkelheit verbrennt.
Mit Schrecken wird mir klar, dass es nicht die Lampe ist, die das Zelt erhellt.
Es ist Feuer.
Das verfluchte Ding steht in Flammen!
Die Zeltbahnen kräuseln sich auf, verkohlte Fetzen fallen hinab. Unaufhaltsam bahnt sich das Feuer seinen Weg, steckt das gesamte Zelt in Brand. Rauch quillt hinein, brennt in meiner Lunge.
»Scheiße!« Ich zerre den Reißverschluss des Schlafsacks auf. Er klemmt und mein Nagel reißt tief ein.
»Cara!«, keuche ich, taste mich blind durch den dichten Qualm. Mir ist schwindelig, die Hitze lässt mich verschwommen sehen. Ich drehe mich um mich selbst, weiß nicht mehr, auf welcher Seite sie gelegen hat. Meine Stimme versagt. Ich stöhne auf, als Funken in mein Gesicht sprühen. Alles glüht.
Ich bekomme keine Luft, kann nicht klar sehen. Verzweifelt greife ich um mich, kann Caras Hand nicht finden. Schwärze flackert am Rande meines Bewusstseins auf, mein Schädel dröhnt. Nein, nicht aufgeben, ich muss mich zusammenreißen. Raus, ich muss hier raus! Und Cara, sie … sie muss … muss irgendwo …
Ächzend gibt das Zelt nach. Ein Funkenregen geht auf mich nieder. Mit letzter Kraft stoße ich mich ab und rolle hinaus, raus aus dem Inferno und den Abhang hinab.
Ich spüre Steine und Wurzeln, die sich in meine Seite bohren.
Mein Kopf knallt unsanft gegen etwas Hartes und gleich darauf übermannt mich Dunkelheit. Sie zieht mich hinab in ihr düsteres Reich, wo ich Cara nicht finden kann.
Ich bin allein.
Raven
Raven Ava Moore, hör mir bitte zu!«
Entnervt löse ich meine Stirn von der kühlen Fensterscheibe und blicke zu meiner Mutter, die vor mir am Steuer unseres Wagens sitzt. Ihre roten Locken wippen unheilvoll, wie gewöhnlich, wenn sie ungeduldig ist.
Wahrscheinlich ist es das Beste, wenn ich meine Musik kurz ausschalte und wenigstens so tue, als würde mich interessieren, was sie zu sagen hat.
Ich nehme die Kopfhörer ab. »Hm?«
Kaum merklich zuckt sie zusammen, als sich unsere Blicke treffen. Das ist in letzter Zeit häufiger der Fall und es tut von Mal zu Mal mehr weh.
Ich weiß, dass ich es habe.
Ihr Gesicht.
Auch ich starre es gelegentlich im Spiegel an, wünschte, ich würde darin mehr von ihr entdecken. Das, was Mom und Dad ständig sehen.
Aber da bin nur noch ich. Sonst herrscht Leere und in mir fühlt sich alles genau so an.
Leer.
»Ich … Ich wollte nur wissen, ob du alles dabeihast. Deine Pflanzen? Die Bilderrahmen? Deine Tabletten?« Mom fängt sich erstaunlich schnell.
»Mhmh«, mache ich zur Antwort. Eigentlich müsste ich sie fragen, immerhin hat sie das Packen übernommen und ist noch dreimal durch das Haus gestürmt, um jedes Zimmer zu überprüfen.
Als könnten sie es kaum erwarten, mich loszuwerden.
Mich nicht mehr sehen zu müssen.
Ertragen zu müssen.
Mom wechselt einen Blick mit Dad, der sich gerade auf den Beifahrersitz fallen lässt. »Im Notfall drehen wir noch einmal um«, sagt er. »Lass uns losfahren, wir sind ohnehin spät dran.«
Mom beobachtet mich noch einen Moment im Rückspiegel, bevor sie den Rückwärtsgang einlegt und aus der Einfahrt rollt.
Ich kann ein Schnauben nur schwer unterdrücken.
Umdrehen.
Als wäre das an diesem Punkt noch möglich. Wir sind längst darüber hinaus.
Diese ganze Sache ist für sie beschlossen und damit unumkehrbar. Sie ist endgültig.
Als könnte Mom meine finsteren Gedanken lesen, beginnt sie mit ihrer Aufmunterungsrede, noch bevor wir die Rosenbüsche hinter uns gelassen haben. »Es wird nicht so schlimm werden, Raven.«
»Granny freut sich sehr auf dich. Sie redet von nichts anderem«, fügt Dad hinzu und Mom schenkt ihm ein dankbares Lächeln.
»Es ist wirklich schön dort«, wiederholt sie zum hundertsten Mal. »Die Natur, die Menschen, der Freiraum und vor allem diese … Idylle!« Sie macht eine allumfassende Geste und bemüht sich, mich über den Rückspiegel anzustrahlen. Ich ziehe eine Grimasse, die entfernt an ein Lächeln erinnert.
Sie gibt nicht auf: »Du wirst ein eigenes Zimmer haben, das viel größer ist als …«
»Rose …«, wirft Dad ein, der bemerkt haben muss, dass ich erbleicht bin. Mom verschluckt sich, hustet. Dad tätschelt ihr den Rücken.
Ein eigenes Zimmer.
Kein geteiltes mehr.
Nie mehr.
»Es ist das Beste für dich«, flüstert Mom leise und ihre Worte sind wie Messerstiche in mein Herz.
Für wen ist es besser, Mom?
Für mich? Oder für euch?
Dabei kann ich es ihnen nicht einmal verübeln. Ich würde mich auch nicht mehr sehen wollen. Es liegt nicht nur an meinem Gesicht, dass ich gehen muss, ich habe es auch verdient.
Jemand wie ich kann nicht bleiben, auch wenn ich mir nichts sehnlicher wünsche.
Ich meine, ich habe Freunde hier, eine Schule, den Ruderclub, ein Leben. Zumindest das, was davon noch übrig ist. Aber in den letzten Wochen hat all das an Bedeutung verloren. Im Krankenhaus hat mich keiner besucht, die Schule fühlt sich so weit weg, so sinnlos an, und die letzten Wettkämpfe im Rudern habe ich durch meine … Auszeit verpasst. Vielleicht sollte ich traurig sein. Vielleicht sollte ich all das vermissen.
Doch es fällt mir schwer, etwas zu fühlen. Irgendetwas.
Ich weiß noch, wie ich auf dem Bett saß. Nicht auf meinem. Die Therapeutin hatte gerade den Raum verlassen, nachdem sie meinen Eltern gesagt hatte, dass ich so weit wäre, nach Hause zu kommen.
Doch sie hatten andere Pläne.
Mom hat sich zu mir auf die weiße Decke gesetzt und sich bemüht, fröhlich auszusehen. Sie versucht immer noch, fröhlich auszusehen. Doch ich hockte nur da und starrte auf den hellen Streifen, den das rote Plastikarmband an meinem Handgelenk hinterlassen hat. Versuchte, so zu tun, als hätte ich sie nicht gehört. Wollte sie nicht hören. Dabei wusste und weiß ich tief in mir ganz genau, warum sie das vorgeschlagen haben.
Den Neuanfang.
Zuhause erinnert alles an mein altes Leben, und die Freunde, die ich glaubte zu haben, sind eigentlich nicht meine. Sie gehören zu ihr. Genau wie die Bücher, die jetzt in den Kartons stecken, die mit Ravens Zimmer beschriftet wurden.
Roter Edding auf brauner Pappe.
Flammen auf einer Zeltplane.
Es sind ihre Sachen, nicht meine, aber das interessiert nicht mehr. Mir packen sie alles aus dem Zimmer ein, obwohl mir nur die Hälfte gehört. Wenigstens ihr heißgeliebtes Tagebuch ist in Milian geblieben. Ich weiß nicht, ob ich es ertragen könnte, ihre intimsten Gedanken in nächster Nähe zu wissen. Ob ich widerstehen könnte. Oder ob ich jetzt, da sie fort ist, die Grenze überschreiten und einen Blick hineinwerfen würde …
Stattdessen landeten Socken in den Kisten, die Mom nie auseinanderhalten konnte, Bücher, die ich nie lesen würde, Klaviernoten, die ich nicht spielen kann. Sagen konnte ich trotzdem nichts, nicht zu den Kartons, nicht zu dem Vorschlag, der erst einen Tag vorher gemacht wurde und am nächsten schon beschlossene Sache war.
Ich hatte schreien wollen, weinen, schimpfen. Was fiel ihnen ein, das von mir zu verlangen? Ich und wegziehen? Fort von hier? Fort von allem, was mir von ihr geblieben ist?
Ein Zimmer voller Erinnerungen, ein Geruch, der an Pullovern haftet, und ein Lachen, das sich zwischen den hellen Kissen versteckt.
Unser kleiner Vorort ist vielleicht nicht der schönste Ort der Welt, aber er ist mein Zuhause.
Unser Zuhause.
Gewesen.
»Entschuldige«, presst Mom hervor, die auf dem Vordersitz wohl die gleichen Gedanken gehabt hat. Ich kann sehen, wie sich Tränen in ihren Augen sammeln. Der Anblick tut mir weh, ich würde gerne die Hand nach ihr ausstrecken, etwas sagen. Dad tut es, er drückt ihre Schulter fest und Mom gelingt es, das Schluchzen zu unterdrücken.
Ich sitze auf der Rückbank. So nah und doch so fern.
In den letzten Wochen habe ich mich von ihnen entfernt, sodass ich jetzt nicht mehr genau weiß, wie das geht. Ihnen nah sein. Jemandem nah sein.
Mom sagt diese Dinge, redet mir Westworgh schön, den Ort ihrer Kindheit, den Ort, an dem ich fortan leben soll. Dabei werde ich das Gefühl nicht los, dass sie es vor allem sich selbst einreden möchte. Dass es okay ist, mich fortzuschicken. Dass sie keine andere Wahl hätten. Dass es besser sei – für alle.
Neuanfang.
Neun waagerecht, wie in einem von Grannys Kreuzworträtsel.
Ich will nichts Neues, brauche es nicht!
Mein Leben war perfekt. Ich war glücklich.
So
verflucht
glücklich.
Ich schließe die Augen. »Entschuldige«, flüstere ich ebenfalls, so leise, dass Mom es nicht hören kann. Sie tritt das Gaspedal durch und rauscht am Ortsschild vorbei.
Goodbye from Milian.
Ich stecke die Kopfhörer zurück in meine Ohren und drücke auf Play. Vertraute Klänge auf dem Klavier, acht Töne, bevor der Gesang einsetzt.
Nicht ihrer.
Dieses Mal nicht.
Bette Midler übertönt die Stimmen meiner Eltern, ich lehne den Kopf gegen die Scheibe und starre hinaus in die endlose Weite.
Ein Meer aus verblassenden Erinnerungen.
Mein letzter Besuch in Westworgh ist ungefähr Lichtjahre her. Über den Sommer und zu Weihnachten waren wir stets bei Granny, irgendwann jedoch hat Dad begonnen, sie abzuholen und zu uns zu bringen, weil Mom nicht wollte, dass sie sich so viel Arbeit macht.
Verändert hat sich in der Zeit nichts. Westworgh sieht immer noch aus wie Westworgh. Die Westriverbridge, die sich über den gleichnamigen Fluss spannt, ist viel imposanter, als es zum Kaff passen würde. Gleich dahinter werden die Straßen schmal, gesäumt von Bäumen, hinter denen die kleinen Häuschen fast verschwinden. Dichte Wälder schließen auf der anderen Seite das Örtchen ein und dort am Rande wohnt meine Grandma. Um zu ihr zu gelangen, müssen wir einmal mitten durch Westworgh fahren. Es ist ein Sonntagmorgen und kaum etwas los auf den Straßen. Der Fluss, der gemächlich neben uns fließt, funkelt im Sonnenlicht, das für meinen Geschmack viel zu fröhlich wirkt.
Für einen Moment bin ich versucht, das alles nur als kurze Reise abzutun. Als Reise, nach der wir wieder nach Hause zurückkehren. Zurück zu ihr.
Ich verspüre ein brennendes Ziehen und diesen verflucht dummen Hoffnungsfunken, der jedes Mal in mir aufflackert, wenn ich durch unsere Wohnungstür trete, in der absurden Hoffnung, dieses Mal jemanden am Klavier im Wohnzimmer sitzen zu sehen. Oder auf der Couch mit einem Buch in der Hand. Am Tisch. Am Kamin.
Irgendwo.
Und jedes Mal verbrennt es mich ein Stück mehr.
So auch jetzt, als ich zu dem leeren Platz neben mir blicke.
Ein Mädchen mit weißblonden Haaren joggt an uns vorbei und dreht sich neugierig zu uns um. Das fremde Kennzeichen kennzeichnet uns im wahrsten Sinne des Wortes als Eindringlinge, mit Sicherheit weiß in einer halben Stunde ganz Westworgh, dass wir hier sind, woher wir kommen und wie wir heißen. Bevor wir auch nur einen Fuß über die Türschwelle gesetzt haben werden, kennt uns jeder. Mag uns jeder.
Oder eben auch nicht.
So war es schon immer.
Als Mom am Straßenrand parkt, muss ich zweimal hingucken, um mich zu vergewissern, dass wir hier tatsächlich richtig sind. In meiner Erinnerung ist Grannys Haus längst nicht so windschief und heruntergekommen. Ich hatte es mehr als Märchenschloss in Erinnerung: im viktorianischen Stil erbaut, rot mit dunklem Dach und einem kleinen Erker im oberen Stockwerk. Hinterm Haus beginnt der Wald, doch im Gegensatz zu früher wirkt es nun, als wäre er herangerückt, als versucht er, sich das kleine, krumme Haus einzuverleiben. Zweige greifen nach der Regenrinne, Efeu klettert an der Fassade empor, zwängt sich mit seinen langen Fingern in jeden Spalt und jede Ritze. An den Balken, welche die Veranda stützen, taumeln Traumfänger aus Naturmaterialien im Wind.
Damals kam es mir geheimnisvoll und aufregend vor, die Treppe Seite an Seite hinaufzustürmen, um die dunklen Ecken und Geheimnisse des Anwesen zu erkunden. Heute wirkt das Haus unheimlich und seltsam einsam, wie es sich da hinter den Bäumen im Vorgarten verbirgt.
Granny steht auf der dunkelgrünen Veranda und winkt uns entgegen.
Immerhin Granny hat sich nicht verändert: Sie trägt noch ihre geblümten Kleider und diesen hellen Schlapphut mit der riesigen Schleife, der ihr nun vom Kopf weht, als sie auf meine Eltern zueilt.
»Rose!«, ruft sie und rafft ihren flattrigen Rock zusammen, sodass ich einen Blick auf ihre flauschigen Pantoffeln erhaschen kann. »Oh, herrje, mein Hut!«
Dad eilt zu ihr und bietet ihr seinen Arm an, während Granny sich nervös durch die krausen Locken fährt. Die hat sie an Mom vererbt, jedoch nicht an mich. Meine Haare lassen sich eher mit labbrigen Spaghetti vergleichen.
Erleichtert atmet Granny auf, als Mom ihr den Hut reicht. Sie nehmen sich in die Arme. Mit ihrem Blick findet sie mich im Auto und fasst mich ins Visier. Ertappt wende ich meinen ab und ziehe mir langsam die Kopfhörer von den Ohren. Es kommt mir vor, als wäre das Auto der letzte sicherere Ort. Die letzte Grenze zwischen diesem Neustart und meinem alten Leben.
Ich will sie nicht überschreiten, auch wenn ich weiß, dass ich nicht hierbleiben kann.
Nicht in Mom und Dads Wagen.
Nicht in ihrem Leben.
Kaum, dass ich die Autotür geöffnet habe und ins Freie geklettert bin, schießt ein dunkler Schatten aus dem Haus heraus und prescht auf mich zu. Vor Schreck lasse ich meinen Rucksack fallen, als sich im nächsten Moment auch schon zwei mächtige Vorderpfoten auf meine Schultern legen und eine raue Zunge quer durch mein Gesicht schleckt.
»Sprinkles!«, stoße ich hervor und mache mich mühsam von dem gigantischen Pitbull los, zu dem wohl kaum ein Name weniger passt.
»Der Bursche ist ein wenig gewachsen, seit du das letzte Mal hier warst«, bemerkt Granny spitz, doch die Wärme ihrer Augen mildert den Tadel ihrer Worte. Mit ausgebreiteten Armen kommt sie auf mich zu. »Schön, dich zu sehen, Raven«, sagt sie und drückt mich kurz und herzlich, während Sprinkles fröhlich um uns herumspringt und laut bellt. Granny riecht genauso, wie ich sie in Erinnerung habe. Nach Keksen, die sie stets backt, als gäbe es einen olympischen Sieg zu erringen. Nach Erde und Kräutern aus ihrem Garten und irgendwie auch nach Maiglöckchen. Ich glaube, das Parfüm haben wir ihr letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt – und schon wieder krampft sich mein Magen zusammen.
»Jetzt reicht es aber!«, schimpft Granny und bringt Sprinkles dazu, sich brav neben mich zu setzen. Doch kaum, dass sie sich Dad zugewandt hat, stupst mich der Pitbull mit seiner Schnauze in die Seite.
»Du bist echt verflucht groß geworden«, murmele ich und kraule ihm die Ohren. Seine Vorliebe dafür hat sich offenbar nicht geändert. Verstohlen wische ich mir übers Gesicht, als keiner hinsieht. Ich wollte ihn Dodger nennen, aber das ist nicht der einzige Kampf, den ich verloren habe.
»Ich dachte, dir würde das große Gästezimmer im zweiten Stock gefallen.« Granny deutet nach oben. Ich nicke hastig und klammere mich an die abgewetzten Träger meines Rucksacks. Dad hat inzwischen mühelos meinen Koffer aus dem Auto gehoben.
»Ich bringe ihn dir nach oben, wenn …«
»Geht schon«, unterbreche ich ihn etwas zu abrupt und ziehe den Griff mit einem Klicken aus. Fest packe ich ihn. Mehr, um mir selbst Mut zu machen.
»Du musst nur die Treppen hoch und …«
»Ich weiß, wo das Gästezimmer ist, Mom, ich war schon mal hier.«
Ohne auf ihren verletzten Gesichtsausdruck zu achten, rattere ich auf die Haustür zu und wuchte den schwarzen Koffer die Stufen der Veranda hoch. Sprinkles überholt mich schwanzwedelnd, flitzt vor mir die Stufen hinauf, wieder runter und gleich darauf wieder hoch. Himmel, ich wünschte, ich besäße nur halb so viel Energie wie dieser Hund. Er passt wirklich ausgezeichnet zu Granny und hält sie fit, wie Mom stets betont. Jetzt ist sie auffällig still.
»Sei nicht so streng mit dir«, höre ich Granny zu ihr sagen. »Die Falten auf deiner Stirn sind ja bald tiefer als der Grand Canyon!«
»Ich weiß.« Mom seufzt. »Wir müssen das Beste daraus machen.«
Ein wunderbar einstudierter Satz.
Das Beste woraus?, frage ich mich immer. Daraus, dass ich gehen muss, weil niemand, nicht einmal ich selbst, meinen eigenen Anblick erträgt? Oder daraus, was geschehen ist?
Denn wie man daraus irgendetwas Gutes ziehen soll, weiß ich beim besten Willen nicht.
Die Rollen des Koffers stoßen gegen die unterste Treppenstufe. Sie ist zu hoch. Vielleicht hätte ich Dads Hilfe doch annehmen sollen, der Koffer wiegt beinahe so viel wie ich und obwohl er nicht danach aussieht, kann mein Dad einfach alles tragen. Jeder Bodybuilder würde vor Neid erblassen.
Daran, dass er bald nicht mehr für mich da ist wie sonst, werde ich mich gewöhnen müssen.
Ich hieve den Koffer Stufe um Stufe nach oben, am ersten Stock vorbei und die schmale Treppe hinauf bis in den zweiten. Das große Gästezimmer befindet sich am Ende des Ganges. Der dunkelgrüne Teppich verschluckt zuverlässig das Rattern der Rollen. Zu schnell bin ich angekommen und halte inne.
Ich will nicht hinein. Ich will das Zimmer nicht sehen oder gar meine Kleidung in den Schrank hängen. Denn das würde bedeuten, dass ich mich mit diesem ganzen Kram abfinde, auch wenn es das Vernünftigste und schlichtweg Einzige ist, was mir bleibt. Doch bedeutet sich damit abzufinden nicht auch, anzufangen zu vergessen?
Sogar Sprinkles muss bemerken, dass etwas nicht stimmt, denn er drückt seinen Kopf aufmunternd gegen mein Bein. Ich tätschele ihn und straffe die Schultern. Es ist nur eine Tür. Eine Tür zu einem neuen Leben. Eines, das ich nicht will.
Ich stoße sie auf wie ein Tor zu einer anderen Welt.
Durch den größer werdenden Spalt erspähe ich die grünen Fäden eines Teppichs. Meines Teppichs. Dad hat ihn vorige Woche hergebracht, damit ich mich heimisch fühle, wenn ich ankomme. Nun, es funktioniert nicht.
Widerwillig zerre ich den Koffer ins Innere des Raumes.
Das Erste, was mir auffällt, ist der Geruch.
Es riecht nach Leere. Wir haben nie im großen Gästezimmer geschlafen und ich schätze, dass Granny es genau deshalb für mich ausgewählt hat. Damit es keine Erinnerungen gibt. Damit ich neue schaffen kann.
Mein Zimmer.
Der Ausdruck passt nicht zu der dunkelgrün gestrichenen Wand, vor der mein Bett steht. Die schwarzen Bettpfosten sind verschnörkelt, es ist zwar eine Matratze vorhanden, aber das Bettzeug liegt einsam und kahl da und wartet auf einen Bezug.
Die gegenüberliegende Wand wird von einem Bücherregal eingenommen, obwohl ich gar nicht so viel lese. Sie hat viel gelesen. Es sollte ihr Regal sein, nicht meines.
Doch statt ihr bin ich hier.
Dad hat die Kisten mit meinem Namen vor das Regal gestellt. Ich brauche sie nur auszuräumen. Ravens Sachen. Während ihre irgendwo auf dem Speicher daheim verstauben und nie wieder hervorgeholt werden. Sicher hat Mom auch einige meiner Sachen zwischen ihre gepackt, aber ich hatte keine Kraft, um nach ihnen zu suchen. Meine Schaukel aus geflochtenem Seegras hängt von der Decke gleich neben dem Regal. Die dazugehörigen Kissen stecken noch in irgendeiner Kiste. Die Schubladen der uralten Kommode stehen offen – wie hungrige Schlünde, die nur darauf warten, meine Kleider zu verspeisen. Die Bügel, die an der zur Kleiderstange umfunktionierten Holzleiter hängen, klappern trostlos. Das war bestimmt auch Dad. Er mag es, alten Dingen zu einem neuen Leben zu verhelfen. Er hat sich Mühe gegeben, das spüre ich. Er will, dass ich mich hier wohlfühle.
Er will, dass ich bleibe.
Wegbleibe.
Ich habe das Gefühl, als würde mir die Kehle mit jeder Sekunde, die ich hier stehe, enger werden. Ich lasse den Koffer los und zerre am Kragen meines Hoodies. Es ist, als würde mir Rauch den Hals verätzen. Hustend stürze ich durch den Raum und reiße die Fenster des Erkers auf. Ich klettere auf die Sitzbank und lehne mich weit nach draußen, versuche verzweifelt, zu Atem zu kommen.
Nur langsam beruhigt sich mein Puls.
Keuchend wische ich mir den Schweiß von der Stirn, lasse mich gegen den dunklen Fensterrahmen sinken. Sie waren früher weiß, offenbar hat sie jemand gestrichen.
Nicht irgendjemand. Dad.
All das hier war Dad.
Mich überkommt ein schlechtes Gewissen bei dem Gedanken daran, wie oft er in den letzten Wochen hergefahren ist, um alles für mich herzurichten. Um es mir so schön und angenehm und leicht wie möglich zu machen.
Oder ihnen.
Ist das hier für mich, oder um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen?
Ich weiß, dass ich gemein werde, trotzdem sind die fiesen Gedanken da, hämmern in meinem Schädel. Ich will nicht neu anfangen. Weitermachen und damit etwas hinter mir lassen, was nicht in die Vergangenheit gehören sollte.
Was nicht vorbei sein sollte.
Hier ist alles anders, alles neu und kein Platz mehr für sie.
Wegen mir.
Die Vorhänge bauschen sich leicht im aufkommenden Wind und ich greife nach meiner Halskette, reibe über den Anhänger. Atme tief ein. Vier Sekunden. Sieben Sekunden Luft anhalten, dann acht Sekunden ausatmen. Sprinkles folgt mir und legt seinen schweren Schädel in meinen Schoß. Ich kraule ihn, während ich nach draußen blicke und die Atemübung wiederhole. Ich versuche, mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren.
Benenne Dinge, die du sehen kannst.
Ich kann den Wald sehen und die Baumwipfel, die sich im Wind wiegen. Das Gästezimmer – mein Zimmer – liegt auf der Rückseite des Hauses und verschafft mir einen Blick über den gesamten Garten und den anschließenden Wald. Green Darkness nennen sie ihn. Ich weiß, dass die Kinder in diesem Kaff Mutproben veranstalten, wer sich am längsten in die Finsternis zwischen den alten Baumstämmen wagt.
Wir haben das nie gemacht. Ich hatte vor nichts Angst und sie war zu vernünftig. Ich schlucke schwer.
Jetzt habe ich Angst.
Eine Scheißangst, um genau zu sein.
Sprinkles schleckt mir über die Hand, als spürt er genau, dass meine Gedanken abdriften. Er wedelt mit dem Schwanz, wobei er unaufhörlich gegen den Koffer trommelt. Ich verdrehe die Augen. Dieses Tier versteht es genauso subtil wie Granny, auf Dinge hinzuweisen, die ich lieber ausblenden würde.
Aber was nützt es? Ich bin selbst schuld daran.
Also klappe ich den Koffer auf, krempele die Ärmel meines Hoodies hoch und lege los. Vorsichtig hole ich ein Teil nach dem anderen aus ihrem sicheren Kokon. Ich fülle die Kleiderbügel und Schubladen, bestücke das Brett über der Kleiderstange mit Pflanzen, beziehe die Bettwäsche, schüttele Kissen und reiße die Kartons auf, die überall im Zimmer verteilt sind. Mom hat sie akribisch beschriftet und vorsortiert. Schulsachen hier, Deko dort.
Mom ist so sorgsam, wie sie es war. Sie hasst Unordnung.
Ich verteile meine Pflanzenskizzen schön durcheinander auf dem Boden, hebe die heruntergefallenen Ketten nicht auf.
Ganz unten im Koffer liegt ein kleines Päckchen, eingeschlagen in braunes Papier. Es knistert, als ich den Traumfänger daraus befreie. Bei allen anderen Sachen war es mir egal, ob Mom sie einpackt, doch nicht bei ihm. Ich streiche über die rauen Hölzer, die den Rahmen bilden, über die Gräser, mit denen sie zusammengebunden wurden. Der getrocknete Lavendel verbreitet einen beruhigenden Duft, die klaren Kristalle, die unter dem Rahmen hängen, klirren tröstlich. In den Ring hat Cara feine Fäden gewebt, die ein verschlungenes Muster bilden.
Den habe ich für dich gebastelt. Er soll dich beschützen, hat sie gesagt, als sie ihn mir in die Hände gedrückt hat.
Vor was?
Albträumen. Trag ihn immer bei dir und sie können dir nichts anhaben.
»Lügnerin«, stoße ich hervor. Selbst Traumfänger verlieren ihre Kraft. Ich hänge ihn dennoch über mein Bett, so wie früher. Auch wenn er nicht mehr dieselbe Wirkung hat, ist er doch mein wertvollstes Geschenk.
Inzwischen ist mir warm geworden und ich zerre mir den Pulli über den Kopf. Dabei rutscht das Shirt darunter nach oben und ein schwarzer Fleck erregt meine Aufmerksamkeit im Spiegel. Ich blicke an mir herunter, habe tatsächlich vergessen, dass nun dunkle Tinte auf meinen Rippen prangt. Gedankenverloren streiche ich über den Strauß aus Ringelblumen und sehe sie vor mir, bilde mir ein, ihren sanften Duft zu riechen.
Alle sagen, ein Tattoo auf den Rippen tue unfassbar weh. Ich habe es kaum gespürt. Vielleicht, weil da dieser andere Schmerz ist, der mich seit Wochen lähmt. Er lässt keinen anderen zu. Er tat es auch dann nicht, als ich es mit einer Schlange auf der Wirbelsäule probierte. Da war nur Druck, ein stetiges Ziehen, während ich mit leerem Blick auf das schwarze Leder der Liege starrte und dem Tätowierer nicht antwortete, der sich um Small Talk bemühte.
Ich wollte etwas fühlen, nicht reden.
Ich will es immer noch. So sehr.
»Ich habe deinen Dad gebeten, meinen alten Schminktisch hier reinzurücken. Ein schmuckes kleines Ding, nicht wahr?«
Granny ist in der Tür aufgetaucht und ich reiße den Kopf hoch, habe sie nicht kommen hören. Sie lächelt und deutet auf den altmodischen Tisch aus dunklem Zedernholz. Die Farbe, mit der rote, rosafarbene und orange Blüten auf seine geschwungenen Füße gemalt wurden, ist inzwischen verblasst und der Spiegel auf ihm fleckig.
Granny kommt zu mir herein und zieht eine der Schubladen auf. »Er meinte, das Ding sei zu wuchtig und kaum über den Flur zu kriegen. Pah! Mit der Ausrede braucht er mir nicht kommen. Hier drin kannst du wunderbar deine kostbaren Schätze aufbewahren. Genau das, was dieses Zimmer noch brauchte.« Sie sieht mich an und ich kann ihrem Blick nicht lange standhalten. »Es gibt noch immer kostbare Dinge für dich, Raven«, sagt sie sanft. »Allen voran dein Leben.«
Ich denke erneut an die Ringelblumen auf meinen Rippen und frage mich, wie ich aus den Scherben noch ein Leben basteln soll.
»Du musst es versuchen«, sagt Granny und drückt meine Schulter. Auf eine zuversichtliche Art und Weise?
Raven
Mom stößt einen Schrei aus. Ein durchdringendes Hupen ist die Antwort.
Müde reibe ich mir die Augen, die ich während der Nacht kaum länger als fünf Minuten geschlossen habe. Ich werfe dem Traumfänger einen verächtlichen Blick zu.
Wann immer ich glaubte, endlich in die dunklen Tiefen hinabzugleiten, rissen mich das Knistern des Feuers und die Hitze der Funken wieder aus dem Schlaf. So ist es seit Wochen. Keine Nacht vergeht, in der ich nicht spüre, wie die Flammen meine Haut verätzen und der Rauch mir die Kehle zuschnürt, bis ich hustend erwache. Im dämmrigen Schein meiner Nachttischlampe kann ich sie vertreiben, die Panik und die Schuld, doch kaum lösche ich das Licht, sind sie zurück. Ich höre das unheilvolle Knacken der Zeltstangen und die Flammen tanzen am Rande meines Bewusstseins. Daran ändert auch das Melatonin nichts, das ich seit einiger Zeit schlucke.
Insofern erwarte ich das erste Morgengrauen nach jeder durchschwitzten Nacht sehnsüchtig, damit ich weiß, dass es vorbei ist. Wer braucht schon Schlaf?
Ich hätte ich mir dennoch einen Wecker stellen sollen, um an meinem ersten Schultag an der Westriverhigh nicht gleich zu spät zu kommen. Sie hätte das getan. Einen Wecker gestellt. Wäre eine halbe Stunde vorm Klingeln aufgestanden und hätte ihre Haare sorgsam geflochten, die bereits herausgelegten und gebügelten Sachen angezogen, während ich nie auch nur eine Sekunde eher als nötig aufstehe.
»Raven! Du liegst noch im Bett?«, ruft Mom aus, als sie einen Wimpernschlag später den Kopf zur Tür reinstreckt.
Ich grummele unverständlich.
»Ich wusste es! Ich wusste, ich hätte dich wecken sollen!« Sie wuselt quer durch den Raum, zieht meine Kommode auf und kramt darin herum.
»Mom, ich kann mir meine Klamotten selbst holen, seit ich fünf bin.« Ich gähne und zerre mir die Decke über den Kopf, nur damit Mom sie gleich darauf wieder herunterreißt.
»Wenn du selbst entscheiden willst, was du anziehst, dann bist du besser in drei Sekunden auf den Beinen. Ich mache unten Sandwiches. Hast du deine Tasche schon gepackt?«
»Ich weiß nicht mal, in welcher Kiste die ist.«
Mom wird blass.
Im nächsten Moment gibt es unten einen lauten Knall und sie wirbelt herum. »Himmel, Mutter bitte! Ich sagte, ich kann Raven auch fahren, dieses Auto schafft es nicht einmal mehr bis zum Bäcker!«, wettert sie, während sie aus dem Zimmer eilt. Von draußen brüllt Granny etwas und ich nutze die Gelegenheit, um mir erneut meine Decke zu schnappen. Ich hasse aufstehen. Selbst ohne die verfluchten Albträume habe ich es gehasst.
Nur widerwillig quäle ich mich aus dem Bett und schleppe mich ins Bad. Missmutig starre ich mein Spiegelbild an. Tiefe Augenringe, zerknittertes Gesicht, abstehende, wirre Haare.
Jep, Westworgh wird mich lieben.
Notdürftig versuche ich, Make-up aufzutragen, doch es ändert nicht viel. Die Narbe an meinem Kinn bleibt dunkel, die Haut am Hals fleckig. Trotz strahlenden Sonnenscheins wähle ich ein schwarzes Printshirt, denn die neue Haut an meinem Oberarm und der Schulter ist noch immer zu empfindlich für direkte Lichteinstrahlung. Die Ärmel meines geliebten Netzoberteils darunter sind lang genug, um meine Hände mit den Narben zu verbergen und mit der lockeren Cargohose fühle ich mich wohl genug, um den ersten Schultag zu meistern.
Unten herrscht helle Aufregung. Offenbar springt Grannys Auto nicht an, dennoch weigert sie sich partout, Mom fahren zu lassen, und redet irgendetwas von Tradition, gutem Start und Abkürzungen, die sie allein kenne. Auf der Anrichte steht ein Teller mit Sandwiches und ich schiebe mir eines zur Hälfte in den Mund, während ich eine bunt bemalte Keramiktasse aus Grannys Küchenschränken angele und mir einen Tee aufgieße. Mom kommt durch die Seitentür gerauscht, die Haare wild vom Kopf abstehend und einen schwarzen Fleck auf der Wange. Die Holzdielen knarren unter ihren Gummistiefeln, in die sie wohl nur hastig gesprungen ist.
»Bist du fertig, Raven?« Sie greift nach der Kaffeekanne und schenkt sich eine Tasse ein. Ihrem wilden Blick nach zu urteilen, hat sie das Koffein dringend nötig. Sprinkles sprintet in die Küche und springt meine Mutter so stürmisch an, dass sie ihren Kaffee vor lauter Schreck auf der Arbeitsplatte verteilt.
»Dreifacher Krötendreck!«, ruft sie. Der Wasserkocher hinter mir blubbert hoch, obwohl ich ihn ausgestellt habe. Mom wischt mit einem Tuch hektisch über die Platte und alle Flüssigkeit verschwindet. »Hast du die Sandwiches eingepackt? Und etwas zu trinken? Ich habe eine neue Thermoskanne für deinen Tee und …«
»Ich hab alles, danke.«
»Okay. Okay gut.«
Sie meidet meinen Blick erneut.
Granny hatte darauf bestanden, dass sie und Dad über Nacht bleiben und erst heute fahren. Mein Herz wird schwer: Sie können zurück.
Ich nicht.
Und so wie es aussieht, will Mom absolut sichergehen, dass ich pünktlich in der Schule lande, damit ich ihnen auf keinen Fall folgen kann.
Einen Moment lag herrscht unangenehmes Schweigen zwischen uns. Der Tee in meiner Tasse schmeckt fad.
»Raven …« Das eine Wort vibriert in der Luft zwischen uns. Von der Hektik von vorhin ist nichts mehr übrig, jetzt ist alles zäh und schwer. Mom streckt zaghaft die Hand nach mir aus. »Wir mussten das tun«, flüstert sie und ich sehe, spüre, dass auch sie leidet.
Genau das ist es ja, was mich so fertig macht.
Ich bin der Grund dafür.
»Klar«, sage ich nur und trete zurück. Moms Hand hängt unberührt in der Luft zwischen uns. Wie gerne würde ich sie nehmen, wie gerne von ihr in den Arm genommen werden. Doch wie könnte ich das von ihr verlangen? Ihr Trost steht mir nicht zu, da ich schuld an ihrem Leid bin.
Dad erscheint in der Tür.
»Ich habe Hyazinths Wagen zum Laufen gekriegt und von uns alles gepackt, wir können los.« Er berührt meinen Arm, doch ich entziehe mich ihm.
»Ich hoffe, ihr kommt gut nach Hause«, presse ich hervor und schnappe mir den Jutebeutel, den ich auf die Schnelle gefunden und mit ein paar Schulsachen bestückt habe, bevor ich nach draußen verschwinde.
Moms leises Schluchzen verfolgt mich.
»Es ist das Beste für sie, Rose«, höre ich meinen Vater sagen. Ich dränge die Tränen mit aller Kraft zurück. Ich darf nicht weinen. Nicht an meinem ersten Schultag. Das würde alles nur noch schlimmer machen.
Auf dem Hof steht Granny neben einem Ungetüm, das sie Auto schimpft. Nein, halt – Lady Anne ist der Name, den sie dafür verwendet.
Ihre alte rostige Klapperkiste hat die besten Jahre zweifelsohne hinter sich, jedes Teil wurde mindestens schon einmal ausgetauscht, sodass die einzelnen Rottöne gar nicht mehr zueinander passen, ein Seitenspiegel fehlt.
»Schnurrt wie ein Kätzchen«, verkündet Granny zufrieden und klettert in den Wagen. Mit Schwung drückt sie die Beifahrertür auf, die gefährlich schwankt und beinahe aus den Angeln kippt.
»Steig ein Raven, sonst kommen wir zu spät!«
Ich bin längst über den Punkt hinaus, an dem mich so was schockieren würde. Nicht bei Granny.
Deshalb lasse ich mich auf den ausgeblichenen Ledersitz plumpsen, der eindeutig schon bessere Tage erlebt hat. Da düst Granny auch schon los – eine gigantische schwarze Wolke stiebt aus dem Auspuff. Sie schlingert vom Grundstück, verfehlt den gusseisernen Zaun um Haaresbreite, genau wie den protzigen dunklen Wagen, der an der Straße vorbeirauscht, woraufhin sie lediglich mit den Augen rollt.
»Wenn der Junge von den Parkers nur halb so gut fahren könnte, wie er aussieht, wäre Westworgh ein ganzes Stück weniger gefährlich!«
Granny gibt ein spektakulär skurriles Bild ab, wie sie da auf ihrem geblümten Sitzkissen den Hals reckt, um mit Müh und Not über das Lenkrad zu spähen. Das Duftsäckchen mit Kräutern, das ich ihr vor Jahren zum Geburtstag geschenkt habe, baumelt dabei nur knapp über dem letzten pinken Lockenwickler, den sie wohl in ihrem Haar vergessen hat.
»Was denn?«, will sie wissen, als sie meinen Blick bemerkt. »Hier läuft alles ein bisschen anders, Raven, Schätzchen. Wenn du dich auf den Straßen behaupten willst, dann musst du fahren.«
Ich kenne wirklich niemanden, der so fährt wie Granny. Oder einen Wagen, der sich fahren lässt wie dieser und ich frage mich, was an Lady Anne überhaupt noch vollständig intakt ist.
Oder je war.
Ich schalte das Radio ein. Rauschen und Knacken sind die Antwort, sodass ich es fluchend wieder abstelle.
»Du wirst dich wohl mit mir unterhalten müssen.« Granny reckt den Hals. »Was sagst du zum Wetter? Ich spüre es ganz deutlich, wir bekommen bald Minusgrade!«
»Es ist Herbst, Granny.« Ich klammere mich unauffällig an den Türgriff, als sie um die nächste Kurve schlingert.
Ich bin erleichtert, als wir den Schulhof erreichen. Granny rast geradewegs durch die größte aller Pfützen und bringt Lady Anne zum Stehen, die eine rußige Abgaswolke ausstößt. Der Motor ächzt, als er abgewürgt wird.
Durch die Windschutzscheibe sehe ich die vielen verwirrten Gesichter, nahezu alle Köpfe fliegen gleichzeitig herum. Ein Mädchen mit braunen Haaren steht direkt neben der Fahrertür und blickt ziemlich säuerlich drein. Sie ist pitschnass und hat das ganz offensichtlich Granny zu verdanken.
»Bis dann«, murmle ich, bevor ich meinen Jutebeutel ergreife und aus dem Auto flüchte, ehe es unter meinem Hintern in seine Einzelteile zerfallen kann.
»Soll ich dich später wieder abholen, Schätzchen?«
Ich schlage die Tür etwas zu heftig zu. »Nein, danke.«
»Na gut, dann ganz viel Spaß!« Granny rauscht davon, vereinzeltes Gekicher von links und rechts bleibt mit mir zurück. Eine Gruppe von Mädchen mit kurzen Kleidchen, die hinter der Brünetten stehen, sehen mich mit unverhohlener Neugierde an.
»Gibt’s ein Problem?«, fahre ich sie ungehalten an.
Die Brünette kräuselt die Nase. »Oh, wie soll ich sagen – deine Grandma hat gerade mein Gucci-Kleid ruiniert. Vermutlich sagt dir das nichts«, sie mustert mich abschätzig, »aber das Ding war ziemlich teuer!«
»Ehrlich? Dafür sieht es aber ziemlich billig aus«, kontere ich sofort.
»Wie bitte?!«
Ich verdrehe die Augen. »Es ist nur Wasser! Mach nicht so einen Stress.«
Das Mädchen schnappt nach Luft. »Wenn du wüsstest …«
Herausfordernd recke ich das Kinn. »Was denn?«
Los, sag etwas, denke ich. Leg dich mit mir an. Sorg dafür, dass ich an irgendetwas anderes denke, etwas anderes fühle. Wenigstens Wut.
Aber sie schnaubt nur und dreht mir den Rücken zu.
Missmutig stapfe ich weiter. Mitten über den Schulhof. Mitten durch die Traube von Schülerinnen und Schülern, die sich seit Jahren kennen.
Mitten in ihrem Leben.
Ich erwidere jeden Augenkontakt herausfordernd.
Beim Klingeln zerstreut sich die Masse, zähflüssig wie zerlaufender Zuckerguss.
»Schätzchen! Hast du denn auch Mathe gemacht?«, äfft jemand die Stimme meiner Granny nach, gefolgt von allerlei dummen Aufforderungen. Ich solle meine Schuhe binden, an Mathe denken und ja artig sein. Schallendes Gelächter folgt. Wütend stoße ich einen Jungen mit der Schulter zur Seite, der mir den Weg versperrt.
»Wow, da versteht jemand wohl null Spaß!«
Ja, weil ihr alle auch total witzig seid!
»Ist die neu hier?«, fragt ein anderer.
»Also ich habe sie noch nie gesehen.«
»Guck mal die Haare an …«
»Ist das ein Piercing in ihrer Nase?«
»Was ist mit ihrem Hals los?«
»Wieso kommt sie nicht früher?«
»Wollte sie wahrscheinlich, aber die Klapperkiste hat zu lange gebraucht!«
»Hahahahaha!«
Ich presse die Lippen aufeinander. So viel zum Thema Neuanfang und Anschluss finden.
Scheiß auf Anschluss, denke ich, als ich mir einen Weg zum Sekretariat bahne. Was will ich mit solchen Leuten zu tun haben, die es nicht einmal ertragen, dass ich ein Septum besitze?
Sie flüstern und glauben, sie wären leise genug, aber ich habe alles mitbekommen.
»Raven Ava Moore, richtig?«
Ich nicke der Sekretärin zu und stecke mir einen Kaugummi in den Mund. Dabei fällt mir ein, dass ich vergessen habe, meine Tabletten zu nehmen, und ich fluche innerlich.
»Sehr schön, das ist dein Stundenplan und hier ist ein Plan der Schule. Du hast jetzt Englisch bei Mrs. Wood in Raum 20.«
Ich nehme die Pläne wortlos entgegen und pralle beinahe mit der weißhaarigen Joggerin von gestern zusammen, die hereinstürmt. Sie bricht in hastige Entschuldigungen aus, bei denen ich abwinke, dann trotte ich durch die mittlerweile menschenleeren Gänge zu Raum 20.
Siebenundzwanzig Köpfe schnellen gleichzeitig zu mir herum, als ich die Tür öffne. Mit einem Mal ist es totenstill im Raum. Natürlich. Was könnte ungewöhnlicher sein als eine neue Mitschülerin? Ich erwidere die Blicke herausfordernd.
Vor allem den von der Brünetten, die in der ersten Reihe sitzt. Sie tupft ihr Kleidchen mit einem Papiertuch trocken und funkelt mich feindselig an.
»Du kommst zu spät!«, schnarrt die Lehrerin mit der schief sitzenden Brille. Sie hat etwas von einem Maulwurf, ihre Nase ist beinahe unheimlich spitz und die winzigen Augen kneift sie zusammen, sodass sie praktisch gar nicht da sind.
»Sorry.« Meine Schritte quietschen auf dem Boden und alle Blicke folgen mir, wie ich den Mittelgang durchquere. Ich starre geradeaus und steuere auf den leeren Platz in der vorletzten Reihe zu. Das schwarzhaarige Mädchen links daneben ist die Einzige, die mir keinen abschätzigen, sondern eher mitfühlenden Blick aus eigenartig dunklen Augen zuwirft.
»Ich hoffe sehr, das kommt nicht noch einmal vor!«, zischt Frau Maulwurf, rückt ihre Brille zurecht und blinzelt kurz auf eine Notiz auf ihrem Pult. »Miss Moore.«
Mit verschränkten Armen sitze ich da, weil ich nicht weiß, was ich sonst mit ihnen machen soll. Ich hasse es, wie sie mich alle anstarren.
»Würdest du dich bitte kurz vorstellen?«
»Hier haben doch anscheinend eh schon alle eine Meinung von mir.« Ich lasse eine Kaugummiblase geräuschvoll platzen. Frau Maulwurf bläht die Nasenflügel.
»Na, dann wäre das ja eine wunderbare Gelegenheit, um zu verhindern, dass sich der erste Eindruck verhärtet.«
»Sie meinen, weil mich jetzt schon keiner leiden kann?«
Ich weiß nicht genau, wieso ich das sage. Doch, eigentlich weiß ich es ganz genau. Seit einigen Wochen provoziere ich Streit, wo ich nur kann. Um etwas zu fühlen, Wut, vielleicht sogar Angst. Ganz egal was, irgendein Gefühl.
Nur nicht Schmerz.
Aber Frau Maulwurf tut mir den Gefallen nicht. Sie deutet nur neben sich. »Komm bitte her und stell dich vor.«
Bitte.
Betont langsam gehe ich zu ihr, drehe mich zur Klasse. Schweige absichtlich.
»Erzähl einfach, woher du kommst und warum du hier bist. Es kommt selten vor, dass jemand nach Westworgh zieht.«
Ach tatsächlich? Und das bei alldem, was dieses Kaff zu bieten hat?
»Colorado«, presse ich hervor. »Ich komme aus Colorado.« Ich will es dabei belassen, auch wenn ich weiß, dass sie das nicht zulassen wird. Warum muss ich es erzählen? Was geht es andere an? Nichts und dennoch quetschen sie es aus mir heraus. Die Therapeutin, der Arzt, unsere Nachbarn.
Als müsste ich es sagen, um es realisieren zu können.
Das habe ich. Es ist bloß scheiße.
»Warum bist du hergezogen?«, meldet sich die Brünette in der ersten Reihe mit scheinheiligem Lächeln.
»Meine Eltern hielten das für eine gute Idee.«
»Wohnst du ernsthaft in der alten Geistervilla?«, spottet sie.
»Bei der Verrückten«, flüstert jemand weiter hinten.
»Bei Granny«, sage ich stoisch.
»Teilt ihr euch auch die Lockenwickler?«
Ich funkle die Brünette an, was sie mit einem frechen Grinsen quittiert. »Beißt sich ein bisschen mit deinen Haaren. Aber du hast ja schon bewiesen, dass du keine Ahnung von Mode hast«
»Ruhe!«
Natürlich schafft es Frau Maulwurf nicht, der allgemeinen Tuschelei Einhalt zu gebieten. Im Gegenteil.
Die Brünette redet sich erst richtig in Rage. »Raven, was ist das überhaupt für ein Name? Hattest du Rabeneltern oder wie?« Sie lacht und die Klasse mit ihr.
»Na ja, wenn sie herzuziehen für eine gute Idee halten …«, höhnt jemand. »Die müssen dich ja richtig gernhaben.«
Mein wunder Punkt. Ich koche über, die Brandnarben an meinem Hals jucken, die neue Haut an Arm und Schulter prickelt hitzig.
»Du willst wissen, warum ich hergezogen bin?«, frage ich die Brünette herausfordernd, die nur spöttisch eine Braue hebt.
Der Satz klettert meinen Hals hinauf und klebt an meinem Gaumen. Das Feuer hat unlängst meinen gesamten Körper in Brand gesteckt und brennt in mir wie die verfluchten Tränen in meinen Augen. Alles in mir zieht sich zusammen. Die Worte zittern in dem zarten Lufthauch, der durch das Fenster weht.
»Meine Zwillingsschwester ist gestorben.«
Stille.
Selbst der Brünetten klappt der Mund zu.
»Es ist inzwischen fünf Wochen her, aber es fühlt sich immer noch verdammt beschissen an, so unter uns.« Ich spüre das Brennen in meiner Brust, die Hitze auf meinen Wangen. »Also danke. Danke für den herzlichen Empfang.«
Ich lächele sarkastisch, während der Schmerz in mir alles andere niederbrennt.
Ich hasse Westworgh. Ich hasse dieses beschissene Kaff so sehr, genauso wie dich, Cara! Denn nur wegen dir muss ich hier sein.
Ohne dich.
Nein, wegen mir. Denn ich weiß, dass ich schuld daran bin, dass sie gestorben ist.
Und das ist das Schlimmste.
Mein Herz rast, schnell und schneller, je stärker ich versuche, mich zu beruhigen. Da ist Rauch in meiner Kehle, Schweiß auf meiner Stirn. Meine Kehle zieht sich zusammen und ich kann nicht atmen, brauche Luft, Luft, Luft.
Brauche Cara.
Bin allein.
Meine Knie zittern, meine Augen brennen. Der Klassenraum verschwimmt um mich herum.
Ich mache eine Kehrtwende, stürze auf den Flur. Es ist mir gleich, was sie denken. Der Boden unter mir schwankt, ich muss mich an den Spinden abstützen. Mein Körper wird von einem Krampf geschüttelt, ich habe ihn nicht unter Kontrolle. Alles zittert, ich kann mich nicht zusammenhalten.
Kopflos stolpere ich vorwärts, finde wie durch ein Wunder die Toiletten, reiße die erstbeste Kabine auf. Meine Beine geben unter mir nach und ich erbreche gequält mein karges Frühstück. Wieder und wieder krampft sich mein Magen schmerzhaft zusammen. Selbst, als nichts mehr übrig ist, muss ich noch würgen. Mein Innerstes steht in Flammen. Ich huste, bekomme keine Luft, die Kehle schnürt sich mir zu. Panisch kralle ich mich an der kühlen Keramikschüssel fest, eiskalter Schweiß bedeckt meine erhitzte Haut und meine Finger beben.
Ich kenne das, habe es schon so oft mitgemacht. Die Hitze, das Feuer, der Rauch, der sich in meiner Lunge festsetzt und mich würgen lässt, obwohl er gar nicht da ist. Obwohl ich in einem schäbigen Schulklo kauere und atmen könnte, doch es will mir nicht gelingen. Mein Hals kratzt, meine Haut fühlt sich unerträglich heiß an und meine Augen tränen. Als wäre ich wieder mittendrin, im Feuer, das sich glühend heiß und unerbittlich auf mich zu frisst. Doch ich entkomme, während sie den Flammen zum Opfer fällt.
Es ist nicht das erste Mal und dennoch brauche ich unendlich lange, bis ich mich beruhigen kann. Bis mein Körper begriffen hat, was mein Verstand ihm zubrüllen will.
Es ist nicht echt! Nicht hier!
Nicht mehr.
Ich greife nach der Kette, klammere mich an sie. Meine Finger streifen die Brandnarben an meinem Hals.
Sie werden mich immer daran erinnern, was geschehen ist.
Als bräuchte ich noch mehr Erinnerungen.
Ich erhebe mich schwankend, spüle ab und stolpere in den Vorraum mit den Waschbecken, um mir den Mund auszuspülen und eiskaltes Wasser über meine Handgelenke laufen zu lassen. Doch ganz gleich, was ich versuche, mir ist unerträglich heiß, mein Puls rast und mein Herz hämmert.
Schwer atmend stütze ich mich am Waschbeckenrand ab, presse meine Stirn gegen das kühle Glas des Spiegels.
Was für ein Auftritt. Gut gemacht, Raven.
Ich will nur noch von hier verschwinden. Der Klasse erneut unter die Augen zu treten, kommt jedenfalls nicht in Frage. Vielleicht tut es ihnen leid – zumindest für die nächste halbe Stunde.
Doch ihre mitleidigen Blicke, was bringen die mir? Am besten fangen sie noch an zu reden.
Es tut mir ja so leid.
Ich bin sicher, sie ist jetzt an einem besseren Ort.
Wenigstens hattet ihr diese gemeinsame Zeit.
Was für ein Bullshit! Ich würde jedem, der mir diese beschissenen Worte in letzter Zeit gesagt hat, am liebsten die Zunge rausreißen, denn sie machen nichts, aber auch gar nichts besser!
Warum gibt es dafür keinen Schalter?
Es tut nur weh. So entsetzlich weh.
Gleichzeitig kommt es mir vor, als dürfte ich nicht aufhören, den Schmerz zu spüren. Zu leiden, um nicht zu vergessen, dass sie echt war. Denn wenn ich erst anfange, sie zu vergessen, was bleibt mir dann noch?
Ein Schluchzen dringt aus meiner Kehle hervor.
Ich liebe Cara.
Meine Zwillingsschwester. Meine einzige Schwester.
Gott, wie sehr ich sie liebe.
Wir haben alles geteilt, unsere Freunde, unser Zimmer, unser Leben, auch wenn wir unterschiedlicher nicht sein konnten.
Cara war perfekt. Nicht weniger als das und jeder, der sie kennenlernen durfte, wusste es vom ersten Moment an.
Sie war wunderschön mit ihren erdbeerblonden Halblocken, den feinen Sommersprossen auf ihrer niedlichen Stubsnase und den großen dunklen Augen.
Sie war freundlich, verlor nie ein böses Wort und sie war unglaublich intelligent. Ihren ersten Mathewettbewerb gewann sie mit fünf. In ihrem Regal türmten sich die Trophäen, Auszeichnungen und Medaillen. Dad fuhr andauernd mit ihr zu Wettkämpfen, brachte sie zu all ihren außerschulischen Aktivitäten. Dem Chor. Dem Veranstaltungsteam. Der Nachhilfe, die sie gab.
Mom sagte oft, dass wir einander wie die Sterne gleichen würden, doch das ist völliger Schwachsinn.
Wir sind wie die Sonne und der Mond.
Sie mit ihrem gleißend hellen, wunderbar wärmenden Licht und ich, ein kleiner Trabant, der in ihrem Schein leuchten darf.
Cara liebte Himmelskörper, besonders den Nachthimmel. Ihre Zimmerhälfte war voll davon, mit Zeichnungen vom Mond, den Sternen und diesem seltsamen Pentagramm, das einem fünfzackigen Stern ähnelt. Ich weiß nicht, was Cara so an dem Mond und seinen Gefährten faszinierte. Manchmal haben wir stundenlang dagesessen und die Sterne beobachtet.
Vor der Welt war Cara all das: Die schöne, freundliche, engagierte und überaus talentierte Cara Lynn Moore. Doch nicht vor mir. Wenn wir zusammen waren, war sie nur eines:
Meine Zwillingsschwester.
Vielleicht hatte Mom doch recht. In Caras Gegenwart fühlte ich mich nicht wie der kleine Mond. Wir waren beide Sterne, die für sich leuchteten und erst gemeinsam ein Bild ergaben.
Bis das Bild zerfallen ist.
Einfach so.
Verbrannt in jener Nacht, vor den Felsen, unter ihrem heißgeliebten Sternenhimmel.
Wegen mir.
Ich bin im Krankenhaus erwacht, den Kopf verbunden, eine Platzwunde. Man leuchtete mir in die Augen, redete von Gehirnerschütterung, schweren Verbrennungen und dem unglaublichen Glück, überhaupt überlebt zu haben.
Überlebt. Ich habe meine Schwester überlebt.
Konnte nicht einmal bei ihrer Beerdigung sein, weil ich noch im Krankenhaus lag.
In meinen dunkelsten Stunden frage ich mich, was geschehen wäre, wenn ich in dem Feuer umgekommen wäre, nicht sie. Wenn sie nun hier wäre, in Westworgh.
Wäre es anders?
Hätte sie es schaffen sollen, nicht ich?
Wären Mom und Dad weniger traurig?
Ich kann mich nicht gegen die Finsternis wehren, die mehr und mehr von mir Besitz ergreift.
Man sagt, dass Zwillinge spüren, wenn dem anderen etwas zustößt. Man sagt, dass es die besondere Verbindung zwischen ihnen ist.
Doch ich habe nichts gespürt.
Was mir blieb, war ein dumpfer, dunkler Schmerz.
»Hey, das ist mein Klo!«
Raven
Ich reiße den Kopf hoch und taumele von dem kalten Spiegelglas zurück. Nach dem Fiasko von eben kann ich gut darauf verzichten, dass mich jemand in diesem Moment der Schwäche sieht.
Allerdings ist das Mädchen vor mir sicher nicht in der Klasse von vorhin gewesen. Sie wäre mir im Gedächtnis geblieben:
Alles an ihr ist dunkelrot. Der knallenge Minirock, die Korsage, die Lederjacke. Ihre roten Nägel sind wie Feuer, das über ihre Finger tanzt. Sie verzieht die grell rot nachgezogenen Lippen zu einem breiten Grinsen, streicht ihre langen Haare zurück. Die sind pechschwarz, weshalb all das Rot nur noch stärker leuchtet.
»Ich flipp aus.« Sie strahlt, als wäre diese Begegnung das Beste, was ihr passieren konnte. »Raven Moore?« Sie mustert mich von oben bis unten, bevor ihr Grinsen noch breiter wird. Sie macht dem Joker gefährlich Konkurrenz damit und ich blinzele perplex.
»Ähm, jep?« Wow, hat es sich so schnell rumgesprochen, dass eine der Neuen diesen Namen trägt und heulend aus der Klasse gerannt ist, um sich auf dem Klo zu verstecken?
Wunderbar.
»Wie cool ist das denn?« Sie hat den Raum mit zwei Schritten ihrer endlos langen Beine durchquert, um mich kurz und überschwänglich an sich zu drücken. Hastig trete ich zurück, sobald sie ihren Klammergriff gelockert hat. Ich war noch nie sonderlich gut in Umarmungen und in letzter Zeit wollten die Menschen mich ständig in den Arm nehmen. Sie fragen nie, ob das für mich okay ist, ob ich das möchte oder ob es mir in dem Moment guttun würde.
Tat es nie. Aber das spielt wohl keine Rolle.
»Sorry, kennen wir uns?«
»Indirekt.« Über ihr Gesicht huscht ein eigenartiger Ausdruck, der Moment ist jedoch genauso schnell vorbei, wie er gekommen ist. Vermutlich bin ich einfach zu benebelt.
Das Mädchen fummelt eine Zigarette aus dem roten Etui in ihrer Tasche und steckt sie sich in den Mund. »Ich bin Kiana«, nuschelt sie. »Crazy Name, ich weiß. Meine Mom fand ihn schön, sie steht auf so ausgefallene Sachen.« Es klickt mehrfach, als sie versucht, die Zigarette anzuzünden. Wie hypnotisiert starre ich die tanzende Flamme an und mein Magen verkrampft sich.
»Ähm …«, mache ich erneut. Toll, Raven, kannst du auch noch etwas anderes sagen?