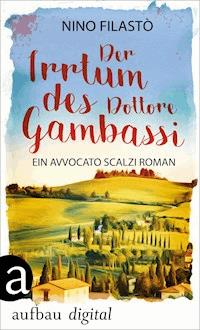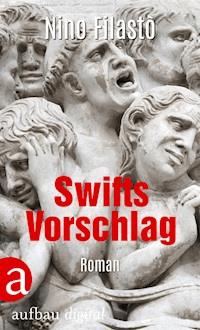Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Avvocato Scalzi ermittelt
- Sprache: Deutsch
Avvocato Scalzis vierter Fall.
Pisa, Anfang der 70er Jahre. Der Wirt einer heruntergekommenen Trattoria wird ermordet aufgefunden. Die Schuldigen scheinen schnell ausgemacht: Witwe und Tochter des Ermordeten sollen sich des krankhaft eifersüchtigen Trunkenbolds entledigt haben. Doch der Florentiner Anwalt Corrado Scalzi, der die Verteidigung der beiden Frauen übernommen hat, ist von ihrer Unschuld überzeugt. Zu viele Lücken in der Beweisaufnahme, zu viele Unstimmigkeiten deuten darauf hin, dass die Frauen geopfert werden sollen, um kriminelle Machenschaften weit größeren Ausmaßes zu vertuschen ...
Der Leser darf sich darauf freuen, einem ungleichen Paar wiederzubegegnen -Scalzi, dem "melancholischen Aufklärer" (FAZ), mit einem Faible für die toskanische Küche, und seiner lebhaften Begleiterin Olimpia, deren Intuition seiner Erkenntnis nicht selten eine Nasenlänge voraus ist.
"Filastòs Können besteht darin, egal ob es sich um Mafia-Intrigen, um Morde an Transsexuellen oder um Kunstfälschungen handelt, seine Texte nicht nur mit den unabdingbaren Spannungselementen auszustatten, sondern gleichzeitig einen subtilen Blick auf die menschlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse Italiens zu werfen." Hamburger Abendblatt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über Nino Filastò
Nino Filastò, geb. 1938, lebt in Florenz als Rechtsanwalt. In der literarischen Tradition von Leonardo Sciascia schreibt er Romane um die Figur des Anwalts Corrado Scalzi, in denen eine kriminalistische Fabel immer auch zum Instrument der Gesellschaftskritik wird. Über den mit Donna Leon und Andrea Camilleri bekanntesten Autor italienischer Kriminalromane schreibt die FAZ: »Filastò führt eine leichte, zeitweise elegante Feder; er ist ein überdurchschnittlicher Erzähler mit sicherem Instinkt für die Erwartungen des Lesers.«
In der Aufbau Verlagsgruppe sind von ihm bisher erschienen: »Der Irrtum des Dottore Gambassi« (OF 1995), »Alptraum mit Signora« (OF 1990), »Die Nacht der schwarzen Rosen« (OF 1997), »Swifts Vorschlag« (OF 1991) und »Forza Maggiore« (OF 2000).
Esther Hansen, diplomierte Übersetzerin, übertrug unter anderen Daria Bignardi, Nino Filastò, Marcello Fois, Diana Lama, Goliarda Sapienza, Susanna Tamaro und Carmine Abate ins Deutsche. 2008 wurde sie mit dem Förderpreis des Deutsch-Italienischen Übersetzerpreises ausgezeichnet.
Informationen zum Buch
Avvocato Scalzis vierter Fall.
Pisa, Anfang der 70er Jahre. Der Wirt einer heruntergekommenen Trattoria wird ermordet aufgefunden. Die Schuldigen scheinen schnell ausgemacht: Witwe und Tochter des Ermordeten sollen sich des krankhaft eifersüchtigen Trunkenbolds entledigt haben. Doch der Florentiner Anwalt Corrado Scalzi, der die Verteidigung der beiden Frauen übernommen hat, ist von ihrer Unschuld überzeugt. Zu viele Lücken in der Beweisaufnahme, zu viele Unstimmigkeiten deuten darauf hin, daß die Frauen geopfert werden sollen, um kriminelle Machenschaften weit größeren Ausmaßes zu vertuschen.
Der Leser darf sich darauf freuen, einem ungleichen Paar wiederzubegegnen – Scalzi, dem »melancholischen Aufklärer« (FAZ), mit einem Faible für die toskanische Küche, und seiner lebhaften Begleiterin Olimpia, deren Intuition seiner Erkenntnis nicht selten eine Nasenlänge voraus ist.
»Filastòs Können besteht darin, egal ob es sich um Mafia-Intrigen, um Morde an Transsexuellen oder um Kunstfälschungen handelt, seine Texte nicht nur mit den unabdingbaren Spannungselementen auszustatten, sondern gleichzeitig einen subtilen Blick auf die menschlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse Italiens zu werfen.« Hamburger Abendblatt
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Nino Filastò
Forza Maggiore
Ein Avvocato Scalzi Roman
Aus dem Italienischenvon Esther Hansen
Inhaltsübersicht
Über Nino Filastò
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil
Kapitel 1: Neujahrsnacht 1971
Kapitel 2: Der Schmetterlingsjäger
Kapitel 3: 7. Mai 1971
Kapitel 4: Die Zeit des Anwalts
Kapitel 5: Wenn aufgrund …
Kapitel 6: Beatrices Mittagessen
Kapitel 7: Der Betrüger
Kapitel 8: Detektivische Nachlese
Kapitel 9: Der Totengräber
Kapitel 10: Einfach nur Betty
Kapitel 11: Gerbina
Kapitel 12: Die Fliegen
Kapitel 13: … höherer Gewalt …
Kapitel 14: Mein lieber Eraldo
Kapitel 15: Gehörnte
Kapitel 16: Verschwörungstheorien
Kapitel 17: … der Tunnel nicht beleuchtet ist …
Kapitel 18: Schwärmer
Kapitel 19: Spiritistische Sitzung
Kapitel 20: Nach der Liebe
Kapitel 21: Gift führt zum Weibe
Kapitel 22: Santa Verdiana
Zweiter Teil
Kapitel 23: Mit Liebe
Kapitel 24: Erster Verhandlungstag
Kapitel 25: Lya De Putti
Kapitel 26: … bitte …
Kapitel 27: Gelage
Kapitel 28: Dicagiuro
Kapitel 29: Die Uhr von Marbelli
Kapitel 30: Via della Madonnina
Kapitel 31: Il Botro
Kapitel 32: Die Magierin
Kapitel 33: Spontane Aussage
Kapitel 34: Das Spezialgefängnis
Kapitel 35: Die Revolte
Kapitel 36: … Weiterfahrt …
Kapitel 37: Psychose
Kapitel 38: Plädoyer
Kapitel 39: … Nur mit grösster Vorsicht, um Unfälle zu vermeiden
Anmerkungen
Impressum
Erster Teil
1 Neujahrsnacht 1971
Giuseppe Malsito glaubte die Umrisse eines Hundes zu erkennen, der versuchte, die Straße zu überqueren. Er nahm den Fuß vom Gaspedal; der Porsche gab ein schnurrendes Geräusch von sich und zog dann wieder kräftig an. Das Licht der Straßenlaternen, die unter den heftigen Windstößen schwankten, warf helle Flecken auf den dunklen Asphalt. Es war vier Uhr morgens, und der 1. Januar 1971 versprach ein stürmischer Tag zu werden. Die Strandpromenade war menschenleer. Niemand bemerkte den übermüdeten jungen Mann im Smoking am Steuer seines blitzenden Porsche, die Fliege gelockert über dem offenen Hemdkragen, eine Zigarette zwischen Zeigefinger und Mittelfinger der linken Hand, mit der er nachlässig das Lenkrad hielt, an seiner Seite die schlafende, in ihren Nerzmantel gekuschelte Gattin.
Die Feiertage waren so gut wie vorüber. Die Silvesterparty im »La Bussola« am Strand von Camaiore hatte ihn zu Tode gelangweilt. Wenig Publikum, mäßige Show. Nini il Rosso an seiner Trompete war wie immer hervorragend gewesen, aber allein hatte er die Gala auch nicht herausreißen können. Die Sängerin Caterina Caselli, allgemein bekannt als »Goldschopf«, hatte kurzfristig abgesagt. Wenn man pro Person 50000 Lire Eintritt zahlte, Essen und Getränke extra, sollte man doch eigentlich erwarten dürfen, über eine Änderung des Abendprogramms rechtzeitig informiert zu werden. An Stelle von Caterina war ein junger französischer Sänger aufgetreten, an dessen Namen er sich beim besten Willen nicht erinnern konnte. Von den Liedern hatte Giuseppe vor allem eines der langsameren gefallen, »Après l’amour«, dem Moment nach der Liebe gewidmet, wenn man sich entspannt eine Zigarette anzündet. Als eine Rockband aus sehr jungen Musikern die Bühne betrat – allesamt in Jeanshosen, und das am Silvesterabend! –, waren Giuseppe und seine Frau ein Stockwerk höher geflüchtet, in den »Bussolotto«, um dort dem Cool Jazz Romano Mussolinis zu lauschen, Sohn des berühmten Verblichenen, der im Profil genauso aussah wie sein Vater in jungen Jahren, so daß man an eine Erscheinung glauben konnte. Giuseppe, der Rockmusik verabscheute, hatte auch für Cool Jazz nicht viel übrig, diesen Intellektuellenkram. Doch zumindest litten die Ohren in dem etwas kleineren Saal des »Bussolotto« weniger unter der Lautstärke, und man konnte bei einem Drink in aller Ruhe seinen Gedanken nachhängen, außerdem gab es dort keine Jugendlichen, die sich ab einem bestimmten Zeitpunkt völlig vergaßen, sich die Hemden vom Leib rissen, nach Schweiß stanken und zu den hämmernden Beats unanständige Bewegungen vollführten. Diese jungen Wilden schienen in letzter Zeit in Mode gekommen zu sein. Giuseppe hatte bereits eine Kostprobe von ihnen erhalten, die ihm voll und ganz genügt hatte, zwei Jahre zuvor auf der Party zum Jahreswechsel 1968 auf 1969, als eine erhitzte Menge ihm und anderen »Kapitalistenschweinen« nachts vor dem Ausgang der »Bussola« aufgelauert und sie mit Abfällen und Beleidigungen beworfen hatte.
Versunken in die Betrachtung des römischen Profils des Jazzers, hatte Giuseppe fast auf eine Wiederholung des Vorfalls gehofft. Noch einmal die Schreie, die Sprachchöre, die rhythmisch skandierten Beschimpfungen, die Tomaten und faulen Eier, das Eingreifen der Polizei, das Tränengas, die Sirenen der Einsatzwagen, die Flucht im Porsche, der sich unter bedrohlichem Aufheulen durch die Menge schob. Er hätte nichts dagegen gehabt, die Langeweile des Abends mit einer Neuauflage der »Bussola ’68«, wie die Zeitungen das Spektakel damals getauft hatten, zu vertreiben. Das im übrigen damit geendet hatte, daß einer der Aufrührer, getroffen von einer Tränengaspatrone, mit gebrochener Wirbelsäule auf der Straße liegenblieb. Selbst schuld, dachte Giuseppe, wäre er mal lieber tanzen gegangen, oder in einer Trattoria frittierten Aal essen, oder an den Strand, um dort in einer Umkleidekabine im Stehen zu bumsen, dann wäre er jetzt nicht querschnittsgelähmt. Auf jeden Fall war der diesjährige Silvesterabend derartig öde verlaufen, daß Malsito ihnen geradezu dankbar gewesen wäre, diesen Hungerleidern und ihren Mädchen, die aussahen, als würden sie nicht lange fackeln, bevor sie einen ranließen, dankbar, wenn sie wieder vor dem Eingang gestanden hätten. Die Nachtlokale der Versilia waren im Winter sterbenslangweilig. Ein Zusammenstoß wie jener im Jahr 68 hingegen erinnerte an die USA, als auf den Campus der amerikanischen Universitäten das allgemeine Chaos ausbrach. Dann hatte es auf Paris übergegriffen. In der Lichterstadt dasselbe Bild: Ströme von schlecht gekleideten Jugendlichen besetzten Straßen und Plätze, errichteten brennende Barrikaden auf den Boulevards, zündeten Autos an, schlugen Schaufenster ein und verwüsteten Geschäfte.
In jener Neujahrsnacht vor zwei Jahren war die Versilia einmal zum Mittelpunkt des Weltgeschehens geworden, wie Paris oder New York. Zumindest hatte Giuseppe sich so gefühlt, als er damals die »Bussola« verlassen hatte und, einen Arm schützend um die Schultern seiner Frau gelegt, mit dem anderen die herabprasselnden Geschosse abwehrend, durch den von Polizisten gebildeten Korridor geeilt war, alles junge Kerle, die ungefähr im gleichen Alter wie die Angreifer sein mußten, aber unter ihren Helmen älter aussahen. Im Mittelpunkt des Weltgeschehens.
Der dumpfe Schlag zerbarst in ein wildes Knattern wie von einem Maschinengewehr. Der Blitz entlud seine Energie in die metallene Brüstung, die den Strand säumte. Elektrische Schlangen züngelten bläulich auf und ließen einen hellen Flammenschein vor dem Gesichtsfeld zurück. Die Apuanischen Alpen zeichneten sich in ihrer ganzen Majestät gegen den Himmel ab, als würden hinter der Bergkette Kanonen abgefeuert. Der Donner grollte noch immer in der Ferne, als die Scheinwerfer auf die hundertjährigen Linden fielen, die die Abfahrt nach Viareggio säumten. Das Gewitter entlud sich. Die Baumkronen bogen sich unter heftigen Böen, und mit den ersten Tropfen klatschten kleine Zweige auf die Windschutzscheibe und verfingen sich in den Scheibenwischern. Das Meer kam wieder in Sichtweite, Blitze erleuchteten die weißen Schaumkronen der Sturzwellen, die sich in der Mündung des Flusses auftürmten und den Fischerhütten auf beiden Ufern bedrohlich nahe kamen. Giuseppe kurbelte das Fenster herunter, und ein eisiger Regen traf seine linke Gesichtshälfte. Während er es wieder schloß, atmete er tief den Geruch von Harz, Wasser und Ozon ein. Er mochte solches Wetter, das fahle Licht, das nun hinter den schneebedeckten Höhen der Berge aufschimmerte. Bald würden sie das Sommerhaus erreichen, wo er und Giovanna die letzten Tage der Weihnachtsferien verbringen wollten, in der Stille der Pinienhaine, abgeschirmt von der Außenwelt, das Telefon ausgestöpselt, weit genug von der Stadt entfernt, um Abstand von den Angelegenheiten ihrer drei Geschäfte zu bekommen, und doch nah genug, um innerhalb einer halben Stunde zurück zu sein, falls sie sich zu sehr langweilen sollten. Er würde sich die Zähne putzen und den sauren Whiskygeschmack aus dem Mund spülen; er würde eine heiße Dusche nehmen und danach in dem Zimmer schlafen, durch dessen Fenster man über das intensive Grün der Pinien hinweg aufs Meer sehen konnte, in der Nase den Duft nach frischen Leinenlaken. Er freute sich darauf, draußen den Sturm toben zu hören und sich vom Tosen der Brandung und dem leisen Knistern des über den Sand zurückströmenden Wassers in den Schlaf wiegen zu lassen. Das neue Jahr brauste auf einem kräftigen Südwestwind heran. Es hatte aufgehört zu regnen, aber noch immer trieben dunkle Wolkenmassen mit hoher Geschwindigkeit auf die Küste zu.
Giovanna neben ihm schlief. Nur sie brachte es fertig, einen solchen Tagesanbruch zu verschlafen. Eine wirklich schöne Frau, Giovanna, außer wenn sie schlief. Ihr Gesicht nahm dann einen etwas angewiderten Ausdruck an, als ob ein lästiges Geräusch oder ein unangenehmer Geruch sie störe.
Giuseppe fiel ein, daß er bei diesem Wetter nicht auf der Küstenstraße weiterfahren konnte. Denn nun begann jener Abschnitt, in dem das Meer wanderte, sich vom Land zurückzog, dann wieder alles verschlingend herankam, vor und zurück seit Jahrhunderten. Wo früher Jugendstilvillen dicht am Strand gestanden hatten, bemühte sich nun eine lange Reihe künstlicher Felsen aus Stahlbeton, häßlicher grauer Quader wie riesenhafte Bauklötze, die Straße vor den Wellen zu schützen. Sie hatten keine Zukunft, die heruntergekommenen Gärtchen mit ihren vom Brackwasser vergilbten Tamarisken vor den kleinen Villen, die selbst im Brackwasser verfaulten und, vom näherrückenden Meer bedroht, im Winter verlassen dalagen und im Sommer von Urlaubern ohne Klasse bewohnt wurden.
Der Libeccio blies stärker. Sturzwellen sprangen über die Felsen, brachen sich an den Mäuerchen am Straßenrand, liefen über den Asphalt und leckten an den Gittertoren der Gärten. Beim Zurücklaufen hinterließen sie tiefe, breite Pfützen, in denen sich das schwankende Licht der Laternen spiegelte.
Giuseppe hielt an: Wenn er in dieser Richtung weiterfuhr, riskierte er, von einer Welle überrollt zu werden. Er bog in eine Straße ein, die ins Ortsinnere führte, um den Weg durch das Dorf zu nehmen. Kurz hinter der Abzweigung weckte auf der anderen Straßenseite etwas seine Aufmerksamkeit. Aus den Maschen des Eisengitters vor einem Geschäft stieg ein feiner Streifen Rauch auf.
»Da brennt es doch«, sagte er. Giovanna schüttelte sich leicht und blinzelte ihn an.
»Warum hältst du an?«
»Da brennt was.«
»Laß uns nach Hause fahren. Wieviel Uhr ist es?«
»Fast fünf. Da drinnen in dem Geschäft ist ein Brandherd. Ein Kurzschluß vielleicht, oder der Blitz …«
Giuseppe nahm den Kamelhaarmantel von der Rückbank, legte ihn sich um die Schultern und öffnete die Wagentür. Der Wind zerzauste Giovannas Haar.
»Bleib hier«, sagte Giovanna, nun etwas wacher, »ich will nach Hause.«
Aber Giuseppe überquerte bereits die Straße. Im schwachen Licht der Straßenlaterne hielt er den Blick starr auf die zusammengerollte Zeitung gerichtet, die zwischen dem Gitter und dem Schaufenster steckte und von der ein Faden dichten, gelblichen Rauchs aufstieg. Er legte eine Hand an das Gitter und drehte sich um, um etwas zu Giovanna zu sagen, die ihn mit ahnungsvoller Sorge beobachtete.
Giovanna sah das Auflodern, den Kamelhaarmantel, der wie von einem Windstoß ergriffen hochflog, und die Gestalt ihres Mannes, der heftig nach hinten gerissen wurde. Der dumpfe Ton, wie von einem Gesenkhammer, der auf Straßenpflaster niedergeht, hallte in ihren Ohren wider. Sie barg den Kopf schützend in den Händen. Ein Regen aus Metallteilen prasselte auf das Dach des Porsche nieder. Mit vor Schreck aufgerissenen Augen verharrte sie kurz, dann stieg sie aus dem Wagen. Ihr Mann lag rücklings ausgestreckt auf dem Bürgersteig, die Beine ragten auf den Asphalt der Straße. Er schien zu zittern. Sie ging einige Schritte näher heran, sah das Blut. Sein Gesicht war völlig blutverschmiert, auch das Hemd und seine rechte Hand, die er auf der Brust verkrampft hatte. Er gab keinen Schmerzenslaut von sich. Als sie an seiner Seite niederkniete, hörte sie ein tonloses Gurgeln, wie von einem Waschbecken, aus dem das Wasser abläuft. In drei oder vier umliegenden Fenstern ging das Licht an. Jemand schaute heraus.
»Hilfe!« schrie Giovanna. »Einen Krankenwagen!«
Es begann wieder in Strömen zu regnen. Giuseppe hatte aufgehört zu zittern, die dunkle Pfütze unter seinem Körper wurde immer größer. Nach über einer halben Stunde kam ein Krankenwagen. Giovanna kniete völlig durchnäßt neben ihrem Mann. In dem Pelzmantel, auf dem sich die roten Lichter der Ambulanz spiegelten, sah sie aus wie eine riesige Kanalratte.
2 Der Schmetterlingsjäger
»Den sollte man aus der Mannschaft ausschließen«, sagte Terzani. »Von wegen Marathonläufer, von wegen Athlet und so. Er ist schlicht und einfach unentschlossen und sät Panik in der eigenen Abwehr.«
Die Diskussion hatte in der Bar begonnen.
In der kleinen, verschlafenen Stadt leerten sich die Bars um elf Uhr, selbst diejenigen, die bis nachts geöffnet hatten. Um Mitternacht schaute der Besitzer von seiner Zeitung auf, betrachtete die beiden Jugendlichen, die Bier tranken und über Fußball stritten – über einen gewissen Partalino, um genau zu sein, der dem an Fußball völlig uninteressierten Mann kein Begriff war –, und beschloß, daß er nun nicht länger zu warten brauchte. Er kassierte ab und setzte die beiden vor die Tür.
Die zwei schlenderten durch das um diese Zeit menschenleere Stadtzentrum und führten ihre Unterhaltung fort. Auf einem Platz angekommen, ließen sie sich auf dem Rand eines Brunnens nieder.
»Du hast ja keine Ahnung von Fußball«, sagte Filippeschi. »Partalino ist unersetzlich in der Mannschaft. Wenn er nicht den Angriff organisiert, macht es keiner. Ein Spieler, der das ganze Feld abläuft, ist eine echte Rarität in unserer Liga. Das Problem sind die anderen in der Mannschaft, die ihm nicht folgen.«
»Weil sie ihn mit dem Schiedsrichter verwechseln«, erwiderte Terzani. »Klar, laufen kann er, aber in die falsche Richtung. Er macht einfach nicht mit beim Pressing. Es sieht viel eher so aus, als wolle er das Spiel kontrollieren, wie ein Schiedsrichter. Und wenn ihm zufällig der Ball zwischen die Beine gerät, gibt er ihn direkt an den nächsten Mitspieler ab, ganz egal, ob der gedeckt ist oder nicht. Und das sogar im Strafraum. Wie viele dieser unüberlegten Ballabgaben im dicksten Strafraum hab ich den schon machen sehen … Ein Libero, der so im Strafraum spielt, ist wie …«
Terzani suchte krampfhaft nach einem passenden Vergleich, aber ihm fiel keiner ein. Er ließ die Beine baumeln und starrte mit offenem Mund auf das Pflaster.
»Wie was?« fragte Filippeschi.
Die Theaterkulisse des hell erleuchteten Platzes nahm Terzanis Aufmerksamkeit nun voll und ganz in Anspruch.
»Was?«
»Partalino. Er ist wie was?«
»Was interessiert mich Partalino. Er spielt bei Florenz, ich bin sowieso für Juve.«
»Was soll dann das ganze Gerede? Seit zwei Stunden liegst du mir mit diesem Partalino in den Ohren. Du solltest froh sein, daß er für die Fiorentina spielt, um so besser für Juve.«
Die Uhr am Palazzo gegenüber schlug eins. Als das Echo verklungen war, hörte man in der Stille das Plätschern des Brunnens. Terzani setzte seine Brille ab, rieb sich die Augen und schaute zu der Uhr hoch.
»Der Platz stammt aus der Renaissance. Früher standen hier dicht an dicht die Bruchbuden eines Elendsviertels.«
»Wann, früher?«
»Im Mittelalter. Diese Gegend hier war voll von dreckigen Spelunken. Sie war so etwas wie ein Sündenbabel im Schatten des Turms.«
»Von was für einem Turm?«
»Dafür, daß du auf einem humanistischen Gymnasium warst, weißt du ziemlich wenig«, stellte Terzani fest. Die beiden Jungen, die in Marradi geboren und aufgewachsen waren, studierten Architektur und teilten sich eine kleine möblierte Wohnung in einem der ärmeren Viertel.
»Der Turm, Dantes Hungerturm. Weißt du, warum er Hungerturm genannt wurde?«
Terzani rühmte sich einer entfernten Verwandtschaft mit dem Dichter Dino Campana, und er liebte die Poesie.
Filippeschi schüttelte den Kopf.
»In diesem Turm, ›der nach mir nur der Hungerturm wird heißen‹, wurde der Graf Ugolino mit seinen Kindern und Neffen eingeschlossen, um Hungers zu sterben. ›Dann war der Hunger stärker als die Trauer.‹ Er aß sie auf, nährte sich von seinen Neffen und Söhnen, der gute Ugolino. Ich glaube, er fing mit den Neffen an, obwohl Dante meinte, daß die vier Gefangenen allesamt Kinder des Conte waren.«
Filippeschi sprang mit einem Satz aufs Pflaster.
»Völliger Unsinn! Das ist nur die gängige Interpretation. Korrekt ist hingegen, daß Ugolino starb – der Hunger war stärker als die Trauer: er brachte ihn um.«
»Daran sieht man, wie weit die kleinbürgerliche Prüderie reicht, die ihre wohlgepflegte Anständigkeit sogar in die Göttliche Komödie hineininterpretieren möchte! Dabei ist Dantes Poem auch ein erstklassiger Horrorroman …«
Terzanis jugendliches Gesicht war mit Sommersprossen übersät. Er trug eine Brille mit sehr dicken Gläsern, und wenn sich sein Gesicht in der Hitze der Diskussion rötete, sahen seine Augen aus wie Eier in Tomatensauce.
»Der Dichter berichtet nur, was sich von einem gewissen Zeitpunkt an tatsächlich in dem Hungerturm abgespielt hat. Der arme Kerl ernährte sich von den Toten, um irgendwie zu überleben. Das ist es, was Dante erzählt. Denk doch mal nach, verflucht! Der gesamte 33. Gesang der Hölle ist voll von der grausamen Atmosphäre des Kannibalismus! ›Der Sünder hob von seinem wilden Fraße / Den Mund empor …‹. Was macht der Conte Ugolino am Anfang des Gesangs? Und am Ende? ›Nach diesem Wort griff er, die Augen rollend, / Den armen Schädel wieder mit den Zähnen / und nagte kräftig, wie ein Hund den Knochen.‹ Er verspeist den Kopf des Erzbischofs, oder etwa nicht?«
»Ich geh jetzt schlafen«, meinte Filippeschi.
Noch so eine Diskussion hielt er nicht aus. Fußball interessierte ihn wenigsten noch, aber die Göttliche Komödie … Um ein Uhr nachts!
»Schlafen? Bist du krank, oder warum willst du so früh ins Bett? Morgen ist Feiertag, der 1. Mai. Keine Uni, statt dessen geht’s auf zu Tamara. ›Tamara, dein Mund hat die Güte einer Lotusblüte …‹«, summte Terzani leise und blinzelte fröhlich hinter seinen Brillengläsern, die so dick waren wie Flaschenböden.
Tamara ging auf den Bahnhofsstrich und machte annehmbare Preise.
»Nicht einmal, wenn sie mich dafür bezahlen würde«, lehnte Filippeschi trocken ab.
»Hast du Angst, dir was einzufangen? Keine Sorge: Tamara ist sauber. Alles eine Frage der Professionalität.«
»Das ist es nicht«, unterbrach ihn Filippeschi, »ich gehe einfach nicht gern zu Huren, okay?«
Die flaschenbodendicken Brillengläser verstärkten noch die Unzufriedenheit in Terzanis Blick. Er litt unter Schlaflosigkeit. Deswegen brach er gerne, vor allem nachts, Wortgefechte über alle erdenklichen Themen vom Zaun (außer über Politik, er haßte Politik): über Literatur, Fußball, Musik, Frauen, Kino. Aus diesem Grund wurde er von vielen gemieden und hatte immer weniger Freunde. Er legte den Kopf in den Nacken und sah zum Himmel empor.
»Was für eine Sternenpracht. Das Wetter ist ideal. Da werde ich wohl auf den Monte Merlato gehen und ein paar Nachtfalter jagen. Willst du nicht mitkommen?«
»Nein.«
Francesco Terzani sammelte in seiner Freizeit Schmetterlinge, eine Leidenschaft, die er voller Stolz mit Nabokov teilte.
Die beiden überquerten die Brücke, die über den Fluß zu ihrem Viertel führte. Das magere Bächlein verströmte einen säuerlichen Verwesungsgeruch.
»Wenn du die Nachtfalter im Dunkeln anstrahlst, öffnen sie ihre Flügel und zeigen Käuzchenaugen oder das Geäder eines Blattes«, sagte Terzani. »Aber die Falter aus der Familie der Schwärmer, der Sphingidae, tragen ein ganz besonders abschreckendes Zeichen, das sie vor Vögeln schützen soll. Sie haben einen breiten und plumpen Körper, den die Natur mit einem Symbol des Todes schmückt. Der Acherontia Atropos trägt zum Beispiel einen Totenkopf. Eine ziemlich merkwürdige Sache eigentlich, weil man damit zwar einen Menschen abschrecken könnte, aber einen Vogel? Denn wie sollten Vögel in der Lage sein, das Symbol für Gift zu verstehen, das Zeichen für Hochspannung und Lebensgefahr? Unglaublich, was?«
Filippeschi gähnte vernehmlich und sichtlich gelangweilt.
»Müde?«
»Ich geh schlafen.«
Terzani machte einen letzten Versuch, den Freund zu überzeugen: »Ich wecke dich doch sowieso auf, wenn ich vom Merlato zurückkomme. Da könntest du lieber gleich …«
»Nein.«
»Den Totenkopfschwärmer findet man nur noch sehr selten in Europa. Wegen der Unkrautvernichtungsmittel. Vielleicht fange ich ja heute nacht einen auf dem Merlato …«
»Was wünscht man einem Schmetterlingsfanatiker, der auf die Jagd geht? Tod der Küchenschabe?«
»Du kannst mich mal.«
»Du mich auch.«
Um zwei Uhr in der Nacht erreichte Terzani mit seinem Fiat Campagnola die Häuser des ersten Ortes hinter der Stadt. Der alte Fiat hätte eine Inspektion dringend nötig gehabt, der Auspuff war kaputt, und der Dieselmotor dröhnte laut in den engen Gassen des schlafenden Dorfes. Er bog von der Straße ab, der ohrenbetäubende Lärm zerriß die Stille des Feldwegs, der nicht mehr benutzt wurde, seit die Zeit der Ochsenkarren vorüber war. Trotz der frischen nächtlichen Brise beschlugen Terzanis Brillengläser vom Schweiß, während er angestrengt versuchte, den Schlaglöchern, vereinzelten Macchia-Büschen und vom Berg herabgestürzten Felsbrocken auszuweichen. Wie immer hatte er sich zur Schmetterlingsjagd umgezogen: er trug eine von Brombeersträuchern zerrissene Hose aus Barchent, einen alten, ausgeleierten Wollpullover, einen zerlumpten Leinenhut. Neben ihm klapperte seine Jagdausrüstung, eine Metallschachtel mit durchlöchertem Deckel, die der Beute noch so lange zu atmen erlaubte, bis die Nadel ihr die Nervenbahnen lähmte, sowie eine selbstgebastelte Falle, ebenfalls aus Blech und mit demselben weichen Material ausgeschlagen, das auch zum Transport von Eiern verwendet wird. Eine geniale Konstruktion: Die Quecksilberdampflampe lockte die Insekten in eine Art Trichter, aus dem sie nicht mehr herausfanden. Terzani betrachtete den Merlato als sein privates Jagdgebiet. In dieser Gegend gibt es nicht das kleinste Bächlein, der karstige Boden saugt den Regen auf wie ein Schwamm, nichts wächst hier richtig, und wo es keine Bauern gibt, gibt es auch keine Unkrautbekämpfungsmittel; ab April beginnen die wildwachsenden Pflanzen zu blühen und ziehen die Insekten an.
Terzani legte den Kopf in den Nacken und wischte sich die Stirn trocken.
Vor ihm tauchte die halbverfallene Einfriedung vom Hof des »Polen« auf.
Seinerzeit hatte der Pole versucht, einige hundert Hektar abschüssigen Terrains urbar zu machen. Er hatte sein Geld in Polen verdient, sein wahrer Name war in Vergessenheit geraten. Den Leuten aus der Stadt hätte der Pole am liebsten ins Gesicht gespuckt, so verächtlich schauten sie auf ihn herab, wenn er als fliegender Zitronenhändler durch die Straßen zog. Die Villa hatte er auf einem Felsvorsprung erbauen lassen, der weit über die Ebene emporragte. Doch seine Versuche, das Land fruchtbar zu machen, und die sinnlose und kostspielige Suche nach einer Wasserquelle, die ihm ein schlitzohriger Wünschelrutengänger in Aussicht gestellt hatte, hatten ihn ruiniert. So war der Pole von einem Tag auf den anderen fortgegangen und hatte die Villa und das Gehöft dem Verfall anheimgegeben. Die Karstwüste hatte sich alles zurückgeholt und das Feld den wilden Kräutern, den Krähen und Ottern überlassen.
Terzani wollte die Falle an einem ganz bestimmten Ort aufstellen, den nur er kannte, in ein von Winden durchflochtenes Brombeergebüsch. Vor den Trichter würde er ein weißes Tuch hängen, um die Lichtbrechung zu erhöhen. Dann hieß es Geduld haben. Vor Tagesanbruch mußte er die Falle abbauen, damit nicht die Raben die Beute fraßen. Die Vögel konnten ihre Schnäbel in die Falle stecken und die Schmetterlinge, in Stücke gerissen, herausziehen.
Hinter einer Kurve tauchten das Bauernhaus und ihm gegenüber die Scheune auf. Auf der engen Straße dazwischen stand mit ausgeschalteten Scheinwerfern ein Auto. Terzani bemerkte es erst hinter der Biegung und mußte heftig bremsen. Sein Wagen stellte sich auf der steinigen Straße quer, der Motor ging aus. Der Schmetterlingsjäger putzte seine Brillengläser. Er war knapp vor dem anderen Auto zum Stehen gekommen, nur ein paar Zentimeter weiter, und er wäre mit ihm zusammengestoßen. Hinten war dem Campagnola durch die Hauswand der Weg abgeschnitten. Er war so unglücklich eingezwängt, daß er weder vor- noch zurücksetzen konnte.
Terzani startete den Motor neu, blinkte mit den Scheinwerfern und stemmte sich mit beiden Händen auf die Hupe. Der Ton gellte wie ein Schrei durch die Nacht. Ein schwarzer Schatten huschte an der Hauswand entlang und wurde sofort von einem der dunklen Fensterlöcher verschluckt. Wütend betätigte Terzani noch einmal die Hupe. Er legte den Rückwärtsgang ein, setzte den Wagen ein wenig zurück, wo jedoch sofort die Mauer aufleuchtete, während vorn noch immer zu wenig Spielraum war. Wieder dröhnte das stotternde Quäken der Hupe durch die Stille. Da tauchten seitlich des anderen Wagens, eines Fiat 1100, die weißen Umrisse eines Gesichts auf. Terzani beugte sich aus dem Fenster.
»Ist das eine Art, sein Auto abzustellen?« rief er.
Der Mann starrte ihn mit offenem Mund an, er keuchte und schien nach Atem zu ringen.
»He!« rief Terzani wieder, »ich rede mit Ihnen! Aufwachen! Fahren Sie Ihre Karre da weg.«
Der Mann bewegte sich nicht. Ein anderer saß bereits auf dem Fahrersitz. Der Mann, der neben dem Auto stand, sagte: »Machen Sie bitte die Scheinwerfer aus. Sehen Sie denn nicht, daß das blendet?«
Er redete mit monotoner Stimme und zog dabei die Silben in die Länge. Terzani gehorchte, und der Wagen setzte ein Stück vor, bis er neben dem Hühnerstall zum Stehen kam. Terzani dachte, daß es keinen Grund gab, den Fiat 1100 nicht gleich dort am Hühnerstall abzustellen. Anscheinend hatten sie ihn extra so geparkt, um die Straße zu versperren. Jetzt war der Durchgang frei. Als er an dem Wagen vorüberfuhr, sah er dem Fahrer ins Gesicht. Es war ein kleiner, untersetzter Mann, dem ein Haarbüschel tief in die Stirn hing und ihn wie einen Jugendlichen aussehen ließ, obwohl er um die Dreißig sein mochte. Der andere schien größer und älter zu sein, mit einem langgezogenen Gesicht und Geheimratsecken. Der Kleine saß über das Lenkrad gebeugt, eine Hand in seine linke Seite gepreßt, der andere, der sich ebenfalls die Seite hielt, stieg jetzt ein. Beide keuchten, sicherlich waren sie gerannt, und auch der am Lenkrad rang mit aufgerissenem Mund nach Atem.
Während er weiter den Berg hinauffuhr, sah Terzani im Rückspiegel, daß der Fiat ihm mit ausgeschalteten Scheinwerfern folgte. Auf dem Paß angekommen, verwandelte der Feldweg sich in ein schmales Sträßchen, das in Serpentinen steil bergab führte. Terzani stellte sein Auto rechter Hand auf einer kleinen Lichtung ab, damit die anderen vorbeifahren konnten, wenn sie wollten. Doch der Fiat hielt, noch immer mit ausgeschalteten Scheinwerfern, etwa fünfzig Meter hinter ihm an.
Der Schmetterlingsjäger stieg aus.
»Was zum Teufel wollt ihr?« rief er.
Die beiden schienen in eine Diskussion vertieft und reagierten nicht, der Kleine gestikulierte wild mit den Händen. Terzani hatte den Autoschlüssel noch nicht abgezogen. Im schwachen Schein des Standlichts bemerkte er, daß die zwei Männer mit besorgten Mienen zu ihm herübersahen. Während er nun den Schlüssel aus dem Schloß zog und nach der Falle griff, alle Türknöpfchen herunterdrückte und überprüfte, ob die Fenster richtig geschlossen waren, ging ihm durch den Kopf, daß er die beiden Unbekannten wohl bei irgend etwas gestört haben mußte.
Er erklomm den steilen Pfad, der auf die Spitze des Merlato führte. Auf dem Bergrücken wuchsen Brombeerbüsche zu Füßen der aufgereihten Felsen, deren Ähnlichkeit mit Zinnen dem Berg seinen Namen gab: il merlato, der »Zinnengekrönte«. Der Weg war mit Disteln, Ginster und dichten Bodenranken bedeckt, die ihn beim Gehen behinderten und ihre dornigen Zweige um seine Knöchel schlangen. Terzani kannte die Gegend wie seine Westentasche. Er befand sich bei den »Höhlenbauen« oder auch »Feenhöhlen«.
Früher hatten die Einheimischen diese dunklen Löcher, die auf der einen Seite des Berges klafften, Höhlenbaue genannt, weil sie sie für Schlupfwinkel von Wildschweinen und Füchsen hielten. Doch Kinder, die sich einen Spaß daraus machten, Steine hineinzuwerfen, hatten berichtet, daß man keinen Aufprall hörte. In jüngerer Zeit bestätigten dann Höhlenforscher, daß es sich um äußerst tiefe Einschnitte handelte, die den karstigen Grund des Merlato durchzogen und sich irgendwo in seinem Inneren verloren. Niemandem war es jemals gelungen, ihre Tiefe genau zu bestimmen. Seitdem nannten die Menschen sie Feenhöhlen, während nur die Alten noch den ursprünglichen Namen benutzten. Ganz unerwartet taten sie sich vor einem auf, einige von ihnen so eng wie Abzugslöcher, andere etwas weiter.
In mondlosen Nächten wie dieser konnte man leicht in eines der größeren Löcher hineinfallen. Der Schmetterlingsjäger knipste seine Taschenlampe an. Er erreichte den Fuß der Felsen. An einer halbwegs zugänglichen, windgeschützten Stelle baute er die Falle auf und spannte den weißen Stoff davor. Dann entzündete er die Quecksilberlampe. Ihr grünlicher Schein drang durch das Pflanzendickicht. Die angestrahlten Blätter verbreiteten die festliche Stimmung eines Weihnachtsbaums. Terzani entfernte sich einige Schritte. Als er an all die prachtvollen Schmetterlinge dachte, die er nun fangen würde, spürte er eine freudige Erregung in sich aufsteigen. Er zündete sich eine Zigarette an, ließ sich auf einem Felsabsatz nieder und betrachtete den paradiesischen Sternenhimmel. Von hier oben aus gesehen wirkten die Sterne größer und heller als sonst. Doch der Schmetterlingsjäger war unruhig. Konnte es sein, daß die beiden Nervensägen immer noch da waren und ihm am Fuß des Berges auflauerten? Er kletterte auf den Felsen und schaute hinab. Weiter unten sah er Scheinwerfer über die Büsche flitzen, hinter einer Kurve verschwinden, dann wieder auftauchen. Der Fiat 1100 entfernte sich rasch den Berg hinab. Die nächtlich feuchte Brise trug das Geräusch des gedrosselten Motors zu ihm herauf, das rauhe Kratzen des gewaltsam eingelegten niedrigeren Ganges vor den Biegungen. In einem Wahnsinnstempo nahm der Wagen der beiden Unbekannten die schmalen Serpentinen.
Die schaffen es noch, sich umzubringen, die Idioten, dachte Terzani.
Er würde lieber nicht hier oben warten, bis er die Beute holen konnte, denn die Feuchtigkeit kroch ihm schon jetzt durch den alten, mottenzerfressenen Pulli bis in die Knochen. Er sah bereits drei oder vier braune Falter an der Öffnung der Falle herumflattern. Besser, er würde im Auto ein Nickerchen halten. Er machte sich an den steilen Abstieg.
Als der Schmetterlingsjäger erwachte, verfärbte sich der Himmel bereits. Er hatte von einem Totenkopfschwärmer von der Größe eines Hundes geträumt. Das riesige Insekt, das er aus einer entsprechend riesigen Falle gezogen hatte, war ihm auf die Brust gesprungen und hatte ihm die Beinchen um den Hals gelegt. Terzani hatte es an sich herangezogen und die Hände in den weichen, seidigen Härchen des Tierleibes vergraben. Im Traum hatten die Augenhöhlen des Totenschädels irgendwie sinnlich gezwinkert, als hielte er statt des Schwärmers die süße Tamara in den Armen. Terzani fühlte etwas Feuchtes, Klebriges am Unterleib, die geträumte Umarmung hatte ihm einen Samenerguß beschert.
Er stieg aus und machte sich auf den Weg zur Bergspitze. Den Traum interpretierte er als ein gutes Omen. Vielleicht würde er dieses Mal einen Sphingidae Acherontia Atropos fangen. Bevor er die Falle erreichte, stolperte er über einen Stuhl, der nur wenige Meter von einer Feenhöhle entfernt verlassen dalag.
3 7. Mai 1971
Tombino hielt inne. Artig drehte er den Kopf zu seinem Herrn hin, ohne ihn jedoch anzuschauen. Bonturo Buti stützte sich mit der Hand an einem Felsblock ab und rang mit gesenktem Kopf nach Atem. Er hustete, spuckte aus und stieg weiter den Berg hinauf. Tombino wedelte kurz mit dem Schwanz und folgte ihm. Der Morgen des 7. Mai war klar und frisch, und über dem Gipfel des Monte Merlato zeigten sich die ersten Sonnenstrahlen.
Bonturo Buti, genannt Massengrab, arbeitete auf dem Friedhof. Die Gemeindeverwaltung zahlte ihm einen spärlichen Lohn dafür, daß er den Friedhof des Ortes am Fuß des Monte Merlato pflegte und dem Totengräber bei der Arbeit half. Der geringe Verdienst allein reichte ihm nicht zum Leben, weshalb sich Bonturo auf eigene Faust noch etwas hinzuverdiente. Die wohlhabenden Toten waren den Beerdigungsunternehmen der Stadt vorbehalten, die sie sofort in Beschlag nahmen. Wer jedoch ohne trauernde Angehörige verstarb, um den kümmerte sich die Pia Assistenza: die wohltätige Einrichtung sorgte für einen Sarg aus Tannenholz, der mit Walnuß-Imitat lasiert war, sowie ein Holzkreuz, auf dem unter einem schützenden Plastikschildchen der Namen des Verstorbenen geschrieben stand. Wenn das Grab wieder zugeschüttet war, legte der Totengräber einen Kranz mit metallenen, entfernt an Lorbeer erinnernden Blättern auf den Erdhügel, immer denselben verrosteten Kranz, von dem schon der Lack abblätterte und der am Tag nach dem eiligen Begräbnis wieder in den Friedhofsschuppen wanderte.
Es gab aber auch jene Toten, die zwar nicht genug zurückließen, als daß davon die feierliche Zeremonie eines Beerdigungsunternehmens bezahlt werden konnte, aber dennoch den einen oder anderen knauserigen Verwandten hatten. Für sie war Bonturo zuständig, und gegen eine kleine Pauschale kümmerte er sich um alles. Er wertete den von der Wohlfahrt gespendeten Sarg mit einer dünnen Harzschicht auf, band eigenhändig ein paar Kränze aus Immergrün, besorgte Kerzen, mietete einen Leichenwagen, und wer bereit war, noch etwas draufzulegen, dem organisierte er bei einem befreundeten alten Steinmetz einen echten Grabstein, dem auch das Oval für ein Foto und die bronzene Schale für das Grablicht nicht fehlten.
In der Leichenhalle des Friedhofs von Asciano wartete schon seit zwei Tagen die sterbliche Hülle eines mittellosen Alten, am nächsten Tag sollte die Beerdigung sein. Die Angehörigen hatten sich reichlich spät an Bonturo gewandt. Den Tannensarg hatte er bereits überstrichen, aber die Kränze fehlten noch. Da ihm das Immergrün ausgegangen war, mußte er auf den Monte Merlato steigen, um dort Bärenklau zu sammeln, eine wildwachsende Pflanze mit leicht dornigen, aber in Form und Äderung sehr dekorativen Blättern.
Leider war er nicht mehr der Jüngste, über Sechzig, und die fünf Kilometer den steinigen Weg bergauf machten sich in Lunge und Beinen bemerkbar. Doch der Wein wollte bezahlt sein, und auch die zwanzig Toscani pro Woche – ein verfluchtes Laster, diese Zigarren – und der Kaffee in der Bar der Casa del Popolo, der die abendlichen Partien Tressette begleitete. Mit dem, was mit der Einkleidung der Leiche, den Kränzen, den Kerzen und der Anzahlung auf den Grabstein für ihn heraussprang, hätte er für den nächsten Monat ausgesorgt.
Vom Friedhof schlug er den Weg dorfauswärts ein. Nachdem er seinen dreirädrigen Piaggio bei der kleinen Bar der Steinbrucharbeiter abgestellt hatte, folgte er zu Fuß dem Feldweg. Völlig unmöglich, mit dem Auto weiterzufahren, das hätte den sicheren Achsenbruch bedeutet. Bonturo trug Gummistiefel und seinen alten Jagdrock aus braunem Cord, der so abgenutzt war, daß er schon ins Grün tendierte; er hatte einen Korb dabei für den Fall, daß er auf eßbare Pilze stoßen würde, und in der Tasche seiner Jagdjoppe ein Stück Schnur, um damit das Bündel Bärenklau zusammenzubinden. Bevor er auf dem Berggipfel anlangte, passierte er den Engpaß zwischen Bauernhaus und Heuschober vom Hof des Polen, die beide verlassen dalagen, ebenso wie die Villa, vor deren Fensterlöchern vereinzelte Läden schief in den Angeln hingen, zu marode, um noch gestohlen zu werden. Massengrab atmete schwer und das, obwohl das steilste Stück noch vor ihm lag. Die Bärenklaustauden wuchsen auf der nordöstlichen Seite des Berges, ein Stück hinter den Höhlenbauen.
Tombino gab ein kurzes Bellen von sich. Er schien nervös, schnüffelte mit der Nase am Boden herum, lief dann plötzlich weiter und verschwand in einem großen Gebüsch. (Eigentlich hatte er bei seiner Geburt den ungleich schöneren Namen Fido erhalten, der Treue, aber weil er stank und sein Fell mit den Jahren immer schlammfarbener geworden war, hieß er nur noch Tombino, Gullydeckel.)
Bonturo hielt sich an einem Ginsterstrauch fest, widerstand der Versuchung, sich eine halbe Toscano anzuzünden, und pfiff nach dem Hund, der sich entfernt hatte und nun bei den Höhlenbauen herumschnüffelte. Was suchte er nur da? Wollte er in eines der Löcher fallen? Tombino antwortete wieder mit einem Bellen, blieb aber hinter einem Dickicht Mohrenhirse verborgen.
»Tombino, alter Stinker! Komm her!« rief Bonturo. Diesmal antwortete der Hund mit einem wolfsähnlichen Geheul. Zwei pechschwarze Krähen stoben aus dem Gebüsch auf und stießen dann zielstrebig erneut hinab.
»Was stellst du bloß mit den Krähen an, he? Laß sie in Ruhe! Hierher!«
Doch es konnten eigentlich kaum die Krähen sein, dachte Bonturo. Tombino hatte unter Anwendung von Fußtritten gelernt, daß er die schwarzen Vögel besser in Ruhe ließ, weil es Unglück brachte, sie zu töten. Unter mißmutigem Schnauben verließ Bonturo den Bergpfad. Bei dem Busch angelangt, sah er, daß der Hund etwas starr fixierte, vor Anspannung zitternd und mit gesträubtem Fell. Tombino mußte ihn gehört haben, doch er drehte noch nicht einmal den Kopf, sondern verharrte regungslos und leise winselnd. Zuerst dachte Bonturo an ein Nest mit Rebhühnern, doch dann nahm er den süßlichen Geruch wahr, den er nur zu gut kannte. Hinter der Mohrenhirse, unterhalb der schwarzen Öffnung eines der Höhlenbaue, brummten die Fliegen. Der Friedhofswärter machte zwei weitere Schritte, zog dann ein schmieriges Taschentuch aus der Hose und hielt es sich vor die Nase. Dann schob er die rotbraun blühenden Hirserispen zur Seite und sah sie.
Die Leiche lag auf dem Bauch, Arme und Beine von sich gestreckt wie ein Brustschwimmer. Hemd und Pullover waren bis zum Hals hochgeschoben und entblößten den Rükken. Das Hemd war blau, und auch der Körper hatte eine schmutzigblaue Farbe, während die Arme und Hände bleicher waren, fast weiß. Er mußte schon eine ganze Weile tot sein, der Typ, wahrscheinlich hatte er dieses Jammertal schon vor mindestens einer Woche verlassen. Massengrab steckte das Taschentuch wieder in die Hosentasche und zog sich statt dessen den Kragen seines Jagdrocks vor die Nase. Nun hatte er die Hände frei. Er kniete nieder, packte den leblosen Körper an den Schultern und rollte ihn, das abschüssige Gelände nutzend, auf den Rücken. Schlapp wie eine Polenta, die aus dem Topf auf den Küchentisch gestürzt wird, machte der Körper eine halbe Drehung. Die fetten blauen Fliegen erhoben sich einen Moment lang in die Luft und fielen dann wie eine Handvoll Kieselsteine wieder auf ihn herab. Aus den Augenwinkeln sah Bonturo gerade noch, wie unter dem Körper eine dicke Feldratte hervorschoß und sich in einen Steinhaufen flüchtete. Einige Schritte entfernt hockten die beiden Krähen auf einem Felsen und beobachteten die Szene, eine drehte ihren Kopf zur Seite, um sich den Schnabel zu reiben. Obwohl Bonturo den Umgang mit Leichen gewöhnt war, stieg ihm beim Anblick des Gesichts des Toten der Anisgeschmack des Sambuca wieder auf, den er vorhin in Form eines caffè corretto in der »Bar delle Cave« eilig in sich hineingeschüttet hatte. Die Augen des Toten quollen aus den Höhlen wie Glaskugeln. Das blaufleckige Gesicht sah aus, als müsse es jeden Moment platzen, so aufgedunsen war es, zwischen den dick geblähten Lippen erahnte man ein Stückchen Zunge.
»Zur Hölle noch mal!« entfuhr es Bonturo, der nicht daran dachte, daß dieser Mann vermutlich schon dort angekommen war.
Anstatt sich zu bekreuzigen, wie es sich gehörte, stieß er einen jener langen, ausgearbeiteten und detailreichen Flüche aus, wie man sie noch von Billardspielern hört, wenn ihnen aus Versehen die Queue, nachdem sie die Kugel berührt hat, über das grüne Tuch rutscht und es zu zerreißen droht.
Massengrab hatte schon eine Menge Ertrunkener gesehen, und den einen oder anderen hatte er auch in den Sarg gebettet. Aber auf dem Merlato zu ertrinken, wo das Meer einige Kilometer entfernt und Wasser für alles Gold der Welt nicht zu finden war, stellte doch eine gewisse Leistung dar. Der war also wohl erwürgt worden, bevor man ihn hier heraufgeschleppt hatte. Vielleicht hatten sie ihm auch direkt vor Ort die Gurgel umgedreht, wer wußte das schon.
Und ausgerechnet er mußte über diese arme Seele stolpern, während unten, auf dem Marmortisch in der Leichenhalle von Asciano der andere Tote auf ihn wartete, der, nebenbei bemerkt, an Altersschwäche gestorben war. Doch nun hieß es ein Telefon finden, die Carabinieri rufen, warten, bis sie kamen, und sie auf den Berg zu der Leiche führen. Und all die Fragen, die sie ihm stellen würden! Bonturo wußte nur zu gut, wie kleinlich der Maresciallo des Ortes in bestimmten Situationen sein konnte: der würde alles haargenau erklärt haben wollen … Und anschließend würde er vor dem Richter der Stadt aussagen müssen … Und wer wußte, was ihm noch alles bevorstand … Das bedeutete: keine Kränze für den Alten, die Angehörigen erbost, der Verdienst futsch …
Er trat mit dem Fuß nach Tombino, der immer noch wie versteinert dastand und an einem Bein des Toten schnüffelte. Gottverfluchter Unglückshund, ohne ihn wäre er seelenruhig an dem vermaledeiten Störenfried vorbeigelaufen, ohne ihn zu bemerken, schön versteckt hinter seinen Stauden, wie er da lag. Tombino winselte, sah mit traurigem Blick zu ihm auf und hockte sich nieder, um sich das Bein zu lecken, wo ihn der Tritt getroffen hatte.
Massengrab sah sich um. Keiner da. Wer sollte sich auch hier oben herumtreiben, um halb sechs in der Früh? Er könnte natürlich einfach zurückgehen, dachte er, und so tun, als sei nichts gewesen. Aber das konnte er eben nicht, verflucht noch mal! Schon weil er auf dem Friedhof arbeitete und von der Gemeinde bezahlt wurde. Letztlich war er ja eine Amtsperson und trug eine gewisse Verantwortung für das Gemeinwohl. Und wenn bekannt würde, daß er den Ermordeten entdeckt und seinen Fund geheimgehalten hatte, dann war er seine Arbeit los, ganz zu schweigen davon, grundgütiger Himmel, daß er der Mitwisserschaft angeklagt werden würde.
Schlecht gelaunt begann Bonturo den Abstieg, als er schon nach wenigen Schritten über etwas stolperte. Er stieß noch einen Fluch aus, beugte sich hinab und hob einen Stuhl auf, besser gesagt ein mit rotem Plastikband bespanntes Metallgestell, an dem die Beine fehlten. Er fragte sich nicht, was ein Barstuhl ohne Beine hier auf dem Merlato verloren hatte. An diesem unglückseligen Morgen hatte er wahrlich schon genug Überraschungen erlebt, es reichte ihm langsam. Voller Wut schleuderte er den Stuhl ins Gebüsch.
4 Die Zeit des Anwalts
Sie sahen aus, als wären sie einem jener neorealistischen Filme der Nachkriegszeit entsprungen. Und in gewisser Hinsicht waren sie das auch. Der Mann war dürr, die Wangen eingefallen, er trug einen zerschlissenen Anzug, viel zu warm für die Jahreszeit, das weiße Hemd am Hals aufgeknöpft und über den Kragen des Jacketts geschlagen, im Knopfloch das Abzeichen der Vereinigung der Widerstandskämpfer, der »Associazione Nazionale Partigiani«. Die Frau hatte ihr Sonntagskleid aus großblumig bedruckter Seide an, der Rock reichte ihr bis zu den Waden, der weiße Lackledergürtel schlang sich eng um die Taille. Sie war füllig, hatte sanfte Augen und rabenschwarzes, nur von wenigen weißen Strähnen durchzogenes Haar, das im Nacken zu einem dicken Knoten gesteckt war. Ihre herzförmigen Lippen leuchteten rot. Wenn man nachrechnete, mußte der Mann bereits über Fünfzig sein, obwohl er jünger aussah, wie jemand, an dem die Jahre im Gefängnis keine Spuren hinterlassen hatten.
Nach dem 8. September 1943 hatte sich der Mann den Partisanen im Chianti zwischen Florenz und Siena angeschlossen. In dem aufgewühlten Klima der Monate nach der Befreiung, als Abrechnungen noch eine moralische Verpflichtung zu sein schienen, hatte er den faschistischen Dorfgeistlichen umgebracht, der während der Besatzung für die Deutschen spioniert hatte: der Priester war schuld daran gewesen, daß die Soldaten der Italienischen Sozialrepublik Mussolinis einen Freund von ihm hingerichtet hatten. Drei Schüsse aus einer 9-kalibrigen Beretta am Ausgang der Kirche, als der Priester gerade die Karfreitagsprozession anführen wollte. Das schwere Kreuz, das er trug, hinderte ihn an der Flucht und begrub ihn unter sich. Ein berühmter Schriftsteller hatte den Vorfall und den sich anschließenden Prozeß zu einem Roman verarbeitet.
Corrado Scalzi hatte den Roman gelesen. Das Buch hatte als Vorlage für einen mittelmäßigen Film gedient, in dem die romantische Liebesgeschichte der beiden Verlobten, die noch während der Haft des Mannes heirateten, hoffnungslos verkitscht worden war. Die Namen waren im Film nur wenig abgeändert worden. Das Drehbuch hatte dem Mann seinen Decknamen aus dem Partisanenkrieg gelassen, ja er war sogar im Titel des Films aufgetaucht. Als er wieder in Freiheit war, hatte das Paar wiederholt Anrufe von Leuten bekommen, die sich erkundigten, wie es dem »dreckigen Mörderschwein und seiner Hure« ginge. Die anonymen Anrufer waren keineswegs ausschließlich politische Gegner, vielmehr glaubte die Ehefrau auch Stimmen von Dorfbewohnern wiederzuerkennen, die ihnen den Filmruhm und das wenige Geld, das sie aus der Produktion bekommen hatten, mißgönnten, wie sie vermutete. Daher hatten sie beschlossen, die Filmemacher wegen übler Nachrede zu verklagen.
Es bedrückte sie, daß die zurückliegenden Ereignisse kein Ende fanden, wie eine sich immer weiter windende Schlange. Die Justiz hatte sich 1948 des Mörders bemächtigt, als der Priester schon seit drei Jahren tot und begraben war. Ein übereifriger Staatsanwalt war der Ansicht gewesen, daß es sich bei dem Mord nicht um eine Kriegsepisode handelte, sondern um einen Akt der Rache und der persönlichen Vergeltung. Das Schwurgericht hatte in erster Instanz die Amnestie nach dem sogenannten Togliatti-Gesetz zur Anwendung gebracht. Der Staatsanwalt war daraufhin in Berufung gegangen. Und da sich in der Zwischenzeit das politische Klima im Land verändert hatte, ließ nun der Umstand, daß ausgerechnet ein Priester ermordet worden war, die Tat noch ruchloser erscheinen. So war der ehemalige Partisan wieder ins Gefängnis gewandert, verurteilt zu dreißig Jahren Haft. Aufhebung durch den Obersten Gerichtshof aufgrund eines Verfahrensfehlers. Erste Wiederaufnahme des Verfahrens, erneuter Ausschluß von der Amnestie. Die Verhandlungsführung wurde mit der Zeit immer spitzfindiger, nachvollziehbar nur noch für Eingeweihte, für die Betroffenen jedoch voll undurchschaubarer Formulierungen. Neue Instanz der Kassation, erneute Aufhebung. Das zweite Berufungsverfahren bestätigte das Urteil: die Gefängnistore öffneten sich wieder. Dann noch einmal das Kassationsgericht … Acht Instanzen! Und er immer rein und raus, ein ewiges Hin und Her, eine Liebe, die sich von Besuchstermin zu Besuchstermin verzehrte, das Mädchen diesseits, der Mann jenseits der großen Marmortische in den schmuddeligen Besucherzellen, verstohlene Küsse unter den Blicken der Wärter in der ehemaligen Festung von Volterra, in den Klöstern des Schwesternordens »Le Murate« von Florenz und San Gimignano. Zu jener Zeit waren die Gefängnisse schmutziger als heute; vielleicht weniger unpersönlich, aber nur für jene, denen es gelang, der Haft einen romantischen Aspekt abzugewinnen. Nicht jedoch für sie beide, die einfache Menschen waren und nur unter der Düsternis der Gefängnismauern litten. Die Wechselbäder aus Verurteilung und Urteilsaufhebung lasteten auf ihr noch schwerer als auf ihm, das Warten auf den erhofften Straferlaß, das Gewicht der frischen Wäsche und der zusätzlichen Mahlzeiten, die sie ihm in die verschiedenen Gefängnisse brachte, immer darum bemüht, in seiner Anwesenheit zu lächeln, damit er nichts von den Mühen und Demütigungen erfuhr, unter denen sie lebte.
Eines schönen Tages dann schien alles ein Ende zu haben: Der Straferlaß war rechtskräftig, die Freiheit in greifbare Nähe gerückt. Doch mit dem Film kroch die Schlange wieder aus dem Unterholz, wenn auch ihr Kopf hinter all den Windungen schon längst außer Sichtweite war, absurde zwei Jahrzehnte entfernt.
Daß sie sich irgendwie wehren wollten, jetzt, nachdem endlich alle Ressentiments, alle Hoffnungen und Ängste vergessen schienen, zusammen mit der Jugend, die für immer dahin war – bis es dann plötzlich wieder losging mit den Zeitungsartikeln, den bösen Blicken und, schlimmer noch, den feindseligen Anrufen von Dorfbewohnern mit hartnäckigem Erinnerungsvermögen –, das verstand Scalzi nur zu gut. Doch daß sie deshalb einen Anwalt aufsuchten, sich freiwillig mit der Justiz einlassen und den ganzen Gerichtsapparat erneut in Gang setzen wollten, dieses Mal allerdings auf Seiten derer, denen Unrecht geschehen war – das erschien ihm weniger heroisch als vielmehr bizarr.
Die Frau wirkte entschlossener als der Mann. Vielleicht, weil sie den dämmrigen Fluren nachtrauerte, den steilen Treppen der Gerichtsgebäude, vielleicht in Erinnerung an die seltenen Momente des Entgegenkommens von Richtern und Justizbeamten, die sich doch meist verschlossen und abweisend gezeigt hatten im Namen komplizierter und undurchschaubarer Gesetze, vielleicht eine Art Stockholm-Syndrom, dachte Scalzi.
Natürlich hätte er versuchen können, den Film beschlagnahmen zu lassen, aber er fühlte sich schon vor Prozeßbeginn entwaffnet. Er ahnte, daß auch auf dem neuen Verfahren, ähnlich wie auf dem mittlerweile abgeschlossenen, die Trägheit der italienischen Justiz lasten würde. Er sah es kommen, wie sich auch der nächste Prozeß im langsamen Rhythmus eines indischen Mantras hinziehen würde, verschleppt von einer langen Folge von Tönen, die mit dem eigentlichen musikalischen Thema nichts mehr zu tun hatten.
Scalzi versuchte, die beiden davon zu überzeugen, sich gegen Zahlung einer bescheidenen Abfindung mit einer außergerichtlichen Einigung zufriedenzugeben.
Versunken betrachtete er die Fliegen, die um den Lampenschirm kreisten und den Beginn des Sommers ankündigten. Zu welchem Zweck diese kleinen Tierchen ihre endlosen, konzentrischen Kreise um die Lampe beschrieben, würde wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Das Messing und die geschliffenen Gläser gaben nichts Eßbares her, und da das Licht nicht eingeschaltet war, konnten sie sich nicht einmal daran wärmen. Scalzi vermutete eine Art rituellen Tanz. Auf jeden Fall war gegen sie kein Kraut gewachsen. Weder nützte es, das Zimmer im Dunkeln zu lassen, noch, die Luft mit Insektiziden zu verpesten, die Fliegen verschwanden für eine Stunde und kehrten dann wie magisch angezogen zurück, als sei der Raum eine Dorfmetzgerei.
Der Vorschlag einer gütlichen Einigung – auf der man im Falle einer Ablehnung nicht weiter bestanden hätte – wurde von den beiden Mandanten, die lieber wieder vor Gericht ziehen wollten, negativ aufgenommen.
Und so begann ein Freitag nachmittag unter der hartnäckigen Belagerung durch Klienten und Fliegen mit verbalen Bemühungen, die zwei Nachtfalter zur Vernunft zu bringen, die sich nicht davon abbringen ließen, um die glühende Lichtquelle zu flattern, obwohl sie sich schon einmal daran verbrannt hatten. In solchen Momenten fühlte Scalzi die unerträglich langsam verrinnende Zeit seines Berufs auf sich lasten wie die beklemmende Enge eines Käfigs.
Verstohlen blickte er auf die Uhr, fast drei, die Sekretärin war noch nicht aus der Mittagspause zurück. Das Telefon läutete.
Avvocato Barbarinis rauhe Zigarrenraucherstimme klang zögerlich, fast als schäme er sich.
»Viel zu tun zur Zeit?«
»Es geht so, eher nicht.«
»Möchtest du morgen zu mir kommen? Ich lade dich zum Mittagessen ein.«
Scalzi zögerte kurz. Achtzig Kilometer waren nicht die Welt, aber es wurde schon recht warm um diese Jahreszeit. Für den kommenden Tag, den Samstag, waren keine Termine angesetzt, weder Gefängnisbesuche noch Verhandlungen. Er hatte eigentlich zwei Ferientage eingeplant: spät aufstehen und nach dem Mittagessen ins Kino. American Graffiti von George Lucas müsse man unbedingt gesehen haben, meinte Olimpia. Sie hatte gelesen, daß der Film die Generation der Studentenunruhen in Amerika beschrieb und von dem Punkt handelte, an dem die Welt begonnen hatte, sich unaufhaltsam zu verändern. Ihr zufolge zeigte der Film, »wie wir damals waren«, nächtliche Autorennen à la James Dean und so, all das, was nach der Ermordung Kennedys und dem Vietnamkrieg dem Untergang geweiht war … und vieles mehr. Fast zuviel für Scalzis Geschmack, aber wie hätte er ihr klarmachen sollen, daß er sich eigentlich viel lieber noch einmal Das Ding aus einer anderen Welt in einem Programmkino ansehen würde, das eine Reihe von Science-fiction-Filmen aus den fünfziger Jahren zeigte. Er hätte sich die übliche Strafpredigt über seinen Filmgeschmack eines Pubertierenden anhören müssen, und vielleicht hätte sie sogar mit ihm geschmollt, wie letzte Woche, als er ihr gestanden hatte, daß ihn Alice in den Städten von Wim Wenders fürchterlich gelangweilt habe.
Barbarini unterbrach das Schweigen: »Bice hat gesagt, wenn du kommst, kocht sie dir eine ihrer Spezialitäten.«
Beatrice, Barbarinis Frau, kochte außergewöhnlich gut und einfallsreich.
»Etwas typisch Toskanisches«, insistierte Barbarini, »Bice hat ein neues Kochbuch und experimentiert gerade mit der Florentiner Renaissanceküche.«
»Es ist nur, daß …«
»Olimpia bringst du natürlich mit. Vielleicht könntest du, na ja …« Barbarini schien verlegen nach Worten zu suchen. »Du könntest sie bitten … also … daß sie nicht … Bice ist nicht mehr die Jüngste, sie hat nun mal gewisse Vorstellungen von …«
»Daß sie ihre Zunge im Zaum hält? Ist es das, was du sagen willst?«
»Genau. Als sie sich das letztemal gesehen haben, hat Olimpia sie eine ›angeschimmelte Paranoikerin‹ genannt.«
»Ich kann mich nicht erinnern, das gehört zu haben.«
»Na ja, irgendwas mit Schimmel und Paranoia war auf jeden Fall dabei. Sie mögen sich nicht besonders, die beiden. Vielleicht der Altersunterschied.«
»Wobei es immer deine Frau ist, die als erste angreift. Ohne Olimpia in Schutz nehmen zu wollen, aber ich selbst finde die ewigen Tiraden über die jungen Leute von heute auch ziemlich nervtötend.«
»Ich werde Bice bitten, nur über Rezepte zu reden, einverstanden? Also, kommst du? Es ist ziemlich wichtig: eine dringende berufliche Angelegenheit.«
»Kannst du mir das denn nicht jetzt sagen?«
»Nein, nicht am Telefon«, wehrte Barbarini brüsk ab.
»Also gut«, lenkte Scalzi ein, »dann bis morgen. Sag Bice schon mal im voraus vielen Dank für das Essen, und sie soll sich nicht zuviel Arbeit machen, ich ziehe die leichte Küche vor, und Olimpia ißt sowieso fast ausschließlich Salat.«