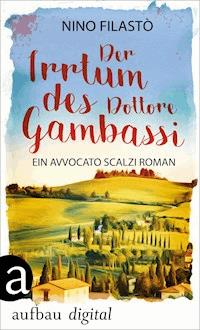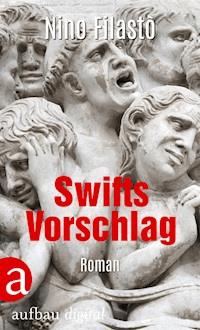Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Avvocato Scalzi ermittelt
- Sprache: Deutsch
Avvocato Scalzis fünfter Fall.
Ein Archivar wird in einer Florentiner Bibliothek ermordet aufgefunden. Was hatte er in jenem Buch aus dem 17. Jahrhundert gefunden, in dem er seit Monaten las - überzeugt, dass seine Entdeckung ihn zum Millionär machen werde? Corrado Scalzi gelangt rein zufällig auf die Spuren dieses seltsamen Mordes und stößt schließlich auf ein Geheimnis, das Jahrhunderte weit in die Geschichte der Stadt zurückreicht. Bis zu Masaccio, dem großen Maler der Renaissance, der mit nur 27 Jahren, eines vermutlich nicht ganz natürlichen Todes starb ...
Ein Toskana-Krimi für Florenz- und Kunstliebhaber.
"Das vielfarbige Flair von Florenz, der kritische Blick des Florentiners auf Beschränktheit und Filz, hell blitzender Alltagswitz und dunkel wallende Mystik - das sind die markanten Zutaten dieses Krimis." Jens-Uwe Sommerschuh im Magazin der Sächsischen Zeitung.
"Filastò führt eine leichte, elegante Feder; er ist ein überdurchschnittlicher Erzähler mit sicheren Instinkten für die Erwartungen des Lesers." FAZ.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über Nino Filastò
Nino Filastò, geb. 1938, lebt in Florenz als Rechtsanwalt. In der literarischen Tradition von Leonardo Sciascia schreibt er Romane um die Figur des Anwalts Corrado Scalzi, in denen eine kriminalistische Fabel immer auch zum Instrument der Gesellschaftskritik wird. Über den mit Donna Leon und Andrea Camilleri bekanntesten Autor italienischer Kriminalromane schreibt die FAZ: »Filastò führt eine leichte, zeitweise elegante Feder; er ist ein überdurchschnittlicher Erzähler mit sicherem Instinkt für die Erwartungen des Lesers.«
In der Aufbau Verlagsgruppe sind von ihm bisher erschienen: »Der Irrtum des Dottore Gambassi« (OF 1995), »Alptraum mit Signora« (OF 1990), »Die Nacht der schwarzen Rosen« (OF 1997), »Swifts Vorschlag« (OF 1991) und »Forza Maggiore« (OF 2000).
Esther Hansen, diplomierte Übersetzerin, übertrug unter anderen Daria Bignardi, Nino Filastò, Marcello Fois, Diana Lama, Goliarda Sapienza, Susanna Tamaro und Carmine Abate ins Deutsche. 2008 wurde sie mit dem Förderpreis des Deutsch-Italienischen Übersetzerpreises ausgezeichnet.
Informationen zum Buch
Avvocato Scalzis fünfter Fall.
Toskana-Krimi für Florenz- und Kunstliebhaber
Ein Archivar wird in einer Florentiner Bibliothek ermordet aufgefunden. Was hatte er in jenem Buch aus dem 17. Jahrhundert gefunden, in dem er seit Monaten las – überzeugt, daß seine Entdeckung ihn zum Millionär machen werde? Corrado Scalzi gelangt rein zufällig auf Spuren dieses seltsamen Mordes und stößt schließlich auf ein Geheimnis, das Jahrhunderte weit in die Geschichte der Stadt zurückreicht. Bis zu Masaccio, dem großen Maler der Renaissance, der, nur 27-jährig, eines vermutlich nicht ganz natürlichen Todes starb.
»Das vielfarbige Flair von Florenz, der kritische Blick des Florentiners auf Beschränktheit und Filz, hell blitzender Alltagswitz und dunkel wallende Mystik – das sind die markanten Zutaten dieses Krimis.« Jens-Uwe Sommerschuh im Magazin der Sächsischen Zeitung
»Filastò führt eine leichte, elegante Feder; er ist ein überdurchschnittlicher Erzähler mit sicheren Instinkten für die Erwartungen des Lesers.« FAZ
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Nino Filastò
Fresko in Schwarz
Ein Avvocato Scalzi Roman
Aus dem Italienischenvon Esther Hansen
Inhaltsübersicht
Über Nino Filastò
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil
Kapitel 1: Grau
Kapitel 2: Schwarz
Kapitel 3: Archivare
Kapitel 4: Private Ermittlerin
Kapitel 5: Ermittlungen von privater Seite
Kapitel 6: Bleisoldaten
Kapitel 7: Gerichtsverhandlung
Kapitel 8: Zigeunertango
Kapitel 9: Ein gewisser Pepo
Kapitel 10: Historia Florentina: Masaccios Tod
Kapitel 11: Historia Florentina: Die Sagra und eine Geheimgesellschaft
Kapitel 12: Gelehrter Disput
Kapitel 13: Ein alter Bekannter
Kapitel 14: Vernehmung des Angeklagten
Kapitel 15: Chinesische Dialektik
Zweiter Teil
Kapitel 16: Auf dem Abstellgleis
Kapitel 17: Der Eingeschlossene von Sant’Agata
Kapitel 18: Auf der Suche nach Biserka
Kapitel 19: »An den Besiegten erkenne den Sieger«
Kapitel 20: Krebse, Kaviar, Sassicaia
Kapitel 21: Florentiner Notturno
Kapitel 22: Klösterliches Geheimnis
Anmerkungen
Impressum
»Nun haben wir ihn, das ist alles«, sagte er. »Ich kenne einen Hund, der diesem Geruch bis ans Ende der Welt folgen würde. Wenn eine Meute einem über den Boden einer Grafschaft geschleiften Hering nachspüren kann, wie weit kann dann ein speziell geschulter Hund einem derart stechenden Geruch folgen?«
Arthur Conan Doyle, Das Zeichen der Vier
Den Freunden des Vereins ArtWatch
Erster Teil
1Grau
Bereits auf dem Hinweg zur Bar war Olimpia mit ihrem Regenschirm kurz im Rahmen des Schaufensters aufgetaucht, zwischen den spinnenförmigen Armen der Göttin Kali und einem vom Regenwasser geschwärzten, verwitterten Wächter der Nepalbrücke. Dabei hatte der Ruf zur Pflicht sich noch auf einen flüchtigen Seitenblick beschränkt. Auf dem Rückweg von der Kaffeepause jedoch überquerte sie zielstrebig die Straße, ließ sich aus der linken Faust eine Erdnuß in den Mund fallen, während die rechte den Schirm hielt, dann stieß das wandelnde Gewissen der Anwaltskanzlei mit dem Knie die gläserne Tür des Geschäfts einen Spaltbreit auf und steckte den Kopf herein:
»Ich grüße die Herrenrunde vom Borgo Santa Croce. Du kannst dich ja kaum retten vor Arbeitswut, was, Avvocato?«
Corrado Scalzi fühlte sich ertappt. Heute nachmittag waren ihm die Akten, die sich auf seinem Schreibtisch stapelten, noch dröger vorgekommen als sonst. Das Klingeln des Telefons hatte ihn so genervt, daß es ihn kaum auf dem Stuhl hielt, unter dem Tisch scharrte er nervös mit den Beinen, die innere Unruhe ließ ihm keinen Frieden. Wenn er aus dem Fenster sah, fiel sein Blick auf einen bleiernen Himmel, der sich in der Scheibe spiegelte und die Blätter der Steineiche mit einem grauen Schleier überzog.
So hatte Avvocato Scalzi die Kanzlei mit einer dahingebrummelten Ausrede verlassen, nachdem er sich davon überzeugt hatte, daß heute keine Termine mehr anstanden – zumindest keine, die sich nicht verschieben ließen.
Ein graues Florenz war gar nicht lustig. Bei Sonnenschein spielten die Steine des Zentrums leicht ins Bläuliche. Doch an diesem Februartag war der Himmel dicht und trist wie das Fell einer Maus, und die Sträßchen im Viertel Santa Croce wirkten in ihrem trostlosen Grau wie aus Rauch gemacht.
Die Leuchtschrift der kleinen Bar neben der Kanzlei war erloschen. Die Straßenlaternen schienen eine gelbliche Schleimspur auf die Mauern zu zeichnen. Die Feuchtigkeit breitete sich aus und trieb den durchdringenden Geruch des Hochwasserschlamms vom Arno durch die in einem Oval verlaufenden Gassen, die zu Römerzeiten die Laufgräben des Amphitheaters gewesen waren. Scalzi mußte bei dem Geruch in den menschenleeren Straßen an den Muff unter den Röcken einer ungepflegten Alten denken. Die kleinen, auch in der Hochsaison von Touristen vernachlässigten Geschäfte strahlten einen Hauch von Melancholie aus. In den seltenen Pausen des Mopedgeknatters, das aus der Via de’ Benci herüberkam, hörte er das gleichmäßige Rauschen des feinen, fast unsichtbar strömenden Regens.
Scalzi hatte die hundert Meter zwischen der Kanzlei und der kleinen Kreuzung zurückgelegt, von welcher der Borgo Santa Croce abzweigte. Giuliano saß in seinem Laden hinter dem Telefontischchen und sprach leise mit Signor Palazzari, der fröstelnd in Mantel und Schal gewickelt war, auf dem Kopf einen breitkrempigen Hut.
Giuliano war also von seiner Indienreise zurück. Scalzi betrat das Geschäft für orientalische Antiquitäten, das den beziehungsvollen Namen »Homo Sapiens« trug.
Die Glastür hatte sich automatisch wieder geschlossen, und Olimpias Stimme war nicht mehr zu vernehmen, so daß der Avvocato seiner Irritation nur mit einem fragenden Blick Ausdruck verleihen konnte.
Olimpia stieß nochmals die Tür auf, blieb aber draußen im Regen stehen:
»Im Büro warten Leute auf dich.«
»Laß sie warten«, schnaubte Scalzi.
Das Gespräch der beiden Männer wandte sich gerade einem neuen Thema zu.
»Dieses Männlein, das immer wie eine Maus hier vorbeihuschte und dabei fast mit den Mauern verschmolz …«, setzte Giuliano an.
»Der mit dem Bart?« erkundigte sich Signor Palazzari.
»… der immer irgendwie wütend aussah, immer in Eile war, als hätte er wahnsinnig wichtige Dinge zu erledigen«, präzisierte Giuliano.
Ein Gefühl der Langeweile überkam Scalzi. Jetzt würden sie wieder über jemanden herziehen. Er hatte gehofft, daß seine Laune sich beim Anblick der farbenfrohen tibetanischen Tankas und des japanischen Porzellans bessern würde. Daß der Handelsreisende vielleicht ein paar exotische Abenteuer zum besten geben oder ihnen einen ungewöhnlichen Gegenstand zeigen würde, den er auf seiner Reise erstanden hatte.
Doch auch im »Homo Sapiens« glich die Atmosphäre dem Tag dort draußen. Als Scalzi hereingekommen war, beendete Signor Palazzari gerade seinen Klagegesang über einen Anflug von Grippe. Giuliano wiederum schien deprimiert. Seine Neuerwerbungen würden erst in einer Woche per Kurier aus Nepal eintreffen; außerdem war sowieso nichts Besonderes darunter, der Markt gab zur Zeit nicht viel her, die Reise war langweilige Routine gewesen, die nur von den Ausläufern eines schrecklichen Erdbebens unterbrochen wurde, das die Region Gujarat heimgesucht hatte.
Das indische Fernsehen hatte laut Giulianos dramatischem Bericht von Opferzahlen gesprochen, die an die »zweieinhalb Lakh« heranreichten, wobei das indische Wort lakh gleichbedeutend sei mit hunderttausend und das Erdbeben folglich zweihundertfünfzigtausend Tote und Vermißte gefordert hatte.
Scalzi versuchte die Unterhaltung noch einmal auf die Naturkatastrophe zu lenken:
»Ich sehe darin geradezu etwas metaphysisch Böses. Die Schulkinder zum Beispiel. Wie viele verfluchte Zufälle mußten zusammenkommen, damit dieses Beben der Stärke acht just in dem Augenblick losbrach, als eine Prozession von über zweihundert singenden und irgendeinen Gedenktag feiernden Kindern in die Gasse zwischen den baufälligen Häusern einbog? Als hätte eine böse Macht das genaustens geplant und ausgetüftelt. Alle unter den Trümmern begraben, nicht eines gerettet! Wir werden von da oben regiert, aus dem Weltraum, von einem allmächtigen Außerirdischen, der ganz entschieden ein Sadist ist …«
Aber niemand ging auf Scalzis eschatologische Provokation ein.
»Den kenne ich gut«, fuhr Signor Palazzari unbeirrt fort, ohne den Einwurf des Avvocatos zu beachten. »Ich habe ihn sogar schon mal für ein Gespenst gehalten.«
»Wen?« fragte Giuliano, abgelenkt durch Olimpia, die mit plattgedrückter Nase den im Schaufenster ausgestellten Schmuck begutachtete und in der er eine potentielle Kundin vermutete.
»Na, diesen Typ, von dem du redest. Ich meine, man könnte ihn geradezu für ein Gespenst halten …«
Signor Nino Palazzari liebte Geschichten, die auf irgendeine Art mit dem Übersinnlichen zu tun hatten. Immer wieder erzählte er von einer Vorfahrin seiner Familie, die vom Papst in aller Form seliggesprochen worden war und deren Leichnam in einem Kloster in Messina ruhte; er dachte nie daran, daß diese Stadtlegende den Besuchern des »Homo Sapiens« nur zur Genüge bekannt war. Die Leiche der frommen Frau sei noch völlig intakt, so seine Überzeugung, und das, obwohl sie bereits im siebzehnten Jahrhundert verstorben war. Palazzari zufolge hörten die Fingernägel der alten Tante nicht auf zu wachsen, so daß die Klosterschwestern sie ihr immer wieder schneiden mußten und die Späne anschließend den Gläubigen als Reliquien verkauften.
Das Prasseln des nun heftiger strömenden Regens überlagerte allmählich das entfernte Rauschen der Autos auf dem nassen Asphalt der Via de’ Benci.
Signor Palazzari kicherte, indem er seine Nase zwischen Mantelkragen und Schal vergrub:
»Calogero Catanese, kennst du den?«
»Den Trickspieler? Aber natürlich!« Giuliano nickte mit angewiderter Miene.
»Der hat es geschafft, deinem huschenden Männlein eine bedeutende Briefmarkensammlung abzuluchsen, im Wert von rund zweihundert Millionen Lire. Die hatte sich die graue Maus nach und nach aus den Familienarchiven des Florentiner Adels zusammengesammelt. Im Gegenzug erhielt er von Catanese eine Leibrente: eine halbe Million monatlich, schriftlich vereinbart und alles. Der edle Signor Catanese zahlte drei oder vier Monate lang, dann stellte er alle Zuwendungen ein. Unser gespenstischer Alter … wie heißt er doch gleich …«
»Jacopo Brancas«, ergänzte Giuliano, »Spitzname Ticchie.«
»Stimmt. Ticchie. Warum er wohl so genannt wird? Florentinische Spitznamen sind häufig sehr rätselhaft. Ich, zum Beispiel, wurde als junger Mann an der Universität Nino Grappino genannt. Warum?«
»Vielleicht vom Grappa, weil du in deiner Jugend hin und wieder einen gebechert hast?« vermutete Giuliano.
»Also, dieser arme Ticchie … Wenn ich so darüber nachdenke, vielleicht ist der Name eine Abkürzung von ›lenticchie‹, Linsen. Da Brancas sich Tag und Nacht die Augen über den Manuskripten ruiniert, ist er blind wie ein Maulwurf. Und hat immer eine Brille mit Metallgestell auf, so eine kleine, altmodische, mit kreisrunden Gläsern … Ach, das muß ich euch erzählen …«
Wieder mußte Palazzari sein Lachen im Mantelkragen ersticken.
»Ticchie wußte, daß ich mit Catanese befreundet war, ich kannte ihn noch von der Universität. Auch seine Freunde kann man sich ja nicht immer aussuchen. Mit Tränen in den Augen kam Ticchie also zu mir, der Ärmste. Er bat mich, den Betrüger Mores zu lehren. Daß er die Briefmarkensammlung zurückbekommen würde, war ausgeschlossen, damit hatte er sich abgefunden. Aber Catanese sollte ihm doch zumindest einen Teil der Leibrente zahlen, wenn schon nicht jeden Monat, dann doch wenigstens jeden dritten, und wenn nicht die ganze Summe, so doch zumindest die Hälfte … Er tat mir leid, und ich nahm mir vor, mit Catanese zu reden. Ticchie hatte nicht mal genug Geld fürs Essen. Wenn ich den Betrüger also traf, und das war zu jener Zeit nicht gerade selten, sagte ich daher immer: ›Nun bezahl ihn schon, verflucht noch mal, finde eine Lösung für ihn, gib ihm eine einmalige Sonderzahlung, du willst doch nicht einen armen Christenmenschen quälen, oder? Du bist wirklich fies …‹ Und so weiter. Ich ließ ihn nicht in Ruhe, ich nervte ihn, wie die sprechende Grille aus Pinocchio.«
Olimpia hielt es nicht länger im Regen. Sie schloß den Schirm, schüttelte das Wasser ab und betrat den Laden.
»Was ist, Avvocato? In der Kanzlei wirst du seit fünf Uhr erwartet«, sagte sie leise.
»Ich komme ja gleich«, brummte Scalzi.
»Eines Tages dann«, fuhr Signor Palazzari fort, »ich will gerade wieder einmal mit meinem Sermon ansetzen, unterbricht mich Catanese: ›Wie, du weißt es noch nicht? Der arme Brancas alias Ticchie ist gestorben. Vor fast drei Monaten.‹ – Den Hungertod gestorben, du Witzbold, denke ich bei mir. Aber ich bin froh, daß die Sache endlich ein Ende hat, ich habe die Nase voll davon. Und es gab auch keinen Grund, daran zu zweifeln, da ich Ticchie schon länger nicht mehr gesehen hatte. Aber es vergeht eine kleine Zeit, ich weiß nicht mehr, wie lange. Eines Abends … Es war ein Abend wie heute, regnerisch, ich bin hier … das heißt, ich stehe auf der anderen Seite der Straße, unter dem Bogengang der Bar delle Colonnine. Ich warte darauf, daß der Regen nachläßt, damit ich die Straße überqueren kann, es schüttet wie aus Eimern, geradeso wie jetzt. Da glaube ich ihn plötzlich zu sehen, Ticchie, grau in grau, wie er still an der Straßenecke der Via de’ Neri steht. Ein Irrtum, denke ich: bei diesem Regen und der Funzelbeleuchtung an der Kreuzung … Doch dann sehe ich, wie er über die Straße geht, bleich wie ein Leintuch, ganz langsam einen Fuß vor den anderen setzend. Die Augen hat er starr auf mich gerichtet, Vorwurf im Blick. Als er auf der Mitte der Kreuzung ankommt, gibt es keinen Zweifel mehr: Er ist es! Dabei bin ich so sicher, daß er tot ist, daß mir ein eisiger Schauer über den Rücken läuft. Daß der Catanese gelogen haben könnte, kommt mir nicht mal in den Sinn, ich weiche seinem starren Blick aus, der Schauer ist bei den Füßen angekommen und sammelt sich dann in der Mitte, so daß es mir die Arschbacken zusammenzieht. Ich bin felsenfest überzeugt, daß ich es mit einem Gespenst zu tun habe, das aus seinem Grab auferstanden ist, um mir vorzuwerfen, ich hätte mich bei dem Gauner nicht für ihn eingesetzt. Dann geht Ticchies Geist grußlos an mir vorüber, er gleitet wie auf Eis. Als er die Tür zur Bar delle Colonnine erreicht, bin ich sicher, daß er durch sie hindurchschweben wird, und sehe zu meiner Überraschung, daß er sie ganz normal aufdrückt. Erst als ich höre, wie er einen Cappuccino bestellt, komme ich allmählich wieder zu mir. Aber meine Arschmuskeln entspannen sich erst, als ich ihn trinken sehe.«
»Wenn du ihn heute treffen würdest«, bemerkte Giuliano in melancholischem Ton, »wäre er wirklich ein Geist. Das habe ich letzten Dienstag in der Osteria de’ Benci erfahren. Am Montag haben sie Ticchie gefunden, tot, er saß am Tisch in einem kleinen Nebenraum der Nationalbibliothek. Aber vermutlich hatte er unser irdisches Jammertal schon seit zwei Tagen verlassen. Mindestens seit letzten Samstag, die graue Maus konnte wohl auch mit Büchern verschmelzen, nicht nur mit Mauern. Man sagt, daß er schon zu riechen begann und ein Student ihn deshalb bemerkt habe.«
»Das habe ich auch gehört. Eine Bibliotheksangestellte hat es mir erzählt. Sie aber sagte, er sei ermordet worden«, mischte sich Olimpia ein, die derlei makabre Geschichten mochte. »Dazu würde auch passen, daß seit Montag permanent ein Einsatzwagen der Kripo vor der Nationalbibliothek steht.«
2Schwarz
Der Mord an Brancas machte keine Schlagzeilen. Dabei war er ein einziges Rätsel, auf das sich die Zeitungen zu einem anderen Zeitpunkt mit Vergnügen gestürzt hätten.
Zunächst einmal war da die Todesart, kein ganz gängiger Mord, sondern das Werk eines Profis, der sein Opfer von hinten stranguliert hatte. Als Brancas gefunden wurde, ruhte er mit dem Kopf auf dem alten Buch, das vor ihm auf dem Tisch lag. Der Kragen seines Pullovers verdeckte das rote Mal der wahrscheinlich metallenen Schlinge, mit der man ihn erwürgt hatte.
Vielleicht um den anderen Bibliotheksbesuchern den unschönen Anblick des verarmten Archivars zu ersparen, hatte die Direktion Ticchie einen kleinen Raum überlassen, der früher als Sammelstelle für restaurierungsbedürftige Bücher gedient hatte. Ein abseits gelegener Ort, an dem Brancas seit neuestem den Tisch mit einem anderen Forscher teilte, der ungefähr in seinem Alter, aber wesentlich besser gestellt war als er.
Sein gewohnter Tischnachbar war seit Samstag abwesend, dafür war sein Platz vorläufig von einem nordafrikanischen Studenten belegt worden.
Wenn man nur etwas genauer hinsah, bemerkte man, daß der Kopf irgendwie unnatürlich dalag, ganz schief und schlaff wie bei einem geschlachteten Huhn.
Doch der Student, der dem Opfer gegenüber gesessen hatte, war viel zu sehr in eine Originalausgabe des Rotbuchs der Wächter der Ehrenhaftigkeit über das Wirken der Florentiner Sittenaufsicht vertieft, um es wahrzunehmen. Seine historisch-soziologische Examensarbeit beschäftigte sich mit der Sünde im Florenz der Renaissance. Dazu gehörte eine juristische Analyse der Steuern und gelegentlichen Sonderabgaben, welche die Kommune den Prostituierten aufzwang, die in der Zeit vom vierzehnten bis sechzehnten Jahrhundert die Gegend um den Mercato Vecchio bewohnten; es gab damals eine so große Zahl von Bordellen und Straßenhuren in dem Bezirk, daß er schon fast einem Rotlichtviertel ähnelte. Diese Sittenchronik aber war in einem sehr unvollkommenen Latein verfaßt und mit flatternder Bürokratenhandschrift geschrieben und folglich schwer zu entziffern. Daher hatte der Student seinem Tischnachbarn den ganzen Morgen keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt. Erst um die Mittagszeit hatte er plötzlich bemerkt, daß ihm ein Leichnam gegenübersaß, als ihm nämlich auffiel, daß der unangenehme Geruch nicht der Verpackung entstieg, also den lumpigen Kleidern der reglosen Figur, sondern sozusagen dem Inhalt. In der Zeitung hieß es, daß der zerstreute Student nach dieser Entdeckung erst einmal auf die Toilette gerannt sei, um sich zu übergeben.
Auch das Tatmotiv war ziemlich mysteriös. Wer konnte etwas gegen den Archivar Ticchie haben, der mit bibliographischen Recherchen sein Leben fristete, vorausgesetzt, er fand einen Auftraggeber, was in letzter Zeit immer seltener vorkam?
Die weniger lukrativen Aufträge stammten vom Heraldischen Institut, das im Namen ehrgeiziger Geschäftsleute nach Resten adliger Herkunft forschen ließ und ihm dabei sehr deutlich die Hand führte und die Ehrbarkeit beeinflußte. Hin und wieder beauftragte ihn auch ein Notar mit Recherchen in kleineren Erbschaftsstreitigkeiten. Einige Kunsthistoriker, die man an einer Hand abzählen konnte, ließen sich von ihm bei der Veröffentlichung eines Buches helfen, das einen historischen Teil über das alte Florenz enthielt. Ticchie war als Experte auf diesem Gebiet bekannt, so daß er für die Glaubwürdigkeit sowohl der Quellen als auch der Details ein sicherer Gewährsmann war.
Doch diese Beschäftigung war dem Untergang geweiht. Bei den derzeitigen demokratischen Verhältnissen nahm die Zahl der Geschäftsleute, über deren Namen auf der Visitenkarte ein Krönchen thronte, kontinuierlich ab. Ebenso die der Kunstwissenschaftler, die es noch für notwendig hielten, sich über historische Hintergründe zu informieren. Der größere Teil von ihnen fand es angenehmer, sich hinter der hermetischen Sprache einer rein ästhetischen Kritik zu verbarrikadieren.
Und im übrigen war der strahlende Stern des Internets gerade dabei, allen Bibliotheksmäusen den Garaus zu machen. Allgemeines Ausmisten, keine staubgrauen Nager mehr, die sich, über alte Folianten gebeugt, die Augen verdarben beim Versuch, Inkunabeln und andere Schwarten zu entziffern, wo es doch genügte, einen Eintrag anzuklicken und ein paar Sekunden zu warten: Ja, wozu brauchte man überhaupt noch Bibliotheken?
Ein Geheimnis also das cur und auch das cui prodest1.
Und noch ein weiterer Umstand sorgte dafür, daß der sonst unstillbare Durst der Journalisten nach dem Unerklärlichen gelöscht war: Die Stadt hatte bereits genügend Mysterien. In Florenz waren Verbrechen in den letzten Jahren so normal geworden, daß sie keiner Nachricht mehr wert waren; die Stadt schien unentrinnbar in ein Knäuel aus Greueltaten verstrickt.
Die Taten des »Ungeheuers von Florenz«, des berüchtigten Pärchenmörders, gar nicht einmal mitgezählt, hatte es eine Reihe von Morden an Huren in ihren eigenen Wohnungen oder anderswo gegeben, die von der Justiz so lange ungeahndet blieben, bis sie dem allgemeinen Vergessen anheimgefallen waren. Eine mehr oder weniger, was tat’s, schließlich gab es ihrer so viele und in allen Farben, vom Milchweiß der Slawinnen bis zum Nachtschwarz der Nigerianerinnen, die an den Umgehungsstraßen auf und ab schlenderten, am Bahnhof oder an den Ufern des Arno auf Kundschaft warteten, wen interessierte es schon, wenn sich hin und wieder jemand dazu herbeiließ, ihre Zahl ein wenig zu dezimieren? Zumal ja immer nur Ausländerinnen ermordet wurden, Afrikanerinnen, Albanerinnen, Mitteleuropäerinnen, Russinnen, und jene Mädchen verschont blieben, die die Gäßchen um den Mercato di San Lorenzo bevölkerten, die weniger verschlossen und zugänglicher waren, ein Schandfleck natürlich auch sie, doch immerhin in einer Gegend, die seit Jahrhunderten dem Geschäft der käuflichen Liebe vorbehalten war. Vielleicht gerieten auch deshalb die abscheulichen Morde an den ausländischen Freudenmädchen sofort in Vergessenheit.
Dann waren da die Homosexuellen, die nachts im Parco delle Cascine ermordet wurden. Aber das geschah so häufig, und die Verbrechen blieben so vollkommen undurchschaubar, daß die Stadt sich in einem Dilemma befand: Entweder mußte sie den Park in Festbeleuchtung tauchen und die gelblichen Friedhofslaternen ersetzen, welche die Dunkelheit, anstatt sie zu durchdringen, nur noch unheimlicher machten, oder aber die Zufahrtswege sperren und die Gärten in der Nacht schließen. Vor diese Entscheidung gestellt, hatten die öffentlichen Träger für die übliche Taktik votiert und die Dinge im gewohnten Halbschatten belassen.
Hinzu kamen noch zwei Adlige, die im Palazzo ihrer Ahnen niedergestochen worden waren, sowie ein Händler für sakrale Gegenstände, der um neun Uhr vormittags in seinem Laden mitten im historischen Zentrum mit dreißig Messerstichen barbarisch hingerichtet wurde … Das Mysterium schien Florenz zu seiner Wahlheimat gemacht zu haben, aber es konnte dem Tourismus nur schaden, zu deutlich die Finger in die Wunde der nicht aufgeklärten Verbrechen zu legen.
Eine Woche also nachdem der Mord an dem Archivar landesweit durch Zeitungen und Fernsehnachrichten gegangen war, wanderte Brancas auf die Lokalseite, um dann innerhalb von zwei Wochen ganz zu verschwinden.
Allerdings genügten diese vierzehn Tage nicht, auch im »Homo Sapiens« das Interesse an dem Ereignis zum Erliegen zu bringen. Noch nie hatte ein Verbrechen das Umfeld des Konventikels so unmittelbar betroffen. Nicht nur die Bekanntschaft des Signor Palazzari mit dem Opfer, eine oberflächliche Bekanntschaft, gewiß, die aber durch die Episode mit dem Gespenst eine eigentümliche Betonung erfahren hatte, hielt das Thema am Leben. Ticchie war außerdem ein enger Freund Niccolò Pasquinis gewesen, eines weiteren Stammgasts im Laden für fernöstliche Antiquitäten.
Pasquini, der den ebenso blasphemischen wie hochtrabenden Spitznamen »der Messias« trug, besuchte das »Homo Sapiens« normalerweise einmal im Monat. Seine Besuche hatten ein doppeltes Ziel: Erstens kam er zum Spionieren, zweitens zum Lästern.
Niccolò sah Giuliano als Konkurrenten an, da er mit der gleichen Importware aus dem Fernen Osten handelte. Allerdings lag sein Geschäft in den Außenbezirken der Stadt, sehr weit von den touristischen Ufern des Arno entfernt, in deren Nähe sich das »Homo Sapiens« befand. Wieso also ein Konkurrent? Doch Pasquini war nun mal so ein Mensch, er sah alles unter dem Aspekt des Wettstreits. Giuliano verkaufte die gleichen Dinge wie er? Giuliano suchte dieselben Orte auf, folgte denselben exotischen Reiserouten? Also waren sie Konkurrenten, und es spielte keine Rolle, daß die Kunden des »Homo Sapiens« ausländische Touristen waren, hauptsächlich Amerikaner, die auf ihrem Weg von den Uffizien zur Basilika an dem Geschäft im Borgo Santa Croce vorüberkamen, und daß er, Niccolò, einen festen Kundenstamm von Sammlern hatte, denen er die gleichen Gegenstände verkaufte, für die Giuliano den dreifachen Preis verlangte. Man mußte das »Homo Sapiens« trotzdem im Auge behalten und versuchen, mit der Weisheit und den Gaben eines professionellen Beichtvaters die Geheimnisse des »Konkurrenten« zu ergründen.
Auf der anderen Seite empfand Pasquini, der nur selten Leute zum Reden hatte, um in seinem abseits, zwischen anonymen Wohnblocks gelegenen Laden die Zeit totzuschlagen – er wickelte seine Geschäfte fast ausschließlich über Korrespondenz ab –, den steten Publikumsverkehr im »Homo Sapiens« als höchst anregend für seine Lästerzunge. Und darin war er Meister: in der Verbreitung von Indiskretionen meist sexueller Natur, die diese oder jene Person von öffentlichem Ansehen betrafen.
Palazzari, der eine Antipathie gegen ihn hegte, sagte, er sei nur deshalb aus dem Priesterstand ausgetreten, um endlich Beichtgeheimnisse offenlegen zu können, ohne sich den Vorwürfen des Heiligen Offiziums auszusetzen. Tatsächlich war Niccolò Priester gewesen, bevor er begann, mit äußerst heidnischen Objekten zu handeln, die in früheren Zeiten als ketzerisch oder gar als Instrumente der Schwarzen Magie galten und ihn damals auf den Scheiterhaufen hätten bringen können.
Wenn Pasquini im »Homo Sapiens« war, nahm das Gespräch stets eine bestimmte Wendung. Niemals versäumte er es, beim Betreten des Ladens mit derselben geistlosen Bemerkung die Stimmung gefrieren zu lassen, aus der unschwer der Neid auf das vornehme und städtische Erscheinungsbild des in seinen Augen konkurrierenden Geschäfts herauszulesen war: »Der Homo sapiens, der verständige Mensch, hat ausgedient. Mit Dummheit kommst du heut weiter als mit Verstand!«
Ein Weilchen wartete der Messias dann ab, bis das laufende Gesprächsthema sich erschöpfte. Hin und wieder zog er dabei Giulianos Aufmerksamkeit auf sich, indem er wie nebenbei ein zum Verkauf angebotenes Objekt berührte: »Oh, wo hast du das denn her? Ich wette, aus Bali. Der Stil kommt mir bekannt vor …« Dabei irrte er sich absichtlich, um Giulianos Widerspruch zu provozieren und sich auf diese Weise von der braven Seele eine neue Bezugsquelle offenbaren zu lassen, einen noch wenig bekannten Markt, einen exotischen Grossisten mit traumhaften Preisen. Dann trat ein bösartiges Glitzern in Pasquinis winzige Äuglein, in dem sich die Befriedigung über den in Erfahrung gebrachten Geheimtip spiegelte. Er wurde ganz steif, rieb sich die Hände, auch sie winzig, wie alles an ihm irgendwie reduziert erschien: seine Statur, seine Arme und Beine, ja selbst die honigsüße Stimme eines Sakristans.
Wenn er an der Versammlung teilnahm, die Olimpia die »Herrenrunde vom Borgo Santa Croce« nannte, wartete Pasquini höflich die erste Gesprächspause ab, um dann mit sanfter Stimme, beharrlich wie eine Stechmücke, im genau richtigen Moment die neueste unerhörte Indiskretion loszuwerden. Seine liebsten Ziele waren dabei Personen des öffentlichen Lebens der Stadt. Schauspieler, Sänger, Maler, Künstler ganz allgemein, aber auch Prominente anderer Berufssparten sowie im Licht der Öffentlichkeit stehende Amtspersonen. Fast immer drehte sich das gelüftete Geheimnis um sexuelle Fehltritte, meistens im Bereich der Homophilie: »Habt ihr schon von dem und dem gehört, der dabei erwischt wurde, wie er einen Jungen im Kino belästigt hat? … Der Maler Caio, ja, ganz recht, Herrschaften, unser alter, allseits bekannter Caio: Er liest junge Fixer in einer Bar auf, bringt sie in seine Villa in Fiesole und läßt sich von ihnen mit Tritten traktieren. Nackt wie ein Wurm stöhnt er dann: ›Mehr, Liebster!‹ Bei den Junkies von San Pierino ist es bereits zum lukrativen, wenn auch langweiligen Nebenverdienst geworden: ›Was machst du heute abend?‹ – ›Ich fahr rauf nach Fiesole, dem Maler ein paar Arschtritte verpassen …‹«
Pasquini also war auch mit dem Toten befreundet gewesen. Ihr Umgang miteinander beruhte auf jener merkwürdigen Kraft, mit der sich Gegensätze anziehen. Schweigsam der Archivar, wortreich bis zur Erschöpfung – seiner Zuhörer – der Messias. Ticchie so keusch, daß man ihn mit Fünfzig noch für jungfräulich gehalten hätte. Pasquini dagegen mit dem Ruf eines Don Juan, und ebendiese Leidenschaft für das andere Geschlecht hatte ihn auch das Priesteramt gekostet, das die Kurie ihm nach unzähligen Skandalen in der ihm unterstellten Landpfarrei entzogen hatte. Verwahrlost wie ein Penner Ticchie, häufig in viel zu große Kleider der Wohlfahrt gehüllt, die zerschlissen, zusammengestückelt und oft in lächerlich grellen Farben gehalten waren. Pasquini dagegen stets in korrekten Maßanzügen in immer dunklen Tönen, mattem Schwarz, rauchfarben, vielleicht ein Überbleibsel seiner einstigen religiösen Tätigkeit, dazu Hemden aus Rohseide, Schuhe von Ferragamo. Seine phantasielos gemusterten Markenkrawatten von Ferré, Versace oder Gucci bildeten darin den einzigen Farbfleck.
Der Unterschied zwischen den beiden sprang nicht nur ins Auge, er stieg auch in die Nase. Ticchie umgab ein strenger Geruch von schlecht verdauter und reichlich mit Knoblauch gewürzter Armeleutekost, während Pasquini nach dem edlen Aftershave einer vornehmen alten Apotheke im Stadtzentrum duftete.
Worin also bestand das verbindende Element ihrer Freundschaft? Wovon handelten ihre stundenlangen Gespräche in Pasquinis chaotischem Lädchen – die sie nicht einmal für einen Espresso unterbrachen, Ticchie wegen fehlender finanzieller Mittel und Pasquini aus angeborenem Geiz? Niemand konnte es sagen, und doch wußte man im »Homo Sapiens« von ihren häufigen Zusammenkünften, Palazzari hatte es erzählt, der sie mehrmals beim Tête-à-tête überrascht hatte im staubigen Hinterzimmer von Pasquinis Butike, wo es stank wie in einem Trödelladen von Calcutta und die Gegenstände wahllos übereinandergetürmt waren.
An einem Morgen im März, vier Wochen nach der Tat, verweilte Avvocato Scalzi auf dem Rückweg vom Gericht für einen Augenblick in Giulianos Laden, der bereits voll von Menschen war, die sich angeregt unterhielten. Das heißt, eigentlich lauschten sie andächtig einem Monolog, denn Pasquini hielt hof. Und wie immer, wenn der Ex-Priester erst einmal in Fahrt war, konnte niemand ihn in seinem Wortschwall unterbrechen.
Außer Giuliano sah man natürlich Signor Nino Palazzari, heute aber auch den Journalisten Luigi Carparelli, einen Verschwörungstheoretiker, der von der fixen Idee besessen war, daß hinter allem und jedem umgelenkte Geheimdienste steckten. Schließlich war da Luca, der »Onkel«, so nannten ihn der Geschäftsführer und die Kellner der Osteria de’ Benci, wobei diese Familienbande reichlich dunkel waren, wenn man bedachte, daß die Familie des Trattoria-Besitzers von vornehmer persischer Herkunft war, Luca Graziadei hingegen ein waschechter Neapolitaner.
Pasquini hatte seit dem Mord an Ticchie Giulianos Laden fast täglich aufgesucht. An diesem Vormittag nun hielt er dem versammelten Publikum einen Vortrag, den er um so eindringlicher verstanden wissen wollte, als er mit leiser, fast gehauchter Stimme sprach. Und natürlich ging es seit einem Monat immer wieder um dasselbe: um das Verbrechen an dem alten Archivar.
Pasquini hegte seine Zweifel. Angefangen bei dem Tatmotiv. Ihm zufolge waren die Beweggründe in den Tiefen der Vergangenheit zu suchen. Nicht in der persönlichen des armen Brancas, vielmehr in der historischen Vergangenheit, so als hätte der Ermordete über Ereignisse geforscht, die nicht länger als eine Woche zurücklagen und ihn persönlich betrafen. Er hätte wissen müssen, und Pasquini war nicht müde geworden, ihn darauf hinzuweisen, daß es gefährlich war, gewisse vergangene Dinge wieder auszugraben, fast so, als erlebte man sie ein zweites Mal. Doch Brancas hatte nicht auf ihn gehört, und seit vielen Monaten war er nun schon in diese Forschungen vertieft, für die er sehr alte Druckschriften und einige seltene und wertvolle Manuskripte konsultierte, welche er dank seiner jahrelangen Tätigkeit als Archivar und Wissenschaftler in der Nationalbibliothek und dem Staatsarchiv einsehen durfte.
Was jedoch die jüngste Recherche betraf, so hatte er sich selbst seinem Freund und engsten Vertrauten Niccolò gegenüber sehr verschlossen gezeigt, da er dessen indiskrete Natur fürchtete. Ein völlig unbegründetes und kleinliches Mißtrauen, wie der Messias fand, der doch, wenn ein Freund ihm etwas Vertrauliches mitteilte, schweigen konnte wie ein Grab.
Wenn die Polizei ihn verhört hätte, wie es ihre Pflicht gewesen wäre, anstatt ihre Zeit mit pseudowissenschaftlichen Ermittlungen zu verplempern, hätte Pasquini wertvolle Hinweise zu den Nachforschungen beisteuern können, die, zumindest von außen besehen, nicht recht in Schwung kamen.
Zum Beispiel schien der arme Ticchie in letzter Zeit vor irgend jemandem Angst zu haben.
»Ist das etwa uninteressant? Es könnte doch eine heiße Spur sein, den oder diejenigen ausfindig zu machen, vor denen sich der arme Brancas so sehr fürchtete, oder?«
Der Messias hatte ihn oft an seinem Arbeitsplatz in jenem abgeschiedenen Raum der Nationalbibliothek besucht, er hatte sich ihm gegenüber an den Tisch gesetzt, wo der Archivar seine verstaubten Folianten wälzte und seine so geheime Recherche betrieb.
»Ich habe gute Augen, jawohl. Ich kann Gemütszustände erkennen. Ich merke es, wenn jemand auf glühenden Kohlen sitzt. Manchmal sah ich, wie er ganz plötzlich blaß wurde, die Hände rang und einen richtig verängstigten Gesichtsausdruck bekam, so als befände er sich in Lebensgefahr.«
Das aber hatte er erst in den Monaten unmittelbar vor seinem Dahinscheiden bemerkt. Vorher sei Brancas zwar ein sorgenvoller Charakter gewesen – so wie er die Straßen beinahe entlangrannte, vornübergebeugt und die Tasche voll alter Zeitungen unter den Arm geklemmt –, doch hatte es sich dabei eher um alltägliche Sorgen gehandelt. In den letzten Monaten aber habe er diesen verzweifelten Blick bekommen. Er, der wahrhaftig Sitzfleisch hatte, der Stunde um Stunde ohne die geringste Bewegung am Tisch ausharren konnte, wenn man mal von der rechten Hand absah, die die Seiten umblätterte, während die linke sich Notizen machte – er war Linkshänder –, schien von einem bestimmten Augenblick an plötzlich Hummeln im Hintern zu haben, er rutschte auf dem Stuhl hin und her, unterbrach die Lektüre oder das feinsinnige Gespräch mit dem Freund, blieb minutenlang am Fenster stehen, um in einer Art Panik auf die Geräusche zu lauschen, die von draußen hereindrangen.
»Einmal sah ich, wie er aufstand, über den Flur ging und ans Fenster trat. In krampfhaft gespannter Haltung blickte er einige Minuten hinaus. Plötzlich sah ich, wie er zurückwich, als hätte ihn etwas erschreckt. Er kehrte zum Tisch zurück und biß auf seinem Kopierstift herum – er benutzte diese unmöglichen alten Kopierstifte der Marke Fila, ich sehe noch genau seine blauverschmierten Lippen vor mir –, dann setzte er sich wieder hin und stützte den Kopf in die Hände. Fast hatte ich den Eindruck, als wolle er wie ein Kind anfangen zu weinen.«
»Als er das nächste Mal«, fuhr Pasquini fort, »vom Tisch aufstand und zum Fenster im Flur ging, trat ich neben ihn. Ich sah die Autos auf der Suche nach einem Parkplatz, wie sie vor dem Eingang der Bibliothek anhielten, dann die Polizei bemerkten, die den Verkehr zum Corso dei Tintori umleitete, so daß sie sich am Ende wieder in den Verkehrsfluß am Arno einfädeln mußten. Plötzlich schnellte Ticchie nach hinten, als hätte er eine Schlange gesehen. Da sah ich, wie ein größeres Motorrad in Richtung Arno davonfuhr. Und ich erinnerte mich, daß Brancas immer dann sehr unruhig geworden war, wenn von der Piazza her das Dröhnen einer großen Maschine hörbar wurde. Wäre so was nicht interessant für die Ermittlungen? Ich war sein einziger Freund. Und dennoch hat mich nie einer befragt. Nie einer hat gesagt, entschuldigen Sie, Sie kannten ihn doch sehr gut, haben Sie vielleicht einen Verdacht? Ist Ihnen irgend etwas aufgefallen?«
Pasquini erinnerte sich, daß der Motorradfahrer mit großer Geschwindigkeit am Fenster vorbeigefahren war, wie ein dunkler Blitz. Gemerkt hatte er sich nur die schwarze Lederkluft des Fahrers und seinen schwarzen Helm mit abgetöntem Visier.
Die Polizei hätte diesen »schwarzen Reiter« finden, sie hätte ihn identifizieren und befragen sollen, um endlich mal einen Schritt weiterzukommen.
Da nun mischte sich der Verschwörungstheoretiker Carparelli ein. Der Motorradfahrer sei ein sehr schwaches Indiz, genaugenommen überhaupt keins. Es sei durch nichts bewiesen, daß Ticchie ausgerechnet vor diesem Mann in Schwarz Angst hatte, der doch, zumindest laut Pasquinis Bericht, nicht im geringsten auf den Archivar am Fenster geachtet hatte. Alles an dem Verbrechen ließe auf dunklere Hintergründe schließen, er selbst glaube darin die Handschrift eines mysteriösen Agenten zu erkennen. Denn wenn der Schlüssel zu dem Verbrechen, so zweifelte der Journalist, in den Recherchen lag, die der Verstorbene durchgeführt hatte, wie war es dann möglich, daß der Messias trotz seines Scharfblicks und seiner profunden Kenntnis des Ermordeten deren Gegenstand nicht herausgefunden hatte?
Brancas, so erwiderte Pasquini, sei eben sehr zugeknöpft gewesen, Fragen sei er immer ausgewichen, er habe sich so lächerlich verhalten wie ein Schuljunge, der seinen Banknachbarn nicht abschreiben lassen will, er habe sogar die Titel der eingesehenen Bücher mit Zeitungsschnipseln abgedeckt, die er für seine Notizen benutzte.
Überhaupt, die Zeitungsschnipsel. Man stelle sich nur mal dieses Elend vor: Der arme Mann benutzte alte Zeitungen als Notizzettel. Pedantisch schnitt er sie in kleine Quadrate, um dann mit dem Kopierstift in Ameisenschrift quer über die gedruckten Zeilen zu kritzeln. Zusammengehalten wurden die Zettel von einer rostigen Büroklammer.
Einmal, als Ticchie seinen Platz verlassen hatte, um zur Toilette zu gehen, und das Zettelbündel auf dem Tisch zurückgeblieben war (nicht so das Buch, über dem er gerade arbeitete, das hatte er vorsichtshalber mitgenommen), hatte Pasquini versucht, die Notizen zu lesen, aber ohne Erfolg, die blasse Farbe des Kopierstifts auf den gedruckten Zeilen der Zeitung verschmolz mit der winzigen Handschrift zu einem unentzifferbaren Etwas, das eines Geheimdienstes würdig gewesen wäre.
Luigi Carparelli nickte ahnungsvoll: »Sag ich doch.«
Etwas hatte der Messias dennoch herausgefunden. Bei den Recherchen, mit denen sich Brancas vor seinem gewaltsamen Tod beschäftigt hatte, handelte es sich nicht um Kinkerlitzchen, da steckten keine Wappenjäger dahinter und auch keine sich streitenden Erben. Da ging es um eine Sache, bei der eine ganze Menge Geld im Spiel war.
Eines Vormittags nämlich, nachdem er sich stundenlang Auszüge aus einem Buch gemacht hatte, das aus dem siebzehnten Jahrhundert stammte, wie der Messias an der Bindeart hatte erkennen können, hatte Brancas mit hochroten Wangen unter dem Bart – ein absoluter Ausnahmezustand, da seine natürliche Gesichtsfarbe eher ein blasses Grau war – mit der Faust auf den Tisch geschlagen und gesagt:
»Das ist es! Mit dieser Information könnte ich Millionär werden, wenn ich wollte!«
Eine weitere Spur konnte Pasquini zufolge ein gewisser Typ sein, der in letzter Zeit mit an Brancas’ Tisch gearbeitet hatte.
»Ein zurückhaltender älterer Herr, der mir immer seinen Platz überließ, wenn ich Brancas besuchen kam. Er ging dann auf den Flur, eine Zigarette zu rauchen, aber ich hatte das Gefühl, daß er unseren Gesprächen lauschte wie ein Spion.«
Luigi Carparelli nickte:
»Sag ich doch.«
3Archivare
Der ältere Herr wartete schon seit über eine Stunde, als Scalzi ihn bemerkte, während er den letzten Klienten des Tages zur Tür begleitete.
»Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf?«
Der Herr stand auf und hob die Hand zu einem militärischen Gruß in Augenhöhe.
»Chelli!«
Damit schien der Klient alles Nötige gesagt zu haben, um endlich sein gutes Recht zu erhalten und vorgelassen zu werden.
Doch Scalzi erwartete keinen Klienten mehr, der Name Chelli stand nicht in seinem Terminkalender, innerlich war er schon darauf eingestellt, nach Hause zu gehen. Er spürte, wie Gereiztheit in ihm aufstieg und sich der Müdigkeit eines langen Tages zugesellte, den er am Vormittag im Gerichtssaal und am Nachmittag in anstrengenden Sitzungen mit einigen der wehleidigsten Klienten der Kanzlei verbracht hatte. Er verließ das Wartezimmer und stützte die Hand auf den Schreibtisch von Lucantonio, dem Anwaltsgehilfen und Faktotum der Kanzlei:
»Wer hat dem Signore gesagt, daß er warten soll?«
»Ich nicht«, murrte Lucantonio genervt.
»Das war ich.«
Olimpia erschien auf der Schwelle ihres Zimmers am Ende des Korridors.
Scalzi ging ins Wartezimmer zurück. Der Mann richtete sich auf, er war alt, sehr hochgewachsen, hatte ein langes Gesicht und den Augenausdruck eines geprügelten Hundes.
»Es tut mir leid«, sagte Scalzi, »Sprechstunde nur nach Vereinbarung.«
Er wies auf die Tür hinter sich.
»Dottor Siciliano wird einen Termin mit Ihnen ausmachen, wenn Sie ein andermal wiederkommen möchten. Guten Abend.«
Aber der neue Klient rührte sich nicht von der Stelle, er fixierte den Anwalt mit abwesender Miene. Scalzi nahm seinen Mantel vom Kleiderständer und wollte gerade hineinschlüpfen, als Olimpia sich zwischen ihm und der Tür aufbaute.
»Es ist aber wichtig …«
»Er soll an einem anderen Tag wiederkommen.«
»Sehr wichtig … es geht um den Mord an Brancas. Der interessanteste Klient seit Monaten.«
»Wunderbar«, sagte Scalzi und öffnete die Tür zum Treppenhaus, »dann laß du dir doch seine wichtige Geschichte erzählen.«
»Ich bin aber nicht der Anwalt«, protestierte Olimpia.
»Das ist egal. Ich bin müde. Wir sehen uns zu Hause.«
Und er ging. Aus dem Klang seiner schnellen Schritte auf der Treppe sprach die Ungeduld, mit der er seiner Wohnung am Stadtrand zustrebte, wo die Luft sauberer war und man in den Bäumen das beruhigende Gurren der Tauben hören konnte.
Beim Abendessen herrschte beleidigte Stille. Schließlich brach Olimpia das Schweigen.
»Er ist Archivar, genau wie der andere.«
»Welcher andere?«
»Na, der Tote. Dieser Brancas. Ticchie.«
»Also gut«, seufzte Scalzi, »dann erzähl mal.«
Eigentlich bevorzugte er beim Abendessen Themen, die nichts mit der Arbeit zu tun hatten, doch Olimpia davon abzubringen, daß sie ihm ihren Bericht über diesen so wichtigen Fall des neuen Klienten gab, war ein aussichtsloses Unterfangen.
Besagter Klient ging also der gleichen Beschäftigung nach wie der Ermordete. Sie hielten sich häufig in demselben Kämmerlein der Nationalbibliothek auf, das Brancas großspurig seinen »privaten Lesesaal« nannte. Signor Chelli hatte darum gebeten und auch die Erlaubnis erhalten, gleichfalls dort arbeiten zu dürfen.
»Was einem doch irgendwie merkwürdig vorkommt«, Olimpia sah Scalzi vielsagend an, »da es sich allem Anschein nach um eine Art Abstellkammer handelt, klein und stickig, mit nur einem Tisch darin. Am Samstag, als Brancas ermordet wurde, war unser Mann nicht in dem Kabuff, und auch nicht am Montag darauf. Er sagte mir, er habe die Grippe gehabt.«
Signor Chelli stöberte aus persönlicher Leidenschaft in der alten florentinischen Geschichte. Als leitendem Angestellten bei der Handelskammer und nunmehr im Ruhestand ging es ihm vergleichsweise gut, er mußte für seinen Lebensunterhalt nicht mehr arbeiten.
Brancas tat ihm leid, der sich immer so verzweifelt bemühte, Mittag- und Abendessen miteinander zu verbinden. Chelli hatte ihm mehrmals seine Hilfe angeboten. Für ein konkretes Ziel hätte er sich gern ein wenig die Augen verdorben. Aber Brancas war von eher ungeselliger Natur, um nicht zu sagen abweisend, und wachte eifersüchtig über seine Forschungen, besonders jene letzten in der Zeit vor seiner Ermordung.
»Unser Klient«, fügte Olimpia hinzu, »hat Ticchie einmal brummeln hören, daß er, wenn er wollte, mit einer bestimmten Information aus diesem sehr seltenen und kostbaren Buch, in dem er gerade las, Millionär werden könnte. ›Der arme Kerl‹, hat Chelli gedacht. ›Was muß er für ein Hungerleider sein, wenn er eine Million Lire noch für Reichtum hält. Die wirklich reichen Italiener nennen sich heutzutage Milliardäre …‹«
Chelli hatte den Versuch gewagt und Brancas gefragt: »Welche Information denn?« Aber Ticchie hatte nur gehässig gelacht, hehehe, was soviel heißen mochte wie: ›Wenn du glaubst, einen Moment der Schwäche bei mir ausnutzen zu können, hast du dich getäuscht.‹
In der Zeit danach war Signor Chelli aufgefallen, daß Brancas Angst hatte. Manchmal schien er geradezu terrorisiert.
»Interessant«, meinte Scalzi, »über die Aussicht, Millionär zu werden, hat er auch schon jemand anderen informiert.«
»Wen?«
»Einen, der im ›Homo Sapiens‹ ein und aus geht. Ein gewisser Pasquini.«