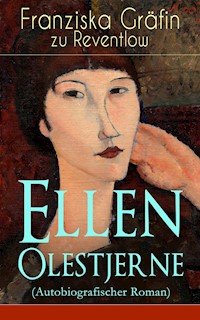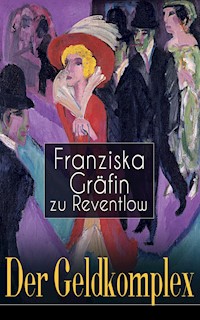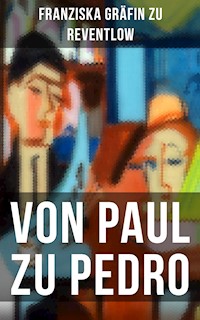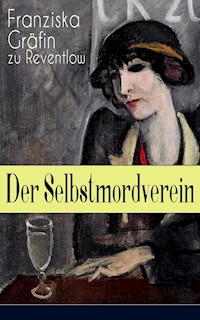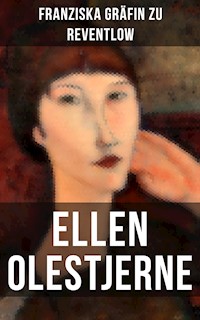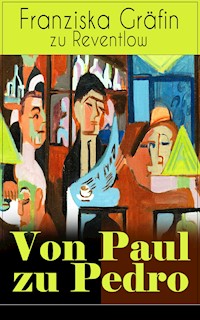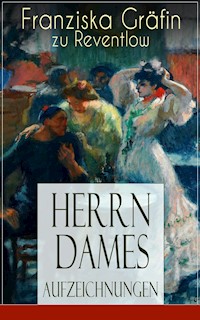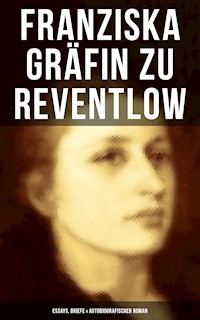
Franziska Gräfin zu Reventlow: Essays, Briefe & Autobiografischer Roman E-Book
Franziska Gräfin zu Reventlow
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Franziska Gräfin zu Reventlows Werk 'Essays, Briefe & Autobiografischer Roman' taucht der Leser tief in das Leben und Denken dieser faszinierenden Schriftstellerin ein. Mit einem einzigartigen literarischen Stil, geprägt von Offenheit und Intensität, wirft sie in ihren Essays und Briefen einen schonungslosen Blick auf die Gesellschaft ihrer Zeit. Ihr autobiografischer Roman bietet einen weiteren Einblick in ihre Gedankenwelt und ihre persönlichen Erfahrungen. Die Kombination dieser verschiedenen Textformen macht das Buch zu einem facettenreichen und bereichernden Leseerlebnis. Reventlows Arbeiten sind in ihrem literarischen Kontext einzigartig und zeigen eine außergewöhnliche Sensibilität für soziale und kulturelle Fragen ihrer Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franziska Gräfin zu Reventlow: Essays, Briefe & Autobiografischer Roman
Inhaltsverzeichnis
Essays:
Das Männerphantom der Frau
1898
Der Mann! – Einmal muß der Moment ja doch schließlich kommen – trotz der strengsten Mutter und der wachsamsten Tante – der Moment, wo »der Mann« nicht mehr hinwegzuleugnen ist und wo das junge Mädchen anfängt, etwas zu fühlen und zu begreifen, etwas – ja, wie soll man es definieren, dieses geheimnisvolle Etwas, die Vorempfindung des andern Geschlechts im eignen Blute?
Daß er, »der Mann«, existiert, hat man ja auch schon vorher gewußt, aber wie er existiert, wie er beschaffen ist, auf welchen Bedingungen sein Dasein sich aufbaut, weshalb, wozu und inwiefern er eben »der Mann« ist, das wird bekanntlich dem heranwachsenden Weibe so lange wie möglich verborgen gehalten.
Bis die Stunde der großen Offenbarung kommt, früher oder später. Und die Offenbarung wird jedem in anderer Form und Gestalt, je nachdem wie er – oder sagen wir in diesem Falle lieber: sie – und ihr inneres und äußeres Leben sich gestaltet. Es läßt sich das weder generalisieren noch spezialisieren, das eine wäre zu oberflächlich und das andere zu schwierig oder richtiger gesagt, einfach unmöglich. Es ist eben ein individuelles Erlebnis, das nur in seinen Folgen und Wirkungen an die Oberfläche tritt und auch da wieder in unterschiedlicher Form.
Im allgemeinen hat die Frau von heutzutage es aufgegeben, »Gretchen« zu mimen. Es liegt ihr nicht mehr und man verlangt auch nicht mehr danach. Damit soll jedoch nicht bestritten werden, daß noch hier und da, wenigstens bei uns im lieben Deutschland, ein wirkliches unverfälschtes, fast möchte ich sagen, chronisches Gretchen vorkommt, das stille deutsche Mädchen, das in Gedanken, Worten und Werken stets auf dem vorgeschriebenen Wege bleibt, mit Scheuklappen vor den Augen und einem unerschöpflichen Vorrat von himmelblau und rosa gestreiften Illusionen durch die Welt geht, die böse Welt, die ihm selbst beim besten Willen nicht den Schmelz von den Flügeln zu streifen vermag.
Für diese verkörperte Jungfräulichkeit sind die Männer entweder Halbgötter oder Schurken. Das heißt, sie kennt und sieht nur die Halbgötter, aber sie weiß, daß es auch Schurken gibt, sie weiß es als historische Tatsache, die ihre Gefühlssphäre nicht weiter berührt. »Der Mann«, an den sie denkt, mit dem ihre Gedanken sich beschäftigen, von dem sie träumt, ist der Inbegriff alles »Großen und Edlen« – Er, der Herrlichste von Allen.
Es ist daher ein furchtbarer Moment, wenn sie schließlich doch einmal erfährt, daß alle Männer »so« sind. Das Mädchen mag vor solcher Erkenntnis behütet bleiben, einmal durch sein eignes Wesen und dann durch die tausend und abertausend Schranken, die Brauch und Sitte um sie her aufrichten, sie mag älter und selbst alt werden, ohne ihre Illusionen einzubüßen. Wird sie aber Braut und Frau, so ist es unvermeidlich, daß ihre Ideale Schiffbruch leiden. – Die Braut sucht in das Innenleben des Geliebten einzudringen, sich ein Bild davon zu machen, ihn ganz zu verstehen, und da stößt sie auf manchen Punkt, der dunkle Ahnungen in ihr erweckt, er möchte Gebiete durchwandert haben, deren Pfade nicht immer mit weißem Sand bestreut waren. Sie wehrt sich dagegen, sie will nicht daran glauben und hofft immer noch, daß doch vielleicht dieser eine, von ihr Auserwählte, anders ist wie die andern. Sie möchte wenigstens für sich noch einen Altar retten, an dem sie beten und das Weihopfer ihres Lebens vertrauensvoll niederlegen kann. Aber selbst, wenn sie diesen schönen Wahn noch mit in die Ehe hinüberrettet, als Frau erfährt sie doch früher oder später einmal etwas von der unvermeidlichen »Vergangenheit« des Gatten. Der Altar des unbekannten Gottes stürzt zusammen und an die Stelle des Idols tritt das Bild eines verzerrten Scheusals und das ist der Mann, ihr Mann jeder Mann ohne Ausnahme.
Irgendwie muß der Schlag überwunden werden. Die einfachste Lösung aus diesem Konflikt, den wohl jede Frau, die ahnungslos in die Ehe tritt, durchzumachen hat, ist die praktische christliche. Mütter, Tanten und Pastoren sind jederzeit damit bei der Hand, wenn sie etwas von dem Sturm erfahren, der die Seele des armen Gretchens aufgewühlt hat: Man muß sich eben damit abfinden, es ist nun einmal der Gang der Welt. Das Weib soll und muß vergeben, immer wieder vergeben und mit seinem Überfluß von Reinheit die Mängel des andern ausgleichen.
Die einen ergeben sich in ihr Schicksal, als stille Frau an der Seite des Sünders auszuharren, und versuchen in tausendfacher Entsagung das zertrümmerte Götterbild wieder zusammenzuflicken, und wenn sie Mutter werden, in ihren Kindern die vernichteten Ideale wieder aufzubauen. Die andern wenden sich und werden »moderne Frauen«. Jede, auch die hypermodernste, hat wenigstens in frühester Jugend einmal ein ähnliches Gretchenstadium durchgemacht. Aber wer nicht zum chronischen Gretchen veranlagt ist, und das sind nicht viele, ist damit fertig, ehe die Heirat in Frage kommt. Das moderne junge Mädchen ist fast durch die Bank demi-vierge, wenn es die Schule verläßt. Es ist auch kaum anders möglich bei der starken Betonung des Sexuellen – wie Laura Marholm sagt: des »zentralen Gebietes«, die das Hauptcharakteristikum unserer Zeit ist. In Schule und Pension wird die Neugier geweckt und gesteigert, und dann bekommt man irgendwie einmal ein sogenanntes »schlechtes Buch« in die Hand, das auf dem Schreibtisch des Vaters entdeckt, oder von einem Bruder eingeschleppt wird. Man darf nicht in's Theater, wenn die »Gespenster« gegeben werden, und für 20 Pfennig kann man sie kaufen, um zu ergründen, weshalb das Verbot erlassen wurde. Oder die ältere Generation spricht sich bei einem Gesellschaftsabend mit Entrüstung über die Kreutzersonate aus – jeder Primaner besitzt sie und ist mit Freuden bereit, sie zum nächsten Rendez-vous mitzubringen. Und die demi-vierge verschlingt Ibsen und Zola und Hermann Bahr. – Immer intensiver wird der mit leisem Schauder untermischte Wissensdrang, das Wesen des Mannes zu ergründen, dieses unheimlichen Mannes, der sich in den Tiefen und Abgründen des Lebens bewegt, von denen wir nichts wissen dürfen. Es ist aus mit den Idealen und Illusionen, man will auch nichts mehr von ihnen wissen, man ist stolz, keine mehr zu haben, und will jetzt nur noch Wahrheit, möglichst krasse und detaillierte Wahrheit alles wissen, alles begreifen. Und aus der theoretisch gestillten Neugier wächst eine rasende Empörung hervor, eine wütende Auflehnung gegen die »verlogene Gesellschaft«, die von uns verlangt, daß wir es mindestens den Engeln gleichtun sollen an Unschuld und Reinheit, nur um den sorgfältig gehüteten Schatz diesem Moloch von »Mann« in die Arme zu legen, – daß wir Perlen sammeln sollen, um sie vor die Säue zu werfen. Das innerste Gefühl empört sich dagegen, es muß etwas geschehen, um die Weltordnung abzuändern, denn diese Weltordnung ist niederträchtig und empörend, der Mann hat die Kraft und das Recht auf alle Güter des Lebens, das Recht alles Große und Schöne zu vollbringen, wenn er Lust dazu hat, und ebensogut besitzt er die uneingeschränkte Freiheit, schlecht und gemein und lasterhaft zu sein, ohne daß ihm irgend jemand dreinzureden wagt.
Und sie gehen hin und werden Bewegungsweiber. Der Mann ist ihnen fortan etwas, das überwunden werden muß. Und das Bewegungsweib konstruiert sich ein seltsames Phantasiegebilde zurecht und sagt: das ist der Mann, so ist der Mann, wir haben ihn endlich erkannt. Er steht nicht über der Frau, wie man uns gelehrt hat, er ist durchaus kein Halbgott, ja nicht einmal ein interessanter Teufel. Er ist einfach borniert, denn er faßt die Frau nicht als selbständigen Menschen auf, sondern sieht in ihr immer nur das Geschlecht, das Werkzeug seiner schnöden Lust und seiner egoistischen Laune. O Gott, wie ist er überflüssig, dieser Mann, wahrhaftig, wir können ebenso gut ohne ihn auskommen, denn wir wollen nicht nur Weib sein, sondern vor allem freie selbstständige Menschen.
Sie betrachtet ihn nun entweder als Objekt der Verachtung, oder als Gegner, der aufs äußerste bekämpft werden muß, da man ihn ja leider nicht mit Stumpf und Stiel vom Erdboden vertilgen kann. In exceptionellen Fällen mag er vielleicht noch als Kamerad geduldet werden, aber wohlverstanden nur als Kamerad auf gemeinschaftlich menschlicher Basis (und das ist schließlich eine noch schwerere Verkennung des Mannes, wie wenn man ihn als Sünder und Lady-killenden Schurken auffaßt.)
Von allen diesen Frauen, die sich emanzipieren, um zu beweisen, daß das Weib nicht inferior ist und bei jeder Gelegenheit betonen, daß sie im Gegenteil den Mann für minderwertig halten – von allen diesen Frauen hat wohl selten eine den Glauben an ihn durch Desillusionierung auf praktischem Wege verloren. Wo das vorkommt, schlägt die Frau andere Wege ein, um sich dafür zu rächen, daß sie angebetet hat, wo er nur genießen wollte. Da sie bei einem sogenannten »Fehltritt« – was ja meistens der Fall ist, wenigstens, wenn es der erste war – den Kürzeren zieht, und schlecht dabei wegkommt, überträgt sie den Begriff des »gewissenlosen Verführers« von dem einen Mann im Speziellen auf die Männer im Allgemeinen, und wenn sie einen ausgebildeten »Weib-Instinkt« besitzt, sucht sie an anderen heim, was der Eine ihr getan. Sie wird alles daran setzen, in den Männern die Illusion über das Weib zu vernichten, weil ein Mann ihr die Illusion über sein ganzes Geschlecht geraubt hat.
Frauen sagen und schreiben oft seltsame Sachen. So Laura Marholm: »Unter den Frauen und nicht zum wenigsten unter den deutschen Frauen ist es sehr allgemein, daß sie den Mann nicht so feierlich nehmen, wie er sich's einbildet, und wie sie's ihm einbilden. Sie finden ihn komisch, nicht erst, wenn sie mit ihm verheiratet sind (sic!), sondern sogar schon, wenn sie in ihn verliebt sind. Die Männer wissen es gar nicht, wie komisch die Frauen sie finden ...«, und weiterhin: »Besonders für das junge Mädchen ist der Mann ein ewiger Lachreiz mit einem Schauder darin.« –
Laura hätte richtiger getan, wenn sie ihr Werk »das Buch der hysterischen Frauen« betitelt hätte, anstatt es kurzweg »Buch der Frauen« zu nennen. Das junge Mädchen, für welches der Mann ein ewiger Lachreiz mit einem Schauder darin ist, gehört direkt in die Kaltwasseranstalt. Nach Marholm'scher Ansicht ist die Frau überhaupt die hysterische Sphinx par excellence und man kann den unglücklichen Mann nur bedauern, der sich mit ihr aufs Rätselraten einläßt. Es ist doch zum Mindesten originell die Frage über die Beziehungen zwischen Mann und Weib – die für einen normalen Menschen überhaupt keine »Frage« ist – lösen zu wollen, indem man an 5 oder 6 »exzeptionellen Weibnaturen« nachzuweisen sucht, daß sie sich noch viel exzeptioneller ausgewachsen hätten, wenn sie zur rechten Zeit den rechten Mann gefunden hätten. Es ist sonderbar, daß die Verfasserin, die doch den Mut gehabt hat, so energisch zu betonen, daß die Frau des Mannes nicht »entraten« kann, ohne schweren Schaden an Leib und Seele zu nehmen, eines fast ganz ignoriert, oder wenigstens nur en passant erwähnt, nämlich die Mutterschaft. Sie spricht von »dem Weibchen, das durch die Wälder rennt mit dem klagenden Ruf nach dem Gatten«, aber sie scheint – trotz der Behauptung, daß sie sich das Spiel des Lebens schon geraume Zeit hindurch angesehen hat – nicht dahinter gekommen zu sein, daß dieser intensive Schrei des Weibes nach dem Manne im letzten Grunde doch nichts weiter ist wie der Ausdruck des tiefen Verlangens nach Mutterschaft. Wenn es absolut notwendig war, ein Buch der Frauen zu schreiben, hätte man ihm als Motto das Wort von Nietzsche voranstellen sollen: »Alles am Weibe ist ein Rätsel und alles am Weibe hat nur eine Lösung: Schwangerschaft.« Der angebliche Weiberfeind hat das Weib besser verstanden wie es sich selbst jemals zu verstehen vermag, und es liegt ja auch in der Natur der Sache, daß ein Geschlecht immer nur vom andern Geschlecht richtig verstanden wird, niemals aber von dem eignen, das immer durch die subjektive Brille sieht. Das Weib, mag es geistig hoch oder tief stehen, normal oder »exzeptionell« veranlagt sein, seinem physischen Bau nach bleibt es doch immer zur Mutter geschaffen und daher ist die Bedeutung seines ganzen Geschlechtslebens mit seinen praktischen Konsequenzen eine ganz andere wie beim Mann. Er wird zum Mann durch die betätigte Erkenntnis des andern Geschlechts, das Weib hingegen wird niemals dadurch die Höhe seines Wesens erreichen, daß es einen oder mehrere Männer gekannt hat, sondern einzig und allein durch die Mutterschaft, die alle Funktionen seines Geschlechtslebens zur Entwicklung bringt. Im Gegensatz zu unserer Zeit, wo manche Frau sich gegen den Gedanken sträubt, Mutter zu werden, galt die Unfruchtbarkeit bei allen alten Völkern für eine Schande und wurde als Fluch der Gottheit angesehen, bekanntermaßen vor allem bei den Juden. Man denke an Laban's Werbung um Rebekka, die ihre Geschwister mit dem Wunsche ziehen ließen: Wachse in viel tausend mal tausend (1. Mose 24, 60). Bewußt oder unbewußt liegt hier die Idee zu Grunde, daß Kinderlosigkeit das Schlimmste ist, was einer Frau zu widerfahren vermag. Die Frau, die nach Laura Marholm Mutter werden kann, ohne eigentlich in das Geheimnis der Mannesliebe eingedrungen zu sein, ist weit mehr Geschlechtswesen wie die sterile »Geliebte und Gefährtin« des Mannes. Irgend jemand hat da sehr richtig bemerkt, eine Frau fängt erst dann an geistreich zu werden, wenn sie keine Kinder bekommt.
Zweifelsohne würden weit mehr verlassene Frauen ins Wasser gehen, wenn es sich nur um den Mann und die Liebe handelte, aber in Wirklichkeit gehen sie nur ins Wasser, wenn sie die Schande fürchten oder nicht wissen, wie sie das Kind durchbringen sollen. Eine Frau, die den Sinn des Lebens wirklich erfaßt hat, wird in dem Mann, der ihr ein Kind geschenkt und sie dann verlassen hat, nicht den Verführer und Verräter sehen. Es ist ja gewiß tausendmal schöner, wenn die wahre Liebe dazu kommt und dann ergibt es sich meistens von selbst, daß man beisammenbleibt, auch wenn »der Rausch verflogen« ist, aber es gibt auch Fälle, wo der Mann für die Frau – mag sie sich dessen bewußt sein oder nicht – nur das Mittel zum Kind ist, ebenso wie sie für ihn das Mittel zur Betätigung seiner Manneskraft war. Und wozu noch zusammenbleiben, wenn der beidseitige Zweck erfüllt ist? Es ist eine schwere Verkennung der menschlichen Natur, wenn man das zur sittlichen Forderung aufbauscht, was höchstens einen praktisch berechtigten Hintergrund haben kann. Und wenn die Frau in solchem Falle verständig genug ist, wird sie den Mann dafür segnen, daß ihr durch ihn das höchste Gut ihres Lebens zuteil geworden ist, und wird ihn ruhig gehen lassen, wenn die Verhältnisse es mit sich bringen. Zu dieser Verständigkeit sollte man die Frauen erziehen und sie ihnen praktisch ermöglichen. Aber statt dessen treibt die Gesellschaft, die sich davor scheut, für die unehelichen Kinder sorgen zu müssen, den Mann zur Prostitution und die Frau zum »Verbrechen gegen das Leben«.
Was bleibt dem Mann denn anders übrig, wie das Bordell aufzusuchen, wenn er nicht in der Lage ist, für eine Familie zu sorgen, oder für alle Kinder, die er zu zeugen vermag, Alimente zu zahlen? Und was soll die Frau tun, wenn sie sich weder der allgemeinen Verachtung, noch dem für ihre Konstitution fast übermenschlichen Kampf mit dem Dasein gewachsen fühlt, und noch dazu weiß, daß auch ihr Kind dafür büßen muß, wenn es die Frucht einer Sünde ist, die weder Standesamt noch Kirche zur christlichen Pflicht geadelt hat. – Der liebe Gott im Paradies wußte die Frage besser zu lösen. Als die Sache einmal geschehen war, machte er aus der Notwendigkeit eine Tugend, und aus Adam und Eva ein Paar, mit der Aufgabe, die Welt zu bevölkern und gab ihnen noch dazu die Verheißung mit auf den Weg. Bei diesem System war das Strafgesetzbuch überflüssig. Unsere moderne Gesellschaft würde Verbrechertum und Degeneration vielleicht besser bekämpfen, wenn sie sich das zum Beispiel nähme. Wie man von jedem Mann, der im Staat verwendet werden soll, den Beweis seiner Fähigkeit verlangt, so sollte man von jeder Frau verlangen, daß sie wenigstens einmal im Leben ein Kind zur Welt bringt, und danach erst beurteilen, ob sie ein brauchbares Mitglied der Gesellschaft zu sein imstande ist. Aber die Welt hat sich nun einmal angewöhnt, sich verkehrt herum zu drehen, und dabei wird es wohl auch vorläufig bleiben.
Es ist bei alledem wahrhaftig kein Wunder, wenn die beiden Geschlechter sich verkehrt verstehen, und sich wunderliche Vorstellungen von einander machen. Und es ist so, wie die Verhältnisse liegen, ganz berechtigt, wenn man sie vor einander warnt, indem man seinem Sohn sagt: Hüte Dich vor den Weibern, und die Tochter beschwört: Nimm Dich vor den bösen Männern in Acht. Ich möchte hier noch einmal auf Laura Marholm zurückgreifen, und im Gegensatz zu ihrer Theorie von dem ewigen Lachreiz die Behauptung aufstellen, daß die Frau im allgemeinen weit eher geneigt ist, den Mann tragisch zu nehmen – weit tragischer jedenfalls wie der Mann die Frau. Es mag ja manche Frau geben, die in einem bestimmten Mann, und zwar ist es meist der Gatte, nur den »guten Kerl« sieht, über den sie sich gelegentlich lustig macht, aber im Grunde imponiert ihr der Mann als solcher doch stets – vorausgesetzt, daß er die Bezeichnung Mann wirklich verdient. Es ist eben nur Mode, das um keinen Preis einzugestehen, damit »er« sich seiner Überlegenheit nicht allzusehr bewußt wird. Wozu sonst dieser verzweifelte Kampf um die Gleichberechtigung, das Suchen nach Beweisen, daß man es ihm gleichtun kann?
Und woher die Eifersucht? – Außer der Mutterliebe, die wohl die größte und tiefgehendste Umwälzung im Seelenleben der Frau hervorbringt (und die Mutterliebe ist ja doch auch ein Gefühl, dessen Urheber im letzten Grunde nur wieder der Mann ist), gibt es nichts, was die Grundelemente der weiblichen Natur so bis ins Tiefste hinein aufzuwühlen vermag, wie eben die Eifersucht. Und während naturgemäß das Weib in allem, was mit der Mutterschaft zusammenhängt, eine passive Rolle spielt, tritt mit der Eifersucht ein dramatisches Moment in ihr Leben ein, das sich bis zur wildesten Tragik steigern kann.
Beim Mann ist es mit der Eifersucht etwas ganz anderes; selbst in akuten Fällen wird dieser – vorausgesetzt, daß er das erforderliche Quantum von Selbstgefühl besitzt sich niemals völlig von ihr hinreißen lassen, sei es auch nur aus Furcht, sich lächerlich zu machen. Und wenn er sich genötigt sieht, einzuschreiten, so wendet sein Zorn sich in erster Linie gegen das treulose Weib, und dann erst gegen den Nebenbuhler – auch wenn er sich genötigt sehen sollte, diesen zu »fordern«, resp. aus der Welt zu schaffen – weil es sich nun einmal so gehört. Das Weib dagegen will nur die Konkurrentin beseitigen, unschädlich machen. Der Mann, mag er noch so schuldig sein, sinkt dadurch nicht in ihren Augen – im Gegenteil, er steigt im Preis, weil auch andere auf ihn bieten. Und in diesem Kampfe – Weib gegen Weib um den Mann – ist es zu allem imstande, zu den raffiniertesten Intrigen, der gefühllosen Grausamkeit – sagen wir es nur offen heraus: zur größten Gemeinheit. Der Mann wird die Gattin oder Geliebte, die ihn betrogen hat, verlassen, vielleicht auch töten, wenn er zum Äußersten gebracht wird; die Frau dagegen hört nicht auf, zu lieben, weil sie hintergangen worden ist, sie geht bis zum Letzten und Furchtbarsten, um die verratene Liebe zurückzuerringen, und über »die Andre« zu siegen. Es sind stets nur Frauen gewesen, die zum Vitriol gegriffen haben, denen die Eifersucht diesen hyperteuflischen Gedanken eingegeben hat, die Rivalin, wenn sie auf keine mildere Weise beseitigt werden kann, wenigstens durch Vernichtung ihrer Schönheit unschädlich zu machen.
Es ist auffallend, wie wenig die Literatur sich mit der Eifersucht des Weibes im großen Stil beschäftigt hat. Sie hat einen »Othello« geschaffen, aber wo ist die Feder, die das weibliche Gegenstück dazu zeichnen könnte? Ein Mann würde wohl schwerlich dazu imstande sein – und eine Frau wird es niemals tun, darf es auch eigentlich nicht tun, weil sie sich und ihr ganzes Geschlecht in seiner grausamsten Blöße an den Pranger stellen müßte. Und alles das ist nur wieder ein Beweis, ein wie mächtiger Faktor der Mann im Leben der Frau ist. Er vermag das Wahrste und Beste, was in ihr schlummert, wachzurufen, er führt sie in die tiefe, süße Tragik hinein, die dem Liebesleben jeder Frau zu Grunde liegt. Und dafür zeigt sie sich auch ihm gegenüber – sobald sie wirklich das an ihm findet oder zu finden glaubt, was der Halt- und Mittelpunkt ihres Lebens ist – von ihrer schönsten und glücklichsten Seite – treu und opfermütig, tapfer und offen – dieselbe Frau, die irgend ein anderes Weib mit dem tödlichsten Hasse verfolgen kann.
Man denke z.B. an Rebekka West in »Rosmersholm«, die vor keinem noch so verbrecherischen Mittel zurückscheut, bis sie es endlich soweit gebracht hat, das verhaßte Weib des geliebten Mannes in den Tod zu treiben, und die gleichzeitig diesem Manne gegenüber an Liebe und Aufopferung nicht ihresgleichen findet.
Die Freundschaft zwischen zwei Frauen ist daher etwas unendlich seltenes, und nur dann möglich, wenn kein Mann in Frage kommt, also in Fällen, wo entweder jede einen hat, oder keine einen hat. Eine von den wenigen, die den Mut gehabt hat, in Bezug auf ihr eigenes Geschlecht der Wahrheit die Ehre zu geben, hat gesagt: »Ein Weib ist niemals offen und ehrlich gegen ein Weib, legt niemals ganz das Visier ab, sondern ist stets auf ihrer Hut, vorsichtig, berechnend, hinterlistig, verschmitzt weil sie die tausend kleinen Mittel der Täuschung und Verstellung, die sie im Leben und in der Liebe braucht, auch bei ihresgleichen vermutet.«
Und wo bleibt bei all' dieser Tragik der »Lachreiz«? Es ist jedenfalls nur ein sehr bittersüßes Lächeln, mit dem die Frau sich über den Mann im allgemeinen lustig macht, oder ein Theaterlächeln, das über den schweren ernsten Kampf, der dahinter steckt, hinwegtäuschen soll. Am gescheitesten handeln demnach wohl schließlich noch diejenigen, die den Mann überhaupt nicht »aufzufassen« suchen, sondern einfach den gegenseitigen sexuellen Standpunkt praktisch zur Geltung bringen. Es geschieht dies allerdings schwerlich aus Gescheitheit, denn die gescheitesten Frauen sind gewöhnlich nicht die erotisch veranlagtesten, sondern einfach aus Instinkt, und der Instinkt ist bekanntermaßen in allen Lebenslagen der sicherste Führer, weil er nicht durch Erwägungen und Reflexionen getrübt wird, und die Frau läßt sich im Allgemeinen weit mehr von ihm leiten wie der »denkende Mann«.
Aber das Weib mit dem normalen, unverkümmerten, unentwegten Geschlechtsinstinkt – wo ist das zu finden? In der guten Gesellschaft ist es eine Ausnahme und gilt für eine Abnormität, und selbst das mythische »Weib aus dem Volk« mit 7 unehelichen Kindern besitzt ihn vielleicht in weit geringerem Maße, wie man dem Anschein nach glauben möchte. In der Kokotte, dem »Mädel« und der Lebedame aus fin de siècle-Kreisen, da vielleicht noch am ehesten ist »das Weib« zu finden, das absolute Weib, das den Mann am besten kennt, und am richtigsten zu beurteilen und zu nehmen weiß. Das »lasterhafte« Weib hat oft mehr richtiges, ja sogar mehr Feingefühl auf dem Geschlechtsgebiet wie die beste Gattin und das keuscheste Gretchen, denn grade kraft seiner Lasterhaftigkeit, das ist: vielseitigen Kenntnis der Männer, sieht es in ihm weder den Übermenschen, noch den Schurken, sondern einfach »den Mann«, nicht als X, sondern als feststehende, gegebene Größe, ohne welche das Exempel nicht aufzulösen ist.
Es mag das vielleicht wie ein Widerspruch zu dem vorhin über die Mutterschaft und die daraus hervorgehenden Empfindungen Gesagten klingen, weil man sich den Typus der grande amoureuse gewöhnlich nicht mit dem der Mutter vereint zu denken pflegt. Aber einmal ist das Leben überhaupt so reich an Widersprüchen, daß es schwer ist vom Leben zu reden, ohne sich hier und da in einen Widerspruch zu verwickeln, und in diesem Falle liegt er überhaupt mehr in der Idee und der allgemeinen Annahme wie in der Wirklichkeit.
Man kann oft genug beobachten, daß gerade Frauen, die viel geliebt und gelebt haben, die besten Mütter werden. In Japan gelten die Mädchen sogar für die geeignetsten Ehefrauen, wenn sie eine bestimmte Anzahl von Jahren in den Teehäusern zugebracht haben, und die Teehäuser bedeuten etwa dasselbe, wie eine Berliner Kneipe mit Damenbedienung. Schließlich sei noch auf die moderne Literatur hingewiesen. Ich erinnere nur an Zola's »Nana«, den Typus der »feilen Dirne«, die durchaus nicht ohne Muttergefühl für ihren kleinen Louison ist, und während einer nochmaligen kurzen Schwangerschaft, – um sich im Pastorenjargon auszudrücken: »besseren Regungen zugänglich« ist; ferner an Prevost's »Zabeau«, welche die Liebe zu ihren Kindern an die Grenze des Wahnsinns bringt.
Man pflegt gewöhnlich anzunehmen, daß eine Frau, die viel mit Männern zu tun gehabt, dadurch überhaupt ihre Weiblichkeit einbüßt, und naturgemäß müßte doch gerade das Umgekehrte der Fall sein. – Dazu kommt noch das Geschrei nach Abschaffung der Prostitution, die doch das einzige Mittel ist, die Gesellschaft einigermaßen so zu erhalten, wie es allen wünschenswert erscheint. Wie schon oben gesagt, bleibt dem Manne nichts anderes übrig, und die Erfahrung zeigt, daß die Männer im Großen und Ganzen auch durchaus nicht gewillt sind, die Prostitution abzuschaffen. Es sind fast immer Frauen, die dafür eintreten, und zwar meistens solche, die das Leben vom Teetisch aus beurteilen. Trotzdem ist es eine Frau gewesen, Pauline Tarnowskaja, die Mitarbeiterin Lombroso's, die auf Grund umfassender anthropometrischer Untersuchungen an Tausenden von Prostituierten die natürliche Prädestination zur Prostitution festgestellt hat; wie man ja bisher immer an die Prädestination des »Genies« als unumstößliche Tatsache geglaubt hat. Sie hat damit also bewiesen, daß die Natur selbst den Typus »Prostituierte« liefert.
Wer sich gegen diesen wissenschaftlichen Beweis sträubt und dabei bleibt, daß die Prostitution in direktem Gegensatz zu der eigentlichen Natur des Weibes steht, der tue einmal die Augen auf, um zu sehen, wie zahllose »anständige« und geachtete Frauen in der Ehe vollständig das Leben einer Prostituierten führen mit dem einzigen Unterschied, daß es nur ein Mann ist, anstatt mehrerer, dem sie sich tagtäglich ohne Liebe und ohne Sinnlichkeit hingeben, und der sie dafür versorgen muß – ohne daß sich ihr Gefühl jemals dagegen empört.
Selbstverständlich wäre es sehr töricht und zwecklos, ihnen das irgendwie zum Vorwurf zu machen, ebensowenig wie man es dem Mann verargen kann, wenn er die Frau so nimmt, wie sie sich ihm darbietet. Und grade darin liegt der Grund, weshalb die Frauen das Wesen und die Handlungsweise des Mannes oft so gänzlich mißverstehen – eben weil sie selbst sich nicht richtig zu geben und hinzugeben wissen.
Und das führt mich in Versuchung zum Schluß noch einmal Nietzsche zu zitieren: »Es ist ein Kind im Manne, das spielen will, auf, ihr Frauen, so entdeckt mir doch das Kind im Manne.«
NB! Es erscheint hier ein seltener Vogel, und er hat einen goldenen Ring im Schnabel. Gräfin zu Reventlow, eine Angehörige des höchsten nordischen Adels, deren Vorfahren noch vor 100 Jahren den dänischen Thron inne hatten, diese hübsche, tapfere und mutige junge Frau hat mit dem feinen Instinkt, der gerade diesen Nachkommen aus einer vielhundertjährigen sorgfältigen Menschen-Auslese oft innewohnt, das Heraufkommen einer neuen Zeit gewittert und hat ihre Sache, ihr Talent, ihre Schönheit in den Dienst der neuen Bewegung der Geister gestellt, von der die Literatur nur einen Teil bildet. Gleich jenen Damen aus der höchsten französischen Aristokratie am Ende des vorigen Jahrhunderts, vor Beginn der französischen Revolution, hat sie ihr Wappen-Schild hingeworfen, den verrosteten Schlüssel zu ihrer Burg abgegeben, auf die tiefen Verbeugungen verzichtet und ging – ähnlich wie die Gräfin von Butler-Haimhausen, die Gräfin von Dennewig u. a. – unter das Volk, um die Sache der Gesamtheit zu ihrer eigenen zu machen. In dem Moment, da sie merkte, daß die Aristokratie des Blutes durch die Aristokratie des Geistes abgelöst werde, stellte sie sich sofort dem Aufgebot und erschien als Amazone in den Reihen der Schriftsteller, der Dichter und der Artisten, wo man sie mit Verwunderung betrachtete. Inzwischen ist sie auch schon konfisziert worden und hat so die Feuertaufe empfangen. Wenn zwei dasselbe tun, so war es auch hier nicht dasselbe. Solche Menschen sind eben ganz eigentümliche Streiter! Sie zwingen mit ihrem Namen eine ganze Vergangenheit, für die neue Sache zu streiten. Alle diese illustren Ahnen müssen nun nolens volens für die neue Bewegung Zeugnis ablegen. Denn woher stammt sie denn, diese Gräfin? Welcher Leute, welcher Leben, welcher Schicksale Endprodukt ist sie? Da wir heute wissen, daß kein Gedanke, kein Gedankenhauch, einer menschlichen Seele aufgeklebt, aufoktroyiert werden kann, wenn sie ihn nicht, wenigstens als Keim, von ihren Ahnen mitbringt: Welcher Gedanken letzte Konsequenz ist sie unweigerlich? ... Also rühren Sie sich, meine Herrschaften, in Ihren Gräbern! – Natürlich erheben die noch lebenden, im aristokratischen Hühnerhof zurückgebliebenen, Gänschen voll Entsetzen ihre weißen holdseligen Flügel und blicken mit gespenstischen Augen und offenen Schnäbeln auf diese mutatio rerum ... Wir aber begrüßen mit herzlichem Händedruck diese neue Streiterin, die, wie im deutschen Volksmärchen, mit ihrem »Schwan kleb' an!« alle bezaubert, wohin sie kommt, und rufen ihr entgegen: Heil!
Erziehung und Sittlichkeit
Von uns »modernen« Menschen, die wir der jüngeren Generation angehören, haben viele – ich darf wohl ruhig sagen, die meisten – einen schweren Kampf kämpfen müssen, ehe sie sich von dem angestammten Milieu, von dem Einfluß einer sogenannten guten Erziehung und all ihren vorsintflutlichen Moralprinzipien und Anschauungen freimachen, um sich auf den Boden einer freieren Lebensauffassung zu stellen.
Es ist deshalb auch wohl mehr wie selbstverständlich, daß wir danach trachten, diese Errungenschaften des Kampfes unseren eigenen Kindern zukommen zu lassen.
Wir werden uns dabei unbedingt in einen schroffen Gegensatz zu der Erziehungsmethode stellen müssen, die in allen guten Familien üblich ist und deren Hauptcharakteristikum das Verschleiern und Vertuschen aller das Geschlechtsleben betreffenden Fragen ist.
Eben dieses Vertuschungssystem soll durch die lex Heinze nun auch der Allgemeinheit im öffentlichen Leben – soweit es sich innerhalb des Gebietes von Kunst und Wissenschaft bewegt – aufoktroyiert werden. Eines seiner Hauptmomente ist die Verpönung des Nackten in der Kunst.
Wir aber sehen im Nackten überhaupt – sowohl im Leben wie in der Kunst – nicht nur keine »Sünde«, sondern ein positives erzieherisches Moment von hoher Bedeutung. Denn wir wollen die heranwachsenden jungen Seelen nicht in dem lüsternen Schauder vor der Nacktheit erziehen, sondern zur gesunden Freude an allem Schönen, mag es nun Kunst oder Natur, nackt oder angezogen sein – zum gesunden Abscheu vor allem, was wirklich unschön ist.
Sie sollen jenes künstlich angezüchtete »Schamgefühl« gar nicht kennenlernen, das in jedem Wesen des anderen Geschlechts einen Gegenstand der verbotenen Neugier sieht und eben dadurch auch am eigenen Körper ein unheimlich lockendes Rätsel.
Vielleicht wäre das zu erreichen, indem man sich nicht mehr ängstlich vor dem Anblick der persönlichen oder bildlichen »Nudität« schützt und seine natürliche, naive Neugier durch eine seinem Verständnis angemessene Antwort zufrieden stellt, anstatt sie durch das obligate »Das verstehst du doch nicht« – oder »Davon spricht man nicht« – noch mehr zu reizen. Wir wollen ihm gerade seine Unbefangenheit bewahren, indem wir das Sexuelle so viel wie möglich aus den das Leben des Kindes bedingenden Elementen ausschalten. Dieser Zweck kann nur dadurch erreicht werden, daß das Geschlechtsbewußtsein, so lange es irgend angeht, zurück gedrängt wird. Und das Mittel, diesen Zweck zu erreichen, ist nicht etwa jenes Vertuschungssystem, das das Kind in ewigem Zweifel läßt und eben dadurch seine Neugier reizt – sondern eine gemeinsame Erziehung beider Geschlechter ohne alle überflüssige Geheimnistuerei und verbunden mit der Ausbildung eines rein ästhetischen Wohlgefallens an der Nacktheit.
Wir wollen deshalb in der Erziehung darauf hinwirken durch häufige Betrachtung des Nackten – sei es im Leben oder in künstlerischen Darstellungen, sei es am eigenen oder am Körper eines anderen –, daß die Wertung des Schönen immer stärker in den Vordergrund tritt. Und eine solche Anschauungsweise wird das »Schnüffeln« nach den Sexualcharakteren ganz von selbst aufheben. Es wird uns auf diese Weise unendlich viel leichter fallen, das Kind vor jeder verfrühten Schädigung seines Geschlechtslebens zu bewahren, es zu lehren, daß der Maßstab seiner Handlungen nicht sein »moralisches«, sondern ausschließlich sein ästhetisches Gefühl sein soll. Das ist meiner Ansicht nach das beste Schamgefühl, was wir in unseren Kindern entwickeln können.
Tritt dann später bei dem geschlechtsreifen jungen Menschen durch Betrachtung des Nackten eine sinnliche Reaktion ein, so brauchen wir dieselbe nicht zu fürchten. Wir wollen die Auslösung des Geschlechtstriebes nur so weit als möglich herausschieben – bis sie mit dem Eintritt der völligen physiologischen Reife zur gebieterischen inneren Notwendigkeit wird. Mir speziell als Mutter würde es weit sympathischer sein, wenn mein Sohn mit 18 Jahren ein ihm gleichstehendes junges Mädchen verführt, als wenn er sich seine Unschuld bis in die Zwanzig hineinbewahrt, um sie dann schließlich im Bordell zu verlieren. – Wenn dann Knabe und Mädchen sich beim Erwachen als Mann und Weib wiederfinden, so wird diese bestätigte Erkenntnis des eigenen wie des anderen Geschlechts ihnen zu einer Offenbarung werden, aus der sie als neue Menschen hervorgehen. Und dann werden sie auch den Verlust der »Unschuld« nicht etwa als Niederlage sondern als Triumph, als frohen Sieg empfinden.
Zur Niederlage hat ihn überhaupt erst das Christentum gemacht, das bei seinen altruistischen Tendenzen jede Forderung, die aus jedem rein persönlichen Empfinden hervorgeht, mit der unliebenswürdigen Bezeichnung »Sünde« belegt. Aber das lebendige Recht, das jede normale und erst recht jede starke Persönlichkeit in sich trägt, läßt sich durch tote Abstraktionen und dogmatische Formeln nicht aus der Welt schaffen, um so weniger, da all diese moralischen Forderungen von einer einzigen dazu noch mythisch-sündlosen Persönlichkeit – Christus – abgeleitet sind.
Das Christentum hat den Menschen in einen unlöslichen Konflikt zwischen seine eigene Natur und die ihm aufgezwungene Moral gestellt.
Da die Kirche einzig und allein durch diesen moralischen Zwang die Obermacht behaupten konnte, so schuf sie zum Beispiel einerseits als Vorbild das Zölibat, andererseits muß sie aber daneben die bekannte Pfarrersköchin dulden, von der der Volkswitz sagt: Der Teufel holt keine Pfarrersköchin, denn da die Vertreter der Kirche im letzten Grunde ja auch nur Menschen sind, so leiden sie ebensogut wie alle anderen unter den »Anfechtungen des Fleisches«. In der Kasuistik erfanden sich dann speziell die Jesuiten ein vorzügliches Mittel, das moralisch Verbotene sophistisch in ein moralisch Erlaubtes zu verdrehen und so die Befriedigung ihrer natürlichen menschlichen Sinnlichkeit zu ermöglichen – wie z.B. der Holländer Cornelius Adriansen oder der Pater Girard.
Bekannt genug ist ja fernerhin das Ausfragen in der Beichte, das mit Vorliebe an Kindern geübt wird, um ihnen den Begriff der Keuschheit klar zu machen.
Wir morallosen Nichtchristen sind gewiß die Letzten, die es jemand zum Vorwurf machen, wenn er tut, was er nicht lassen kann. Wir empören uns nur gegen die Heuchelei, die durch diese christliche Moral großgezüchtet wird und die jetzt durch die Lex Heinze noch mehr gesteigert werden soll – wir empören uns dagegen, daß diese Art von Leuten Jahrhunderte hindurch die Erzieher der Menschheit waren – daß sie jetzt uns und unsere Kinder lehren wollen, was Schamgefühl ist.
Aber die Lex Heinze ist schließlich nie eine vereinzelte Äußerung, auf die wir, wenn sie uns wirklich aufgedrängt werden sollte, schon die rechte Antwort in Worten und Werken finden wollen. Wir machen vor allem Opposition gegen die ganze Anschauungsweise, die sich solche Eingriffe in das persönliche Leben und Empfinden erlaubt.
Und im Prinzip der Erziehung wird der Konflikt fortbestehen, so lange eben das Christentum besteht. Der erste, allererste Begriff, den die christliche Erziehung das Kind lehrt, ist »die Sünde«. Dadurch wird ihm von vornherein die Harmlosigkeit dem Leben gegenüber genommen und zugleich der lockende Reiz des Heimlichen, Verbotenen suggeriert. Es beginnt an sich selbst zu zweifeln, denn es erfährt, daß es mit eigener Macht die Sünde nicht überwinden kann, daß es gleichsam an einer unheilbaren Krankheit – der Erbsünde – leidet, also »sündig« ist, selbst wenn es gar nichts Schlimmes getan hat. Mit einem Wort, es sieht sich in lauter unlösliche Widersprüche verwickelt, besonders natürlich wieder da, wo der Religionsunterricht das sexuelle Gebiet streift.
Zum Beispiel: Das Kind lernt in der Religionsstunde »Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren« – und: »Gott selbst hat den Ehestand eingesetzt und geheiligt« – Und gleichzeitig muß es in der Kirche beten: »Ich armer sündiger Mensch, der ich in Sünden empfangen und geboren bin« –
Ist das etwa kein Widerspruch? Ich soll meine Eltern ehren und die Ehe ist etwas Heiliges – und doch müssen meine Eltern eine Sünde begehen, um mich in die Welt zu setzen. –
Wird das Kind dadurch nicht direkt angetrieben, in dem Zusammenleben seiner Eltern etwas Verbotenes zu sehen und darüber nachzugrübeln, worin hier Verbotenes besteht? –
Man erzählt ihm von Christi Geburt und Marias Schwangerschaft, während dieselben Vorgänge im gewöhnlichen Leben ängstlich verborgen oder mit albernen Storchengeschichten umgangen werden.
Es lernt in der biblischen Geschichte, daß Abraham, Jakob, Salomo, David etc. auserwählte Knechte Gottes waren. Dabei gibt man ihm unbedenklich die Bibel in die Hand, wo es lesen kann, daß Jakob ein äußerst mangelhaftes Verhältnis für die Begriffe: Mein und Dein hatte daß Abraham im stillschweigenden Einverständnis mit dem lieben Gott sich »zu seiner Dienstmagd Hagar legte« – daß Salomo »700 Weiber zu Frauen hatte und 300 Kebsweiber«. Das sind nur ein paar aufs Gradewohl herausgezogene Beispiele, es ließen sich aber noch unzählige andere anführen, die, ohne gerade unzüchtig zu sein, doch das Schamgefühl gröblich verletzen können. Die Bibel ist so ziemlich die pikanteste Lektüre, die man einem heranwachsenden Kinde in die Hand geben kann. Und doch fällt es – meines Wissens wenigstens in den meisten protestantischen Familien – keinem Menschen ein, dieselbe wegzuschließen. –
Das Christentum gibt in seinem Dekalog fast ausschließlich Verbote, es stellt nur fest, was der Mensch nicht soll, nicht darf, ohne jede Rücksichtnahme auf die Wünsche und Bedürfnisse des Individuums. Niemals ist die Rede davon, was dasselbe darf, kann, mag, muß.
Der gleiche Widerspruch zieht sich auch durch unser ganzes Gesellschaftsleben, das ja immer noch auf christlichen Grundlagen beruht und ebenso durch das Staatsleben, in dem z. B. der Totschlag verboten, der Krieg aber erlaubt ist.
Und was kommt bei dieser negierenden Lebensauffassung heraus?
Das Christentum verspricht dem sich gläubig Unterwerfenden zur Belohnung imaginäre Güter in einem Jenseits, das noch »keines Menschen Auge geschaut hat«. Den Lebensinhalt des Christen bildet also im Grunde nur die Sehnsucht nach dem Tode.
Wir aber wollen unsere Kinder nicht in dieser hoffnungslosen Entsagungsödigkeit aufziehen, die man uns in unserer Kindheit gepredigt hat, – die manchen von uns um den schönsten Teil seiner Jugend gebracht hat. Dieses trostlose »Nein!« dem Leben gegenüber – das eben ist die Erbsünde von der wir sie erlösen wollen, zu einem frohen, selbstbewußten: »Ja«.
Und da sie nun doch einmal in Sünden empfangen und geboren sind, wollen wir sie auch den Mut zur Sündhaftigkeit lehren, – die wir lieber Lebensfreude nennen.
Erinnerungen an Theodor Storm
Am grauen Strand, am grauen Meer
Und seitab liegt die Stadt, Der Nebel drückt die Dächer schwer Und durch die Stille rauscht das Meer Eintönig um die Stadt.
Doch hängt mein ganzes Herz an Dir, Du graue Stadt am Meer, Der Jugend Zauber für und für Ruht lächelnd doch auf Dir, auf Dir Du graue Stadt am Meer.
In Husum, der kleinen, grauen Stadt am Nordseestrand, zieht sich dicht am Hafen eine enge stille Straße hin, genannt die »Wasserreihe«. Dort steht ein schmuckloses Haus, umgeben von einem schwarzen Bretterzaun, über dem uralte Kastanienbäume ihr dunkles Laubdach emporwölben. In diesem Haus wohnte Husums Dichter Theodor Storm lange Jahre seines Lebens hindurch, hier hat er jene Novellen geschrieben, die auf dem Boden seiner Heimat spielen, auf dem Boden dieses abgelegenen, in grauen Nordseenebeln verborgenen Erdenwinkels, dessen intime Reize keiner so wie er zu belauschen und so unvergleichlich wiederzugeben wußte. Seinem bürgerlichen Beruf nach war Storm, solange er in Husum lebte, Amtsrichter. Die Husumer pflegten, in der Liebe und Verehrung für ihren Sänger, seinen Titel stets zu ignorieren und nannten ihn zum Unterschied von zahlreichen Namensvettern nie anders wie »Dichter Storm«. Er selbst verabscheute alles, was einer Beweihräucherung ähnlich sehen konnte.
Als ihm einmal in einer Abendgesellschaft ein besonders begeisterter Verehrer in etwas aufdringlicher Weise zu huldigen bestrebt war, indem er stets aufs Neue sein Glas emporhob und, Storm zutrinkend, ausrief: »Dichter! – Dichter!«, da wandte Storm sich schließlich ärgerlich mit einem ziemlich laut gemurmelten »Schafskopf« ab und würdigte den armen X. keines Blickes mehr. Er wollte eben wie jeder wahre Künstler nur ein Mensch unter Menschen sein.
Storm hat nie zu denen gehört, die Unrast des Genies auf unruhig verschlungenen Wegen durch die Welt umtreibt. Ihn hat der kleine Kreis, in dem sein Leben verlief, nie im freien künstlerischen Schaffen eingeengt. Er hat sich die seltene Gabe der Lebensfreude am Kleinen und Kleinsten bis ins späteste Alter hinein bewahrt, obgleich das Leben auch ihm manches schwere Herzeleid zugefügt hat. Seine erste Frau, die von seltener Schönheit gewesen sein soll, starb bei der Geburt des 7. Kindes. Ihr hat er die ergreifenden Verse nachgedichtet:
Das aber kann ich nicht ertragen, Daß so wie sonst die Sonne lacht, Daß wie in deinen Lebenstagen Die Uhren gehen, Glocken schlagen, Einförmig wechseln Tag und Nacht;
Daß, wenn des Tages Lichter schwanden, Wie sonst der Abend uns vereint; Und daß, wo sonst dein Stuhl gestanden, Schon andre ihre Plätze fanden Und nichts dich zu vermissen scheint.
Indessen von den Gitterstäben Die Mondesstreifen schmal und karg In deine Gruft hinunterweben Und mit gespenstig trübem Leben hinwandeln über deinen Sarg.
Storm heiratete später noch einmal. Sein Familienleben war auch in zweiter Ehe das denkbar glücklichste. Seine Gattin wußte mit liebevollem Verständnis das Heim des schaffenden Mannes zu einer wohltuenden Häuslichkeit zu gestalten, und die Kinder hingen mit fast schwärmerischer Verehrung an ihm, dessen heiter jugendfrisches Gemüt Verständnis für alles hatte, was jung und frei emporwuchs. Das Storm'sche Haus war eine wirkliche Idylle, man mochte kommen, wann man wollte, an Winterabenden, wenn die zahlreiche Familie beim warmen Kaminfeuer beisammen saß und der Dichter mit seiner klangvollen, etwas leisen Stimme vorlas, manchmal seine eigenen Werke – oder an Sommertagen in dem lauschigen Garten, den er selbst mit liebevoller Sorgfalt pflegte. Storms äußere Erscheinung hatte etwas von einer Märchengestalt an sich, der kleine, etwas gebeugte Mann mit dem langen, schlohweißen Bart und den milden hellblauen Augen, der in seinem schwarzen Beamtenrock so still und unauffällig einherging. So sah man ihn Tag für Tag, im Sommer mit einem breitkrempigen, weißen Strohhut, winters mit brauner Pelzmütze und dickem, weißem Shawl um den Hals, durch die winkeligen Gassen der kleinen Stadt gehen, um seinen Amtsgeschäften obzuliegen oder seinen Spaziergang zu machen.
Storms Lieblingsweg war der Seedeich, der, hart an der Stadt beginnend, sich meilenweit in die grüne Marsch hineinschlängelt. Gegen Westen blickt man auf das Meer mit den vorgelagerten, meist »wie Träume im Nebel« liegenden Inseln und landeinwärts auf weite grüne Wiesenflächen, die in unabsehbarer Ferne mit dem Horizont verschwimmen. Mit der Heimatliebe aller eingebornen Küstenbewohner, die selbst in der schönsten Gebirgs- oder Waldgegend die andern oft unverständliche Sehnsucht nach diesem unendlich weiten Horizont ihres Flachlandes nicht los werden, hing Storm an seiner Heimatgegend. Stundenlang konnte er an Sonntagen dem Anschlagen der Wellen gegen den Strand und dem einförmigen Schrei der Seevögel lauschen oder in die rotblühende Heide, die sich auf der andern Seite der Stadt hindehnt, hineinwandern.
In religiösen Sachen war Storm völliger Freidenker und pflegte auch mit seiner Meinung nicht hinter dem Berge zu halten. Das war vielleicht das Einzige, wodurch er die strenge an dem guten alten Brauch des sonntägigen Kirchganges festhaltenden Mitbürger hier und da vor den Kopf stieß, ausgenommen noch, daß einige besonders charakterfeste ältere Damen der Gemeinde manchesmal an den »zu freien« Stellen seiner Werke Ärgernis nahmen. Aber im Ganzen war man doch milde und tolerant in der kleinen Stadt und »vergab« dem Menschen, was der Dichter etwa »fehlen« mochte, und Storms liebenswürdige Persönlichkeit trug über alle Bedenken gegen seine Ansichten in diesen oder jenen Lebenssachen stets den Sieg davon.
Eines eigentümlichen Zuges möchte ich hier noch Erwähnung tun. Storm glaubte trotz seiner rationalistischen Lebensauffassung an alle möglichen Geister. Es war so eine Art Märchenglauben in ihm. Er verkehrte viel in der Familie des Landrats, dem das alte, malerisch von Ulmen umkränzte Schloß Husums mit seinen weiten Räumen, großen Sälen, Wendeltreppen und unheimlich düsteren Gängen zur Amtswohnung diente. Nachdem Storm Husum schon verlassen, kehrte er alljährlich zu längerem Besuch im Schlosse ein und war dann durch keine Macht der Welt zu bewegen, sein Quartier in einem der ziemlich zahlreichen Zimmer aufzuschlagen, in denen es »spuken« sollte. Abends vermochten wir Kinder ihn öfters zum Erzählen von Geister- und Spukgeschichten, dann konnte ihn selbst das Gruseln so heftig ankommen, daß er stets eines von uns als Begleitung mitnahm, wenn er sich nach den entlegenen Gastzimmern, die er bewohnte, begeben wollte.
Damit habe ich schon vorgegriffen. Im Jahre 1880 verließ Storm Husum, um frei von Amt und Bürden seinen Lebensabend in dem anmutigen holsteinischen Dörfchen Hademarschen zu beschließen. Er baute sich dort ein eigenes Haus und lebte die Jahre, die ihm noch vergönnt waren, nur seinem Schaffen und seiner Häuslichkeit. Jedes Jahr kam er auf längere Zeit wieder nach Husum. Der Abschied von der alten Heimat wurde ihm stets aufs Neue schwer und er sprach in den letzten Jahren sogar davon, sich wieder ganz dort niederzulassen. Aber es kam nicht mehr dazu. Theodor Storm starb im Juni 1888. Er war schon lange schwer leidend gewesen, aber vom Sterben wollte er nie etwas wissen. Ihm, der zeitlebens ein Priester des Schönen gewesen, erschien der Tod als etwas Häßliches, Grauenvolles und er sprach oft in bezug auf sein Alter davon, wie schön auch das Abendrot noch sei, wenn die Sonne niedergegangen.
In seiner grauen Stadt am Meer liegt er begraben, auf dem kleinen, lindenbeschatteten, alten Kirchhof. Die Husumer haben ihren Dichter nicht vergessen und legen ihm noch manchen roten Heidekranz auf die schmucklosen, grauen Steinplatten nieder, welche die Storm'sche Familiengruft decken.
In seinem Testament hatte Storm ausdrücklich verlangt, ohne Geistlichen und ohne Glockenklang begraben zu werden. Kurz vor seinem Tode hatte er noch einmal darauf hingewiesen, daß er sein letztes Bekenntnis in folgenden Worten seines Gedichtes »Ein Sterbender« niedergelegt habe:
»Auch bleib' der Priester meinem Grabe fern,
Viragines oder Hetären?
»Tout cela est fâcheux. Et, dussé-je passer pour être d'une morale trop légère, j'en reviens volontiers à la ›galanterie‹, c'est-à-dire à cette chose mal définissable, où entraient le désir, le goût vif, l'esprit, la volupté, une pointe de tendresse, et qui se défendait de la douleur, de la mélancolie et des crises du désespoir. La vie moderne est si dure, si âpre, les idées générales ont de si cruelles invertitudes que je me risque comme un remède à conseiller, à louer l'amour sans inquiétude, sans souci du lendemain, sans drame ni crise, rieur et tolérant tout au plus une larme furtive qu'on peut ne pas voir sans être cruel . . .«
COLOMBA, dans l' Echo de Paris.
Darüber, was Frauen ziemt, sind die Ansichten wol noch nie so weit auseinander gegangen wie in unseren Tagen, wo die Emanzipazion und gleichzeitig die Modernität auf erotischem Gebiet immer weitere Kreise zieht und diesen beiden gegenüber hartnäkiger wie je das Filistertum auf seinen Zopfanschauungen und Zopfgebräuchen behart, wie die bekante hipnotisierte Henne, die sich nicht traut, über den Kreidestrich hinauszugehen.
Und all' diese verschiednen Anschauungen und ihre verschiedne Betätigung rufen allgemeine Streitstimmung hervor und verwirren manches harmlos neutrale Gemüt. Wer hat Recht und wer hat Unrecht? – Und was ist hier das Rechte, und was das Unrechte? – so halt es hin und wider, denn wir ordnungsliebenden Europäer halten es nun einmal für notwendig, das bei jeder Gelegenheit festzustellen.