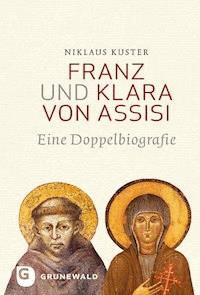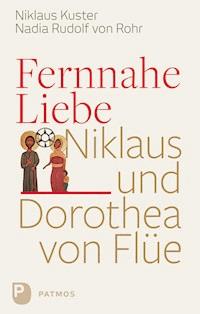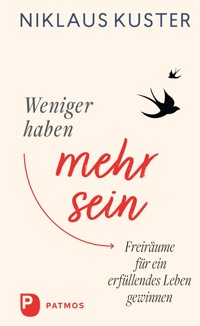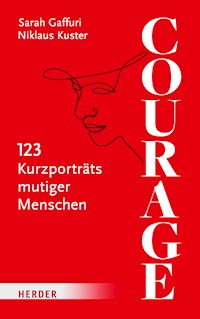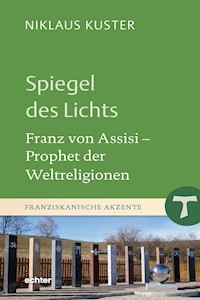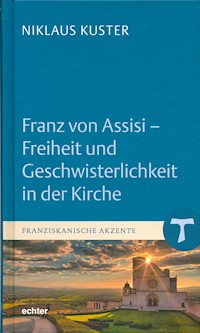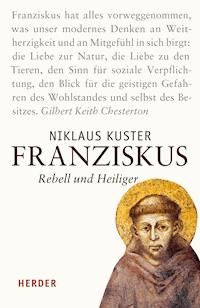
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Anschaulich und fundiert zeichnet der Kapuziner Niklaus Kuster das Leben des heiligen Franziskus nach. Zugleich machen die Auslegungen der bekanntesten Schriften von Franz von Assisi die Spiritualität und Kreativität des Heiligen für unsere heutige Zeit fruchtbar. Ausgewählte Bilder verdeutlichen die Botschaft zu radikaler Nachfolge, zu Geschwisterlichkeit und zu geistiger Freiheit noch einmal in -besonderer Weise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Niklaus Kuster
Franziskus
Rebell und Heiliger
Impressum
Titel der Originalausgabe: Franziskus
Rebell und Heiliger
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2009, 2010
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Finken & Bumiller
Umschlagmotiv: Archiv Herder
E-Book-Konvertierung: epublius GmbH, Berlin
ISBN (E-Book): 978-3-451-80456-4
ISBN (Buch): 978-3-451-30153-7
Inhalt
VORWORT
I. LEBENSSKIZZE
1 Leben in Assisi
2 Vom Büßer zum Bruder
3 Sendung bis an die Grenzen der Erde
4 Der lebendige Heilige
II. SPIRITUALITÄT
5 Der eine Vater und seine geschwisterliche Welt
6 Jesus Christus und eine menschliche Gesellschaft
7 Der Geist Gottes und eine lebendige Kirche
III. AKTUALITÄT
8 Grenzüberschreitungen
9 Prophetisches
Anhang
Chronologie
Quellen
Literaturauswahl
Personenlexikon
Glossar
VORWORT
Assisis berühmter Sohn ist in einer Welt geboren, die viele wie ein Paradies empfinden. Landschaftlicher Zauber, mittelalterliche Gassen und italienische Lebensfreude allein erklären jedoch nicht, weshalb Menschen aus allen Ländern nach Assisi reisen. In keiner anderen Stadt wird auf den Plätzen so viel und in allen Sprachen gesungen. An keinem anderen Ort der Welt gehen Fremde verschiedener Kulturen, Kirchen und Religionen so offen aufeinander zu. Im Jahr 1986 beteten in Assisi Vertreterinnen und Vertreter aller Welt- und einiger Naturreligionen erstmals in der Geschichte gemeinsam um Frieden. Angesichts eines neuen „westlichen Kreuzzuges“ kamen sie Anfang 2002 erneut zusammen, noch besorgter, zahlreicher und entschlossener. Im Zeichen der New Yorker Terrorkatastrophe und des neuen Afghanistankrieges drückten dreihundert Delegierte kleiner und großer Religionen in dem umbrischen Städtchen dieselbe Überzeugung aus, die Franz von Assisi vor bald 800Jahren ins Heerlager des Sultans Malik al-Kâmil geführt hat: Nicht Waffen und Kreuzzüge, sondern Vertrauen auf Gott und in jeden Menschen überwinden letztlich Hass und Gewalt in der Welt. Eindringlicher denn je ruft der blaue Planet nach gemeinsamer Sorge für die Schöpfung und nach dem Einsatz aller für den Frieden. Nicht zufällig ist es das kleine Subasio-Städtchen, in dem die Religionen der Welt ein gemeinsames Zeichen setzten: ein Ort, an dem Menschen aller Länder, Sprachen und Generationen deutlicher als anderswo ihre innere Verwandtschaft erfahren.
Dieses Buch zeichnet das spirituelle Porträt des Menschen Franziskus, der sich schlicht „armer kleiner Bruder“ – fratello poverello – nannte. Seine persönliche Geschichte führt uns in die mittelalterliche Welt Umbriens, in der Städte neu erstanden und selbstbewusste Zünfte den Adel entmachteten. Nur scheinbar fern, erweist sich diese Zeit als die Morgenröte unserer eigenen Epoche. Ungeahnte Freiheit und blühender Handel, Reisefreude und Bildungsdurst, der Bau prächtiger Wohntürme und ausgelassene Feste, der Reiz der Mode und das Leben „in piazza“ standen in hartem Kontrast zu sozialer Armut, grausamen Kriegen und einer lebensfernen Kirche.
Die bewegte Lebensgeschichte des Francesco di Pietro di Bernardone ist zunächst von italienischer Lebensfreude geprägt, bis ihn existenzielle Erschütterungen in eine Krise führen. Lange Jahre spiritueller Suche lassen den jungen Luxuskaufmann dem tieferen Sinn des Lebens nachspüren. Er findet schließlich zu einer befreienden Spiritualität, die ihn Welt und Menschen mit geschwisterlichen Augen sehen lehrt. Seine individuelle Gottsuche am Rand der Stadt verändert seinen Blick auf die Welt und lässt ihn im Jahr 1208 erste Gefährten finden. Sie begegnen dem aufkommenden Frühkapitalismus kritisch, setzen sich gemeinsam für eine menschliche Gesellschaft ein und beginnen, die Kirche von unten zu erneuern. Im Frühling 1209 – vor genau achthundert Jahren – anerkennt der mächtigste Papst des Mittelalters InnozenzIII. diese geschwisterliche Bewegung an der Basis von Kirche und Gesellschaft.
Franziskus entdeckt mit seiner fraternitas eine inspirierte Lebenskunst und eine innere Freiheit, die im Kern radikaler als die französische Revolution ist, die prophetisch in seine Kirche spricht, den Dialog mit anderen Religionen aufnimmt und bis heute Menschen aller Kulturen fasziniert. Mit seiner Liebe zur Welt, der Tiefe seiner Quellen und der Freiheit in seinem Leben wird Franziskus auch in der Postmoderne für die einen zur Herausforderung und für andere zum spirituellen Begleiter in der eigenen Suche nach Sinn.
Im 800.Frühling,
seit sich der franziskanischen Bewegung
„Stadt und Erdkreis“ öffneten
Br. Niklaus Kuster
I.LEBENSSKIZZE
1.Leben in Assisi
Franziskus begegnet uns als Sohn einer reizvollen Kleinstadt und Spross eines selbstbewussten Bürgertums. Ehrgeizig und vom Leben verwöhnt, entdeckt er erst als erfolgreicher Kaufmann die Schattenseiten seiner Welt. Der Weg aus der Krise führt nach Jahren existenzieller Suche zum Bruch mit seiner Zunft und seiner Stadt. Zwei Einsiedlerjahre vor Assisis Mauern bringen ihn schließlich auf die Spur eines neuen Lebens. Wenn er fortan barfuß durch ganz Italien und den halben Mittelmeerraum zieht, bleibt er doch immer ein Sohn Assisis. Die umbrische Hügelstadt hat Franziskus geprägt. In jungen Jahren erlebt er das Erwachen der städtischen Kultur, trägt die bürgerliche Revolution mit und profitiert von jenem frühen Kapitalismus, der am Morgen der Moderne steht. Sein Ausstieg aus dem Kaufmannsleben führt nicht zur Verachtung dieser Welt, sondern eröffnet einen leidenschaftlichen Dialog mit ihr. Seine Karriere nach unten lässt ihn die Fußspuren des „armen Christus“ entdecken. Er verkündigt dessen Evangelium nicht wie die Kirchenmänner seiner Zeit, sondern mit der Sprache der städtischen Piazza, die in den konkreten Alltag der Menschen spricht.
Eine erwachende Kleinstadt vor 1200
So klein Assisi im 12.Jahrhundert auch war, genoss es doch die Sympathie und die persönliche Sorge des Stauferkaisers. FriedrichI.Barbarossa privilegierte das alte Städtchen im Jahr 1160: An der Westgrenze seines Herzogtums Spoleto gelegen, fand es als staufische Grafschaft den direkten Schutz des Kaisers. Erst wenige Jahrzehnte zuvor war die antike Umbrierstadt neu aus dem Verfall erstanden, den Goten und Langobarden in der Völkerwanderung eingeleitet hatten und der schließlich durch die Raubzüge der Karolinger besiegelt worden war. Der Neubau der Kirche San Rufino kündigt im 11.Jahrhundert das Neuerwachen des einst blühenden Asisium an. Wie überall in Europa wächst auch die Bevölkerung Italiens infolge des wärmeren Klimas, der besseren Anbaumethoden und einer ausgewogeneren Ernährung. Dieser Wachstumsschub führt zur Wiedergeburt der städtischen Kultur. Inmitten der ländlich-feudalen Welt des Hochmittelalters entstehen vitale Kleinstädte, in denen ein neuer Geist weht. „Stadtluft macht frei“, denn sie löst die Menschen aus Hörigkeit und Feudalbeziehungen, befreit sie von der Scholle oder aus engen Burgen und verbindet sie in einem neuen Sozialgebilde zu einer engen Schicksalsgemeinschaft. Gewerbe und handwerkliche Berufe, Märkte und Handel bringen die Geldwirtschaft zurück. Handelsreisen sowie Bildung erweitern den Horizont perspektivenreich und fördern den Austausch von Ideen. Im Zeichen seines wirtschaftlichen Aufschwungs drängt das entstehende Bürgertum immer drängender nach einer Beteiligung an der politischen Macht. Nach den großen Städten erringen in Mittelitalien gegen Ende des 12.Jahrunderts auch die kleinen Zentren die kommunale Selbstverwaltung. Adel und Bischöfe sehen ihre landesherrlichen Vorrechte von republikanischen Ideen bedrängt.
In dieser bewegten und spannenden Zeit des Umbruchs wird Franziskus geboren. Kurz vor seiner Geburt hatte das aufstrebende Städtchen Assisi bereits einen ersten Versuch unternommen, die deutsche Fremdherrschaft abzuschütteln. Daraufhin ließ Barbarossa im Jahre 1174 seinen Reichserzkanzler, den Mainzer Erzbischof ChristianI. von Buch, gegen die kleine Subasiostadt ziehen. Mit viel Glück blieb ihr nach erfolgreicher Belagerung das Schicksal Spoletos erspart, das keine zwanzig Jahre zuvor, mit Feuer und Schwert verheert, unter kaiserliche Botmäßigkeit hatte zurückkehren müssen. Nach Rückschlägen Barbarossas in der Lombardei muss sein Sohn HeinrichVI. die Stadt Perugia im Jahr 1186 von neuem besetzen. Herzog KonradI. von Spoleto, ein Gefolgsmann des Kaisers aus dem schwäbischen Urslingen (heute Irslingen bei Rottweil), hat als Graf von Assisi über eine zunehmend selbstbewusste Bürgerschaft zu wachen. Zeitweise residiert der Herzog sogar in der kaiserlichen Rocca über der klimatisch angenehmeren Subasiostadt. Die Verlagerung des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens vom Land in die Stadt zwingt auch den Adel der Umgebung dazu, von seinen feudalen Landsitzen in städtische Wohntürme zu ziehen. Aristokratische Clans bevölkern die kleine Oberstadt Assisis. Weil ihnen ihr Großgrundbesitz als Zeichen himmlischen Segens erscheint, nennen sie sich „boni homines“ (gute Menschen), die sich als Maiores über die Bürger erheben. Diese hatten sich als Minores und „homines populi“ (Leute des Volkes) auf die Unterstadt zu beschränken. „Ordnung muss sein“ – und solange ein deutscher Graf über die Stadt wacht, wird Assisi zumindest politisch noch von den Adeligen dominiert.
Ein ehrgeiziger Kaufmannssohn
Franziskus kommt in der Unterstadt zur Welt. Seine Familie zählt zu den reichsten in Assisi. Der Vater gehört der Kaufmannszunft an. Durch die Produktion eigenen Wolltuches, den Handel mit Luxusstoffen und mit Geldverleih hat die Familie ein beachtliches Vermögen erwirtschaftet. Mindestens fünf Häuser sowie Grundbesitz in der Umgebung kann Pietro di Bernardone sein Eigen nennen. Dass seine Frau aus Südfrankreich stammen soll, wird erst in späteren Überlieferungen greifbar – und bleibt zweifelhaft, denn eine andere Tradition meint, dass Pietro sie in Lucca kennengelernt habe. Nachweisen lässt sich die Herkunft der Mutter Francescos ebenso wenig wie ihr erst spät bezeugter Name Pica. 1182 wird dem Paar ein erster Sohn geboren. Dass die Mutter dem kleinen Giovanni gleich nach der Geburt weder den Namen seines Vaters noch des Großvater Bernardone gibt, könnte auf den 24.Juni, den Johannestag, als Geburtsdatum hindeuten. Tatsächlich wird Franziskus später als Wanderprophet Johannes den Täufer in besonderer Art ehren. Vater Pietro ist gerade auf Geschäftsreise in Frankreich. Der Import kostbarer Stoffe aus Südfrankreich und deren Verkauf auf den Märkten des Spoletotals tragen wesentlich zum Erfolg des Handelshauses bei. Als der glückliche Vater zurückkehrt und sein Söhnchen zum ersten Mal in den Armen hält, benennt er es in Francesco um. „Panno francesco“ ist ein begehrter französischer Modestoff. Der neue Name erinnert an kostbares Tuch und steht für Reichtum, Eleganz und erfolgreiche Geschäfte. „Französisch“ sind damals aber auch die neue Poesie, höfische Kultur und Minnelieder, die von italienischen Kaufleuten bewundert werden. Der kleine Francesco wird von der sagenhaften Tafelrunde des Königs Artus hören und sich als Jugendlicher selbst in ritterlichem Verhalten üben. Selbst als er, nunmehr erwachsen geworden, mit der frühkapitalistischen Mentalität seiner Zunft bricht, nimmt er das Edel-Ritterliche und die Kunst der Troubadours mit in ein ganz anderes Leben. Doch bis dahin sind es noch viele sonnige und ereignisreiche Jahre.
Umsichtig bereitet Pietro seinen ersten Sohn auf den Kaufmannsberuf vor. In der Pfarrschule von San Giorgio erhält Francesco eine rudimentäre Grundbildung. Im Kreis einiger privilegierter Söhne lernt er Lesen, Schreiben und Rechnen, und er erwirbt Elementarkenntnisse in Latein. Die Notare schrieben damals lateinisch, und auch Geschäftsabschlüsse, Kauf- und Verkaufsverträge wurden in dieser Schriftsprache abgefasst. Mittellatein diente zudem der internationalen Verständigung. Vom Vater lernt der junge Franziskus wohl auch Provençalisch, die Sprache der wichtigsten Geschäftskontakte mit Südfrankreich. Die Bildung des Jungen war damit ganz auf die Bedürfnisse der führenden Bürgerschicht ausgerichtet. Sie lässt Franziskus nach seinen eigenen Worten dennoch einfältig und ungebildet bleiben:„idiota et ignorans“ (Test, Ord) – ein Mann ohne höhere Bildung und mit der ungelenken Schrift eines Händlers.
Mit 14Jahren wird der Kaufmannssohn volljährig. Somit muss er 1196 dem Adel Assisis und dem deutschen Grafen in der Rocca erstmals die Herrendienstpflicht schwören. Zugleich tritt er in die Zunft seines Vaters ein. Sie führt die Zünfte an, denn sie steht über den Handwerkszünften der Schuhmacher, Weber, Schneider, Schmiede, Steinmetze, Wagner, Bäcker und Metzger. In seiner Zunft entwickelt sich Franziskus zu einem gewandten Großkaufmann. Sein jüngerer Bruder Angelo ist wohl weniger tüchtig. Die Hoffnungen der Eltern ruhen auf dem Ältesten, der das florierende Handelshaus des Pietro di Bernardone talentiert weiterzuführen verspricht. Wahrscheinlich nimmt der Vater seinen Sohn nun auch auf Handelsreisen in die Zentren der südfranzösischen Textilproduktion mit. Die Freude, mit der Franziskus später immer wieder spontan „französisch“ spricht oder wie ein Troubadour des Languedoc singt, erklärt sich am besten durch solch direkte Kontakte. Während der Junior im Geschäft erfolgreich und ehrgeizig dem Beispiel seines Vaters folgt, zeigt er sich in der Freizeit weit sinnenfreudiger und großzügiger als Pietro. Die mit dem Alltag in Assisi bestens vertrauten „Dreigefährten“, eine der verlässlichsten Quellensammlungen, erinnern sich: „Dem Spiel und Sang ergeben, durchzog er bei Tag und Nacht mit Gleichgesinnten die Stadt Assisi. Dabei war er so freigebig, dass er alles, was er haben und verdienen konnte, für Gastmähler und andere Dinge ausgab“ (Gef 2).
Die Eltern sehen die Großzügigkeit ihres Ältesten wohl nicht ungern: Extravagante Kleidung und eine elegante Erscheinung, höfische Sitten und der Verzicht auf Pöbelhaftes, ja auf jedes grobe Wort, finesse im Verhalten und Sprechen sowie Großherzigkeit gegen Kleine und Arme – all das verheißt ihm eine glanzvolle Zukunft in der kleinen Stadt. Der lebensfreudige und verschwenderische Sohn macht zunächst in der „Gemeinschaft der Tänzer“ Karriere, die im Lauf des Jahres weltliche und religiöse Tanzspiele aufführt. Hierbei wird das Frühlingserwachen ebenso ausgelassen gefeiert wie später die Weinlese im Zeichen des Bacchus. Phantasie und Geld lassen Franziskus zum Anführer solcher Feste werden (Gef 7). Sein ganzes Leben wird er ein Tänzer, Dichter und Gaukler bleiben, der wie ein „Troubadour“ auftritt, seine Botschaft leidenschaftlich gern inszeniert und schließlich auch zu seinen Predigten tanzt.
Mit 16Jahren erlebt der junge Kaufmann ein erstes Schicksalsjahr seiner Heimatstadt mit, das sein ganzes Leben prägen wird. Kaiser HeinrichVI., Barbarossas Sohn, fällt Ende 1197 in Süditalien einer Seuche zum Opfer. Sein Söhnchen Friedrich ist erst drei Jahre alt. Assisi nutzt nun das entstehende Machtvakuum im Reich geschickt aus. Als der deutsche Herzog in Spoleto sich 1198 mit dem neu gewählten Papst InnozenzIII. überwirft und dessen Druck weichen muss, stürmen die Bürger die Rocca noch vor Ankunft des päpstlichen Gesandten. Gewiss hat sich auch Franziskus an dieser Zerstörung beteiligt. Mit den Steinen der Stauferburg werden die Mauern des Städtchens erweitert und die Tore befestigt – ein klares Zeichen dafür, dass Assisi seine neu gewonnene Freiheit entschlossen verteidigen will. Im folgenden Jahr bricht innerhalb dieser Mauern der Bürgerkrieg aus: Die Spannungen zwischen Maiores und Minores eskalieren. Die Bürger, denen Assisi seine wirtschaftliche Blüte verdankt, setzen sich jetzt auch politisch durch und errichten eine demokratische Gemeindeordnung. Adelige, die sich nicht in die neue Comune einfügen, werden aus der Stadt vertrieben. In der Oberstadt gehen stolze Geschlechtertürme in Flammen auf, während die Bewohner auf ihre Landsitze fliehen müssen. Anfang 1200 wechseln einige aristokratische Sippen gar ins sichere Perugia, um von dort aus gegen Assisi zu agieren. Auch der Offreduccio-Clan, die Familie der kleinen Clara, gehört zu ihnen. Das eben erst sechsjährige Adelstöchterchen wird Franziskus erst viel später nach seinen Exilsjahren kennenlernen.
Ritterträume
Bald nach der bürgerlichen Revolution in Assisi eskaliert seine alte Rivalität zur weit größeren und mächtigeren Etruskerstadt Perugia. Franziskus nimmt als junger Mann an den ersten Volksversammlungen der Gemeinde teil. Er erlebt den begeisterten Aufbruch einer Kleinstadt, die künftig demokratische Entscheidungen fällt und sich durch jährlich gewählte Konsuln leiten lässt. Entschieden demokratisches Denken kennzeichnet später auch die franziskanische Bewegung der „Minderbrüder“ in ihren Versammlungen, ihrer gemeinsamen Wegsuche und Ämterstruktur. Doch bleiben wir noch bei Assisi, dessen neues Lebenszentrum nun die Piazza del Comune wird. In deren unmittelbarem Umfeld verfügt Pietro di Bernardone über zwei Häuser. Die Familie setzt sich in der neuen Stadtmitte fest.
Die äußeren Spannungen, die der talentierte Sohn erlebt, schmälern weder seinen Ehrgeiz noch seine Lebenslust. Er lernt, auf den Volksversammlungen zu sprechen, profiliert sich als Kaufmann, tanzt abends mit Freunden durch die Gassen, reitet mit schönen Stoffen auf den großen Markt von Foligno – und träumt kühn von einer glanzvollen Zukunft. Der Reichtum seines Hauses und der Einfluss seiner Familie sollen mit der kulturellen Eleganz des entmachteten Adels verbunden werden. Um in den Ritterstand aufzusteigen, hat der junge Kaufmann drei wesentliche Bedingungen zu erfüllen: Er muss sich Pferd und Rüstung leisten können, er muss sich in allem und insbesondere Bedürftigen gegenüber ritterlich verhalten, und schließlich soll er sich auch im Kampf auszeichnen. Die ersten beiden Bedingungen erfüllt der ehrgeizige Sohn Pietros bereits. Was noch fehlt, ist die furchtlose Bewährung im Krieg. Doch schon bald bietet sich eine Gelegenheit hierzu in der Städtefehde gegen Perugia. Vermutlich im Herbst 1202 kommt es zum blutigen Zusammenstoß zwischen Assisi und seiner Rivalin. Bei Collestrada am Tiber erlebt Franziskus die Niederlage Assisis als grauenhaftes Debakel. Er hat zu Pferd gekämpft und wandert nun mit den Söhnen Reicher und Vornehmer an gefallenen Freunden vorbei in Perugias Kerker. Über ein Jahr dauert die Kriegsgefangenschaft. Erst der Vertrag zwischen boni homines und homines populi vom 6.November 1203 ermöglicht die Heimkehr der Gefangenen und bringt Assisis Bürgern zugleich einen politischen Rückschlag ein. Seine Gefährten erinnern sich, dass ziskus die Dunkelheit, das Elend der Zusammengepferchten und den Psychoterror im Kerker erstaunlich gut ertragen hat (Gef 4). Nach seiner Rückkehr wird er allerdings von einer langwierigen Krankheit niedergestreckt, die dunkle Schatten über sein bislang so farbenfrohes Leben wirft. Der erste Biograf berichtet, wie Franziskus nach Monaten im Dunkeln ans Licht Assisis kommt: auf einen Stock gestützt, an dem er sich neue Kraft antrainieren muss (1C 3).
Assisi im 13.Jahrhundert: Die Stadt teilt sich in die adelige Ober- und die bürgerliche Unterstadt. Franziskus’ Familie setzt sich an der Piazza del Comune fest, die nach dem kommunalen Umsturz ab 1198 zum eigentlichen Stadtzentrum wird. 1: Rocca der Staufer, 2: Oberstadt, 3: Piazza San Rufino, 4: Piazza del Comune, 5: Unterstadt, 6: Abtei San Pietro
Franziskus nimmt sein früheres Leben wieder auf, doch die Stadt scheint ihren Glanz verloren zu haben. Einige Monate später hört der junge Mann von einem legendären Söldnerführer, der im Auftrag des Papstes gegen die Anarchie im unruhigen Süden Italiens kämpft. Als ein Adeliger aus Assisi sich im Frühjahr 1205 diesem Apulienfeldzug anschließen will und dafür Begleiter sucht, rüstet sich Franziskus ein zweites Mal für den Krieg. Bereits im Vorfeld träumt er von einem herrschaftlichen Wohnturm voller Waffen (Gef 5). Ehrgeizig gesteigerte Träume verbinden sich mit ritterlichem Verhalten im Alltag. So soll der junge Kaufmann seine erste Ausrüstung einem anderen Adeligen geschenkt haben, der verarmt war und dem er so die Beteiligung am Kriegszug ermöglicht (Gef 6). Giotto hat den Traum vom Palast und die Begegnung mit dem Ritter in seinem biografischen Freskenzyklus verewigt.
Doch die kühnen Träume von Pferden, Sätteln, Schilden und Schwertern reichen nur zwei Tagesritte weit. Eine unruhige Nacht in Spoleto bewegt den Dreiundzwanzigjährigen zur Rückkehr: Im Halbschlaf soll ihn eine innere Stimme gefragt haben, warum er Knechten nachlaufe und nicht dem Herrn selbst diene (Gef 5, AP 4–7). Zu jener Zeit wird Spoletos Domfassade mit einem monumental-prachtvollen Giebelmosaik geschmückt, das Christus als „Pantokrator“ auf einem Goldthron darstellt. Ist es dieser Herr, der Weltenherrscher, der in sein Innerstes spricht?
„… als ob es Christus nicht gäbe“
„Cum essem in peccatis“: Mit diesen vier Worten bezeichnet der spätereHeilige im Jahr 1226 rückblickend sein bisheriges Leben. Der Historiker Raoul Manselli interpretiert diese Wendung im Sinne eines Lebens ohne Gott. Gewiss hat Franziskus als Junge in der Pfarrschule mit dem Psalterbuch Lesen und Schreiben sowie Latein gelernt. Fraglos hat er sich am religiösen Brauchtum der Stadt beteiligt und hat sonntags auch mit der Familie den Gottesdienst besucht. Doch der ferne Gott der Romanik erreicht das Alltagsleben der Bürger nicht. Als Weltenherrscher, von Sonne und Mond bedient, zeigt ihn das Portal der neuen San Rufino-Kirche, hoch über Erde und Menschen thronend.
Franziskus und ein verarmter Ritter (Giottoschule, Basilica San Francesco in Assisi): Der Bürgersohn im Schnittpunkt zweier Welten: Er hat die florierende Stadtwelt in seinem Rücken und die ländliche Adelswelt mit ihren Burgen vor sich. Er schenkt den Mantel einem Ritter, der verarmt und bedürftig zu Fuß unterwegs ist, während der Kaufmann sich bereits das Pferd, Statussymbol des Adels, leisten kann. (© Archiv Herder)
Wen wundert es, dass dieser König aller Könige und Herr aller Mächte unerreichbar bleibt und keinen Einfluss auf das Geschick geschäftiger Bürger nimmt? Tatsächlich reagiert Franziskus, wenn er im Geschäft herzlos handelt und einen armen Bettler hinauswirft, nicht auf die Ermahnungen kirchlicher Moral oder biblischer Gleichnisse. Es ist sein ritterliches Ideal, das Reue weckt, wenn magna rusticitas (bäuerische Grobheit) das Gebahren des Kaufmanns weit hinter höfisch-edlem Umgang (curialitas, cortesia) herhinken lässt. Von Spoleto nach Assisi zurückgekehrt, führt der junge Kaufmann sein gewohntes Leben weiter. Doch stellt er sich nun der Unruhe, die sein Innerstes seit den dunklen Erfahrungen von Krieg, Kerker und Krankheit bewegt. Weder Geschäft noch Besitz, weder Wissen noch Charme, weder Freunde noch Ärzte hatten verhindert, dass sein Leben in bodenlose Abgründe fiel. Stimmen aus jenem Dunkel verschaffen sich nun Gehör und finden keine Antwort. Was nützen modische Kleider, wenn du innerlich leer und nackt bleibst? Was sollen Feste mit Freunden, wenn sie deine Seele allein lassen mit schrecklichen Erinnerungen und bohrenden Fragen? Was haben Reichtum und politisches Geschick des Vaters denn geholfen, als die Krankheit ihn in den Abgrund führte? Franziskus tut einen wichtigen Schritt. Weil er spürt, dass er vor sich selbst davonläuft, stellt er sich seinen Fragen und beginnt mitten in seiner Realität zu suchen.
Assisi, Dom San Rufino: Das Portaltympanon des neuen Domes stammt aus Franziskus’ Zeit. Es zeigt den Weltenherrscher der Romanik zwischen Sonne und Mond thronend, umgeben von seiner Mutter, die ihren Sohn als Königin stillt, und vom Stadtpatron Rufin. (© Niklaus Kuster)
Er ringt um Antworten, um Werte und um ein Leben, das wirklich trägt. Er ahnt, dass kein Mensch es ihm zeigen kann – nur Gott allein, so fern er ihm auch erscheinen mag.
Wege hinauf und Wege hinunter
In seinem Hunger nach neuer Lebensfreude und nach einem tieferen Sinn wird Franziskus zunächst zu einem hilflos Suchenden. Ab und zu stiehlt er sich aus der Stadt hinaus. Vom Berghang des Subasio blickt er hinunter auf Assisi, auf seine Lebenswelt und seine Erfahrungen. Mit der Zeit entdeckt er in den Wäldern Höhlen, in die er sich zurückziehen kann. Ihr Halbdunkel entspricht wohl seiner inneren Welt (1C 6). In dieser Zeit beginnt der Kaufmann vermutlich jenes Gebet zu sprechen, das erstmals waches Hören auf die kirchliche Verkündigung erkennen lässt und das ihn über Monate begleiten wird (GebKr):
Altissimo glorioso Dio,
illumina le tenebre de lo core mio
et da me fede dricta,
sperança certa e caritade perfecta,
senno et cognoscemento,
Signore, che faça
lo tuo santo e verace commandamento.
Amen.
Sinngemäß lassen sich die auf altumbrisch überlieferten Worte so übersetzen:
Höchster, lichtvoller Gott,
erleuchte die Finsternis in meinem Herzen:
gib mir einen Glauben, der weiterführt,
eine Hoffnung, die durch alles trägt,
und eine Liebe, die auf jeden Menschen zugeht.
Lass mich spüren, wer du, Herr, bist,
und erkennen, wie ich deinen Auftrag erfülle.
Amen.
Farnziskus’ Wege hinauf in die Wälder und stille Stunden sind die eine Suchbewegung. Sie fragt nach dem „Altissimo e glorioso Dio“ und erhofft sich Antwort vom romanischen Gott, der „lichtvoll über allem“ thront. Die zweite Suchbewegung führt hinunter. Erst jetzt lernt Franziskus das andere Assisi kennen: die dunklen Gassen der Arbeiter und der Ausgenutzten, das Schicksal des neuen Proletariats, das Elend der Kranken, der Bettler und Gestrauchelten am Rande der Stadt. Die Gefährten erinnern sich an ungewöhnliche Begebenheiten im Leben des Kaufmanns, der sich nun immer öfter abseits der Piazza in der Schattenwelt der untersten Gassen herumtreibt. Eines Tages deckt er den Familientisch mit vielen Broten, die er dann den Bettlern bringt, um so auch den Armen kleine Feste zu bereiten (Gef 9).
Im Jahr 1205, bei der jährlichen Rom-Wallfahrt der Familie und der Freunde, kommt es in der Peterskirche zu einem Eklat. Menschen, die für sich selbst keinen Luxus scheuen, haben den Bettlern am Portal der alten Basilika nur die kleinsten Kupfermünzen hingeworfen. Franziskus schämt sich derart über diese Hartherzigkeit, dass er sein Reisegeld mit lautem Geklirr zum Grab des Apostelfürsten hinunter schleudert. Und nicht genug damit: Seine späteren Gefährten berichten, dass er danach die Kleider mit einem Bettler getauscht und sich für den Rest des Tages selbst in Lumpen unter die Armen gesetzt hat, um unerkannt „auf französisch“ zu betteln (Gef 10). Bis vor kurzem noch ein gefeierter Festkönig, erscheint der Kaufmann seinen jungen Zunftgenossen nun zunächst wie ein Verliebter, dann aber wird er ihnen immer fremder. Seine Sinnsuche entfremdet ihn von Familie und Geschäft, führt ihn an einsam-stille Orte und zu den Hütten der Bettler. Das Leben im Stadtzentrum hat seine letzten Farben verloren. Franziskus stellt sich den dunklen Fragen seiner Seele und erlebt dabei – in den einsamen Höhlen und in der Erfahrung der Armen– Lichtstunden im Schattenreich.
Vier Jahre sind vergangen seit dem Krieg, drei seit dem Kerker, zwei seit seiner Krankheit und eines seit Spoleto. Wachsende Zerrissenheit zwischen Tuchladen und Unterstadt, zwischen Festgelagen und Bettlerkreis, farbenfroher Piazza und einsamer Höhle, familiärem Karriereplan und namenloser Sehnsucht drängen ihn zu einem Wechsel. Doch wie und wohin? Franziskus hält das Alte noch durch und tastet sich zugleich vor in eine neue Lebenswelt.
Umarmung eines Aussätzigen
Keine Stimme von oben, weder vom Himmel noch von Kanzeln, bringt Antwort in seine Sinnsuche. Doch Offenheit für Menschen und Mut zur Stille eröffnen ihm Brücken in bislang unerkannte Bereiche. Im Kontakt mit den Menschen am Rand und mit einem tiefen Geheimnis gewinnt Franziskus verlorene Lebensfreude zurück – und tastet sich weiter. Ein erster Durchbruch erfolgt in der überraschenden Begegnung mit einem Aussätzigen (Test).
In seinem Lebensrückblick bekennt der Heilige, wie er als Kaufmann widerlichen Abscheu vor Leprakranken empfunden hat. Er teilt diesen Ekel mit der gesamten mittelalterlichen Stadt. Der Aussatz hatte sich im Gefolge der Kreuzzüge auch in Europa verbreitet, wo die entsetzliche „Seuche“ übersteigerte Ängste hervorrief. Bereits kleinste Anzeichen der Krankheit oder auch nur auffällige Hautveränderungen genügten, um Menschen jeden Alters mitten aus ihrer Familie und dem Berufsleben zu reißen. Stellte der Arzt den Verdacht auf Lepra fest, kam diese Diagnose einem sozialen Todesurteil gleich. Die Unglücklichen wurden in ein spezielles Bußgewand gekleidet und in einer Art Beerdigungsliturgie aus der Stadt verabschiedet. Sie hatten künftig draußen in Leprosenheimen oder Siechenhäusern zu leben und Buße für die Sünden zu tun, um deretwegen Gott sie angeblich so schwer bestraft hat. Reichten die Güter des Siechenhauses und die üblichen Almosen für ihren Lebensunterhalt nicht aus, konnten sie am Wegrand betteln. Jegliche Annäherung an Gesunde sollte dabei jedoch mit scharfen Auflagen und Sanktionen verhindert werden. Aussätzige hatten deshalb eine Klapper mit sich zu tragen, mit der sie Entgegenkommende warnten und auf Distanz hielten.
Als Franziskus eines Tages im Winter 1205/06 bei einem Ritt in der Ebene unverhofft auf einen Aussätzigen trifft und der schmale Weg ein Ausweichen nicht zulässt, kann er der kläglichen Gestalt nicht einfach ein Almosen zuwerfen und sich davonmachen. Die späteren Gefährten berichten: „Während er sonst gewohnt war, vor Aussätzigen großen Abscheu zu haben, überwand er sich, stieg vom Pferd, reichte dem Aussätzigen ein Geldstück und küsste ihm die Hand. Dieser dankte ihm mit dem Friedenskuss. Franziskus stieg wieder zu Pferd und setzte seinen Weg fort.… Wenige Tage später nahm er eine große Summe Geldes und begab sich zum Aussätzigenhospital. Nachdem er sie alle zusammen versammelt hatte, schenkte er einem jeden eine Gabe und küsste allen die Hand. Als er wegging, war ihm die bittere Erfahrung, Aussätzige zu sehen, in innerste Freude verwandelt. Denn so widerwärtig war ihm zuvor der Kontakt mit Aussätzigen, dass er einen weiten Bogen um ihre Behausung machte, jede Begegnung mied und wenn er einmal einen sah, das Gesicht abwandte und mit den Händen die Nase zuhielt.… Doch Gott fügte es, dass er ein Vertrauter und Freund der Aussätzigen wurde, so sehr, dass er später unter ihnen lebte und ihnen in aller Schlichtheit diente“ (Gef 11).
Auch Franziskus selbst deutet seine ersten menschlich-nahen Begegnungen mit Aussätzigen als die entscheidende Wende in der Zeit seiner Sinnsuche. Im Rückblick auf sein Leben erkennt er, dass der „Höchste“ selbst es war, der ihm diese Erfahrungen ganz unten ermöglicht hat (Test):
Ich lebte zwanzig Jahre lang,
als ob es Christus nicht gäbe.
Damals schien es mir widerlich und bitter,
Aussätzige zu sehen.
Doch Gott selber hat mich zu ihnen geführt,
und in der Begegnung mit ihnen
ist meine Liebe erwacht.
Da verwandelte sich in tiefstes Glück
(Süßigkeit) für Leib und Seele,
was mir bisher bitter erschien.
Kurze Zeit nur, und ich verließ die bürgerliche Welt.
Während die Erfahrungen in Assisis Schattenwelt ihm zu Lichtstunden werden und die Begegnungen mit den ganz Elenden neue Lebensfreude in ihm wecken, verblasst seine einstige Lebensweise im Mittelpunkt der Stadt immer mehr. Der Kaufmann will begreifen, wohin ihn seine seltsamen Schritte führen möchten. Er zieht sich weiterhin an einsame Orte und in Höhlen zurück, wo er sich vom Höchsten Antwort erhofft.
Mystische Begegnung in San Damiano
Wenige Wochen nach der ersten Umarmung eines Aussätzigen begibt Franziskus sich in eine kleine Landkirche, um das erfahrene Glück zu verstehen. Die geographische Lage von San Damiano ist bezeichnend. Es liegt am Rand der Ebene unterhalb Assisis und unweit des Leprosenhospitals. In seiner dunklen Armseligkeit erinnert das einsturzgefährdete Kirchlein an eine Höhle. Wieder ruft der Suchende den Weltenherrscher der Romanik an, den er lichtvoll über allem vermutet. Ihn bittet Franziskus, dass er ihm „die Finsternis im Herzen erleuchte und einen Glauben schenke, der weiterführt, eine Hoffnung, die durch alles trägt, und eine Liebe, die niemanden ausschließt“. Durch die Erfahrungen der letzten Monate und Wochen seltsam und unerwartet mit tiefem Sinn erfüllt, sehnt sich sein Gebet nach Klarheit und einem neuen„Auftrag“. Da geschieht ein zweiter Durchbruch. Die menschlichen Begegnungen haben den jungen Mann auf eine tief mystische Erfahrung vorbereitet. Als Franziskus im Halbdunkel von San Damiano zum „Höchsten, glorreichen Herrn“ betet, fällt sein Blick auf ein ungewohntes Bild: ein Ikonenkreuz, das Christus nicht als Pantokrator in kaiserlicher Majestät auf einem Goldthron zeigt, sondern nackt am Kreuz. Der Höchste, zu dem er seit einem Jahr betet, zeigt sich hier schlicht und verachtet in menschlicher Armut. Nicht der Weltenherrscher, sondern der Menschgewordene, nicht der Erhabene, sondern der Solidarische erwartet ihn. Nicht der Herr der Herren, sondern der Freund der Kleinen, Gefallenen und Verstoßenen berührt ihn da liebevoll, so wie der Aussätzige ihn kurz zuvor umarmt hatte. Mystische Erfahrung auf Augenhöhe – durch menschliche Begegnungen erschlossen (Gef 13). Spätere Biografen deuten das Geschehen als Beauftragung: Eine Stimme vom Kreuz habe dem Kaufmann aufgetragen, die zerfallende Kirche wieder aufzubauen. Kritische Historiker wie Roberto Rusconi weisen zu Recht darauf hin, dass solche Interpretationen erst in den vierziger Jahren auftreten und von theologisch gebildeten Brüdern stammen. Ihre Retrospektive verführt dazu, Franziskus’ weiteres Verhalten im Licht eines göttlichen Projekts zu sehen, das zur Erneuerung der reformbedürftigen Großkirche ruft. Demnach hätte der Suchende den Auftrag hierzu bereits in San Damiano erhalten, ihn allerdings zunächst missverstanden und ihn in der eigenhändigen Restauration dieses zerfallenden Landkirchleins umgesetzt. Nach 1245 wird diese Beauftragungsgeschichte die Franziskaner dann darin bestärken, sich in einen weltweiten Reformorden von Seelsorgern und Volkspredigern zu verwandeln. Damit wird das Geschehen vom Frühjahr 1206 allerdings zu flach und zu funktional gedeutet. Dass Franziskus nämlich spontan sein Geld dem Priester gibt, damit künftig immer ein Licht vor diesem Kreuzbild brenne, wirkt wie die Antwort auf eine tiefe Begegnung – und ist ein sichtbares Glaubensbekenntnis. Hier hat der Suchende die Gegenwart Gottes erfahren, ergreifend und befreiend wie nie zuvor. Giotto deutet das Ereignis in seinem weltberühmten Freskenzyklus mit eindrücklicher Symbolik: Franziskus kniet im zerfallenden Landkirchlein und blickt ergriffen zu Christus, der sich ihm am Kreuz auf Augenhöhe zeigt. Während der Kaufmann gut betucht eingetreten ist, zeigt der Erlöser sich nackt. Während Franziskus von starken Mauern und einem sicheren Dach geschützt wird, hängt sein Herr schutzlos im Regen.
Nun kann es kein Zurück mehr geben: keine Rückkehr in eine Familie, die über mehrere Häuser im Stadtzentrum verfügt, die ihren Reichtum in französischen Stoffen zur Schau trägt und Gewinne auf Kosten ihrer Arbeiter anhäuft. Der Hoffnungsträger der Familie hat eine andere Spur gefunden: einen Herrn, dessen Haus außerhalb der Stadt zerfällt und der – vergessen und aus dem bürgerlichen Leben ausgeschlossen – ihn da erwartet hat, wo die Opfer des städtischen Wohlstands arm und ausgeschlossen um ihre nackte Existenz kämpfen. Der Standortwechsel, den der reiche junge Mann nun vornimmt, lässt sich kaum mit einem Auftrag, sondern vielmehr mit Liebe erklären – mit einer neu geweckten Liebe zu Menschen und zum Menschensohn am Rand dieser Stadt.
Ein neuer Vater
Nach seiner Erfahrung in San Damiano „erhob sich Franziskus voll Freude,… bestieg sein Pferd, nahm Tuch verschiedenster Farbe mit und kam in die Stadt, die Foligno heißt. Dort verkaufte er das Pferd und alles, was er mit sich geführt hatte, und kehrte zur Kirche San Damiano zurück“ (Gef 16). Der schlichte Bericht der späteren Gefährten schildert den letzten Ritt des Kaufmanns. Im Spoletotal erwachen die ersten Zeichen des Frühlings 1206.Nachdem Franziskus sich von seinem Pferd getrennt hat, nimmt er die siebzehn Kilometer vom großen Marktort über Spello und dem Subasio entlang unter die eigenen Füße. Doch tritt er nicht mehr durch die Tore seiner Heimatstadt. Für damalige Verhältnisse hat er ein Vermögen ausgegeben. Das Geld soll für den Wiederaufbau des Kirchleins verwendet werden. Aus Furcht vor Pietro di Bernardone nimmt der zuständige Priester es allerdings nicht an. Er gewährt dem Sohn jedoch die Bitte, in San Damiano leben zu dürfen. Der Vater reagiert heftig. Längst hat das seltsame Verhalten seines Sohnes ihn verunsichert und verärgert. Nun eskaliert der Konflikt. Pietro sammelt Freunde um sich und rückt mit ihnen gegen San Damiano aus. Franziskus weicht „dem väterlichen Zorn aus und sucht eine verborgene Höhle auf, die er sich zu diesem Zweck hergerichtet hatte. Dort hält er sich einen Monat lang verborgen“ (Gef 16). Dieses Versteck liegt vermutlich am Fuß des Monte Subasio im engeren Umfeld von San Damiano. Franziskus braucht Zeit, um sich auf die neue Situation einzustellen. Nur zu gut weiß er, wie hartnäckig der Vater seine Ziele verfolgt – und mit allen Mitteln auch zu erreichen sucht. In seinem Innern wirkt die Christus-Erfahrung von San Damiano nach, als Begegnung mit Gottes Sohn, der sich freiwillig menschlicher Gewalt ausliefert und in seiner Gewaltlosigkeit zugleich machtlos wird. Das Bildprogramm der Kreuzikone bleibt allerdings nicht bei der Passion stehen. Franziskus wird das kunstvolle Bild in diesen Wochen genau betrachten. Es erzählt den letzten Weg Jesu vom Verrat des Petrus bis zur Himmelfahrt.
Franziskus findet Christus in San Damiano auf Augenhöhe. (Giottoschule, Basilica San Francesco in Assisi)
(© Archiv Herder)
Unterhalb des einen Knies Jesu erinnert ein kleiner Hahn an die Nacht seiner Verhaftung und das Verhör am Morgen. Die Tafel über dem Kreuz begründet das Todesurteil des Pilatus. Unter dem Gekreuzigten stehen seine engsten Gefährtinnen, die sich gegenseitig stützen: seine Mutter und Johannes, Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus. Ihnen ist der Hauptmann beigesellt, der die Hinrichtung beaufsichtigt und in dem Gekreuzigten Gottes Sohn erkennt. Über dessen Schulter sind all jene dargestellt, die ebenfalls in den Kreis der Glaubenden finden werden. Ganz klein erkennt man links einen römischen Soldaten: Longinus, der dem Verstorbenen eine Lanze in die Seite stößt. Da er anders als der Hauptmann im sterbenden Jesus nicht Gottes Sohn sieht, deuten Haltung und Format symbolisch darauf hin, dass er noch blind und klein im Glauben ist. Ihm gegenüber steht ebenso klein ein Jude: Auch er ist noch blind für den Messias und steht doch im Lichtkreis des Herrn, der seine Arme weit öffnet. Trotz der blutenden Wunden strahlt die Haltung Jesu Ruhe und Frieden aus. Würdevoll und mit offenen Augen scheint er in seiner betenden Haltung bereits erstanden. Der Querbalken des Kreuzes entpuppt sich beim näheren Hinsehen als das leere Grab. Zwei Engel deuten auf die Stelle, wo der Tote gelegen hat. Andere Engel sprechen mit bewegten Gesten über das Geschehen. Über der Passion ist der Auferstandene dargestellt, der mit wehendem Gewand den Himmel betritt, wo Engel ihn freudig begrüßen. Über dem ganzen Geschehen zeigt sich schließlich die segnende Hand des Vaters, der auch dieses größte Drama der Heilsgeschichte zum Guten wendet.
Kreuzikone von San Damiano, syrisch-römische Bildtradition, 12.Jahrhundert (© Archiv Herder)
Ein Drama steht auch Franziskus bevor. Einen Monat lang nimmt er sich in seinem Schlupfwinkel Zeit, um sich auf den familiären Konflikt vorzubereiten. In der Stille bestätigt sich der Entschluss, seine bürgerliche „Welt zu verlassen“ (exire de saeculo). Das Tafelkreuz von San Damiano hält ihm Jesu Umgang mit menschlichem Wüten vor Augen: nackt und gewaltlos, voller Liebe und mit einem guten Vater über sich. Auf diesen Vater setzt auch Franziskus sein ganzes Vertrauen, wie der öffentliche Zusammenstoß mit dem leiblichen Vater bald zeigen wird.
Prozess vor dem Bischof
Die späteren Gefährten, selbst Bürger von Assisi, schildern, wie der davongelaufene Sohn des Pietro di Bernardone nach den langen Wochen seiner Abwesenheit in der Stadt empfangen wird: „Bei seinem Anblick machten ihm jene, die ihn früher gekannt hatten, erbärmlich harte Vorwürfe, schimpften ihn einen Narren und Verrückten und bewarfen ihn mit Straßenkot oder Steinen.… Das Gerede über die Rückkehr des Verrückten durcheilte Straßen und Gassen der Stadt und gelangte endlich zum Vater. Ohne jede Selbstbeherrschung… schleppte er ihn in sein Haus, sperrte ihn dort mehrere Tage in einen Keller und suchte ihn mit Worten und Gewalt umzustimmen“ (Gef 17). Die Mutter aber nutzt eine Abwesenheit Pietros aus und lässt den Sohn frei. Dieser geht wieder nach San Damiano. Als der Vater zurückkehrt, „überschüttete er seine Frau mit Vorwürfen. Hierauf lief er zum Sitz der städtischen Gemeinde und klagte seinen Sohn vor den Konsuln der Stadt an.“ Franziskus wird von einem städtischen Ausrufer zum Palazzo dei Consoli nahe des neuen Doms in der Via di Santa Maria delle Rose zitiert. Er folgt der Vorladung jedoch nicht und gibt als Begründung an, „er sei frei geworden und unterstehe nicht mehr den Konsuln, weil er einzig und allein Diener des höchsten Gottes sei“ (Gef 19). Dies wiederum veranlasst die Stadtbehörde, den zornigen Kaufmann mit seiner dramatischen Familienangelegenheit an den Bischof weiter zu verweisen. Bischof GuidoI. war ein kluger Mann und ein entschiedener Verteidiger der kirchlichen Freiheit. Durch einen Boten lässt er Franziskus von San Damiano herbeirufen, einem Kirchlein, das ihm selbst direkt untersteht. Daraufhin kommt es zu einer öffentlichen Gerichtssitzung vor oder in dem Bischofspalais in der Unterstadt. Guido erweist sich als informiert, und er zeigt erstaunliches Verständnis für den Sohn. Zugleich redet er dem zornigen Vater, der alles Geld aus dem letzten Marktritt zurückfordert, zumindest indirekt ins Gewissen. Vor der ganzen Versammlung gibt er Franziskus den folgenden Rat: „Dein Vater ist gegen dich in schwere Aufregung geraten und sehr verärgert. Wenn du also Gott dienen willst, so gib ihm das Geld zurück, das du hast! Da es vielleicht auf unrechte Weise erworben ist, will Gott der Sünde deines Vaters wegen nicht, dass du es zum Bau der Kirche ausgibst. Seine Wut wird sich legen, sobald er es zurückerhält.… Gott selbst wird… dir das Nötige verschaffen.“ Daraufhin inszeniert Franziskus ein radikales Zeichen. Er verschwindet kurz in einem Raum des Palais, tritt dann nackt vor Bischof, Versammlung und Vater und spricht die folgenreichen Worte: „Hört alle und versteht! Bis jetzt habe ich den Petrus Bernardonis meinen Vater genannt. Weil ich mich nun aber entschlossen in den Dienst Gottes stellen will, gebe ich jenem das Geld zurück, das ihn so in Unruhe bringt, und alle Kleider, die ich aus seiner Habe besessen habe. Von nun an werde ich sagen: ‚Vater unser im Himmel‘ – nicht mehr Vater Pietro di Bernardone.“ Während der irdische Vater mit den Kleidern und dem Geld erschüttert von dannen zieht und das Volk weint, schließt Bischof GuidoI. den Enterbten in seine Arme und bedeckt seine Nacktheit mit dem eigenen Mantel (Gef 20).
Franziskus enterbt sich im Prozess vor Bischof Guido. Der junge Kaufmann wechselt die Seite von der Bürgerschaft zur Kirche. Direkt über Vater Pietro zeigt sich die Hand des himmlischen Vaters. (Giottoschule, Basilica San Francesco in Assisi) (© Archiv Herder)
2.Vom Büßer zum Bruder
Beim bischöflichen Prozess tritt erstmals die Amtskirche bedeutsam in Erscheinung. Franziskus ist 24Jahre alt. Bei allem Verständnis des Bischofs und seiner einfühlsamen Geste – der neue Büßer Gottes wird seinen Weg allein weitersuchen müssen. Auch für die nächsten beiden Jahre, wohl die schwierigsten seines Lebens, gilt das spätere Bekenntnis im Testament: „Niemand zeigte mir, was ich tun soll. Der Höchste selbst hat mir den Weg gezeigt.“ Und die ersten Schritte führen ihn, so die offizielle Biografie von 1228, aus der Geburtsstadt weg.
Umweg über Gubbio
Ein Armer geworden, wandert der freiwillige Büßer nun nordwärts. Nach einem Tag erreicht er eine kleine Benediktinerabtei, die San Verecondo geweiht war und heute Vallingegno heißt. Die Mönche nehmen den Mittellosen als Küchenjungen auf (1C 16). Vom Hügel des Klosters aus kann Franziskus über einer zauberhaft schönen Frühlingslandschaft den heimatlichen Subasio sehen.
Als die Mönche dem entlaufenen Kaufmann das Leben schwer machen, wandert er einige Wochen später eine knappe Tagesstrecke weiter in die Stadt Gubbio. Der befreundete Kaufmann Federico Spadalunga schenkt ihm dort ein Büßerkleid, und Franziskus zieht ins örtliche Leprosenheim, um Aussätzige zu pflegen (1C 17). Erst im Sommer kehrt er dann entschlossen nach Assisi zurück, wo er sich als Einsiedler bei San Damiano niederlässt. An dieser Stelle ist die spätere Überlieferung vom Auftrag zum Kirchenbau, die der franziskanischen Bewegung überaus lieb wurde, noch einmal kritisch zu befragen: Muss es nicht überraschen, dass Franziskus erst nach einem weiten Umweg hierher zurückkehrt? Dass er zunächst Mönchen dient, danach Aussätzige pflegt und erst dann Steine schleppt? Dass er in seinen Schriften nie vom Aufbauen oder Erneuern der Kirche spricht – auch nicht im übertragenen Sinn? Theologen sprechen