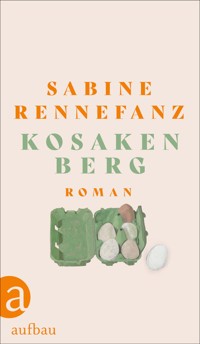13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
In Krisen zeigt sich, wie eine Gesellschaft funktioniert: Wer setzt sich durch? Wer bleibt zurück?
Corona hat nicht nur die Gesundheit der Menschen angegriffen, sondern unsere Gesellschaft auf die Probe gestellt. Am Anfang hieß es: Wir sitzen alle im selben Boot. Doch von Solidarität war bald nichts mehr zu spüren. Die im Grundgesetz verankerte Gleichheit aller wurde über Bord geworfen. Wieder einmal zeigte sich: Krisen gehen zu Lasten von Frauen und Kindern. Welche Ursachen sind dafür verantwortlich? Warum geraten unsere Werte so leicht ins Wanken? Was läuft falsch in der Politik? Sabine Rennefanz wertet aktuelle Studien aus, nimmt politische Einordnungen vor und erzählt von eigenen Erfahrungen als Frau und Mutter zweier Kinder. Ein aufrüttelndes und wegweisendes Buch – für gesellschaftliche Gerechtigkeit, Solidarität zwischen den Generationen und eine nachhaltige Politik für Kinder.
»Kaum eine Journalistin analysiert die Situation von Familien und Kindern so kontinuierlich und präzise wie Sabine Rennefanz.« TERESA BÜCKER
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 171
Ähnliche
Sabine Rennefanz
Frauen und Kinder zuletzt
Sabine Rennefanz
FRAUEN UND KINDER ZULETZT
Wie Krisen gesellschaftliche Gerechtigkeit herausfordern
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeAngaben sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Ch. Links Verlag ist eine Marke derAufbau Verlage GmbH & Co. KG
© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2022
entspricht der 1. Druckauflage von 2022
www.christoph-links-verlag.de
Prinzenstraße 85, 10969 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
ISBN 978-3-96289-149-7
eISBN 978-3-86284-513-2
INHALT
BAZOOKA VERSUS WASSERSPRITZPISTOLE
Eine Einleitung
WIR SITZEN (NICHT) ALLE IN EINEM BOOT
Warum es in der Krise rund um die Uhr Gewinner und Verlierer gibt
LEBEN WIE EIN MANN
In Krisen zeigt sich, wie man selbst funktioniert
VOM HOMEOFFICE ZUM HEIMBÜRO
Über das Verschwinden der Frauen
MODERNISIERUNGSSTAU
Über Gleichberechtigung als Accessoire für fette Jahre
»WIR DANKEN ALLEN, DIE DEN LADEN AM LAUFEN HALTEN.«
Über ein System im Burnout
BILDUNGSREPUBLIK DEUTSCHLAND
Über die Kinder mit der Maske
DIE RENTEN SIND SICHER – DIE ZUKUNFT DER KINDER NICHT
Über Generationengerechtigkeit
ALLE FÜR EINE, EINE FÜR ALLE?
Warum es in der Krise keine Mütterrevolte gab
DAS ENDE EINES ERFOLGSREZEPTS
Merkels letzte Krise
UNSERE NEUEN LEBEN
Ein Ausblick
Dank
Quellenverzeichnis
Die Autorin
BAZOOKA VERSUS WASSERSPRITZPISTOLE
Eine Einleitung
Dieses Buch ist an fünf verschiedenen Schreibtischen entstanden. Schreibtischen, die andere Frauen großzügig für mich freiräumten und mir damit den Raum und die Zeit gaben, die ich zum Schreiben brauchte. Ich bin nicht die Einzige, für die es seit Beginn der Coronapandemie schwierig ist, einen ruhigen Ort zu finden, um zu arbeiten. Vielen Frauen, die Kinder haben, geht es genauso. Zuletzt saß ich an einem wunderschönen alten Holztisch mit Blick auf den Arkonaplatz in Berlin-Mitte. Auf dem Fensterbrett stand eine Briefwaage. Es war ein schwarzer Magnet mit einer silbernen Aufschrift daran befestigt. »Never, never, never give up« stand darauf.
Am Anfang der Pandemie im März 2020 schien es, als müsste man das gesellschaftliche Leben lediglich für eine gewisse Zeit herunterfahren. Es war, als handele es sich um eine vorübergehende Unannehmlichkeit, wie einen Stromausfall, den man mit Kerzen schnell überbrückt und die Dunkelheit auch ein bisschen romantisch findet. Danach schaltet man das Licht wieder an, und alles geht weiter wie bisher, eine kleine, kurze Unterbrechung der Normalität. Dann verging Woche für Woche, ohne dass sich etwas änderte. Das heißt, alles veränderte sich, nur das Licht blieb aus.
Im Mai 2020, die Schulen und Kitas waren seit März geschlossen, es wurde gerade über die Öffnungen von Friseuren und Möbelhäusern diskutiert, warnte die Soziologin Jutta Allmendinger in der Talkshow von Anne Will vor den Folgen der Pandemie: »Die Frauen werden eine entsetzliche Retraditionalisierung erfahren. Ich glaube nicht, dass man das so einfach wieder aufholen kann und dass wir von daher bestimmt drei Jahrzehnte verlieren.« Drei Jahrzehnte: Das wäre Anfang der 1990er Jahre. Damals waren in Westdeutschland gerade mal die Hälfte der Frauen erwerbstätig, es gab kaum Kindergärten und Krippen. Vergewaltigung in der Ehe war kein Straftatbestand. Anfang der Neunziger – das war vor allem für ostdeutsche Frauen eine Zeit der Rückschritte. Um Frauen aus dem Arbeitsmarkt herauszudrängen, wurden nach 1990 Horte und Kitas geschlossen, Betreuungszeiten gekürzt, Elternbeiträge erhöht.
Jutta Allmendinger stützte sich auf eine gerade erschienene Studie, die zeigte, dass sich die Zahl der Frauen, die sich ausschließlich um die Kinder kümmern, im ersten Lockdown von acht auf 16 Prozent verdoppelt hatte. Jede vierte Frau gab im April 2020 an, wegen der Kinderbetreuung ihre Arbeitszeit zu reduzieren, bei den Männern taten das nur 13 Prozent. Ihre Aussage löste eine Debatte aus, die aber bald im Sand verlief. Mütter und Väter erhielten im Herbst 2020 einen Kinderbonus in Höhe von 300 Euro. Schweigegeld, wie es die Autorin Mareice Kaiser nannte.
Wie die Hoffnung auf eine rasch vorübergehende Unterbrechung der Normalität, gab es am Anfang der Pandemie auch die Hoffnung, dass die Coronakrise zu mehr Egalität führen könnte. Zwischen Frauen und Männern, Arm und Reich, Alt und Jung. Es war eine Zeit, in der viele dachten, wir würden uns auf die wirklich wichtigen Dinge besinnen durch die allgemeine Bedrohung, die vor niemandem Halt macht. Die Krise, so die Vorstellung, könnte bestehende Unterschiede, wie zum Beispiel bei der Verteilung der Sorgearbeit, abbauen. Wenn nun durch die Pandemie alle gleichzeitig zu Hause seien, würden Väter sehen, wie viel Arbeit im Haushalt zu erledigen ist, und sich stärker einbringen. Die Krise als Gleichberechtigungsbeschleuniger. Eine schöne Geschichte.
Es muss irgendwann zwischen Frühjahr und Herbst 2020 gewesen sein, als klar wurde: Die Krise würde nicht zu mehr Egalität führen. Ganz im Gegenteil, sie würde die mühsam errungenen Fortschritte gefährden.
Ich habe beim Schreiben dieses Buches meine Mutter vermisst. Als ich meine anderen Bücher schrieb, lebte sie noch. Meine Mutter hatte keine Berufsausbildung. Sie war Hausfrau. Sie las viel, verpasste keine politische Talkshow im Fernsehen. Als ich im Alter von 16 Jahren anfing, kleine Artikel für die Lokalzeitung zu schreiben, war sie meine eifrigste Leserin. Sie hat mir das Vertrauen in meine eigenen Worte gegeben. Ich konnte mit ihr über alles reden, sie war meinungsstark, aber offen für Argumente. Ihr Wissen, ihr Blick auf die Welt fehlen mir. Ich denke daran, wie sie immer in ihrem Wohnzimmer saß, zwischen den alten Möbeln. Und auf dem Tisch stapelten sich Zeitungen und Bücher. Was würde sie zu diesem Buch sagen?
Wir waren oft nicht einer Meinung. Als ich einmal in einer Kolumne über die Schwierigkeit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie schrieb, meinte sie: »Ihr wollt zu viel und so schnell, ihr seid so ungeduldig.« Ihr, das war meine Generation. Ich hätte gern mit ihr über Olaf Scholz’ Bazooka diskutiert. So nannte der ehemalige Finanzminister und heutige Bundeskanzler das Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket, das im Juni 2020 verabschiedet wurde. Es umfasste Maßnahmen mit einem finanziellen Gesamtvolumen von 167,4 Milliarden Euro. Die Politikwissenschaftlerin Claudia Wiesner hat das Konjunkturpaket für das Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft durchforstet und festgestellt, dass 73 Prozent der Gesamtausgaben an Branchen gegangen sind, in denen mehrheitlich Männer arbeiten. Nur 4,2 Prozent des Gesamtfinanzvolumens entfallen auf Branchen und Bereiche, in denen überwiegend Frauen vertreten sind. Die Arbeit von Männern wurde als systemrelevant angesehen, aber nicht die von Frauen. Während für Männer die Bazooka herausgeholt wurde, gab es für Frauen eine Wasserspritzpistole. Oft nicht mal die.
Weltweit haben Frauen allein im Jahr 2020 800 Milliarden Dollar an Einkommen verloren. Das hat die Entwicklungshilfeorganisation Oxfam vorgerechnet. 800 Milliarden Dollar, das ist das Nationaleinkommen von 98 Ländern. In Brasilien hatten im April 2020 weniger als die Hälfte der Frauen einen Job, das war der niedrigste Wert in 30 Jahren. In Australien verloren zehn Prozent der Frauen ihre Stellen. In Japan wurde doppelt so vielen Frauen wie Männern gekündigt. In den USA gaben zwischen März und April 2020 3,5 Millionen Frauen mit Kindern im Schulalter ihren Job auf. Im September 2021 nannte der Wirtschaftsdienst Bloomberg die Coronakrise »den größten Rückschlag für die Gleichstellung seit einhundert Jahren«. Im Englischen spricht man von einer »She-Session«, einer weiblichen Rezession.
Auch in Deutschland belastet die Krise Frauen stärker als Männer, wirtschaftlich, psychologisch, mental. Laut der Studie des Leibniz-Informationszentrums Wirtschaft erleiden Frauen stärkere Erwerbseinbußen in der Pandemie als Männer – und das, obwohl sie schon vor der Krise quer durch alle Branchen rund ein Fünftel weniger verdienten.
In den Bereichen, in denen es viele Minijobs gibt, Gastronomie, Einzelhandel, Tourismus, Kultur, arbeiten vorwiegend Frauen. Die Minijobs fielen durch die Schließungen während des Lockdowns weg, und es gab für sie auch keinen Ersatz. Nirgendwo arbeiten so viele Frauen wie im Gesundheitswesen, 77 Prozent der Beschäftigten sind weiblich. Das Pflegepersonal wurden zwar am Anfang beklatscht, daraus folgte aber wenig. Mittlerweile haben Zehntausende den Beruf verlassen.
Wollen wir zu viel? Will ich zu viel? Ich wollte immer mehr als meine Mutter. Sie war es, die mich dazu ermutigte. Meinem Bild einer emanzipierten Frau entsprach sie nicht. Heute weiß ich, dass sie mir als Kind Struktur und Halt gab. Sie füllte mein Leben mit Gerüchen, Geschmäckern und Energie. Am Ende ihres Lebens bekam sie 272, 34 Euro Rente. Ich bin weicher geworden ihr gegenüber, mein Blick auf sie hat sich verändert, durch ihren Tod, aber auch durch das Schreiben dieses Buchs. Ich habe darin gesellschaftliche Verhältnisse reflektiert, aber auch meine eigenen. Die Frage, inwieweit man sich selbst von traditionellen Rollenmustern gelöst hat, spielt in einem der Kapitel eine zentrale Rolle.
Ich habe mit einigen Menschen über dieses Buch gesprochen, als ich es plante. Manche waren nicht überzeugt, dass es so ein Buch braucht, wie beispielsweise der Beamte eines Bundesministeriums, den ich über meine Arbeit als Journalistin kennengelernt hatte. Die Pandemie habe ihm, wie er mir bei einem Mittagessen sagte, hervorragende Arbeitsbedingungen geboten. »Ich habe so viel geschafft wie nie, weil es keine Ablenkungen gab, man konnte jeden Tag bis Mitternacht arbeiten.« Andere Menschen haben mich unterstützt, gaben wichtige Hinweise, Anregungen und ihre Erfahrungen weiter. Marion, eine Kinderkrankenschwester, die in Brennpunktvierteln Frauen und Kinder betreut, zählt dazu. Ohne sie wäre das Kapitel über diejenigen, die in der Krise Hilfe am allernötigsten brauchen, nicht möglich gewesen.
Ich habe ein Kapitel über gesellschaftliche Solidarität geschrieben. Als ich Kind und Jugendliche war, brach die Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, zusammen. Die Folgen beschäftigten Deutschland in den vergangenen 30 Jahren, und ich erinnere mich noch, wie lange es dauerte, bis dieser Zusammenbruch der ostdeutschen Gesellschaft überhaupt artikuliert wurde. Solidaritätszuschlag hieß treffenderweise eine Abgabe, die 1991 eingeführt wurde, um die Kosten der Wiedervereinigung zu bezahlen.
Einen Zuschlag an Solidarität hatten sich auch viele zu Beginn der Pandemie erhofft. Ich beschreibe, warum daraus nichts wurde und was das über den Zustand unserer Gesellschaft aussagt. Das Virus trifft eben nicht alle gleich, sondern erhärtet vorhandene Ungleichheiten, zwischen Mann und Frau, Arm und Reich, Alt und Jung. Beim Schreiben darüber hatte ich das Gefühl, Margaret Thatcher schaut mir über die Schulter und zieht kritisch, aber auch ein bisschen selbstgerecht, die Augenbrauen hoch. Warum? Sie hat die Existenz von Gesellschaft infrage gestellt, und als wir mitten in der Pandemie steckten, kamen mir selbst Zweifel. »There is no such thing as society«, lautet das berühmte Zitat Thatchers, das als Ausdruck neoliberalen Denkens gilt. Ich stimme ihr nicht zu. Es gibt eine Gesellschaft, aber sie ist angriffen, ihr Zusammenhalt seit Langem gefährdet. Was müssen wir tun, damit bei der nächsten Krise die Bedürfnisse aller Bevölkerungsteile berücksichtigt werden?
Im Flugzeug gibt es vor dem Start diese Sicherheitsübung, und das Personal erklärt, welche Sicherheitsposition man im Fall einer Notlandung annehmen solle: den Kopf nach vorne beugen, den Körper zwischen die beiden Sitzreihen klemmen, Hände über den Kopf verschränken. Brace, brace. So sitzen wir seit zwei Jahren.
Die Lasten dieser zwei Jahre tragen vor allem Frauen und Kinder. Für Kinder ist Corona nicht nur eine Momentaufnahme, sondern eine prägende Erfahrung. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef veröffentlichte zu seinem 75. Geburtstag im Dezember 2021 einen erschütternden Bericht und nennt die Pandemie die größte Krise für Kinder seit der Gründung der Organisation. Seit Ausbruch der Coronakrise sind 100 Millionen Kinder weltweit zusätzlich von Armut betroffen. Errungene Fortschritte seien in Gefahr: die Senkung der Ungleichheit, die Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, der gerechte Zugang zu Bildung. Durch die Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen hat sich vor allem die psychische Gesundheit von Kindern verschlechtert. Es gibt Anzeichen, dass die Zahl der Suizide unter Jugendlichen zunimmt. Laut einer Befragung im Auftrag von Unicef vom Oktober 2021 unter 15- bis 24-Jährigen ist jeder Fünfte häufig deprimiert. In Deutschland ist es jeder Vierte.
Laut Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, gab es in Deutschland zwischen März 2020 und Mai 2021 an über 180 Tagen keinen regulären Unterricht. In einigen Bundesländern waren Schüler der 7. bis 12. Klassen von Mitte Dezember 2020 bis Mai 2021 nicht in der Schule. Wie groß die Lernverluste sind, dazu gibt es bisher nur Schätzungen. Unbestritten ist: Die Kinder und Jugendlichen, die schon vorher Schwierigkeiten hatten, sind durch das Homeschooling weiter abgehängt worden. Ich habe mich in einem meiner Kapitel unserem Bildungssystem und der Frage gewidmet, warum in Deutschland die Einschränkung von Schule und Kita zur wichtigsten Maßnahme der Pandemiebekämpfung wurde.
Noch ein Wort zum Homeoffice an dieser Stelle: Es funktioniert in der Krise nicht. Aus der Vorstellung von mehr Flexibilität für Frauen und der Vereinbarung von Beruf und Familie, die sich mit dem einst cool und modern klingenden Wort verband, ist in den letzten zwei Jahren eine Art Fünfziger-Jahre-Hausfrau-Modell geworden, nur mit Twitter-Account. In meinem Kapitel »Vom Homeoffice zum Heimbüro« beschreibe ich warum.
Jedes der neun Kapitel dieses Buchs steht für sich. Ich analysiere in ihnen, welche für das Funktionieren unserer Gesellschaft wichtigen Bereiche in der Pandemie besonders benachteiligt worden sind, wie Bildung, soziale Arbeit, Familie, und warum Frauen und Kinder so leicht an den Rand gedrängt werden konnten. Ich erkläre, warum es strukturelle Gründe dafür gibt, dass Kinder bei politischen Entscheidungen übersehen werden, und warum die fehlende Generationengerechtigkeit in der Coronakrise exemplarisch für künftige Konflikte steht.
Manch einer wird beim Lesen dieses Buchs vielleicht fragen, warum so kritisch, wo bleibt die Hoffnung, der Aufbruch? Ich kann verstehen, dass man in der Krise nach dem Aufbruch sucht. Davon schreibe ich am Schluss. Ich habe das Kapitel trotz meiner kritischen Bilanz »Ausblick« genannt. Denn ich glaube, nur wenn man die Augen vor den Konflikten, den Wunden der Gesellschaft nicht verschließt, sieht man, wohin es gehen muss.
Januar 2022
WIR SITZEN (NICHT) ALLE IN EINEM BOOT
Warum es in der Krise rund um die Uhr Verlierer und Gewinner gibt
Am Anfang der Coronapandemie hieß es: Wir sitzen alle im selben Boot. Das Virus trifft uns alle gleich. Die Bundesregierung appellierte an Gemeinsinn und Rücksichtnahme. Es verbreitete sich eine Atmosphäre der Empathie. Man war aufeinander angewiesen, es gab eine gegenseitige Schutzbedürftigkeit. Vielen Menschen schien dieser Gedanke zu gefallen. »Social Distancing« lautete das Motto der Stunde, körperlicher Abstand, reduzierte Kontakte, um innerlich näher zusammenzurücken. Manch einer träumte sogar davon, dass Corona eine Chance ist: auf Entschleunigung und zur Überwindung der Vereinzelung. Ein Ende der Gesellschaft der Singularitäten. Es gab die Hoffnung, dass es zu einer Neuentdeckung eines fast vergessenen Wertes kommt: Solidarität.
Woher kam diese geradezu euphorische Hoffnung? Sie schien sich aus einer großen Sehnsucht nach Gemeinschaft, Verbundenheit und der Idee eines neuen »Wir« zu speisen. Und sie bricht mit der Coronapandemie zu einem Zeitpunkt hervor, als sich in westlichen Gesellschaften die Grundauffassung durchgesetzt hatte, dass wir am Ende einer langen Periode stehen, die in den 1980er Jahren mit Margaret Thatcher und Ronald Reagan begann und in Deutschland mit Gerhard Schröder und Angela Merkel endete. Man nennt diese Phase gemeinhin Neoliberalismus. Dahinter steckt die Idee, dass eine funktionierende Gesellschaft eine Gesellschaft starker Individuen ist, die all ihr Denken und Handeln ökonomischen Maximen unterordnen. Ziel aller Politik ist es gewesen, die Rechte und die Bildung des Einzelnen zu stärken. Der Aufstieg des Neoliberalismus fiel zusammen mit einer »Selbstverwirklichungsrevolution«, ein Begriff des Soziologen Andreas Reckwitz. Sie begann in den 1970er Jahren: Pflichterfüllung galt als überkommen, das Lebensziel wurde die Selbstentfaltung und die Stärkung der eigenen Bedürfnisse.
»There is no such thing as society« lautet der berühmte Satz von Margaret Thatcher, der als Ausdruck neoliberalen Denkens gilt. Sie äußerte ihn in einem Interview mit der britischen Frauenzeitschrift Woman’s Own im Jahr 1987. Auf Nachfrage der Sunday Times veröffentlichte Downing Street den Satz ein Jahr später nochmal. »Zu vielen Kindern und Erwachsenen ist vermittelt worden: ›Ich habe ein Problem, also ist es die Aufgabe der Regierung, es zu lösen.‹ Sie übertragen ihre Probleme auf die Gesellschaft. Aber wer ist die Gesellschaft? So etwas wie Gesellschaft gibt es nicht.« Sie berief sich damit auf Ronald Reagan, der schon 1981 in seiner Antrittsrede gesagt hatte: »Die Regierung ist nicht die Lösung Ihrer Probleme. Die Regierung ist das Problem.« Thatcher und Reagan regierten, ungefähr zur selben Zeit, zwei der einflussreichsten Länder der Welt. Sie als Premierministerin des Vereinigten Königreichs, er als Präsident der Vereinigten Staaten.
Auch in Deutschland hieß es, durch den Mauerfall, die Wiedervereinigung und den damit einhergehenden Wegfall gesellschaftlicher Alternativen etwas verspätet, in den neunziger und den beginnenden 2000er Jahren: Sei deines Glückes Schmied! Stärker als je zuvor setzte die wiedervereinte Bundesrepublik auf weniger Staat und mehr Verantwortung jedes Einzelnen. Es war die Zeit, in der die Hartz-IV-Gesetze entwickelt wurden und im Gesundheitswesen die Privatisierung Einzug hielt. Überall wurde von Verschlankung geredet. Alles drehte sich um Unternehmensumsätze, BIP, Aktienkurse. Untermalt wurden die brutalen Einschnitte in den Sozialstaat von Appellen an Eigenverantwortung, wie zum Beispiel in der Bertelsmann-Kampagne »Du bist Deutschland«. In dem Werbespot, der im Fernsehen gezeigt wurde, geht es darum, dass die Menschen aufhören sollen, sich zu beschweren und stattdessen selbst aktiv werden. »Ein Schmetterling kann einen Taifun auslösen«, fabulierte die Fernsehjournalistin Sandra Maischberger. Viele Prominente, auch Fußballer oder Rapper, treten mit Messages darin auf, die etwa lauten: »Wie wäre es, wenn du dein Land wie einen guten Freund behandelst? Meckere nicht, sondern biete ihm deine Hilfe an!«
Die Maxime, dass jeder seines Glückes Schmied sei, wurde verinnerlicht und als Verpflichtung verstanden. Und wer kein Glück hat, benutzt eben das falsche Werkzeug, strengt sich nicht genug an oder macht sonst irgendetwas falsch. Hinter dieser Idee treten die Voraussetzungen zurück, mit denen jeder Schmied ans Werk geht: Herkunft, Klasse, Geschlecht. Die Verhältnisse, in die jede und jeder von uns hineingeboren wird, wurden zu individuellen Risiken gemacht. Nach 30 Jahren ist in Deutschland unübersehbar, dass diese Politik eher Spaltung, Entfremdung und soziale Ungleichheit hervorgebracht hat. Und ein Gesundheitssystem, das Krisensituationen nicht standhält.
Dass das Einzelkämpfertum des Neoliberalismus den sozialen Frieden und die Demokratie gefährdet, darüber hat sich der Soziologe Heinz Bude schon vor der Pandemie Gedanken gemacht. Solidarität entsteht erst dann, wenn Abhängigkeiten begrüßt, Verbindungen gepflegt und Verpflichtungen beherzigt werden, schreibt er in seinem Buch »Solidarität. Die Zukunft einer großen Idee«. In der Coronakrise wurde an einen Gemeinsinn appelliert, den es längst nicht mehr gab. Es wurde ein Begriff hervorgeholt, der vielen nichts mehr bedeutete. Und wenn es eine öffentliche Solidaritätsbekundung gab, verkam sie zu hohler Symbolik, wie das Klatschen für das Pflegepersonal. Es sollte Gemeinschaft und Anteilnahme entstehen, wo vorher Rücksichtlosigkeit und Egoismus geherrscht hatten.
Auf diesen Widerspruch machte die frühere Eiskunstläuferin Katarina Witt im Februar 2021 in einem langen Text aufmerksam. Sie veröffentlichte ihn auf Facebook. Wohl in der Hoffnung, dass ihn dort mehr und Menschen unterschiedlichster Herkunft lesen würden, als das bei klassischen Printmedien gemeinhin der Fall ist. Sie könne die Parole der Politik, wir säßen alle in einem Boot und müssten das gemeinsam durchstehen, nicht mehr hören: »Als Kapitän, inmitten eines Sturms mit meterhohen Wellen, kann ich doch nicht im Leuchtturm sitzen, mit Fernglas den Horizont nach Gefahrenquellen absuchen und Durchhalteparolen über Funk durchgeben, wenn der Mannschaft das Wasser bis zum Hals steht, die ersten schon untergegangen sind und dann mit trockenen Füßen sagen, wir sitzen alle im gleichen Boot.« Witt empörte sich über Regeln, die sich oft zwischen Bund und Ländern widersprachen, über nicht nachvollziehbare Entscheidungskriterien und über die Benachteiligung von kleineren mittelständischen Unternehmen gegenüber großen Firmen: »Die Bürger rudern verzweifelt und unterschiedliche Kapitäne geben ständig von oben verschiedene Kursänderungen durch.«
Ihr emotionaler Eintrag wurde zehntausendfach geteilt und geliked, er hatte offensichtlich einen Nerv getroffen. Einige Medien versuchten, Witt in das Lager der Coronaleugner zu stecken, doch die meisten Reaktionen waren positiv. Die mehrfache Olympiasiegerin wurde nach ihrem Wutausbruch in Talkshows eingeladen und diskutierte mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer über Fairness in der Pandemie. Es schien, als müsste erst eine ehemalige DDR-Eiskunstläuferin kommen, um die Politik auf Ungerechtigkeiten in der Pandemiebekämpfung hinzuweisen. Ihr Beharren auf Gerechtigkeit wirkte sympathisch, rührend, aber auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Weil sich sonst kaum jemand um Gerechtigkeit in der Krise kümmerte? Vielleicht. Das Robert Koch Institut erfasste zunächst nicht einmal, welche sozialen Milieus von Corona besonders betroffen waren.
Stattdessen versuchten die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Regierung, die Bekämpfung der Pandemie als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu vermitteln. So wie es ihr Nachfolger Olaf Scholz nun ebenfalls postuliert. Sein Auftritt während der Pressekonferenz zur Vorstellung des Koalitionsvertrags der Ampelregierung im November 2021 fühlte sich für mich an wie ein Déjà-vu. Allerdings ging er nicht so weit wie Merkel in ihrer Fernsehansprache vom 18. März 2020, als sie sagte: »Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt.«
Ebenfalls im März 2020 schaltete das Bundesgesundheitsministerium einen Werbespot mit dem Titel »Zusammen gegen Corona«. Darin erklärten verschiedene Menschen, warum sie zu Hause bleiben. »Damit wir diese Zeit mit möglichst wenig Opfern überstehen«, sagte eine Frau in die Kamera. »Weil das Leben retten kann«, sagte ein Mann. »Damit Oma und Opa nicht krank werden«, sagten zwei Kinder. Die Solidaritätsappelle folgten politischen Zielen: Sie dienten dazu, vorhandene