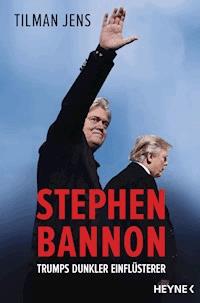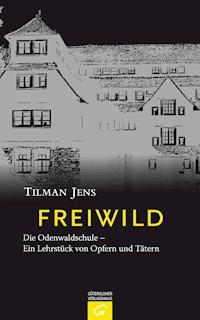
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Odenwaldschule – Klärung, Erklärung, Aufklärung
- Das neue Buch von Bestsellerautor Tilman Jens – selbst Schüler der Odenwaldschule
- Ein Insiderblick auf das vom Missbrauchsskandal erschütterte Elite-Internat
- Erstmals geben Opfer UND Täter Auskunft
Internate, diese Sehnsuchts- und Schreckensorte, haben Tilman Jens früh fasziniert. Sein neues Buch ist durchzogen von persönlichen Erinnerungen aus seiner Zeit an der Odenwaldschule. Dabei geht es ihm weniger darum, skandal-versessen immer neue Missbrauchsfälle zu enthüllen, sondern um die Rekonstruktion der damaligen Stimmung und eine Erklärung, wie es zu den grausamen Vorfällen kommen konnte.
Dazu werden nicht nur die Aussagen der Opfer und Ermittler dokumentiert, sondern auch einige der Täter porträtiert. Nicht Apologie steht hier im Vordergrund des Interesses, sondern eine möglichst genaue Erklärung, herausgearbeitet aus der Konfrontation der Fakten und Aussagen so gegensätzlicher Quellen. So wird dieses Buch nicht nur die konkreten Geschehnisse aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, sondern zugleich jenes Zeitpanorama erhellen, in dem sich die Übergriffe abspielten.
»Da tut sich ein komplexes, schmerzhaftes Sittenpanorama auf, das sich, so viel ist gewiss, jeder einfachen Antwort verweigert. Nicht weniger als dies gilt es exemplarisch zu beschreiben.«
Tilman Jens
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Für Fabian und Schusch, für Ele in Amerika, Astrid in Neuseeland und in Erinnerung an Heimke Lüers, die tot ist. Sie alle wären mir ohne die vielgescholtene Odenwaldschule niemals begegnet.
Inhaltsverzeichnis
Die Schule stellt die größte gesellschaftliche Veranstaltung unserer Kultur dar. Sie beansprucht die lernfähigsten und vitalsten Jahre im Leben der Menschen. Sie verbraucht – schließt man Studium und Ausbildung mit ein – oft zwanzig Jahre, die Hälfte der dann folgenden vierzig Berufsjahre; sie frißt nicht die Kinder, wohl aber die Kindheit und Jugend.
Hartmut von Hentig: Die Schule neu denken. 1993
I. IM PARADIES
Dann und wann schaut Eduard vorbei, das bildhübsche Kalb mit den winzigen Hörnern und der unaufhörlich bimmelnden Glocke um den Hals. Sonst aber hockt er da, Tag für Tag, der Herr im kurzärmeligen Hemd, in selbstgewählter Einsamkeit, am Rande des dunklen Tannenwaldes, in sich versunken, mitten in einer umfangreichen Wiese auf einer kleinen Holzbank, freut sich des heißen Sommers und schaut zur Zugspitze hinauf, in deren gewaltigen Felsklüften der kühle ewige Schnee schimmert. Vor ihm ein wackeliger Tisch, auf vier überkreuzte Beine gebockt. Ein Seidel Bier, eine schon recht leere Schachtel Zigaretten, Berge von Schreibpapier, mit einem Stein beschwert, und ein grüner Bleistift. Mehr braucht er nicht, um – eingerahmt von Butterblumen und Anemonen – seine Geschichte, seinen Roman für Kinder, voranzutreiben. Betörende Schriftsteller-Romantik, ein Klassiker, in Buchform, von Walter Trier mit kraftvollen Strichen illustriert, und ebenso im Kino, als Spielfilm in Schwarz-Weiß, in dem Erich Kästner persönlich den Poeten unter dem freien, bayerischen Himmel gibt.
Eine Weihnachtsgeschichte soll es werden, in der geprügelt, gelacht und sehr viel geweint wird. Die Geschichte, das kartonierte Buch mit dem blauen Umschlag, der eine wilde Keilerei im Schnee zeigt, ist bald 80 Jahre alt. Es hat auch mich durch meine Kindheit begleitet. Und es begleitet mich noch immer, gerade jetzt, in dieser turbulenten Zeit.
Schauplatz der Handlung: das Gymnasium zu Kirchberg. Es ist eine ganz besondere Schule. Eine Art Wohnschule. Man könnte ebenso sagen: eine Schülerkaserne. Die Jungens wohnen darin. Sie essen in einem großen Speisesaal an langen Tischen, die sie selber decken müssen. Sie schlafen in großen Schlafsälen; frühmorgens kommt der Hausmeister und zerrt an einer Glocke, die furchtbar lärmend läutet. Der Alltag im Internat, das wird bald deutlich, ist kein Zuckerschlecken. Schüler können grausam und manchmal auch sehr traurig sein. Der Autor in seiner Schreibenklave am Fuße der Alpen mag, sagt er, keine Bücher, die so tun, als ob die Kindheit aus prima Kuchenteig gebacken sei.
Also erzählt Erich Kästner von einem Erziehungsheim, das manchem, der dort ist, die Familie ersetzen muss. Einer von ihnen heißt Jonathan Trotz. Der Vater hat ihn in New York dem Kapitän eines Ozeandampfers nach Deutschland übergeben. Die Passage ist nur für den Hinweg gebucht. Die Großeltern würden den Jungen in Hamburg am Kai erwarten. Doch Oma und Opa, die sind lange schon gestorben. Der Vater hatte das Kind ganz einfach loswerden wollen […] Damals verstand Jonathan Trotz noch nicht, was ihm angetan wurde. Aber er wurde größer, und da kamen viele Nächte, in denen er wach lag und weinte.
Das Kirchberg-Internat wird seine Fluchtburg. In der pädagogischen Anstalt, die Das fliegende Klassenzimmer beschreibt, haben sie schließlich alle an ihren Blessuren zu tragen. Matz, der ewig hungrige Tertianer, der später einmal Boxweltmeister werden will, hat eine eklatante Rechtschreibschwäche – an jeder anderen Schule hätte ihn vermutlich das consilium abeundi, der Rat, augenblicklich das Weite zu suchen, ereilt. Martin, der ulkigste Primus von Europa, muss sich um seine verarmten Eltern sorgen, der Vater hat seine Arbeit verloren. Der kleine, ewig heimwehgeplagte Uli, den sie beim Theaterspielen in ein Dirndl-Kleid stecken, gilt bei seinen Mitschülern, nicht ganz zu Unrecht, als Schisser vor dem Herrn, bis er sich, um endlich für voll genommen zu werden, in einem Akt der Verzweiflung von der hohen Turnleiter stürzt.
Eine Heimschule ist nun einmal bevölkert von schwierigen Fällen. Viele sind früh schon vom Leben gezeichnet. Die Pädagogen, die sie unterrichten, stehen den gestrandeten Kids oft nur wenig nach, auch ein Internatslehrer hat zumeist seine Blessuren. Doktor Johann Bökh zum Beispiel, Zigarrenraucher, Fliegenträger. Die Schüler nennen ihn Justus, weil er so verflixt gerecht sein kann. Dieser Johann Bökh wurde Lehrer, weil er ein Schultrauma hat. Auch er ist schon in Kirchberg aufs Internat gegangen. Und hat dort elend gelitten. Als die Mutter krank wurde, und es in der Klinik auf Leben und Tod stand, ist der brave, fleißige Junge heimlich abgehauen, um – das alte Kästner-Thema! – ein guter Sohn zu sein und der Schwerkranken die Fieberhand zu halten. Er wird ertappt, zur Rede gestellt, verwarnt, mit Karzer bestraft … und türmt doch immer wieder.
Damals gab es niemanden, dem er sich hätte anvertrauen können, auch Kirchberg war einmal ein Hort repressiver Gesinnung. Seit dieser Zeit hat Bökh – vielleicht einer der ersten Reform-Pädagogen der Weltliteratur (und dazu gehört das Fliegende Klassenzimmer fraglos) – von einer anderen Schule geträumt, die nicht Presse, sondern ein Lebensort mit freundlichen Lehrern ist, damit die Jungen einen Menschen hätten, dem sie alles sagen könnten, was ihr Herz bedrückte.
An Doktor Bökh habe ich alsbald so manchen meiner leibhaftigen Staatsschul-Pauker in Tübingen gemessen. Dass sie bei diesem Vergleich nicht immer sonderlich gut wegkamen, versteht sich. Die waren aus anderem Holze geschnitzt. Für die war Schule Zucht und Ordnung. Ganz anders das Leben im Internat! Der von Justus verbreitete Geist des Vertrauens, von Selbstständigkeit und Solidarität schien das Klima nachhaltig zu inspirieren: Die Tertianer halten zusammen, so unterschiedlich ihre Biographien, ihre Temperamente, ihre Begabungen sein mögen. An Erich Kästners Versuchsschule bleiben Konkurrenz wie Missgunst außen vor. Auch die Schüler und die Lehrer begegnen einander mit Respekt, was in dieser zeitlos lehrreichen Weihnachtsgeschichte freilich nicht Distanz bedeutet, sondern Nähe. Sehr viel Nähe sogar.
Der Hauslehrer Bökh scheint, wenn er nicht gerade unterrichtet oder seinen Schutzbefohlenen aus der Patsche hilft, ein recht einsamer Mann. Internate sind eben nicht nur Schlupfwinkel für gestrandete Schüler. Ob er verheiratet ist oder war, wissen wir nicht; Frauen finden im Fliegenden Klassenzimmer allenfalls als Mütter oder als Tanzstunden-Damen der unrühmlich angepassten Primaner Erwähnung. Aber, so viel steht fest, dieser Justus hatte einmal einen sehr guten Freund, einen Gefährten aus Kirchberger Pennälertagen. Der hat für ihn einst im Karzer eingesessen. Sie wollten Kumpane fürs Leben werden. Sie studierten zusammen. Sie wohnten zusammen. Sie trennten sich auch nicht, als der eine von ihnen heiratete. Dann aber bekam die Frau ein Kind. Und das Kind starb. Und die Frau starb. Und am Tage nach dem Begräbnis war der Mann verschwunden. Doktor Bökh hat sehr, sehr traurige Augen, als er den Jungs von seinem verlorenen Freund erzählt.
Aber wo Lehrer und Schüler, wie in Kirchberg, aller Hierarchien zum Trotz letztlich Partner sind, finden auch die vertracktesten Probleme ihre glückliche Lösung. Martin, Matthias, Johnny und Co. haben den Abgetauchten längst ausfindig gemacht. Er lebt, gar nicht weit von der Schule, in einem ausrangierten Waggon der Deutschen Reichsbahn … und scheint auch sonst ein wenig von der Rolle. Einst war er Arzt, nun verdingt sich der Nichtraucher – wie ihn die Kinder nennen, weil sein Domizil aus lauter Nichtraucher-Abteilen besteht – als Klavierspieler in einer zweifelhaften Vorstadtspelunke, die Zum letzten Knochen heißt und in der die Männer beim Tanzen die Hüte aufbehalten. Dem Himmel sei Dank: Bökhs gewitzte Schüler machen dem Spuk ein Ende und führen die beiden, Johann und Robert, wieder zusammen. Der Eremit aus dem Nichtraucherwagen darf Schularzt werden. Nie wieder einsam!
Auf einem Internat wie diesem werden nicht einzig Formeln und Vokabeln gepaukt, da wird, weit mehr – so wie es Hartmut von Hentig Jahrzehnte später im Geist des Fliegenden Klassenzimmers formulieren sollte – Schule als sozialer Erfahrungsraum begriffen, als Ort, an dem der Einzelne die Notwendigkeit, die Vorteile und den Preis des Lebens in der Gemeinschaft erfährt. Das gilt für alle, die in Kästners Kirchberg-Gymnasium leben. Für Justus, den Hauslehrer. Und für seine Schüler erst recht.
Wie tränenrührend, auch für den Leser, ist der Brief, den Martin Thaler Tage vor Heilig Abend aus einem Städtchen namens Hermsdorf bekommt. Die Tinte ist verwischt. Die Mutter hat geweint. Denke Dir, mein gutes Kind, ich kann Dir diesmal die acht Mark fürs Fahrgeld nicht schicken. Es reicht an keiner Ecke, und dass Vater nichts verdient, weißt Du ja. Es wäre also, hier wie dort, um Haaresbreite ein traurig-einsames Fest geworden … doch dann schlug, einmal mehr, die Stunde von Johann Bökh. Er drückt, als all die anderen Schüler schon fort sind, dem kleinen Martin, der mutterseelenallein durch das Gelände streift, einen Zwanzig-Mark-Schein in die Hand. Das reicht für die Heimfahrt und für die Rückreise. Und für ein paar Geschenke dazu. Großes, rührseliges Happy End. Das Internat: ein Sehnsuchtsort! Schule könnte so schön sein. Nicht nur an Weihnachten.
Viele Jahre, nachdem ich mich als kleiner Junge erstmals in Gedanken sehnsüchtig nach Kirchberg davongestohlen hatte, drückte mir mein bücherversessener Vater – es muss 1971 gewesen sein – ein schreiend oranges Bändchen in die Hand, das die Fortsetzung des Fliegenden Klassenzimmers zu beinhalten versprach. Der Titel war nicht eben ein Kracher. Probleme der Schule im gesellschaftlichen Wandel. Das Beispiel Odenwaldschule. Edition Suhrkamp eben! Muss das ein 17-Jähriger lesen?
Von den Verfassern Walter Schäfer, Wolfgang Edelstein und Gerold Becker hatte ich noch nie etwas gehört. Aber die Unterzeile des schmalen Taschenbuchs erinnerte mich an die euphorischen Schilderungen eines alten Freundes der Familie. Dem Beispiel Odenwaldschule hatte schon Wolfgang Hildesheimer einiges abgewinnen können. Er war von 1930 bis 1933 bei Paulus Geheeb, dem Gründer, Schüler in Ober-Hambach. Als Weber Zettel in Shakespeares Sommernachtstraum, eine Eselsmaske über den Kopf gestülpt (das Foto ist erhalten), hat er auf der Freilichtbühne erste Erfahrungen mit dem Theater gemacht, in der Schreinerei tüchtig gearbeitet, so heißt es im Abgangszeugnis, im Deutschen zuweilen recht Gutes geleistet – und verlor ganz nebenbei, wie er erzählte, in den Armen einer freundlichen Mitschülerin seine Unschuld.
Das Beispiel Odenwaldschule also verhieß viel. Und das eng gesetzte Büchlein, von dem sich innerhalb eines Jahres 24.000 Exemplare verkaufen sollten, löste meine gespannten Erwartungen zu voller Zufriedenheit ein. Da wurde in der Tat eine ganz andere Schule beschrieben als das Frontal-Unterrichts-Gymnasium daheim am Neckar, das mir in der Unterprima gerade das Leben sauer machte. Da gab es keinen fixen Stundenplan, sondern – schon ab Klasse elf – ein Kurssystem mit weitestreichenden Wahlmöglichkeiten. Da standen für den, der sich dafür interessierte, Politik, Soziologie auf dem Stundenplan; das Fach Chemie, das mir so abgrundtief fremd war, ließ sich – so der Schüler, der letztliche Souverän, dies wünschte – ohne Folgen abwählen. Die schikanösen Betragens-Noten – mein strunzautoritärer Griechisch-Pauker in Tübingen, ein Herrenreiter von Adel, schien es zu genießen, wenn er mir mal wieder ein Noch befriedigend ins Zeugnis würgen konnte – auf der Odenwaldschule waren Gehorsamsbenotungen seit ihrer Gründung gestrichen, als ärgerliches Relikt aus der pädagogischen Steinzeit.
Der eigentliche Unterricht, das Büffeln und Prüfen, das merkte ich bei der Lektüre von Gerold Beckers mit faszinierender Leichtigkeit formuliertem Essay über Soziales Lernen als Problem der Schule, war in diesem Internat nur ein Element von vielen. Satte 40 Punkte umfasst das bis heute erfrischend rebellische Curriculum, das auf Ober-Hambachs Höhen gepflegt wurde. Lauter taugliche Tugenden fürs Leben! Ertragen lernen, auch anders zu sein als andere zum Beispiel. Oder: Freude am eigenen Körper zu erhalten und zu steigern lernen. Oder – o, süße Freiheit! – ein entspanntes (von Verachtung und Angst ebenso wie von Unterwürfigkeit freies) Verhältnis zu Institutionen und Bürokratie erwerben. Oder aber – welch lebensweiser Erzieher schien hier zu sprechen! – den Wert von Ordnung und den Wert von Unordnung schätzen lernen (in geordneten und regelfreien Räumen leben können). Gerade die letzte Verheißung, die mit den entregelten Räumen, war nach meinem Geschmack.
Die OSO – so die Abbreviatur für Odenwaldschule Ober-Hambach – verstand sich, wie Becker in einer Broschüre 1972 zu seinem Amtsantritt als Schulleiter schrieb, als Umgebung, die dem Aufwachsen bekommt. Steife Hierarchien hatten ausgedient. Schüler und Lehrer, die hier, ganz im Sinne des propagierten Teamworks, Mitarbeiter heißen, lebten in kleinen Parzellen zusammen, Tür an Tür, jahrgangsübergreifend und beherzt koedukativ, in Familien eben – und auch als solche benannt; nur die Jüngsten bis zu Klasse fünf hatten ihr eigenes Haus. Sogar einige Schüler durften solche Wohngruppen übernehmen und sich dann Kameraden-Familien-Oberhaupt, im OSO-Slang kurz KFO, nennen. Hinter dieser Praxis des freien Miteinanders schien sich einmal mehr ein Lernziel zu verbergen. Das Zusammenleben von Jungen und Mädchen, die Mischung von Altersstufen, macht es unumgänglich, dass alle immer – und gelegentlich sehr mühselig – neu lernen, Bedürfnisse und Empfindlichkeiten zu respektieren, die sie vielleicht selbst nicht haben.
Gerold Becker schwärmte von einer Heimordnung, die den Bedürfnissen der Schwächeren einen Vorrang vor denen der Stärkeren einräumte. Eine Schule fürs Leben also, in der nicht Drill und Disziplin, sondern die Erziehung zur Mündigkeit oberste Priorität genoss. Freiheit in Selbstverantwortung : das war Losung und Appell zugleich. Wo immer es ging, hatten die Jugendlichen ein Mitsprache-Recht. Sogar ein Schüler-Parlament wurde in den Statuten installiert – ausgestattet mit einem eigenen Etat in Höhe von 3000 Mark per anno, was Anfang der 70er-Jahre eine ganze Menge war.
Am südlichen Zipfel des damals noch roten Hessen schien eine freie Schüler-Republik ausgerufen. Dort unterrichtete der Theologe Becker 1971, als das orangene Manifest erschien, Psychologie und Religion und war im Begriff, Leiter der Schule pädagogischer Wunder zu werden, wo man selbst den allerorts existenten Alkohol- und Drogen-Problemen mit bemerkenswerter Gelassenheit ins Auge sah. Kein blindwütiges Verbot, sondern ein Appell an die Vernunft: mit Genussmitteln, Medikamenten, Drogen, Rauschmitteln sinnvoll umgehen lernen.
Strafen, wusste der Freund und Gefährte Hartmut von Hentigs, sind ohnehin nur beschränkt wirksam, rigorose Maßnahmen eine Art Offenbarungseid. Sätze wie diese kamen für mich, der ich in Tübingen wegen Renitenz oder verbaselter Schulhefte von Gymnasialprofessor Steinthal in schöner Regelmäßigkeit zum Rektoratsarrest, der leidigen Rexarena, einbestellt wurde, einer Freiheitserklärung gleich.
An der Odenwaldschule aber, das war die Quintessenz des verführerischen Aufsatzes, wurden keine Zöglinge gehalten, keine Untertanen gezüchtet. Auf dem Zauberberg der modernen Reformpädagogik gediehen Menschenkinder mit vielen, vielen Rechten, zu denen ab einem gewissen Alter auch das Recht auf eine freie, durch keinen Erwachsenen gestörte Entfaltung von Lust und Sinnenfreude gehörte. Die Schule jedenfalls versprach, noch einmal Gerold Becker, alles zu tun, damit Kinder und Jugendliche die Sexualität als beglückend und kommunikationsstiftend erfahren. Kurzum, hier lockte, gegen einen schon damals nicht unerheblichen Eintrittszoll, ein Paradies des unbeschwerten und viel umfassenden Lernens, das seinen Besuchern, aller Libertinage zum Trotz, nicht zuletzt den Start in ein erfolgreiches Berufsleben versprach. Die Reifeprüfung dort glich einem Gütesiegel.
Dieses Internat entließ, allem Anschein nach, einzig glückliche Schüler. Gerold Becker, dieser Wahlverwandte Johann Bökhs, stellte das Licht des traditionsreichen Instituts, an dem schon Klaus Mann, Beate Uhse oder Daniel Cohn-Bendit die Freiheit studierten, nicht unter den Scheffel. Man kann ohne Schönfärberei sagen, dass fast alle Schüler gern oder sehr gern an der Odenwaldschule sind, jedenfalls, dass sie hier lieber sind als irgendwo anders. Der Leiter schien zu wissen: Das eigene Zuhause war vielen Kindern, die in seiner Nähe lebten, offenkundig ein Gräuel.
Ein Malheur – meine Mutter sprach von einer narzisstischen Kränkung – sollte auch mir unverhofft die Pforten zum Mekka der modernen Pädagogik öffnen. Die Lehrer des Tübinger Uhlandgymnasiums hatten auf der Zeugniskonferenz im Sommer 1972 mehrheitlich beschlossen, dass es angezeigt sei, den Schüler Jens nicht zu versetzen. Da war ohnehin die eine oder andere Rechnung offen. Richten Sie sich auf eine Ehrenrunde ein, verkündete mir, höhnisch grinsend, am nächsten Morgen der Rechenlehrer namens Heinzelmann, ein biederer Herr mit Hornbrille – und von recht schwäbischer Mundart.
Das tat weh – und war die Chance! Meine Eltern ließen sich leicht überzeugen. Ich durfte zur Aufnahmeprüfung anreisen, in das von Gerold Becker so begeistert gezeichnete Walddorf, in dem jedes der mit tönernen Dachpfannen, so genannten Biberschwänzen gedeckten Wohnhäuser einem Schlupfwinkel, einem Schutzraum vor dumpf-autoritärer Pädagogen-Herrschaft zu gleichen schien. Überall Giebel, Gauben und kleine Erker. Knallrote Fensterläden sorgten für die nötige Farbe im Ensemble.
Die Aufnahmeprüfung, abgehalten in einem betörend unaufgeräumten Raum, werde ich niemals vergessen. In diesem Rektorat wurde kein Arrest abgebrummt, hier wurde niemand weggesperrt. Hier wurden Utopien gesponnen und Freiräume geschaffen. Lernen: ein Abenteuer. Schule: ein Ort ohne Angst. Woran es denn hapere, fragte mich ein heiter-entspannter Gerold Becker, der 36-jährige Mann in einem hellen, handgestrickten Pullunder, als ich ihm von meiner Fünf in Mathematik erzählte.
Resultiert der Ärger nun daraus, dass Du – wie ich – die Dinge, die da verhandelt werden, nicht so recht verstehst? Oder machst Du Flüchtigkeitsfehler? Im ersten Fall empfehle er den altgedienten Schulmeister Vogel, von dem das Gerücht gehe, dass er selbst einem Stein die Grundzüge der Mathematik beibringen könne. Sonst aber sei ich ein Mann für Peter Breuer. Der ist genial und verrechnet sich immer. Lehrer sind fehlbar, und Unterricht kann auch Freude machen – das war die Lektion, die da einem 17-Jährigen mit Souveränität und Selbstironie vorgetragen wurde. Ich hätte nach acht Jahren der Erniedrigung an einem baden-württembergischen Gymnasium die Welt umarmen können. Ich werde Gerold Becker, bei allem, was wir heute über ihn wissen, diese Reifeprüfung niemals vergessen.
Dem heiteren Examen schlossen sich Gespräche mit den Fachlehrern in Deutsch, Politik und Biologie an – Gespräche wohlgemerkt, über Kafka, osmotische Prozesse und Kiesinger/Brandts Große Koalition, keine Abfrage-Verhöre. Und wenig später diktierte Gerold Becker, der Freund, der Mentor aller schwierigen Kinder, einen für mich folgenreichen Brief: Gravierender Unkenntnisse im Englischen zum Trotz hätte ich einen erfreulichen Eindruck hinterlassen, im Deutschen Sinn für literarische Qualität bewiesen, auch wenn ich noch ein wenig ungenau läse und meine Arbeitsweise solider werden müsse, um es zu überdurchschnittlich guten Ergebnissen zu bringen. Dennoch – oder eben deshalb: Ich sei willkommen, mit den besten Wünschen bedacht, auf dass sich der neue Start für mich als erfolgreich und vergnüglich erweise. Schule: vergnüglich! So also geht es auch.
Im September 1972 begann eine neue Zeitrechnung. Ich war aufgenommen in den Kreis der damals noch über 300 Erlauchten, in den verschworenen Zirkel der OSO – und das war nur eines von vielen Kürzeln in dieser weltentrückten Gemeinschaft, sechs Kilometer Fußmarsch bergauf von der Kleinstadt Heppenheim entfernt. SOPO und PÄPS hießen die beliebtesten Wahlfächer der Oberstufe: Soziologie-Politologie-Ökonomie und Pädagogik-Psychologie – was denn auch sonst?
Ein Lego (und von denen gab es viele), der war legasthen und durfte auf eine milde Korrektur seiner Klausuren hoffen. Ein eingekringeltes »L« unter der Arbeit genügte. Statt auf Klassenfahrt gingen schon die Sechstklässler einmal im Jahr auf Projektwoche. Und wenn der Freitag auf einen 13. fiel, dann wurde in der Nacht zuvor der Blaue Wurm, der Spaßgeist der Schule, von der Kette gelassen, dann brach eine Art Ausnahmezustand über die OSO hinein, Pennäler-Anarchie. Dann wurden, ohne dass ernsthafte Konsequenzen zu befürchten gewesen wären, Gartentore ausgehängt, Lehrer-Autos ihrer Reifen entledigt, das Gestühl des Klassenzimmers in den Wald geschleppt. Ein ungeliebter Pädagoge musste gar von den Gebrüdern Lannert, den breitestes Hessisch babbelnden Internatshandwerkern – die plebejische Erdung des Instituts – mit dem Schlagbohrer aus seinem Domizil befreit werden. Eine Meute beherzt zupackender Alumni hatte die Eingangstür zur Lehrerwohnung, kurz nach der Geisterstunde, mit Gips und Ziegelsteinen zugemauert.
Nein, hier waren wir nicht, wie bei den Strafpädagogen in Tübingen, lästiges Arbeitsmaterial von Erziehungsbeamten, auch nicht gequälte Gestalten wie der verirrte Zögling Törleß, der sich im Konvikt zu W., dieser Heimschule der Grausamkeit, wie ein Gefangener und Aufgegebener behandelt sah. Auch Internate können, zumal in der Literatur, bei Robert Walser, Musil oder Hesse, der Horror auf Erden sein, nicht Sehnsuchtsort, sondern eine Enklave des Schreckens. Ein Osoaner aber durfte sich richtig wichtig fühlen, ernst genommen und geborgen. Wir waren Partner auf Augenhöhe, so wie es Brauch ist seit der Gründung 1910. Man duzt und respektiert einander. Die erprobte Internatspolitik – auf der einen Seite die Herrscher, auf der Gegenseite die Schüler – wurde an der OSO nie praktiziert … Der Berichterstatter vom ZEITmagazin geriet im September 1972, ein paar Tage, bevor ich gen Heppenheim umziehen durfte, bei seinem Besuch des Becker-Instituts haltlos ins Schwärmen.
Bereits die Fotos der einst legendären Farbbeilage versprachen eine rundum gute Zeit. Da hockte Schusch in seinem Zimmer vor einem Jimi-Hendrix-Poster und bereitete sich auf einer verklebten Kochplatte das Internats-Nationalgericht Spaghetti. Dazu trinkt man Tee. Am Laborhaus prangte ein SPD-Graffiti: In der OSO nimmt man Politik ernst. Und Holger, der wie ein Honigkuchenpferd strahlte, lümmelte sich mit Freundin Nicole auf dem Couchbett. Auf dem Schreibtisch ein selbstgepflückter Blumenstrauß. Es darf geschmust werden: Ein Primaner wird von seiner Schulfreundin besucht – das verstehen sie unter Koedukation. Kann Schule schöner sein?
Der großen Freiheit zum Trotz: der äußere Rahmen betonte das klassisch-erhabene Erbe. Die von Architekt Heinrich Metzendorf entworfenen Gebäude, malerisch über zwei Anhöhen verteilt, sind bis heute nach Schiller, Herder, Fichte, Platon oder Humboldt benannt. Das Domizil der Kleinen nach Pestalozzi, kurz: Pesta, und das größte – wie könnte es anders sein? – nach Goethe. Dessen Proömium aus Gott und die Welt verlesend, hat Paul Geheeb 1910 die Odenwaldschule gegründet. Es zieht Dich an, es reißt Dich heiter fort,/Und wo Du wandelst, schmückt sich Weg und Ort;/Du zählst nicht mehr, berechnest keine Zeit,/ Und jeder Schritt ist Unermesslichkeit.
Die Aura dieses Internats lebt noch heute von ihren hochkulturellen Verweisen – und doch waren im Unterricht (und vor allem in den bis spät in die Nacht geführten Diskussionen danach) Wallraffs Industriereportagen weit wichtiger als Wilhelm Meisters theatralische Sendung. Wir studierten in unseren Oberstufenkursen Horkheimer, Freud oder Beckett (in der englischen Version des Autors, versteht sich), verglichen Aggressions-Theorien; auch die existentiellen Fragen des Menschseins, ein Leistungskurs über Tod und Verzweiflung oder das Fatum der Langeweile, standen auf dem Stundenplan.
Der Filmausschuss zeigte, auf dass die Inspiration über uns komme, die großen Seelendramen des Kinos: Viscontis Tod in Venedig, Ingmar Bergmanns Schweigen