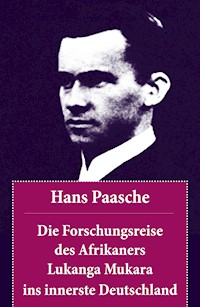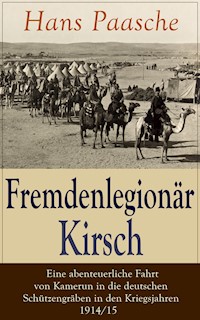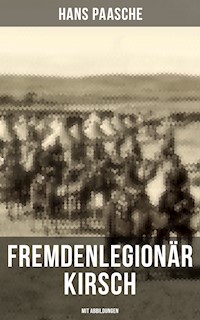
0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In Hans Paasches Buch 'Fremdenlegionär Kirsch (Mit Abbildungen)' begleiten wir den Protagonisten Kirsch auf seinem abenteuerlichen Weg als deutscher Fremdenlegionär. Paasche präsentiert uns eine fesselnde Geschichte, die von Tapferkeit, Kameradschaft und persönlichem Wachstum geprägt ist. Sein literarischer Stil ist prägnant und authentisch, was dem Leser ein intensives Leseerlebnis bietet. Das Buch spielt in einem historischen Kontext und zeigt uns die Härte des Soldatenlebens in der Fremdenlegion. Durch die detaillierten Abbildungen wird der Leser noch tiefer in die Welt von Kirsch hineingezogen. Hans Paasche, ein ehemaliger deutscher Offizier und Schriftsteller, schöpft aus seiner eigenen Erfahrung, um uns diese packende Geschichte zu präsentieren. Seine genaue Darstellung des militärischen Lebens in der Fremdenlegion zeigt seine profunde Kenntnis des Themas. Paasche zeigt mit 'Fremdenlegionär Kirsch', dass er nicht nur ein begabter Schriftsteller, sondern auch ein sachkundiger Beobachter ist. Dieses Buch ist ein absolutes Muss für alle, die an Militärliteratur interessiert sind und einen Einblick in die Welt eines Fremdenlegionärs suchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Fremdenlegionär Kirsch
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Max Kirsch in der Legionärsuniform, in der er bei Prunay in den deutschen Schützengraben überlief.
Dies Buch enthält die Kriegserlebnisse eines jungen Mannes, der deutscher Art und Bildung Ehre gemacht hat.
Der Jugend, die die Welt erobern will, kann kein besseres Beispiel gegeben werden als die Gestalt unseres Helden. Sprachkenntnisse, Kenntnis der Natur und Erdkunde: offenes Auge, körperliche und geistige Gewandtheit, eine einfache, von Genußgiften unabhängige Lebensweise und ein Wagemut seltener Art, das sind die Kräfte, die Kirsch befähigten, sein Vaterland in dieser schweren Zeit zu erreichen.
Sein Glück in all den Wechselfällen der Irrfahrt ist wunderbar. Nachdenkliche Leser werden neben der Selbstverleugnung, mit der Kirsch sich, um einen Weg zur Heimat zu finden, den Gefahren der Schlacht aussetzte, noch etwas Großes erkennen, das sich in die Erlebnisse hineinmischt: Menschlichkeit und Kameradschaft im Kreise derer, die Feinde seines Volkes waren.
Die Urkunden und Bilder, die dem Buche beigegeben wurden, gehören zu dem wenigen, was Kirsch bei seiner Flucht in den deutschen Schützengraben bei sich führte.
Es wird unserm Helden nicht schaden, wenn er berühmt wird; er gehört zu den Menschen, die unabhängig von dem, was hinter ihnen liegt, den Weg gehen, den ihnen das sittliche Streben zeigt.
Gut Waldfrieden bei Hochzeit i. d. Neumark. Hans Paasche.
Bei Kriegsausbruch in Kamerun
Auf dem breiten Strome des Kamerunflusses schwimmt unterhalb der Joßplatte das große Dock der Wörmannlinie. Die Landungsbrücken am Ufer von Duala sind voller Menschen. Freundliche Häuser liegen versteckt in dem dunklen Grün der Mangobäume. Auf der andern Seite des Stromes leuchten aus dem Uferwalde die Häuser von Bonaberi hervor. Weiter nach dem Meere hin ragt der Rücken des Kamerunberges empor. Weiße Nebelstreifen bedecken seinen Fuß.
Auf dem Strome liegen zwei große Dampfer. Ihre Riesengestalten und das Dock sind auffallende Erscheinungen in der weiten, wilden Natur.
Das Dock trägt einen Dampfer, an dem bis heute lebhaft gearbeitet wurde. Schwarze Hände nieteten an den Kielplatten vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Heute aber hat der Lärm der Arbeit aufgehört, und nur von Land her, aus der Regierungswerkstätte, tönt ein geschäftiges Klopfen, Schlagen und Hämmern, wie das, seit die Europäer ins Land kamen, an so vielen Stellen der afrikanischen Küste zu hören ist, wo früher nur das tiefe Brüllen der Flußpferde und der Schrei der Ufervögel die Ruhe unterbrachen.
Auf dem Dock ist reges Leben. Neger stehen an den Ventilen, der Dockmeister pfeift, die Neger drehen die Gestänge, und langsam sinken die Kasten in das Wasser, bis der Körper des gedockten Schiffes selbst zum Tragen kommt und die Balken aufschwimmen, die die Bordwand gegen die Wände des Docks gestützt hatten. Der Kapitän des Schiffes steht auf der Kommandobrücke und wartet auf den Augenblick, wo er den Maschinentelegraphen nach langen Tagen zum erstenmal wieder bewegen kann.
Ein Bild aus der Friedenszeit: Der Barredampfer »Marina« im Hafen von Lagos.
Endlich schwimmt die »Marina«. Der Telegraph schnarrt und klingelt, die Maschine springt an, das Schiff steuert im großen Bogen flußaufwärts und fährt sicher durch die Fischerboote der Eingeborenen hindurch, bis auf einen Ankerplatz gegenüber dem Wörmannhause und dem Strandhotel. Der Anker fällt. Der Dampf wird abgestellt.
Jetzt konnte auch ich an Deck kommen und mich mit meinen Kameraden freuen, daß die Arbeit beendet war. Das Schiff war wieder wie neu. Der Kapitän war froh über das gute Manöver des Schiffes, das so lange ruhig hatte im Dock liegen müssen, und spendete seinen weißen Mitarbeitern einen gemeinsamen Trunk.
Meine Tätigkeit an Bord der »Marina« war heute beendet. Ich mußte den nächsten Barr-Dampfer erwarten, der hier gedockt werden sollte, und freute mich auf einige Tage der Erholung. Mein eigentlicher Wohnsitz war Lagos. Da war ich bei der Werft angestellt, auf der die Barr-Dampfer ausgebessert werden, wenn sie bei ihrem schweren Dienst zu Schaden kommen. In Lagos selbst aber können nur kleinere Arbeiten ausgeführt werden; alle Arbeiten, zu denen ein Dock notwendig ist, müssen in Kamerun gemacht werden. Zu solchen Arbeiten war ich im Mai 1914 nach Kamerun gesandt worden.
Der Kapitän gab auch unseren schwarzen Arbeitern, die uns bei der Arbeit treu unterstützt hatten, Urlaub, damit sie zu ihren Landsleuten gehen und sich einige Tage ausruhen konnten. Er versprach außerdem, daß der Lohn auch für die Tage der Ruhe gezahlt werde, zur Belohnung für die gute Arbeit. Die Neger verließen das Schiff in froher Stimmung, und nun herrschte an Bord eine Stille, die nach dem Lärm der letzten Wochen sehr wohltuend war.
Der Kapitän ließ sich ein Beiboot klarmachen und fuhr an Land, um die Geschäftsstelle der Dampferlinie aufzusuchen. Wir anderen, die Maschinisten und ich, lagen in Korbstühlen an Deck, gedachten zu baden und uns auszuschlafen und durchblätterten die letzten Zeitungen, die schon ziemlich alt waren. Es war da etwas von dem Mord in Sarajewo zu lesen. In einem Boot, das mit Negern bemannt war, kam der Dockmeister an Bord und sagte: »Es ist dicke Luft, Rußland macht mobil.« Einer von uns aber sagte: »Ach, heutzutage gibt's so leicht keinen Krieg, und wenn's einen gibt, ist der in fünfzehn Minuten fertig!«
Mit einemmal hörten wir von Land her das bekannte Trillern der Pfeife des Kapitäns. Er stand auf der Landungsbrücke und winkte lebhaft mit einer großen Papierrolle, die er in der Hand hielt. Das fiel uns auf, denn dieser Mann war nicht so leicht aus seiner Ruhe zu bringen. Es mußte etwas Besonderes los sein. Jetzt sahen wir auch, daß auf vielen Häusern der Stadt Flaggen wehten.
Eiligst wurde das Verkehrsboot mit den Schwarzen an Land geschickt und kam mit dem Kapitän zurück. Gespannt erwarteten wir ihn, als er über die Strickleiter an Bord kam.
»Es ist Krieg!« rief er schon von unten. »Telegramm von Deutschland: ›Krieg mit Frankreich und Rußland‹.« Wir lachten ungläubig. Die Nachricht kam uns, die wir die letzten Zeitungen nicht verfolgt hatten, zu töricht vor. Als der Kapitän aber Einzelheiten mitteilte, mußten wir schon glauben, was er uns sagte, und hörten, daß wir uns gleich an Land zu melden hätten. Ich nahm meine Papiere, fuhr an Land und eilte zum Bezirksamt. Ich hatte einen sogenannten Auslandsschein und war danach bis 1916 vom Militärdienste befreit. Ich hatte also noch nicht gedient und bekam die Weisung, abzuwarten.
In den Straßen von Duala war ein ungewöhnliches Leben. Ansiedler, Kaufleute, Ärzte und andere, die sich grade im Lande aufhielten, waren gekommen, um sich bei dem Kommando der Schutztrupps zu melden. Man fürchtete auch Spione. Alle Häuser waren belebt, man trank heute noch mehr als sonst, und die Stimmung wurde immer zuversichtlicher. Niemand zweifelte, daß wir Deutsche beide Gegner bald niedergerungen haben würden. Bald aber kamen Nachrichten, daß es auch mit England losgehe. Jetzt dachte ich besorgt an unsere Kameraden in Lagos. Alles, was deutsche Kaufleute in der englischen Kolonie begonnen hatten, war auf dem Vertrauen aufgebaut, daß Weiße sich in den Kolonien untereinander nie bekämpfen würden; dieser Grundsatz schien durchbrochen zu sein, Freiheit und Eigentum der Deutschen war gefährdet. Auch ich hatte einen Verlust; fast meine ganze Ausrüstung hatte ich in Lagos gelassen.
Mein Vorgesetzter, Herr Ingenieur Hassenstein aus Lagos, war gerade in Duala und stellte sich in den Dienst der Regierung. Er brachte uns die Nachricht, daß die »Marina« besondere Aufträge bekäme, und daß ich als dritter Maschinist an Bord bleiben sollte, weil der Wachdienst für zwei Maschinisten zu anstrengend werden würde.
Man sagte zwar, nach der Kongoakte werde in den Kolonien kein Krieg geführt, dennoch wurde die Verteidigung vorbereitet, und die »Marina« bekam die Aufgabe, die Bojen der Fahrrinne des Kamerunflusses so zu verlegen, daß die Angaben der Segelhandbücher nicht mehr stimmten.
Weit draußen vor der Mündung lag eine große Hafenboje, die gehoben werden mußte. Die Arbeit wurde bei stürmischem Wetter ausgeführt. Die schwere Boje schlug gegen das Schiff; dabei wurden einige Neger, die an den Ketten arbeiteten, schwer verletzt.
Meine Aufgabe war, auf der Brücke aufzupassen, ob feindliche Schiffe hinter der Insel Fernando Póo hervorkämen. Wir waren ein richtiges Vorpostenschiff.
Als wir hier draußen Wache hielten, hatten wir eine große Freude: Alle die deutschen Barr-Dampfer von Lagos kamen mit der Zeit an. Wir hatten sie schon verloren geglaubt. Die Dampfer hatten sich bei den ersten Anzeichen des Krieges in Lagos voll Kohlen geladen und waren dann rechtzeitig ausgelaufen. So waren sie den Engländern entgangen. Zuletzt kamen die Schiffe, die wegen ihrer Langsamkeit und Seeuntüchtigkeit stets bespottet wurden. Als allerletzter kam der »Addo«. Fast alle Neger der Besatzung waren in Lagos heimlich entwichen. Die wenigen Weißen, die das kleine Fahrzeug über die hohe See herüberbrachten, hatten aber den Mut nicht verloren, und wir hörten durch die Nacht die Klänge des Pariser Einzugsmarsches in der echt afrikanischen Konservenmusik eines Grammophons.
Außer den Barr-Dampfern kamen viele Dampfer deutscher Linien in Duala an. Die Kamerunmündung war für alle der einzige Unterschlupf an der westafrikanischen Küste. Noch nie hatte der Hafen so viele Schiffe beisammen gesehen. Und alle die Deutschen, die mit den Dampfern kamen, eilten an Land, um sich bei der Behörde zu melden. Außerdem wurden viele Hunderte Neger aus fremden Kolonien gegen ihren Willen hier gelandet. Sie waren als Fahrgäste nach anderen Häfenplätzen unterwegs gewesen. Jetzt bedrängten sie die Regierung, sie wollten weiterreisen. Viele der Eingeborenen des Landes waren über die Ereignisse so erschreckt, daß sie, so recht nach Art der Wilden, ihr Hab und Gut in Boote einpackten und über den Strom fuhren, um sich ins Innere des Landes zurückzuziehen.
Die Funkentelegraphie unterrichtete Duala in den nächsten Tagen über die Ereignisse in der Welt. Die Funkenstelle auf der Joßplatte bekam ihre Nachrichten von Togo, von Kamina, das mit Nauen in Verbindung stand. Wir erfuhren die Einnahme von Lüttich und das siegreiche Vordringen unserer Truppen. Eines Tages aber kamen schlechte Nachrichten. Wir hörten, daß die Franzosen und Engländer in Togo eindrangen und Lome nahmen, und daß die Deutschen sich vor der Übermacht zurückziehen mußten. Die Stimmung wurde gedrückt. Auch Kamerun war ja ganz von feindlichen Kolonien umgeben, und jetzt wurde noch eifriger an der Vorbereitung der Verteidigung gearbeitet. Im Kamerunfluß sollte die Fahrrinne für große Schiffe gesperrt werden, und die Besatzung der »Marina« wurde beauftragt, zwei Schiffe im Fluß zu versenken.
Draußen lag als Vorposten ein Dampfer der Wörmannlinie. Ein anderer, der große Dampfer »Eleonore Wörmann«, verließ den Hafen. Er hatte den Auftrag, sich nach Südamerika durchzuschlagen und deutsche Kriegsschiffe mit Kohlen zu versehen. Alles jubelte ihm zu. Er hat später an der Küste von Südamerika die Besatzung des Hilfskreuzers »Kap Trafalgar« gerettet und nach Buenos Aires gebracht, wo er jetzt noch liegt.
Wir brachten die beiden ersten Dampfer, die versenkt werden sollten, an die sogenannten »Hundsköpfe«, die schmalste Stelle des Stromes. Dort wurden die Schiffe quer zum Strome verankert. Die Kapitäne, die viele Jahre auf den Fahrzeugen gewohnt hatten und denen die Schiffsräume zur Heimat geworden waren, konnten sich nicht vorstellen, daß man ihre Schiffe wirklich opfern wollte. Der eine stand auf der Brücke und wischte sich die Tränen aus den Augen; aber Eile war geboten und nicht einmal die Ladung konnte von Bord gegeben werden. Wir öffneten die Seeventile des ersten Schiffes, und das Wasser drang mit Gewalt ein. Dann fuhren wir auf das andere Schiff und blieben da nicht lange, weil die Zwischenwände und Schotten schon vorher durchbrochen worden waren und das eindringende Wasser sich deshalb schnell verbreitete. Die Menschen, die von Bord gingen, retteten sich auf die »Marina« hinüber. Eines der Schiffe legte sich auf die Seite, das andere ging senkrecht unter. In dunkler Nacht fuhren wir nach Duala und landeten die Besatzungen.
Als wir einige Tage später wieder auf Vorposten lagen, kam ein Dampfer in großer Fahrt den Strom herunter. Wir erkannten den britischen Handelsdampfer »Sokoto« und hatten Verdacht, daß er den Hafen ohne Erlaubnis der Regierung verlassen wollte. Wir hielten ihn an, mußten uns aber überzeugen, daß er deutsche Lotsen mitbrachte und vorschriftsmäßig abgefertigt worden war. In einer Dankbarkeit, die wir ihm nachfühlen konnten, dippte der Engländer, als er weiterfuhr, dreimal die Flagge und heulte mit der Sirene.
Wir wurden in diesen Tagen stark angestrengt. Ein Auftrag jagte den andern. Noch zwei Dampfer, die »Anna Wörmann« und die »Lome«, wurden in der Fahrrinne versenkt, dann bekam die »Marina« eines Abends den Auftrag, dem Dampfer »Renata Amsing« Fahrgäste abzunehmen und sich zu einer Fahrt über See bereit zu halten.
Wir gingen in der Nacht längsseit. Der Kapitän hatte Bedenken, so viele Leute an Bord zu nehmen, denn er fragte sich, wie er alle diese Menschen verpflegen sollte. Es hieß, die Schwarzen hätten selbst genug Verpflegung mit. Da es aber spät in der Nacht war, konnte das nicht nachgeprüft werden.
Gegen Morgen legte ein Negerboot an, das einen Europäer an Bord brachte. Es war ein bekannter Rechtsanwalt aus Duala. Ich empfing ihn an Deck. Er wollte mitfahren. Der Kapitän überzeugte sich, daß die Papiere des Herrn in Ordnung waren, und willigte schließlich ein, obwohl der Herr, außer einer Aktenmappe, nichts mit sich hatte. Er gab an, er sei Reserveoffizier und wolle auf irgendeinem Wege nach Deutschland.
Eigentlich sollte ich jetzt von Bord gehen. Da sich aber andere Maschinisten weigerten, mitzufahren, wenn das Schiff keine Waffen mitbekomme, meldete ich mich freiwillig und sagte zum Kapitän: »Ich habe ja noch von der Dockarbeit her den notwendigsten Teil meiner Ausrüstung an Bord und kann ohne weiteres mitfahren.« Mich reizte die Kriegsaufgabe der »Marina«, und ich hoffte in wenigen Tagen an Erlebnissen reicher nach Duala zurückzukehren.
Am folgenden Abend brachte uns der Dampfer »Bonaberi« Chronometer und leider auch noch eine ganze Anzahl Neger. Die kletterten in der Dunkelheit an Bord. Kurz darauf lichteten wir den Anker und fuhren stromabwärts. Bei dem geringen Tiefgang des Schiffes kamen wir leicht über die Barre hinweg.
Die Fahrt war sehr geheimnisvoll. Niemand durfte Licht machen oder laut sprechen. Dabei war das Schiff mit Negern überladen. Jeder Winkel an Deck und in den Bunkern war besetzt. Wenn ich von der Maschine zu meiner Kammer ging, mußte ich über Menschen und immer wieder Menschen klettern. Männer, Weiber und Kinder lagen schweigend und geängstigt durcheinander. Das ganze Schiff roch nach Negerhaut.
Das Wetter war günstig, obwohl nicht die ruhige Jahreszeit war. Die Luft war etwas diesig, das erleichterte unser Entkommen.
Wir hatten erfahren, daß englische und französische Schiffe vor der Flußmündung lagen. Das Kanonenboot »Surprise« war gemeldet worden. Die Decklichter des Maschinenraumes blieben geschlossen, damit das Geräusch der Maschinen nicht weit zu hören sei, und es war unerträglich heiß unten. Der Maschinentelegraph, der ein lautes Glockenzeichen gibt, wurde nicht benutzt; die Befehle an die Maschine wurden durch das Sprachrohr heruntergerufen. Die Türen der Kessel mußten lautlos bedient werden. Es war ein Zustand, der die Nerven stark in Anspruch nahm. Endlich, nach langen Stunden der Spannung rief der Kapitän herunter: »Nun vorwärts, alles klar.«
Ich eilte an Deck und sah mich um. Die Küste Kameruns verschwand. Vor uns lag die spanische Insel Fernando Póo, ein gewaltiger Bergkegel, der sich aus dem Wasser heraushebt. In der Morgendämmerung kreuzte das Schiff vor dem Hafen von Santa Isabel.
Die Fahrt des Dampfers »Marina« zu Beginn des Krieges von Kamerun aus.
Meuterei an Bord der »Marina«
Der Kapitän fuhr an Land und erkundigte sich, ob er die Neger landen dürfe. Das wurde nicht erlaubt, und wir mußten weiterfahren.
Das Schiff steuerte weit von Land ab und hielt sich außerhalb der befahrenen Schiffahrtslinie. Der Kapitän sagte uns, er werde nach Kap Palmas fahren. Das war die Heimat unserer schwarzen Besatzung; das Gebiet an der äußersten Südspitze der Sklavenküste, wo die französische Kolonie an die Negerrepublik Liberia angrenzt.
Die Offiziere der »Marina« waren der Kapitän, der Erste Offizier, der Erste und der Zweite Maschinist und ich als Dritter Maschinist. Außer diesen war, als sechster Weißer, noch der Rechtsanwalt aus Duala an Bord.
Der Kapitän, Freiherr von Geyer zu Lauf, war ein erfahrener Mann. Er hatte schon viel erlebt und erzählte in der Messe öfter, wie er im Russisch-Japanischen Kriege mit einem Schiff die Blockade gebrochen hatte. Er war verheiratet und hatte seine Frau und einen kleinen Sohn in Deutschland gelassen. Obwohl er ein Bayer war, trank er sehr wenig. Er hatte immer eine große Ruhe und jedermann lobte die feine Art, wie er mit Menschen umging.
Zu ihm paßte gut der Zweite Maschinist, Brun. Beide gehörten auch einem Kreise von Europäern an, die die Lagoslöwen genannt wurden. Er war ein Kieler Junge, aus guter Familie und hatte früher einmal studiert. Aus der Zeit hatte er über das Gesicht zwei breite Schmisse und auf der Brust große Narben, die man bei der offenen Kleidung in der Hitze oft sah. Aus seiner Lebensgeschichte wußte man, daß er das Studium eines Tages aufgab, nach Afrika fuhr und da hängenblieb. Und dann wurde er ein so eingefleischter Afrikaner, daß er es schon beim ersten Urlaub in Deutschland nicht mehr aushielt und gleich in Hamburg wieder umkehrte. Das gab ein großes Hallo, als er postwendend wieder in Lagos eintraf.
Der Erste Maschinist war viel in Australien gewesen, und seine ständige Redewendung war: »Als ich in Sidney war«. Er sprach sehr gut Englisch und tat sich darauf viel zugute. Durch langen Aufenthalt in englischem Lande hatte er sich auch innerlich den Engländern sehr genähert.
Als Erster Offizier war der Kapitän des »Eggo« an Bord, eines der Barrdampfer, die wir in der Kamerunmündung versenkt hatten. Er stammte aus einer Fischerfamilie in der Nordsee und war im Sprechen so unbeholfen, wie er in anderen Dingen geschickt war. Nie sah man ihn ohne Tabakspfeife.
Der Rechtsanwalt endlich hielt sich an Bord meist beim Kapitän auf. Er war sehr reizbar und vertraute sich niemandem an.
Die übrige Besatzung des Schiffes bestand aus Negern. Es waren Leute, zu denen man großes Vertrauen haben konnte, und die im Dienst schon viel geleistet hatten. Ihre Kenntnisse als Matrosen und Heizer waren erstaunlich gut. Ich hatte auch meinen treuen Diener Freitag mit mir.
So schön der erste Tag der Seefahrt war, ein Blick auf das Deck belehrte uns, daß wir eine gefährliche Ladung an Bord hatten: 800 Schwarze, Menschen jeden Alters, auf einem Dampfer von nur 600 Tonnen. Jeder Fußbreit des Decks war mit Menschen bedeckt. Wir mußten unsere Kammern verschlossen halten, damit die Neger nicht da hinein drängten, und erreichten kaum, daß ein schmaler Gang freigelassen wurde, auf dem wir von der Kammer zur Maschine gehen konnten.
Die Schwarzen, die in der Nacht ruhig gewesen waren, verloren allmählich ihre Schüchternheit. Es waren Neger aller Küstengebiete Westafrikas. Unser Unglück aber waren 200 Aschantineger aus Accra. Sie hatten durch ihre Frechheit eine gewisse Überlegenheit über die anderen Neger.
Gleich heute gab es einen Mordslärm. Es war nur ein einziger Reiskessel an Bord. Den beschlagnahmten natürlich die dreisten Accraleute. Das wollten sich die anderen nicht gefallen lassen. Der Kapitän ließ die »Headmänner« zusammenrufen und befahl ihnen, wie sie es einrichten sollten. Das wirkte aber gar nicht, und der Streit wurde immer heftiger.
Die Neger hatten viel Gin mitgebracht, einen aus Europa eingeführten Schnaps. Der Kapitän bemühte sich vergeblich, den Negern das gefährliche Rauschgetränk wegzunehmen, das auf Schwarze bekanntlich ebenso schädlich wirkt wie auf Menschen mit anderer Hautfarbe. Die Häuptlinge waren schon stark betrunken und vergaßen deshalb die Achtung vor den Weißen. Besonders die Accraleute, diese Hosennigger, waren nicht zu beruhigen. Sie glaubten wohl, daß die wenigen Weißen gegen die Menge der Schwarzen wenig ausrichten könnten.
Wir beobachteten, daß die Neger das Süßwasser verschwendeten, das wir zum Trinken mit hatten, und mußten schnell einschreiten, weil Wassernot an Bord furchtbar gewesen wäre. Deshalb ließ der Erste Offizier ein Schloß vor den Wasserhahn legen und das Wasser nur in kleinen Mengen ausgeben.
Schon am zweiten Tage fehlte es an Nahrung. Die Schwarzen beklagten sich beim Kapitän, sie hätten Hunger. In der lächerlichen Sprache, in der die Küstenneger Westafrikas sich mit den Europäern verständigen, sagten sie: » Massa, I beg you, look my belly, I want chop, I get plenty hungry«. Zu deutsch: »Herr, ich bitte dich, sieh meinen Leib, ich will was zu essen haben, ich bin sehr hungrig«.
Es stellte sich heraus, daß die Neger in ihren Bündeln und Matten nicht genug Nahrungsmittel mitgebracht hatten. Das war eine neue, schwere Sorge.
Der Kapitän schickte die Ersten, die sich beklagten, weg. Aber es kamen immer mehr. Es half nichts, daß man die Neger ermahnte, sich gegenseitig auszuhelfen. Sie wurden gewalttätig, und bald fielen die ersten Schläge zwischen Leuten, die sich um das Essen stritten. Wir konnten da nicht einschreiten und mußten fürchten, daß die hungrigen Neger bald auch gegen uns Gewalt anwenden würden, um Nahrungsmittel zu bekommen. Der Zustand war schlimm. Wir besprachen uns untereinander. Die Sorge ließ uns in der Nacht nicht ruhig schlafen.
Am Nachmittag des dritten Tages war ich gerade in der Maschine, als mein schwarzer Diener meldete, daß die Neger in die Messe eingebrochen seien und Nahrungsmittel herausgeholt hätten. Das wollten wir nicht hingehen lassen und suchten die Täter. Dabei aber waren die Eingeborenen so frech, daß wir die Meuterei kommen sahen.
Als wir den Abend in der Messe saßen, wurde die Tür aufgerissen. Ein betrunkener Häuptling kam herein und machte dem Kapitän Vorwürfe, auf anderen Dampfern dauere die Fahrt weniger lange, er wolle wissen, wo denn die Reise hinginge. Vor der Messe sammelte sich ein ganzer Haufe Betrunkener. Wir verließen die Messe, schlossen ab und gingen auf die Kommandobrücke, in den Raum des Kapitäns. Wir hatten aus der schwarzen Besatzung des Schiffes Posten aufgestellt, konnten aber nicht hindern, daß die beiseitegedrängt wurden, und mußten schon dulden, daß das Bootsdeck von den Negern eingenommen wurde. Das also hatten sich die Neger durch ihre Überzahl erzwungen, und wir konnten auf weitere Gewalttaten gefaßt sein.
Der Kapitän hoffte, daß der Schnaps der Neger jetzt ausgetrunken sei. Leider aber hatten die Neger gerade davon noch Vorrat genug und tranken in der Nacht weiter. Es gab schon gegen Morgen großen Lärm. Die Schwarzen kamen untereinander in Streit. Weiberstimmen klangen dazwischen, mehrere Neger wurden getötet und andere im Streit lebendig über Bord geworfen.
Der Erste Offizier ging auf das Vordeck und wollte Ruhe stiften, da wurde er von einem betrunkenen Neger von hinten mit einem Buschmesser verwundet und fiel besinnungslos an Deck.
Ich kam gerade aus meiner Kammer, sah das, griff nach meinem Revolver und schoß in die Luft. Die Schwarzen stutzten und wichen zurück. Diesen Augenblick benutzte ich und griff schnell zu, um den Verwundeten auf die Brücke zu tragen; der Zweite Maschinist, Brun, half dabei. Ich bedrohte die nachdrängenden Schwarzen mit der Waffe.
Als die Neger dennoch schreiend und schimpfend vordrangen, schoß ich in die Menge, und neben mir fielen noch andere Schüsse. Mir wurde ganz rot vor den Augen, als ich auf die Menschen abdrückte. Das Schreien der Getroffenen mischte sich in das Wutgeheul der betrunkenen Neger. Mir fiel ein, daß mein Platz notwendig an der Maschine sein müsse, wenn der Verkehr über Deck durch die meuternden Neger gesperrt werden würde, was bevorzustehen schien. Ich nahm deshalb meinen Revolver schußbereit und sprang mit Wucht in die Menge hinein, um mir einen Weg zu bahnen. Die Nahestehenden fielen auf andere, und ich war in wenigen Sekunden am Niedergang zur Maschine. Hastig schloß ich die Tür hinter mir, zog die Schlüssel heraus, sprang an die andere Tür, durch die zum Glück auch gerade Brun hereinkam, und schloß auch diesen Zugang.
Zum Verständnis der Vorgänge an Bord der »Marina«. Der Dampfer nach einer Handzeichnung, die Kirsch aus dem Gedächtnis anfertigte.
Der Erste Maschinist war unten und bemühte sich gerade um ein Maschinenlager, das warm gelaufen war.
Wir fragten nach der Kommandobrücke hinauf, wie es dem Ersten Offizier gehe, und erfuhren, daß er wieder bei Besinnung sei.
Die Schwarzen, die uns jetzt in wilder Wut nachstellten, klopften und hämmerten gegen die Tür des Maschinenraumes.
Von oben kam durch das Sprachrohr die Anfrage: »Könnt ihr's unten aushalten?« Unsere Antwort war: »Jawohl, wir werden's schon machen.«