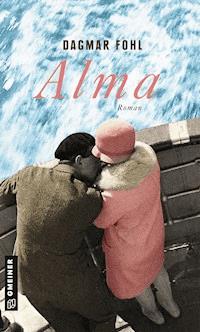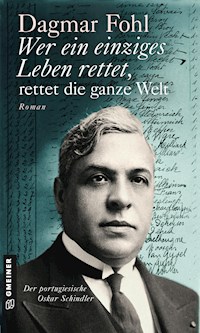Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Elfriede Lohse-Wächtler verlässt mit 16 Jahren ihr Elternhaus und wird freischaffende Künstlerin. Als sie sich in den Maler und Sänger Kurt Lohse verliebt, gerät sie in eine Lebenssituation, die sie in eine psychische Krise treibt. Persönliches Unglück, bittere Armut, Anstaltsaufenthalte und der menschenverachtende Nationalsozialismus bestimmen das Schicksal der hochbegabten Künstlerin. Ein ergreifender Roman, der die Innensicht und Situation der Malerin eindrücklich ans Licht bringt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dagmar Fohl
Frieda
Roman
Zum Buch
Die deutsche Camille Claudel Ein selbstbewusstes Mädchen wählt den Lebensweg einer Künstlerin. Mit 16 Jahren verlässt Elfriede trotz Geldnot, Krieg und Hunger das autoritäre Elternhaus, um ihre Kunst zu verwirklichen und frei zu leben. Nach dem Krieg beginnen wilde Jahre mit ihren Künstlerfreunden, darunter Otto Dix und Oskar Kokoschka. Kurt Lohse, Maler und Sänger, wird Elfriedes große Liebe. Die Künstlerin gibt ihr Atelier auf, zieht zu ihm und heiratet. Doch nach anfänglicher Verliebtheit zeichnen sich in der Ehe unüberwindliche Risse ab und führen die Künstlerin auf einen tragischen Weg in Einsamkeit, bittere Armut, Rotlicht-Milieu und Nervenzusammenbruch. Die Bilder, die sie in der Hamburger Psychiatrie von Patienten malt, bringen ihr nach ihrer Entlassung den künstlerischen Durchbruch. Aber das Schicksal der Elfriede Lohse-Wächtler geht seinen Weg, ohne dass die Malerin, die für ihre Freiheit kämpft, es aufhalten kann. Ein ergreifender Roman, der die Innensicht der Künstlerin eindrücklich nachfühlbar macht.
Dagmar Fohl absolvierte ein Studium der Geschichte und Romanistik in Hamburg und arbeitete als Historikerin und Kulturmanagerin. Heute lebt sie als freie Autorin in Hamburg und schreibt Romane über Menschen in Grenzsituationen. Psychologisch fundiert zeichnet sie Seelenzustände ihrer Protagonisten mit ihren Lebens- und Gewissenskonflikten, und beleuchtet gleichzeitig die gesellschaftlichen Verhältnisse und Probleme der jeweiligen Epoche, in der ihre Protagonisten agieren.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Alma (2017)
Schneemusik (2017)
Der Schöne im Mohn (2016)
Amrum sehen und sterben (2016)
Palast der Schatten (2013)
Der Duft von Bittermandel (2011)
Die Inseln der Witwen (2010)
Das Mädchen und sein Henker (2009)
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Nachlass Elfriede Lohse-Wächtler, Hamburg
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6064-7
Haftungsausschluss
Der Roman beruht auf Tatsachen. Die Personen der Handlung haben gelebt und gewirkt. Der Text basiert auf Quellen, Briefen und Sekundärtexten von und über Elfriede Lohse-Wächtler. Die kursiv gedruckten Passagen und Brieffragmente sind Originalzitate.
Die Rechtschreibung der Quellentexte wurde der modernen Rechtschreibung angepasst.
1916–1929
Es lebt die Erde!
Wir kommen und geh’n;
Von ihr,–
Über sie,–
Zu ihr,–
Von Licht und Geist
Durchdrungen!
Umgeben!
Wollen wir leben
Das Leben
Elfriede Lohse-Wächtler
Ich packe alles, was mir wichtig ist, in den grauen Pappkoffer, ich presse mit dem Knie den Deckel zu, klopfe mit der Faust auf das widerspenstige Schloss, bis es endlich einschnappt. Ein letztes Mal sehe ich mich in meinem Zimmer um, ergreife den Koffer, trete aus der Tür heraus, durchquere das Wohnzimmer mit den Blümchentapeten und Spitzendeckchen samt dem ganzen Nippes, den ich noch nie habe leiden können, gelange in den Flur, lege ohne zu zögern den Abschiedsbrief an die Eltern auf die kleine Kommode. Es gibt nichts, was mich am Fortgehen hindern kann, auch nicht der Krieg, der Krieg schreckt mich weniger als das ewige Geschrei und die Attacken des Vaters. Noch einmal fühle ich den ohnmächtigen Hass in mir aufsteigen, wie ein Pfeil schießt er durch mich hindurch, bis es in meinem Kopf sirrt. Wenn der Vater vor mir gestanden hätte, um mich aufzuhalten, hätte ich zurückgeschlagen, und die Mutter wäre hinzugekommen in dem vergeblichen Versuch, den Streit zu schlichten und Vater und Tochter auseinanderzubringen, und der kleine Hubert hätte weinend daneben gestanden, ohne zu begreifen, was sich vor seinen Augen abspielt.
Ich blicke in den Flurspiegel, betrachte mein blaues Auge, das gerade beginnt, sich moosgrün und braungelb zu verfärben; ich schenke ihm keine weitere Beachtung mehr, nehme meinen schwarzen Mantel vom Haken, setze den kleinen Hut auf, öffne die Wohnungstür, trage den Koffer über die Schwelle und lasse die Tür ins Schloss knallen. Ich stehe jetzt im Treppenhaus, und wenn der Koffer nicht so schwer gewesen wäre mit all den Farben, Pinseln und Papieren, wäre ich die Stufen hinuntergerannt,
meiner Freiheit entgegen,
fort
von der Voglerstraße,
fort
aus der Welt der gestärkten Weißwäsche, der sterilen Sauberkeit und Ordnung,
fort
von dem Vater, der mich schlägt und erstickt,
fort
von dem Spießer, der nur seine Buchhaltung und die Sicherheit im Kopf hat, dessen Leben tot ist, der jeden Tag früh morgens zur Arbeit rennt und abends zurückkehrt und mit stoischer Beharrlichkeit sein sinnentleertes Leben führt,
fort
von dem Despoten, der seinen Charakter mitten im Gesicht trägt.
Niemals werde ich dieses Gesicht malen, diese Mienenlandschaft mit ihrem wutgestauten Blick unter den buschigen Augenbrauen, dieses Schlachtfeld mit dem vom Bart umschlossenen störrischen Mund, der von einem Moment zum anderen seinen giftigen Zorn herausschreit, Befehle erteilt und den unbeherrschbaren Vater-Groll über die Familie schüttet,
fort
von dem Zigarrenmachersohn, der es zum Buchhalter gebracht hat und nichts mehr wissen will von seiner proletarischen Herkunft, der sich die bürgerlichen Tugenden auf die Fahnen schreibt und auf das von ihm bestimmte Wohl und Ansehen seiner Familie bedacht ist, der seine Frau zu seinem Dienstmädchen macht und seine Kinder auf den in seinen Augen rechten Weg stößt, der mit seiner Strenge sein eigenes Leben und das seiner Familie in eine Zwangsjacke steckt, nur, um in der Kaste des Bürgertums zu bestehen, weil für ihn der soziale Abstieg das Schlimmste ist,
fort, nur fort von ihm!
Ich lasse mich nicht von seiner Autorität einschüchtern, ich setze mich zurWehr! Ich werde niemals Kostümschneiderin werden, auch wenn ich gern Kleider nähe.
Zwei Semester sind genug! Ich habe die Modeausbildung aufgegeben und bin in die Grafikklasse der Gewerbeschule gewechselt. Männer und Frauen können hier gemeinsam Kunst studieren. Ich habe die Aufnahmeprüfung auf Anhieb bestanden. Ich habe den Vater nicht um Erlaubnis gefragt. Deshalb schlug er mir mit seiner Faust auf mein sich nun in allen Schattierungen verfärbendes Auge. Es ist nicht der erste Hieb, den er mir ins Gesicht geboxt hat, aber es wird der letzte sein, das schwöre ich mir.
Ich bin 16 Jahre alt, das Leben liegt vor mir, ein Leben, wie ich es mir erträume, und nicht, wie der Vater es von mir erwartet und in mich hineinzuprügeln versucht.
*
Ich schleppe den Koffer zur Haltestelle und fahre mit der Straßenbahn in die Pillnitzer Straße zu Londa. Sie lebt seit Kriegsbeginn in Dresden und arbeitet als Lazarettkrankenschwester, was ich nur schwer verstehen kann. Warum lässt auch sie sich in die Kriegsmaschinerie einspannen? Sie ist in vielen Dingen anders als ich, sie trägt biedere Rüschenblusen aus Taft, Röcke mit Spitzenbesatz und spielt Laute; dennoch sind wir Freundinnen. Es ist unsere Eigenwilligkeit, die uns verbindet. Auch Londa kämpft für ihre Unabhängigkeit.
Wir teilen uns von nun ab ihr Zimmer, es ist eine kleine dunkle Kammer, in der Londa den meisten Platz für ihre Kleider belegt. Eigentlich hätte ich lieber allein gewohnt mit mehr Raum zum Arbeiten, ich weiß jedoch nicht, wo ich sonst unterkommen könnte.
Londa hat für mich ein kleines Regal und einen Nachtschrank frei geräumt. In dem Schränkchen verstaue ich die wenige Wäsche, die ich mitgenommen habe. Meine Malsachen lege ich griffbereit auf das Regal.
Ich werfe mich auf das Bett, verschränke die Arme hinter dem Kopf und sehe die Freiheit in einem Strudel bunter Farben vor mir aufleuchten. Ich lasse mir von niemandem mehr vorschreiben, wie ich zu leben oder was zu malen habe!
*
Ich biete dem Friseur eine Porträtzeichnung gegen einen Haarschnitt. Er willigt ein, weil er ein Geschenk für seine Frau zur Silberhochzeit sucht. Ich sage ihm, was ich wünsche. Er verzieht das Gesicht; es wäre eine Sünde, mein schönes Haar abzuschneiden. Ich lasse mich nicht davon abbringen.
Ich beobachte seine zögerlichen Schnitte im Spiegel und fordere ihn auf, kräftig zuzuschneiden bis an die Ohren.
Endlich klappert die Schere.
*
Ich verändere meine Kleidung. Ich trage Russenblusen mit hohen Stehkragen und lange Röcke, die ich selbst entwerfe. Um die Taille binde ich einen breiten Ledergürtel. Bevor ich aus dem Haus gehe, setze ich meinen großen verbeulten Künstlerhut auf und stecke mir eine Pfeife in den Mund.
Auf der Straße hagelt es böse Blicke und Schimpftiraden. Alle Häme prallt von mir ab. Sollen doch die Spießer an ihrer Langweiligkeit ersticken!
Auf dem Weg zu den Eltern beglotzen mich die Blasewitzer Nachbarn. Die Drexler ruft mir zu, ob ich nun vollkommen verrückt geworden sei, zetert, dass meine Eltern eine solche Tochter nicht verdient hätten und ich mich schämen solle, so herumzulaufen. Fleischer Zitzlitz watschelt aus der Ladentür, kreuzt die Arme über seinem talgigen Bauch und schnauft. Seine Frau blökt im Hintergrund in ihrer Schafsstimme, dass ich eine Schande wäre für das ganze Viertel.
Mit der rechten Hand nehme ich die Pfeife aus dem Mund, mit der Linken ziehe ich den Hut und verbeuge mich mit einem Grinsen.
*
Hubert öffnet die Tür. Ihm gefällt besonders meine Pfeife. Die Mutter verbirgt ihr Gesicht in den Händen.
»Warum kannst du nicht Ruhe geben, es ist alles schon schlimm genug.«
Ihre ängstliche Stimme macht mich wütend. Eine Mutter, die in schneeweißer spitzenbesetzter Kittelschürze und mit Haarknoten herumläuft, die tagein, tagaus den Vater bedient in ständiger Furcht, ihn zu verärgern, ist mir kein Vorbild.
Wir gehen in die Küche. Die Mutter stellt mir eine Buchtel hin. Ich verschlinge sie, ich habe lange nicht mehr etwas so Gutes gegessen. Die Mutter setzt sich neben mich und beäugt mich. Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Ich rate ihr, sich auch meine Frisur schneiden zu lassen. Sie boxt mich sanft auf den Oberarm und gluckst. Ich beginne, ihr gefangenes Haar zu lösen. Als unser Lachen durch die Küche schallt, hören wir Schlüsselgeklapper. Die Mutter schrickt auf, ihr Gesicht verhärtet sich. Sie steckt die Haarnadel fest, huscht in den Flur, stellt dem Vater die Pantoffeln bereit. Ich höre ihr Geraune. Ohne die Worte zu verstehen, weiß ich, dass sie ihn vor meinem Anblick warnt, um den ersten Aufprall seiner Wut abzumildern.
Der Vater öffnet die Küchentür – er bleibt am Türrahmen stehen. Seine Augen sind auf mich gerichtet, während sein Gesicht zornrot anläuft und sich in ein Dunkelkarminrot verfärbt. Ich sitze am Tisch und halte seinem Dolchblick stand, ohne Angst, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich will ihm zeigen, wer ich wirklich bin!
Kein Wort schreit aus seinem Mund.
Es hat ihm die Sprache verschlagen.
Er bleibt wortlos stehen, er kommt nicht auf mich zu.
Er schlägt mich nicht!
Dreht sich um, verlässt die Küche.
Knallt hilflos mit der Tür.
Spürt, dass er verloren hat!
Und ich, ich lache!
Ich lache mich kaputt!
*
Im Zeichensaal der Kunstgewerbeschule. Der helle Raum ist sehr gut ausgestattet. Wir haben verstellbare Pulte mit seitlich ausziehbaren Ablagen, und Pendeldeckenleuchten, die ich in die gewünschte Höhe ziehen kann. Mein Platz ist das hintere Pult rechts am Fenster. Ich habe von dort aus einen Blick auf alle Studenten. Hier fühle ich mich richtig, hier werde ich das lernen, was meine Kunst voranbringt.
Ich blicke auf die drei großen Vogelmodelle, die auf den Schränken an der rechten Saalwand stehen und ihre Gefieder spreizen. Ich sehe sie auffliegen in eine wunderbare Zukunft.
Ein Bild zu malen ist das größte Abenteuer. Wenn es zu leben beginnt und sich in die Lüfte erhebt, wenn es sich von meiner Absicht löst und das zu Tage fördert, was ich zuvor nicht geahnt habe, vergesse ich völlig, dass Krieg herrscht und jeden Tag unzählige Menschen ihr Leben verlieren.
*
Ich kann von meinen Bildern weder die Schule bezahlen noch leben, ich muss Batiken oder Gruß- und Geschenkkarten anfertigen und Möglichkeiten schaffen, sie zu verkaufen, sonst würde ich verhungern. Der Vater gibt mir keinen Pfennig, solange ich nicht in die Modeklasse zurückkehre. Er hat die Tante zu mir geschickt, um mich umzustimmen und mein Grafikstudium aufzugeben.
»Wenn du keine Kostüme schneidern willst«, sagt sie, »warum gehst du dann nicht zur Post, da hast du ein sicheres Einkommen.«
Ich schicke sie fort und bleibe bei dem, was mir wichtig ist.
Der Vater lässt mir ausrichten, was nun folgen würde in meinem Leben, hätte ich mir selbst eingebrockt, also müsste ich auch allein damit fertig werden.
Ohne die Suppentöpfe, mit denen die Mutter Hubert heimlich zu mir schickt, hätte ich es noch schwerer.
*
Mir fehlt Platz zum Arbeiten. Ich fahre in die Voglerstraße, um mithilfe der Mutter zu batiken und zu nähen. Seit der Vater mich wieder geschlagen hat, komme ich nur noch, wenn er bei der Arbeit oder auf der Jagd ist und Tiere abknallt.
Alle Türen in der Wohnung stehen offen, ich muss ständig die Zimmer wechseln. In der Küche steht das Bügelbrett, ich lege es mit Stoffen aus, während die Färbetöpfe auf der Herdplatte dampfen und mehrere Bügeleisen im Herdfeuer glühen. Im Wohnzimmer trage ich Kreidestriche auf die Stoffe auf und mache den Zuschnitt. Da der Ausziehtisch immer zu klein ist, arbeite ich auf dem Fußboden weiter.
Ich setze mich an die alte Nähmaschine. Wenn die Fußbedienung klemmt und sich nicht reparieren lässt, rufe ich Hubert, damit er das schwarze Eisenrad mit der Hand dreht. Er muss auch die heruntergefallenen Stecknadeln wieder aufsammeln und ins Nähkissen stecken.
Die Mutter hilft beim Ausbügeln und Abstecken, und sie verwöhnt mich immer mit einem guten Essen.
Wir sitzen am Küchentisch. Ich sehe in ihr verbittertes, unglückliches Gesicht: die Augen ernst und freudlos, der Mund verkantet, die Gesichtszüge streng.
Sie will Frieden in der Familie, sie hadert mit meinem und mit ihrem Leben. Wenn der Vater im Haus ist, läuft sie nur auf Zehenspitzen herum und trägt einen Maulkorb um den Mund. Sie schützt sich gegen ihn wie gegen Staub und Mottenfraß. Sie hat einen Schonbezug über sich gestülpt wie über die Möbel.
Manchmal genügt der bloße Anblick der Mutter, mich wütend zu machen. Ich möchte ihre Angst aus ihr herausschütteln oder sie an den Haaren packen und sie anschreien, warum sie sich nicht endlich von dem Vater befreit. Doch ich kann ihr nicht helfen. Ich kann ihr Leben nicht ändern, ich kann nur meines führen, wie ich es für richtig halte.
Ich laufe ins Schlafzimmer zur Anprobe und stelle mich zum Abstecken vor den großen Spiegel. Neben den Betten habe ich den Leiterstuhl als Staffelei aufgestellt und arbeite zwischendurch an einem Ölbild. Ohne zu malen geht es nicht! Ohne zu malen würde ich veröden. Den Pinsel in der Rechten, eine Zigarette in der Linken stehe ich vor der Leinwand, ich rauche immer beim Malen, inhaliere tief und stoße den Rauch mit heftigem Druck wieder aus, bevor ich zum nächsten Strich ansetze.
Jedes Mal, ehe der Vater von der Arbeit zurückkehrt, schleiche ich mich fort und beseitige alle Spuren meines Besuches. Nur der Geruch der Farben bleibt in der Wohnung haften und verrät dem Vater meine Anwesenheit. Es ist mir egal.
*
Der Krieg nimmt kein Ende. Auf den Straßen hinken immer mehr Invaliden in zerlumpten Uniformen. Viele Studenten der Gewerbeschule und der Kunstakademie sind eingezogen. Ich bete, dass alle Freunde gesund zurückkommen.
Der Unterricht in der Zeichenklasse langweilt mich. Seit Monaten zeichnen wir nur tote Formen. Ich muss Dinge lernen, die dem, was ich auf die Leinwand bringen will, widersprechen. Professor Erler mahnt mich zur Geduld und pocht auf eine Ausbildung mit Grundfertigkeiten.
*
Wieder einmal ziehe ich durch die Stadt auf der Suche nach Nahrungsmitteln. Ich beobachte, wie eine gut gekleidete Frau etwas vom Boden aufhebt, es zum Mund führt und zu kauen beginnt.
Es gibt nichts mehr zu essen in Dresden. Selbst die Reserven sind aufgebraucht. Der Hunger nagt an uns wie eine gefräßige Ratte und frisst uns von innen auf. Ich klappere alle Läden ab. Alle Menschen laufen sich die Füße wund nach einem Löffel Fett, einer Handvoll Mehl, aber es gibt nichts, keine Äpfel, keine Früchte, keine Eier, überhaupt keine Lebensmittel, nicht einmal genügend Bäckerbrot. Die Regale sind leer.
Ich nehme meinen großen Rucksack mit den Lederriemen, fahre in die Umgebung und stehle auf den Feldern alles, was ich auftreiben kann. Ich klaue für die ganze Familie. Die Feldwächter schrecken mich nicht ab. Weder die Eltern noch Hubert sollen hungern. Außerdem muss ich die Mutter aussöhnen. Als sie bei ihrer Freundin war, habe ich ihre Speisekammer aufgebrochen und mit Hubert zusammen Maggisuppe und Brot gegessen. Ich habe ihr aber einen Rest Brühe im Topf übrig gelassen und eine Scheibe Brot dazugelegt.
*
Franz Pfemfert hat Felixmüllers Holzschnitt von meinem Kopf in ›Die Aktion‹ veröffentlicht!
*
An Kunst ist nicht zu denken. Ich muss wieder Essen besorgen. Die Verwandten in Husinec erwarten mich. Die Fahrt ist mit Hindernissen verbunden. Mehrmals stoppt der Zug und steht lange auf den Gleisen still. Die Fahrgäste wissen nicht, warum.
Endlich bin ich angekommen. Vom Bahnhof aus gehe ich den Rest des Weges zu Fuß. Ich spaziere die Hauptstraße entlang, an der Kirche und am Geburtshaus von Jan Hus vorbei.
Die Stimmung in der Familie ist niedergedrückt. Großmutter Anna starb letzte Weihnachten. Auch ich vermisse die Großmutter. Ich sehe ihr Gesicht vor mir. Zwischen den Brauen kerbten sich zwei senkrechte Falten in ihre Stirn, während ihre Augen immer etwas Sanftmütiges ausstrahlten, selbst wenn sie sich ärgerte. Sie war energisch und warmherzig zugleich.
Ihre samtweiche Haut duftete nach Rosenholz. Ich umarmte die Großmutter bei jeder Gelegenheit, schmiegte meine Wange an die ihre, um sie zu fühlen und an ihrer Haut zu schnuppern.
Ich denke an die Monate, die ich nach der Schule in Husinec verbrachte. Die Großmutter und die Tante gaben mir Luft zum Atmen. Es gab keine strengen Regeln, ich durfte in den Tag hineinleben und ihn selbst gestalten. Ich habe viele Wanderungen gemacht und gezeichnet, Tschechisch gelernt und im Laden geholfen. In den Regalen herrschte ein wahlloses Durcheinander, das ich in eine sinnvolle Ordnung brachte. Die Großmutter schlug die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie nichts mehr wiederfand.
Drei Tage lebe ich wie im Schlaraffenland. Ich werde von morgens bis abends mit Essen versorgt. Ich sähe aus wie ein Streichholz, sagt die Tante und plündert für mich und die Familie Wächtler den Laden und die Speisekammer. Sie gibt mir Mehl, Speck, geräucherte Würste, einen Schmalztiegel, Eingewecktes, Käse, sogar eine kleine Tüte echten Kaffee, auch frisches Gemüse, nicht nur Kohlrüben und Kartoffeln, und für Hubert Schokolade und eine Zuckerstange.
*
Mit einem großen Koffer und einem Rucksack voller Nahrungsmittel komme ich nach Dresden zurück. Ich kann die Kostbarkeiten kaum tragen.
Die Mutter hat Tränen in den Augen, als ich meine Präsente auf ihrem Küchentisch ausbreite. Huberts Wangen glühen. Sein Hunger verdoppelt sich beim Anblick der Speisen. Wir geben ihm ein Stück Brot und die Zuckerstange. Die Mutter verspricht, zum Abendbrot ein Stück Wurst auf den Tisch zu bringen.
*
Endlich beginnen wir mit Porträt- und Aktzeichnungen! Mein Stift fliegt über das Papier. Endlich fangen die Bilder an zu leben!
Ich besuche bei jeder Gelegenheit die Galerie, schaue mir die neueren Meister an und studiere Körper und Gesichter. Wenn ich zu nah an die Gemälde herangehe, steht sofort einer der grün uniformierten Aufseherfrösche neben mir und beäugt mich misstrauisch.
Wir arbeiten auch oft im Zoo. Ich mache eine Bewegungsskizze nach der anderen.
Ich werde mir immer sicherer in dem, was ich schaffen will. Doch ich sehe diese Ideen weder in der Zeichenklasse noch auf den Gemälden.
*
Der Hunger treibt mich aus der Stadt. Ich habe auf einem Gutshof in Neschwitz Arbeit gefunden, wo auch russische Kriegsgefangene schuften. Wir helfen bei der Ernte und versorgen das Vieh. Die Männer buchten tiefe Gräben auf den Weiden aus und reparieren die Zäune.
Die Mutter sorgt sich um mich. Ich werde nicht von den Russen vergewaltigt. Die freundlichen Männer verstehen mein Tschechisch, und ich ihr Russisch. Sie erzählen mir von Kriegserlebnissen und von ihren Familien, die sie sehr vermissen. Immer wieder zeigen sie mir Fotos ihrer Frauen und Kinder.
Ich zeichne dem einen oder anderen ein Porträt. Die Männer freuen sich und schicken die Bilder nach Hause.
*
Ich kann die hungernden Eltern und Hubert für ein paar Wochen aufs Land holen, damit sie zu essen haben. Der Vater hat seinen Groll gegen mich besänftigt, weil seine Familie die Kriegsjahre ohne meine Hilfe nicht überstehen würde, aber das bedeutet nicht, dass er meine Lebensweise akzeptiert.
Auch ich bin ihm gegenüber milder gestimmt. Er ist kein Nationalist und Kriegshetzer. Er schreibt weiterhin Briefe an die französischen Freunde, die uns vor dem Krieg einmal besuchten.
*
Wieder in Dresden. Krieg und Hunger, Hunger und Krieg. Ich möchte endlich wieder in Ruhe malen können!
Die Zeitungen berichten, die deutschen Truppen würden von den Alliierten immer weiter zurückgedrängt.
Der Krieg muss ein Ende haben!
*
Ich lebe im Chaos von Revolution, Kriegsende, Republik. Es grenzt an ein Wunder. Ich kann ein eigenes Atelier beziehen! Conrad Felixmüller, Londas Freund, hat es mir überlassen. Sie sind ein Paar seit seiner Entlassung aus der Arnsdorfer Psychiatrie, in die er wegen seiner Kriegsdienstverweigerung eingesperrt wurde. Londa und Conrad wollen heiraten und nach Klotzsche ziehen, und ich übernehme das Atelier! Es befindet sich in der Rietschelstraße in der Pirnaer Vorstadt, sehr zentral und nicht weit gelegen vom Eliasfriedhof, der Synagoge, dem Landgericht und dem Stadthaus.
Es ist ein helles, vierfenstriges Eckraumatelier!
*
Den ganzen Tag laufe ich im Zickzack und räume die Möbel hin und her, die Felixmüller mir überlassen hat. Den Hocker stelle ich vor die Staffelei ans Fenster, daneben die rote Kiste mit den Malsachen, Tisch und Stühle kommen in die Mitte des Raumes, die Kommode schiebe ich neben das Bett in die fensterlose Zimmerecke. Das Bett besteht nur aus einer auf vier Holzklötzen liegenden Matratze, es wird nicht zu sehen sein, ich werde es tagsüber mit einem Batiktuch abdecken und als Chaiselongue nutzen.
Ich sehe meine Mappe durch und entscheide mich, die Wände mit Zeichnungen und Holzschnitten von Felixmüller, Dix und ein paar anderen Künstlerfreunden zu behängen, natürlich auch mit Bildern von mir selbst. Ich lasse mir Zeit, sie richtig zu platzieren, um jedes gut zur Geltung zu bringen. Den Holzschnitt, den Felixmüller von meinem Kopf gemacht hat, habe ich an die Tür neben meine ›Nachtwandlerin‹ gehängt. Felixmüllers Losung, die er in großen Lettern an die Wand über der Kommode gepinselt hat, bleibt stehen.
KUNST IST ABSOLUTION
*
Wenn ich die Haustür öffne und die ausgetretenen delligen Stufen hinaufsteige, wenn ich den Schlüssel ins Schloss stecke und ihn kräftig hin- und herruckeln muss, bevor die Tür sich öffnen lässt, habe ich das Gefühl, meinen Platz gefunden zu haben.
Von meinem kleinen Balkon aus schaue ich hinunter auf meine wunderbar verrufene Umgebung. Ich wohne jetzt dort, wo die armen und »verruchten« Leute leben, wo sich Arbeiterkneipen und Bordelle aneinanderreihen, wo Prostituierte in den Hauseingängen zum Straßenbild gehören wie Betrunkene, Bettler und Hausierer, wo auch Arbeiterfrauen ihren Körper verkaufen, weil der Lohn zum Leben nicht ausreicht. Es sind Menschen, die mich zu Bildern inspirieren, Menschen, die ich nicht geschönt malen will, sondern so, wie ich sie sehe und empfinde.
Ich will die Wahrheit malen!
Es gibt zu viele blinde Maler. Sie krakeln mit Stiften, sie panschen mit Farben und sehen doch nichts. Ich will das wahre Gesicht unter den Masken der Menschen enthüllen. Ich male, was mir das Leben zeigt.
*
Die zeichnerische Dressur hilft mir nicht mehr weiter. Ich verlasse die Grafikklasse. Ich kann von Professor Erler nichts mehr lernen, ich muss zu meinen eigenen Vorstellungen von Kunst gelangen. Ich will als freie Künstlerin leben. Alles, was ich tue, alles, was ich denke, hat dieses Ziel.
*
Dix, Griebel, Dietrich und viele andere Künstler gehen bei mir ein und aus. Dix wohnt um die Ecke in der Ziegelstraße. Ich gehöre jetzt der Dresdner Künstlerszene, den Sezessionisten und Dadaisten, an. Ich bin eine moderne Künstlerin! Wir malen Bilder und schreiben Gedichte, die die meisten Kunst- und Literaturliebhaber als unsinnige Schmiererei und Schwafelei abkanzeln.