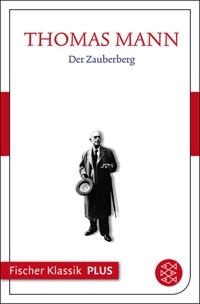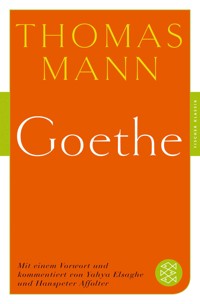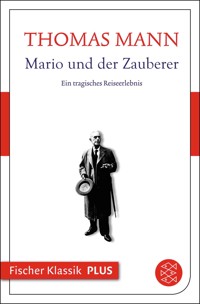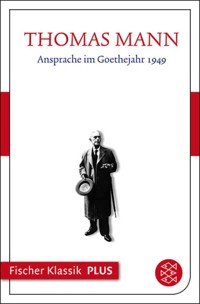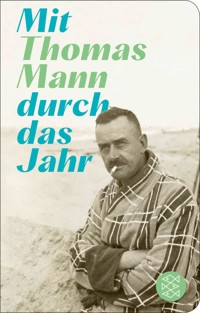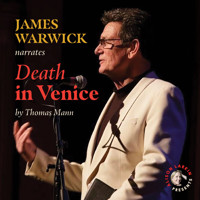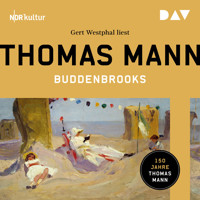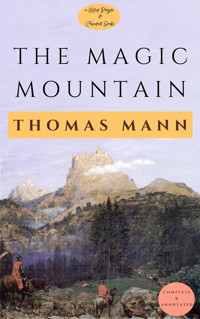2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Bereits in den Jahren 1905/1906 hatte Thomas Mann mit der Planung für einen Roman über Friedrich II. begonnen, der schlussendlich nicht zustande kam. Unter anderem auf Basis der für dieses Vorhaben bereits gesammelten Notizen und Exzerpte entstand in der zweiten Jahreshälfte 1914 dieser ›Abriß‹. Das für den Roman angelegte Gegensatzpaar aus der soldatischen, männlichen Tatkraft und der literarischen, weiblich konnotierten »zersetzenden« Skepsis wird hier in seinen Facetten entfaltet, allerdings in einer Figur (für den Roman war Voltaire als inhaltlicher Gegenpol vorgesehen, der hier lediglich noch eine Randfigur darstellt). Vorangegangen waren der Abhandlung die nationalistisch und kriegsbejahend anmutenden ›Gedanken im Kriege‹, auf die klare inhaltliche Bezüge verweisen – der Ton ist hier allerdings zurückgenommen, weshalb auch die Reaktionen weniger polemisch ausfielen. Veröffentlicht wurde der Essay zuerst in Der neue Merkur (Januar/Februar 1915), Mann selbst nahm ihn später auch in einen Sammelband auf (›Altes und Neues‹, 1953).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 99
Ähnliche
Thomas Mann
Friedrich und die große Koalition.
Ein Abriß für den Tag und die Stunde
Essay/s
Fischer e-books
In der Textfassung derGroßen kommentierten Frankfurter Ausgabe(GKFA)Mit Daten zu Leben und Werk
{55}Friedrich und die große Koalition
EIN ABRISS FÜR DEN TAG UND DIE STUNDE
Ja, womit soll man anfangen! Der Geschichtschreiber – und nun gar der Gelegenheitshistoriker – ist immer jener Versuchung ausgesetzt, der Wagner auf das großartigste erlag, als er, eigentlich nur gesonnen, den Untergang seines Helden aufzuführen, von einer begeisterungsvollen Pedanterie sich immer weiter im Mythos rückwärts locken ließ, ein immer größeres Stück der »Vorgeschichte« mit aufzunehmen sich genötigt fand, bis er endlich am Grundanfange und Anbeginn aller Dinge notgedrungen haltmachte: beim tiefsten Es des Vorspieles vom Vorspiel, womit er denn feierlichst und fast unhörbar zu erzählen anhob. Da aber Raum und Zeit den lebhaftesten Protest dagegen erheben, daß wir bei dieser Skizze der Ursprünge eines Krieges, dessen Wiederholung oder Fortsetzung wir heute erleben, mit dem tiefen Es beginnen, so wollen wir uns einen Stoß geben und mit dem großen Mißtrauen den Anfang machen, dem tief wurzelnden und, wenn wir billig sein wollen, ziemlich begründeten Mißtrauen der Welt gegen König Friedrich II. von Preußen.
Man erinnere sich nur: Der junge Mann, knabenhaft seinen Zügen nach, zierlich und etwas dicklich von Statur, »das niedlichste Menschenkind im Königreich«, wie ein Fremder urteilte, von lebhafter Gesichtsfarbe und kindlichen Backen, mit großen, kurzsichtig glanzblauen Blicken, sowie einer Nase, die genau in der Linie der Stirn verläuft und vorn eine naive Rötung aufweist, nach damaligen Bildern zu urteilen, – dieser niedliche junge Mann, dessen teils liederliche, teils schreckhafte und momentweise fürchterliche Kronprinzenvergangen{56}heit bekannt ist, libre-penseur dabei, keck philosophisch, Literat, Verfasser des überaus humanen »Antimacchiavell«, durchaus unmilitärisch, wie es bisher den Anschein hatte, zivil, lässig, selbst weibisch, ein Schuldenmacher, auf Kurzweil und Prunk von Herzen bedacht, – wird König, weil ehrloserweise keine Tracht Prügel und kein Am-Halse-Würgen von seiten seines beängstigenden Papas ihn seinerzeit hat bewegen können, sich eine Kugel in den Kopf zu schießen oder wenigstens zugunsten seines Bruders zu resignieren, und benimmt sich als König in einer Weise, daß man nicht weiß, was man denken soll. Der Tag seiner Thronbesteigung hieß fortan: »La journée des dupes« – fast alles kam anders, als man es sich gedacht hatte. Diejenigen, die vor der Rache des neuen Herrn gezittert hatten, wurden nicht gestraft, und die, welche ihre Stunde gekommen glaubten, sahen sich enttäuscht. Die Glücksritter und Poeten, die den Thron umschwärmten und sich mit hoffnungstrunkenen Vivats nicht genugtun konnten, wurden zusehends kleinlauter, und ein lustiger Bruder von Rheinsberg, der die Harmlosigkeit hatte, das Tönchen von damals zutraulich wieder anzuschlagen, bekam einen glanzblauen Blick und das schneidende Wort: »Monsieur, à présent je suis Roi!« Auf deutsch: »Die Possen haben ein Ende!« Das ist die Stelle bei Shakespeare, die schönste vielleicht in seinem ganzen Werk, wo jemand unter einem ebensolchen Blicke zu jemandem sagt: »Ich kenn’ dich, Alter, nicht.«
Einiges, was der junge Herr gleich in den ersten Tagen tut, hat ja literarischen Habitus, – ist also keck und etwas extravagant. Er schafft die Folter ab, – desto besser für die Diebe. Er erklärt, daß Gazetten, wenn sie ein bißchen amüsant sein sollen, nicht geniert werden dürfen, und hebt die Zensur auf (führt sie übrigens ein Jahr danach wieder ein). Er proklamiert religiöse Toleranz, – nun, das ist die berühmte Aufklärung. {57}Aber was wird aus dem galanten, üppigen, sorglosen Musenhof, den man sich erträumt hatte und an dem die Mode und der schöne Geist herrschen sollten? Gar nichts wird daraus. Der Herr ist vor allen Dingen auf einmal eisern sparsam. Nichts von Gehaltserhöhung für die Beamten. Nichts von Aufhebung der hohen Zölle, – wie sehr auch gewisse Leute sich auf dergleichen gespitzt haben. Die Domänenkammern bekommen ausdrückliche Weisung, daß das genaue Finanzsystem des hochseligen Königs strikte zu respektieren ist. Finanzminister Boden, ein verhaßter Geizkragen, bleibt. Von Vertrauensseligkeit, Lässigkeit, Sorglosigkeit – auch nicht eine Spur. Jedem wird auf die Finger gesehen wie nie zuvor. Damals war es, daß Baron von Pöllnitz, Oberzeremoniemeister, wörtlich den Seufzer tat: »Ich wollte hundert Pistolen geben, wenn ich den alten Herrn wieder haben könnte!«
Kein irgendwie grundstürzender Systemwechsel also, keine Zügellockerung in der Verwaltung, keine neuen Gesichter im Ministerium. Aber eines bleibt doch wohl sicher: Die verkörperte Zivilität ist zur Herrschaft gelangt, die Literatur im seidenen Schlafrock, – der Korporalstock hat abgewirtschaftet, mit dem Potsdamer Militarismus wird es gründlich zu Ende sein. Ja, freilich! Gerade hier gibt es die vollkommenste Überraschung. Der schlappe und ziemlich wollüstige junge Philosoph entpuppt sich zur allgemeinen Verblüffung als passionierter Soldat, – welcher nicht daran denkt, das militärische Fundament des Staates zu schwächen. Zu schwächen? Er vermehrt die Armee um fünfzehn Bataillone, fünf Schwadronen Husaren (die er nach österreichischem Muster einführt) und eine Schwadron Gardedukorps, womit sie nun also rund neunzigtausend Mann stark ist. Die Uniform, früher ein vermaledeiter Sterbekittel, zieht er überhaupt nicht mehr aus. Sein Konservatismus geht so weit, daß er jede Veränderung in den {58}Kommandostellen unterläßt. Die Heeresorganisation ist ein Denkstein der Regentenweisheit von Unsers höchstgeliebtesten Herrn Vaters Majestät, sie ist im wesentlichen nicht anzutasten. Ein paar Plumpheiten im Werbewesen werden allenfalls abgestellt, das Fuchteln der Kadetten, Mißhandlungen des gemeinen Mannes haben ehrenhalber zu unterbleiben, – das ist alles. Was sich aber ändern zu sollen scheint, das ist der Sinn der Einrichtung, der Geist, in dem man sich ihrer bedient, kurzum: ihre politische Bedeutung, – und dies eben ist das Bedenkliche.
Das Militär war ja so etwas wie ein Puschel des höchstseligen Herrn gewesen, eine rauhe und ziemlich kostspielige Liebhaberei, über die man an allen Höfen gewitzelt hatte und die bei den europäischen Geschäften nie irgendwie ins Gewicht gefallen war. Auf einmal ist es »die Macht des Staates« – dies ist der Ausdruck Friedrichs in einem der ersten Briefe, die er als König schreibt, – eine sonderbar sachliche Auffassung, die übrigens auch darin zum Ausdruck kommt, daß der Institution das Schrullenhafte und Kuriose, das ihr anhaftete, genommen wird. Das Riesenregiment, sehenswürdig aber etwas stupid, wird abgeschafft – es tut bei der Leichenparade für Friedrich Wilhelm zum letzten Male Dienst, und nur ein Bataillon »Grenadiergarde« wird der Pietät halber beibehalten. »Die Macht des Staates« … Preußens Vertreter an fremden Höfen führen plötzlich eine Sprache, daß man seinen Ohren nicht traut. Preußen tritt auf, Preußen wünscht durchaus, sich als die beträchtliche Realität betrachtet zu wissen, die es ist, – sein überraschender junger König nimmt eine Miene an, als empfinde er seine Stellung nicht sowohl als die eines deutschen Reichsstandes, denn als eine europäische, er gibt zu verstehen, daß er nicht gemeint ist, »immer nur zu spannen und niemals abzudrücken«, wie das spöttische Europa es so lange von Preußen gewöhnt gewesen ist …
{59}Aber was soll man aus alldem nun machen! Hat er denn bis dahin Komödie gespielt? »Der größte Fehler an ihm«, hat Graf Seckendorff einmal über den Kronprinzen nach Wien geschrieben, »ist seine Verstellung und Falschheit, daher mit großer Behutsamkeit sich ihm anzuvertrauen ist.« Ja, das scheint so. Und wenn Seckendorff fortfährt: »… Er sagte mir, er wäre ein Poet, könne in zwei Stunden hundert Verse machen. Er wäre auch Musiker, Moralist, Physiker und Mechaniker. Ein Feldherr und Staatsmann wird er niemals werden,« – so sieht es jetzt aus, als ob auch dies Verstellung und Falschheit von seiten des jungen Menschen gewesen sei. Denn was nun kommt, ist denn doch das Stärkste an Überraschung und zeigt überhaupt erst, wessen man sich von ihm zu versehen hat.
Nicht ein halbes Jahr ist seit Friedrichs Thronbesteigung vergangen, als Karl VI. stirbt, und kaum ist der Kaiser unter der Erde, so erhebt Friedrich zur größten Bestürzung seiner eigenen Minister, Generale, Verwandten und der ganzen Welt irgendwelche Ansprüche auf Schlesien, – Ansprüche, vollständig unbegründet dem Buchstaben nach und feierlichen Verträgen zufolge, begründet, wenn man denn will, in mancherlei Untreue und Schnödigkeit, die Brandenburg von Habsburg je und je hat erdulden müssen, und Ansprüche jedenfalls, die Friedrich, wenn Maria Theresia sich nicht fügt, was sie unmöglich tun kann, mit dem Schwerte geltend zu machen sich anschickt. »Alles ist vorbereitet,« schreibt er an Algarotti; »es handelt sich nur um die Ausführung der Entwürfe, die ich seit langer Zeit in meinem Kopfe bewegt habe.« Seit langer Zeit? Und alles längst vorbereitet? Ohne daß irgend jemand eine Ahnung davon gehabt hat? Ohne daß er von solchen Ansprüchen und Absichten sich bisher das Geringste hat anmerken lassen? Aber dann ist er ja ein hinterhältiger, versteckter und in aller Rheinsberger Geselligkeit einsamer junger Mensch gewesen! – An Voltaire übri{60}gens schreibt er: »Der Tod des Kaisers zerstörte all meine friedlichen Ideen.« Damit nämlich Voltaire in Frankreich die Ansicht nicht aufkommen läßt, als sei der Angriff von langer Hand her vorbereitet gewesen. Ein sowohl einsamer als namentlich auch schlauer junger Mensch.
Es bleibt dabei: Friedrich überzieht das Kaiserhaus mit Krieg, – der Markgraf von Brandenburg, der als Erzkämmerer den Vorfahren Maria Theresias das Waschbecken zu reichen gehabt hat. »C’est un fou, cet homme là est fol,« sagt Ludwig XV., der doch von großer Politik irgend etwas verstehen muß. »Eine Unbesonnenheit, ein überaus tollkühnes Beginnen,« sagt ganz Europa. Und der englische Minister in Wien findet schon jetzt, daß Friedrich in den politischen Bann getan zu werden verdiene.
Aber eine Unbesonnenheit oder nicht, – Österreich ist schlecht in Form, die Sache geht gut aus für Preußen. Es kommt Mollwitz, wo Friedrich geschlagen wird und zehn Meilen weit ausreißt, während Schwerin nachträglich für ihn siegt, – es ist gar kein sehr königlicher Ruhmestag, aber es ist ein Erfolg. Übrigens langt auch Bayern nach der Kaiserkrone, Frankreich steht ihm bei, Wien ist in Bedrängnis, es kommt obendrein Chotusitz, wo Buddenbrock die Österreicher in das brennende Dorf wirft, und Maria Theresia, die »lieber an Bayern eine ganze Provinz, als an Preußen ein einziges Dorf abtreten wollte« (sie haßt diesen Friedrich mit ganzer Weibeskraft), muß, Kummer in ihrem weißen Busen, Tränen in ihren blauen Augen, einen Frieden unterfertigen, der dem König Ober- und Unterschlesien und die Grafschaft Glatz zusichert, – er hat sie, sie sind sein.
Was weiter? Es sind rund zwei Jahre vergangen, als Friedrich von neuem Krieg macht, – angeblich, um als Kurfürst des Reiches dem bedrängten bayrischen Kaiser Sukkurs zu bringen, in {61}Wirklichkeit wohl mehr darum, weil Maria Theresia unterdessen gegen Frankreich und Bayern etwas zu erfolgreich gewesen ist und weil Friedrich argwöhnt, daß sie sich, wenn die anderen am Boden liegen, gegen ihn wenden wird, um Schlesien wiederzunehmen, dieses schöne, unverschmerzbare Schlesien, über das sie in Schluchzen ausbricht, sobald sie nur davon hört. Auch ist sie nicht ohne mächtige Freunde, – wie denn König Georg II. von England, Besieger der Franzosen und Alliierter der Kaiserin-Königin seit Worms, 1743, ihr wörtlich geschrieben hat: »Madame, ce qui est bon à prendre est bon à rendre,« der Brief ist in Friedrichs Händen. England und Österreich haben sich gegenseitig die Besitzungen gewährleistet, die sie bis 1739 innegehabt. Bis 39? Das war ja wohl, bevor Friedrich Schlesien nahm! Und zwischen Österreich und Sachsen kommt es zu ähnlichen Verträgen … Genug! Die österreichischen Historiker schwören zwar himmelhoch, daß die Kaiserin damals keinen Angriff geplant habe, aber es war genug für Friedrich. Er steht sehr gut mit Frankreich, hat seit dem Juni einen Offensivvertrag auf zwölf Jahre mit Richelieu in der Tasche, ist also nicht ohne diplomatische Rückendeckung. Er hat »die Macht des Staates« in diesen zwei Jahren um achtzehntausend »Schnurrbärte« (wie Voltaire zu sagen pflegte) vermehrt, hat die schlesischen Festungen vortrefflich ausgebaut, und im Hochsommer 44 schlägt er abermals los, fällt, ohne auch nur den Krieg zu erklären, achtzigtausend Mann hoch in Böhmen ein, zieht auch durch Sachsen, ohne den dortigen Kurfürsten im geringsten um Erlaubnis zu bitten, rückt gegen Prag, rückt geradezu gegen Wien.
Die Sache geht sehr schwer, sie steht dann und wann direkt verzweifelt. Karl von Lothringen wirft sich vom Elsaß nach Böhmen und bedroht Friedrichs Verbindungen mit Schlesien, die sächsische Armee hat der König im Rücken, – es gibt eine {62}