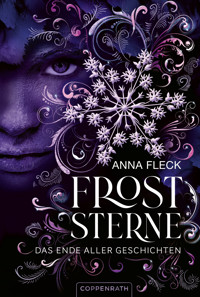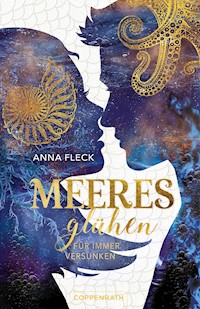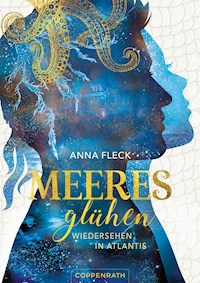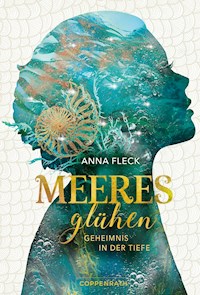14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Coppenrath Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Froststerne
- Sprache: Deutsch
Zum Dahinschmelzen: die neue magische Romantasy-Trilogie von Meeresglühen-Autorin Anna Fleck! Er zog mich an sich. Mein Herz randalierte in meiner Brust, ich bekam es nicht unter Kontrolle. Die Musik umschwirrte uns, vermischte sich mit den Schneeflocken. Und Erik war so nah, so nah wie noch nie. Küss mich, sonst küsse ich dich ... Elvy glaubt längst nicht mehr an Märchen. Aber als ihr heimlicher Schwarm Erik mitten in Stockholm in einem mysteriösen Schneesturm verschwindet, entdeckt sie die unfassbare Wahrheit: Die Schneekönigin, sagenhafte Macht des Winters, ist zurück und sinnt auf Rache. Um Erik zu retten, macht Elvy sich auf den Weg in den hohen Norden. Ihre Reise führt sie durch tief verschneite Wälder im Glanz des Nordlichts, hinein in die Welt der Elfen, Wichtel und Magie. Doch Elvy kämpft nicht nur um ihre große Liebe und eine magische Freundschaft, sondern auch um das Schicksal zweier Welten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 669
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Anna Fleck
Froststerne
Erinnere dich!
Für Frauke –weil du meine Geschichten zu Büchern machst
Von Anna Fleck bereits erschienen:
Meeresglühen (1) – Geheimnis in der Tiefe
Meeresglühen (2) – Wiedersehen in Atlantis
Meeresglühen (3) – Für immer versunken
5 4 3 2 1
eISBN 978-3-649-67235-7
© 2023 Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG,Hafenweg 30, 48155 Münster
Alle Rechte vorbehalten, auch auszugsweise
Text: Anna Fleck
Covergestaltung: Carolin Liepins
Lektorat: Frauke Reitze
Satz: Sabine Conrad, Bad Nauheim
www.coppenrath.de
Die Print-Ausgabe erscheint unter der ISBN 978-3-649-64495-8
INHALT
EIN JAHR VOR DEM EIS
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
DANKSAGUNG
VERLIEBEN OHNE ATEMPAUSE …
EIN JAHR VOR DEM EIS
Der Tag, an dem ich Erik verlor, war ein Tag des Schneesturms. Eines Schneesturms, den ich so noch nie erlebt hatte – und ganz sicher auch sonst niemand auf der Welt. Also … auf unserer Welt.
Dabei fing alles so normal an. Ich saß auf dem Bett, eingekuschelt in meinen Lieblings-Oversizepulli, auf dem Schoß meinen zerschrammten Laptop mit hundert offenen Tabs über New York, Sydney, Barcelona, im Kopfhörer eine chillige Playlist. Das perfekte Setting, um mir meine Traumreise auszumalen. Und hey, wenn ich nächstes Jahr endlich mit der Schule durch war – und eine Gelddruckmaschine erfunden hatte! –, würde ich mir das auch alles in echt angucken. Einfach los und weg, die coolsten Städte der Welt erkunden … Bis es so weit war, hielt mich mein guter Kumpel Internet bei Laune. Immer tiefer versank ich in den Fotos und Reiseblogs – bis ich zwischen zwei Songs hörte, wie etwas gegen die Fensterscheibe prasselte.
Diesmal war es nicht der Regen, der die Stockholmer seit einer Woche von den Straßen vertrieb und auch mich endgültig zum Einsiedlerkrebs gemacht hatte. Nein, diesmal war es Erik, darauf ging ich jede Wette ein.
Und tatsächlich: Kaum hatte ich die drei Schritte zum Fenster überwunden, konnte ich ihn sehen, wie er da unten auf der Straße stand – dicker Parka, aber keine Mütze, na klar. Etwas in meiner Brust machte einen heftigen Satz, wie immer seit dieser bescheuerten Sache letzten Sommer. Doch wie immer ignorierte ich es nach Kräften.
Erik entdeckte mich, grinste und ließ den Arm sinken, mit dem er wahrscheinlich eben eine Handvoll Kiesel zu mir in den zweiten Stock hochgeworfen hatte. So typisch! Ein Wunder, dass er nicht sein Handy geworfen hatte. Mich damit anzuklingeln, fiel ihm immer als Letztes ein.
Ich öffnete das Fenster – nur einen Spalt, aber schon pfiff mir nasskalte Luft ins Gesicht.
»Komm runter, Elvy!«, rief Erik. »Na los, keine Ausreden! Das Abenteuer wartet, die Sonne lacht!«
Ich zog eine Grimasse. Dieser Quatschkopf! Selbst ohne Regen lachte die Sonne nirgends in Schweden, nicht an einem Dezembertag um vier Uhr nachmittags. Dunkel war es da draußen, dunkel und nass und ungemütlich. Sorry, ohne mich. Ich streckte meine Hand hinaus und drehte den Daumen nach unten.
»Eeelvy!«
Mein Problem: Gegen Eriks mitreißende Energie kam die Stubenhockerin in mir nur schwer an. Wollte sie auch gar nicht, wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir war. Schließlich kannten er und ich uns schon, seit wir sechs waren, und seitdem hatten wir uns fast jeden Tag gesehen, gezankt und veralbert. Mittlerweile warf Erik zwar nicht mehr mit Legosteinen nach mir, aber ansonsten hatte sich in den letzten zehn Jahren eigentlich nichts zwischen uns geändert.
Auch der letzte Sommer hat das nicht geschafft, redete ich mir beruhigend zu.
Nach wie vor wusste Erik ganz genau, dass mich seine Combo aus Hundeblick und frechem Grinsen im Notfall bis nach Mordor locken würde.
Fünf Minuten später schlug ich also die Haustür hinter mir zu und bereute es sofort: Die Temperaturen waren noch weiter gefallen, und es fegte ein Wind durch die Straße, der jede Menge feuchte Luft mit sich brachte. Die plötzliche Kälte kam mir so schneidend vor, dass ich zu spüren meinte, wie mein Nasenpiercing einfror – aber das war natürlich Blödsinn, der schmale Silberring hatte mir im Winter noch nie Ärger gemacht. Rasch stopfte ich meine mausbraunen Haare unter die Mütze und zog mir zusätzlich die Kapuze über den Kopf.
»Wow! Eingepackt wie für einen Trip nach Kiruna!«, begrüßte mich Erik. »Warum guckst du dann so erfroren?«
Für den blöden Spruch streckte ich ihm die Zunge heraus und schnaubte: »Nach Kiruna bringen mich keine zehn Pferde. Hallo? Das ist kurz vorm Nordpol!«
»Whoa, friedlich!« In gespielter Angst trat er einen Schritt zurück und hob die Hände. »Hast du wieder deinen Igelmodus aktiviert?«
»Alle 8126 Stacheln und verdammt stolz drauf!«, schoss ich zurück.
»Igel sind total süß, trotz der Stacheln, das ist dir klar, oder?«
»Ich geb dir gleich süß!«
»Nein, echt, und ihr habt wirklich viel gemeinsam.« Sein Grinsen brannte mir fast ein Loch ins Herz. »Braune Kulleraugen, spitze Stupsnase … Ihr mögt Äpfel …«
»Du bist so tot, wenn du nicht aufhörst«, drohte ich, doch innerlich jubelte ich: Er findet mich süß! Nur, um mich gleich darauf wieder zu bremsen: Süß ist wie nett. Und nett ist scheiße.
Erik lachte bloß, ein Sound, der die Sonne zurückbrachte. Dann legte er mir seinen langen Arm um die Schulter und zog mich mit sich die Straße hinunter. Die Sonne wurde noch ein bisschen heller … aber ich boxte ihn sicherheitshalber weg. »Kein Gegrapsche, klar, Forsberg? Heb dir das für deine Rugby-Umkleide auf.«
»Zu Befehl, Coach Andersson!« Er grinste wieder und rückte im Laufen das Metallgestell seiner runden Brille zurecht. Sie war das Einzige an ihm, das nicht recht zu seiner Nordmann-Erscheinung passen wollte, und doch konnte ich ihn mir nicht anders vorstellen. Mit seinem dichten blonden Haarschopf, der breitschultrigen, sportlichen Figur und seinen lässigen 1,90 Metern hätte man ihn in früheren Zeiten bestimmt an die Spitze eines Heers gestellt – oder auf die Planken eines Drachenschiffs. Wegen seiner Weitsichtigkeit aber brauchte er im Alltag eine Brille, und wenn er sie nicht aufhatte, blinzelte er beim Lesen wie ein ausgebuddelter Maulwurf.
Mein Wikinger-Nerd, dachte ich und lächelte verstohlen. Dann aber schnappte ich mir den Gedanken und stopfte ihn wieder zurück in die Tiefen meiner geistigen Rumpelkammer. Hallo? Was sollten diese ständigen Aussetzer bitte? Erik und ich waren Freunde, okay? Das war safe, das sollte so bleiben, hatte ich beschlossen – erst recht, weil er seit Juli mit dieser doofen Tessa zusammen war.
»Hey, Igelmädchen.« In seinen Augen hinter den feuchten Brillengläsern funkelte es neckend, als er sich zu mir herüberneigte. Runterbeugen musste er sich nicht, denn ich war fast so groß wie er. Dafür kaum halb so breit. Im Ernstfall hätte er mich sicher zusammenklappen können wie einen Zollstock, aber so hart er auch manchmal auf dem Spielfeld ranging – abseits davon konnte er keiner Fliege etwas zuleide tun. Erst recht keiner mit Namen Elvy. Außerdem wusste er, dass ich mit meinen langen Beinen echt fies zutreten konnte.
Erik war noch immer beim Rugby. »Weißt du, ich finde ja, du könntest mich ein bisschen bewundern, weil ich uns neulich die Meisterschaft gerettet habe!«
»Vergiss es.« Jetzt grinste ich. »Für dumpfbackiges Anhimmeln sind eure Cheerleader zuständig.« Und Tessa, ergänzte ich bissig, zum Glück nur in Gedanken. »Aber ich erteil dir gleich ein Platzverbot, wenn du nicht endlich damit rausrückst, was ich hier in der Kälte soll!«
»Kälte? Sechs Grad, nicht mal Frost! Du Heulboje!«
»Besser Heulboje als Vollpfosten.«
Wieder lachte er, und wieder merkte ich irritiert, wie sehr mir dieser Sound gefiel. Dass er etwas vibrieren ließ in meinem Kopf, meinem Bauch. Ooookay, Schluss jetzt.
Der Wind trieb feuchtkalte Luft gegen die stuckverzierten Häuserfronten, während ich schicksalsergeben neben Erik durch die nahezu menschenleeren Straßen stapfte, so tief in meiner Kapuze vergraben wie möglich. Sechs Grad? Minus, vielleicht!
Sehnsüchtig blickte ich zu den erleuchteten Fenstern hoch. In manchen davon flackerte sogar der warme Schein einer Kerze und schien mir verlockend zuzuflüstern: Komm rein zu uns, wir haben heißen Tee, Pfefferkuchen und Gratis-WLAN …
Erik hörte eindeutig nichts dergleichen. Stattdessen erklärte er endlich, warum er mich aus meiner Höhle gezerrt hatte: »Erinnerst du dich an dieses verlassene Mietshaus aus den Lokal-News neulich? Von dem du die Adresse herausgefunden hast? Was übrigens mal wieder extrem clever von dir war.«
»Danken Sie nicht mir, danken Sie meinem IT-Genie«, winkte ich ab. »Die Fassade ließ sich ja klar erkennen, also war der Rest ’ne bessere Bildersuche.«
Klar wusste ich sofort, dass er von unserer neusten Lost-Places-Aktion sprach: Herumstöbern in menschenleeren Bauwerken war gerade unser Ding, immer auf der Suche nach Spuren der Vergangenheit. Gar nicht mal so einfach, derartige Plätze in einer angesagten Millionenstadt zu finden – aber es gab sie, wenn auch manchmal nur für ganz kurze Zeit.
Erik marschierte bestgelaunt neben mir her. »Jedenfalls hab ich da schon mal ein bisschen vor Ort rumgeschnüffelt: Bingo! Man kommt über ein Kellerfenster rein!«
»Und das muss heute sein?«, maulte ich. Zugegeben, normalerweise war ich bei diesen heimlichen Touren sofort Feuer und Flamme … aber doch nicht bei solchem Wetter!
Verwundert schaute er mich an. »Logisch! Weißt du nicht, welcher Tag heute ist?«
»Dienstag?«
Er schnaufte amüsiert, blieb stehen und zog ein Tuch aus der Tasche, um seine benieselte Brille zu polieren.
Die letzte Abzweigung hatte uns aus den engen Straßen hinausgeführt, mitten hinein in den Humlegården. Verschwiegen und winterdunkel breiteten sich die Wiesen des großzügigen Stadtparks um uns herum aus. Die kahlen Büsche und Bäume schienen sich unter den schweren Wolken zu ducken, kein Mensch war zu sehen.
Und, Moment – was Erik da von seiner Brille wischte, war kein Regen … sondern Schnee! Hatte ich doch recht gehabt mit meinen Zweifeln an seinem Wetterbericht. Von wegen Heulboje.
Fröstelnd atmete ich tief aus und beobachtete, wie sich eine Atemwolke vor meinem Gesicht bildete. Im Licht einer einsamen Laterne sah ich die Flocken aus dem dunklen Himmel herabrieseln. Ein Stück weiter beugte sich eine Hängebirke über den Weg. Ihre dünnen, kahlen Äste, bereits weiß überzuckert, bildeten ein schützendes Zelt. Ich kannte die Stelle gut: Der Baum war früher eine wichtige Station bei unseren Spielen im Park gewesen, ob als Schatzhöhle, Geheimlabor oder – wie jetzt im Winter – Eisschloss.
Ich konnte nicht anders und hob meinen Arm. Einige Flocken waren daran hängen geblieben und hoben sich glitzernd von dem blauen Stoff ab: So fein war der Schnee, dass er in einzelnen Kristallen herabfiel, jeder davon einzigartig und wunderschön …
»Hey! Erde an Andersson! Also, du hast es echt nicht auf dem Schirm?«
Ich sah hoch und direkt in Eriks braune Augen, in denen wie so oft der Schalk tanzte. Irgendetwas in meinem Magen tanzte auch – bis ich entschieden die Musik abdrehte.
»Es ist der Tag vor deinem Geburtstag«, sagte er und zwinkerte mir zu. »Ich weiß ja, dass du keine Lust auf Party oder großes Trara hast, also ziehen wir die Feier vor, ganz formlos.« Er schien einen Moment zu überlegen, zuckte dann mit den Achseln und zog mich unter die Hängebirke. »Eigentlich wollte ich das in dem Mietshaus machen, aber vielleicht verschieben wir das doch besser. Bei dem Schnee sieht ja jeder unsere Spuren, am Ende gibt’s Stress … Hier ist es auch gut, oder? In unserer alten Polarforscherstation?« Mit dem Kopf deutete er auf den Vorhang aus Zweigen um uns herum. »Also: Augen zu, Hand auf.«
Ich kämpfte einen Moment mit der Überraschung und meinen Handschuhen, dann gehorchte ich neugierig. Ich spürte Eriks warme Finger an meinen, spürte, wie er mir etwas auf die Handfläche legte.
Öffnete meine Augen und sah erst mal nur ihn, wie er mich anschaute, ganz erwartungsvoll und …und irgendwie …
Doch schon hatte er mich losgelassen, lächelte verlegen und sagte rasch: »Na dann … alles Gute zum Nicht-Geburtstag, Igelmädchen.«
Ich überspielte meine eigene Verlegenheit und sah nach, was er mir überreicht hatte.
Es war ein Ring. Ein ziemlich großer Fingerring aus mattweißem Material, vielleicht Holz, offenbar handgeschnitzt und verziert mit runenartigen Zeichen.
Uralt und kostbar wirkte er, wie er da in meiner Hand lag.
Ich machte große Augen. Gleichzeitig dachte ich: Ein Ring! Er schenkt mir einen Ring?! Was … was soll das denn? Freude durchfuhr mich, dicht gefolgt von Panik. Ein Ring war kein normales Geschenk, oder? Ändert das was zwischen uns? Will etwa ER was ändern? Und … will ICH das? Aber was, wenn es nicht funktioniert, was ist mit Tessa und …
»Ist der nicht cool? Ich hab den anderen!« Erik war einen Schritt zurückgetreten, in seinem Gesicht keine Spur mehr von dem seltsamen Ausdruck von eben. Er hielt mir seine Rechte hin, auf deren Zeigefinger nun tatsächlich der Zwilling meines Geschenks steckte, und redete hastig weiter: »Rat mal, woher! Lass, kommst du nie drauf. Aus der Schatzkiste meiner Großmutter, du weißt schon, vom Dachboden, wo wir nie randurften.«
»Und jetzt durftest du?«, fragte ich ungläubig.
»Probier ihn an, na komm!« Er stieß mich in die Seite, was definitiv lässig sein sollte, aber irgendwie nervös wirkte.
Jenseits unseres Dachs aus Birkenzweigen fiel weiter der feine Schnee, funkelte im Licht der Parklaterne und legte sich wie ein hauchzarter Schleier über die dunklen Wege und Grasflächen.
Ich hatte keinen Blick dafür. Schnell schob ich den Ring auf meinen Finger. Und bemerkte sofort das Problem.
»Er passt nicht.« Erik klang total geknickt.
»Ein bisschen zu groß«, gab ich zu, schwer bemüht, meine eigene Enttäuschung zu verbergen. In Wahrheit war er viel zu groß. Etwas für Wikingerhände halt. Dachte Erik echt, dass ich solche Pranken hatte wie er? Dieser Schlumpf.
»So ein Mist«, murmelte er zerknirscht. »Ich dachte, das könnte unser Geheimzeichen werden. Wir beide, die Dachboden-Buddys, weißt du noch?«
Oh. DAS meinte er. Mist. Ich schluckte alles runter, was ich an Verwirrung und inneren Tanzeinlagen zugelassen hatte. Wie blöd von mir: »Dachboden-Buddys« war unsere Version der klassischen Sandkastenfreunde. Menschen, die mit Legos werfen. Alles wie immer. Safe. Das war gut, oder?
Fast automatisch setzten sich meine Füße in Bewegung, trugen mich hinaus aus dem Schutz der Hängebirke, weg von dem Moment. Erik stapfte hinter mir her, seine Stiefel knirschend auf dem beschneiten Parkweg.
Mit gesenktem Kopf fragte ich: »Kann ich den Ring trotzdem behalten? Auf jeden Fall danke, der ist echt –«
»Hey. Guck mal, Elvy!«
Eriks Tonfall brachte mich dazu, wieder aufzusehen. Rasch ließ ich den Ring in der Jackentasche verschwinden und folgte seinem Blick. Verschluckte mich fast vor lauter Staunen.
»Was ist das denn?«, stotterte ich, mein Atem weiß und dicht vor meinem Gesicht. Mit einem Mal war die Luft geradezu eisig. Aber der Temperatursturz war nichts gegen das wundersame Schauspiel, das wir jetzt erblickten.
Durch das Dunkel des Parks schlängelte sich etwas am Boden entlang – eine Spur aus kaltem, funkelndem Licht, vielleicht fingerbreit. Nein, schlängeln war das falsche Wort: Sie sprang vielmehr voran, zerstob dabei immer wieder in feine Verästelungen mit harten Kanten, wie Eisblumen, die im Zeitraffer eine Fensterscheibe überziehen …
Die Spur kam direkt auf uns zu.
Wir machten gleichzeitig ein paar Schritte rückwärts, als das kalte Funkeln den Lichtkreis der Laterne erreichte und sich verlangsamte, knapp zwei Meter entfernt von unseren Füßen.
»Lass uns abhauen!«, stieß ich hervor.
»Nein, warte«, raunte Erik, in seiner Stimme die vertraute Abenteuerlust. »Ich glaub, ich hab darüber was gelesen, das ist so ’ne Lichtinstallation …«
»Spinnst du?«, zischte ich – doch auch ich konnte mich nicht losreißen. Zu einzigartig war das, was da vor unseren Augen erschien.
Die Eisblumenspur hatte sich verlangsamt, kroch jetzt nur noch voran. An ihren Rändern dampfte die Luft vor Kälte, ihr kristallines Glitzern geradezu hypnotisch anziehend. Um uns herum war es vollkommen still – oder ich hörte einfach nichts mehr außer dem feinen frostigen Knirschen, mit dem sich die Spur weiter vortastete. Erik nahm die beschlagene Brille ab. Sein Gesicht glühte vor Aufregung, als er sich auf die Knie herabließ und eine Hand nach dem kalten Funkeln ausstreckte.
»Das würd ich lassen«, murmelte ich und konnte trotzdem nur fasziniert zuschauen.
Er hörte ohnehin nicht auf mich, berührte die Linie und … »Verdammt!« Er riss den Arm zurück und sprang auf die Füße. Schüttelte seine Hand, hauchte sie an, vergeblich.
Auf seiner Fingerspitze saß ein Eisfunken, tanzte und glitzerte. Ich sah den Widerschein in Eriks Gesicht, in seinen weit aufgerissenen Augen, die plötzlich nicht mehr braun waren, sondern milchig, wie bereift …
»Erik? Hey, was ist los?«
Keine Antwort. Sein ganzer Körper wirkte plötzlich starr und verkrampft. Würgende Angst schoss in mir hoch, bannte mich an meinen Platz. Die Eisblumen hatten Eriks Füße erreicht. Krochen blitzschnell an ihm hoch, glitten kalt-knisternd über seine Jeans, den Parka hoch, hüllten ihn ein in Gespinste aus funkelndem Raureif.
Ich muss ihm helfen! Der Gedanke packte mich, riss die Angst weg, löste die Starre. Meine Hände schossen vor, griffen Eriks Jacke. Eiseskälte, knochentief, ließ mich aufschreien. Ich taumelte zurück, sank mit brennenden Handflächen in die Knie, vor meinen Augen schwarze Sterne. Für einen Moment wurde alles unwirklich, trüb und glasklar zugleich. Wie durch Nebel sah ich Eriks Gestalt, jetzt vollständig überzogen von Eiskristallen. Sie funkelten, strahlten immer heller, wurden zu einem Wirbel – einem Wirbel aus Schneeflocken. Ich blinzelte, versuchte verzweifelt, wieder klar zu sehen. Doch die Schneeflocken wurden immer dichter, hüllten Erik ein, rissen ihn auseinander, Stück für Stück …
Er … er löst sich auf … Erik löst sich auf!!!
Mein entsetzter Schrei blieb mir im Hals stecken, meine Glieder gehorchten mir nicht. Von einem Moment auf den anderen tobte ein Schneesturm um uns herum, heulte, pfiff. Nadelspitze Eiskristalle trafen mein Gesicht, ich presste reflexhaft die Augen zusammen.
Als ich sie wieder öffnete, keine Sekunde später … war Erik fort. Verschwunden mit dem Sturm. Nichts als ein paar versprengte Flocken rieselten herab, leuchteten kurz auf im Schein der Laterne hinter mir und schmolzen, kaum dass sie den dunklen Boden berührten.
Auch die Eisblumenspur war fort. Wo Erik eben noch gestanden hatte, groß, lebendig – lag jetzt nur seine Brille, die ihm wohl aus der Hand gefallen war. Zitternd tastete ich nach ihr. Stöhnte auf vor Schmerz, als ich sie fasste, denn meine Handflächen waren wund und gerötet. Frostbrand.
Was immer gerade passiert war – ich hatte nicht geträumt.
Ich schluckte, schluchzte, rang nach Luft. Meine Kehle fühlte sich rau an, vereist. Mühsam kam ich wieder auf die Beine. Verkrampfte meine schmerzenden Finger um Eriks Brille und versuchte zu schreien. Nach ihm. Nach Hilfe.
Vergebens.
Ich war allein in dem dunklen Park.
Natürlich glaubte mir niemand, was geschehen war. Und je mehr Zeit verging, desto weniger glaubte ich es selbst.
Bis die Träume kamen.
Und alles begann.
KAPITEL 1
Am Anfang sehe ich immer das Gleiche:
Weiß. Nichts als Weiß.
Mir wird kalt, und ich merke, dass ich in dichtem Schneetreiben stehe. Die Flocken wirbeln auseinander … und geben den Blick auf Erik frei. Ich weiß, er ist es, auch wenn er seltsam fremd wirkt – größer, blasser. Er sieht mich an. Sagt etwas, das ich in dem pfeifenden Wind nicht verstehe. Streckt seinen Arm nach mir aus. Eine Bitte? Nein, er will mir etwas geben. In seiner Hand liegt ein Herz. Keins dieser stilisierten Liebessymbole – ein organisch geformtes Herz, wie ein anatomisches Modell, aber durchsichtig. Wie aus Glas, Kristall …
Oder Eis.
Mir wird noch kälter, kalt vor Angst.
Ich will nicht hinsehen zu diesem entsetzlichen erstarrten Ding. Tue es doch und traue meinen Augen kaum: Das gefrorene Herz … es schlägt.
Dann wirbelt der Schnee auf, alles wird verschluckt von dem Weiß.
Und ich wache auf.
Der Wichtel war wieder da.
Verdammt.
Er stand auf dem Fensterbrett unseres Klassenraums – außen, wohlgemerkt – und blickte so interessiert zu uns hinein wie Besucher in ein Zoogehege. Er sah genauso aus, wie man sich als Kind einen Wichtel vorstellt: handgroß, rote Zipfelmütze, grüngraues altmodisches Wams und passender Umhang – sofern ich das auf die Distanz erkennen konnte.
Es war nicht das erste Mal, dass ich ihn sah, oh nein. Um genau zu sein, war es das dritte. Beim ersten Mal, vor ein paar Monaten, war er auf einer Laterne im Humlegården aufgetaucht, in der Nähe der Stelle, wo Erik letztes Jahr verschwunden war. Ich hatte ihn nur durch Zufall entdeckt und erst für eine Mini-Skulptur gehalten. Bis er in die Hände klatschte und verschwand, einfach so. Da hatte ich mir noch erfolgreich etwas von Einbildung einreden können.
Beim zweiten Mal wurde das schon schwieriger: Denn da beobachtete ich, wie der Wichtel die Straße vor unserem Haus überquerte, auf dem Rücken einer Streunerkatze. Dabei hüpfte seine Mütze wie verrückt auf und ab, fiel aber nicht herunter, bis die Katze hinter der nächsten Ecke verschwunden war und ich genügend Zeit hatte, mich zu fragen, ob ich jetzt endgültig durchdrehte. Frau Svensson aus dem Erdgeschoss dachte das ganz eindeutig, denn sie hatte den Wichtel nicht gesehen, nur die Katze, und mein wüstes Gestammel wirkte wohl nicht gerade beruhigend auf sie.
Egal: Es gab keine Wichtel. Auch keine Feen, Elfen oder sonst was Märchenhaftes. Jemand wollte mich verarschen, kein Zweifel – mit einer Puppe, einer Projektion, whatever. Und jetzt versuchten sie es sogar an meiner Schule!
Aber nicht mit mir.
»Können wir lüften?« Ich schoss von meinem Stuhl hoch, so schnell, dass er umknallte, und hechtete zum Fenster.
»Elvy, muss das –«
Schon hatte ich die Hand am Griff, aber zu spät. Der Wichtel – oder was immer ich da gerade gesehen hatte – war spurlos verschwunden. Dabei lag unser Klassenraum im dritten Stock!
Stille breitete sich hinter mir aus. Als ich mich umdrehte, ruhten die Augen all meiner Klassenkameraden auf mir. Sie guckten mich an, als ob sie mich gleich einweisen wollten.
Kannte ich diesen Blick? Oh ja, nur allzu gut. Hurra.
Ich starrte herausfordernd zurück, kippte das Fenster und sagte: »Brauchte Sauerstoff. Irgendwer atmet hier zu viel.«
Dann schlenderte ich zu meinem Platz zurück und ignorierte die näselnde Zurechtweisung von Herrn Fridlund, unserem Englischlehrer, genau wie das Gekicher und Geraune im Raum.
»Elvy die Irre braucht Sauerstoff«, hörte ich Tessa zu ihrem Gefolge tuscheln, dann zischte sie mir zu: »Was ist los, wird dir die Luft da oben zu dünn, Bohnenstange?«
Ich blickte betont auf sie herab. »Besser Bohnenstange als Grillgemüse.« Tessa liebte ihre Sommerbräune geradezu fanatisch und hatte sogar eine Sonnenbank zu Hause, die ihr auch im Winter einen knusprigen Teint verschaffte.
Sie funkelte mich an und flüsterte dann ihrer Tischnachbarin etwas zu, was erneut hämisches Gekicher verursachte.
Diese Kuh. Nach Eriks Verschwinden vor einem Jahr hatte sie ziemlich genau zwei Wochen einen auf trauernde Witwe gemacht, aber immer schön kontrolliert, damit bloß ihr Mascara nicht verlief. Dann hatte sie sich mit einem neuen Kerl getröstet und die Sache war für sie abgehakt. Trotzdem ließ sie keine Chance aus, mich als peinliche Spinnerin darzustellen.
Nach außen hin ungerührt, aber innerlich kochend, senkte ich meinen Kopf über das Englischbuch und schuf mir einen Vorhang aus mausbraunem Haar.
Was zum Geier war eigentlich mit meinem Leben los? Die Sache im Park … Mann. Keine geistige Rumpelkammer war groß genug, um diese Erinnerung wegzusperren. Nicht dass ich das gewollt hätte, gerade am Anfang nicht. Völlig aufgelöst hatte ich natürlich erst meinen Eltern und dann der Polizei haarklein erzählt, was ich gesehen hatte – glaubte, gesehen zu haben. Etwas, das vollkommen unmöglich war. Menschen werden nicht von Eisblumen angegriffen und sie lösen sich auch nicht in Schneestürmen auf. Nein, verdammt. Es war mein Kopf, der mich im Stich ließ. Mein Verstand wurde offensichtlich mit einem unbekannten Trauma nicht fertig und baute sich seine eigene Erklärung zusammen.
Ein Bewältigungsmechanismus, hatte es die Therapeutin genannt. Pah. Es kam mir nicht so vor, als ob ich irgendetwas bewältigte. Wie auch, ohne jede Erklärung! Nichts hatte ich vorzuweisen außer Eriks Brille – und der Kälteverbrennung an meinen Handflächen. Letztere deuteten die Ärzte so, dass ich irgendeine vereiste Metallfläche angefasst hatte – den Laternenpfahl zum Beispiel. Klang vernünftig, oder? Ja. Und half kein bisschen weiter.
Die Polizei hatte mich eine Zeit lang misstrauisch befragt und dann als weiteres Opfer eingestuft – auch bekannt als »nutzlose Zeugin«. Natürlich hatten sie nach Erik gesucht. Suchten immer noch nach ihm und seinen mutmaßlichen Entführern, wenn auch nicht mehr auf Hochtouren. Nach einem Jahr ohne jede Spur hatte man den Job wohl an Kommissar Zufall abgegeben. Und die enthusiastisch gestartete Social-Media-Suchaktion unserer Schule war ebenfalls versandet, ohne auch nur einen brauchbaren Hinweis zu liefern.
Übrig blieb ich, die ich doof genug gewesen war, allen meine Version der Story zu erzählen, sodass ich seitdem die Wahl zwischen mitleidigen Blicken und miesen Spitznamen hatte.
Und jetzt sah ich also auch noch Wichtel. Oder besser: Jemand wollte, dass ich Wichtel sah und mich noch mehr zum Affen machte. Egal wem ich das verdankte, damit würde ich ihn nicht durchkommen lassen, niemals. Oder sie.
Aber Erik … Erik ist immer noch weg. Bei dem Gedanken krampfte sich alles in mir zusammen, ein mittlerweile vertrautes, grässliches Gefühl. Er ist weg, ob es nun ein Schneesturm war oder sonst was. Und ich kriege keine Ruhe, bevor ich nicht weiß, was dahintersteckt … oder bis ich ihn wiederhabe.
Immer schwärzer wurde es in meinem Inneren. Zum Glück nahm mich gleich darauf Herr Fridlund dran, und ich richtete all meine Energie darauf, etwas halbwegs Kluges zu dem Robert-Frost-Gedicht auf dem Smartboard vor uns zu sagen. »Frost«. Wie passend. Haha.
Endlich war Schulschluss – Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Schließlich war heute Dienstag. Und dienstags hatte ich ein Date.
Als ich meinen dicken Anorak schloss und auf die Straße trat, war es schon wieder stockdunkel. Also – so stockdunkel, wie es in einer Millionenstadt von Lichtfanatikern eben sein kann. Jetzt, im Dezember, eskalierten die Leute natürlich erst recht: Überall erstrahlte Weihnachtsbeleuchtung, ob in den Wohnungsfenstern, an öffentlichen Gebäuden oder in den Schaufenstern der Geschäfte. Schräg gegenüber unserem Schultor lockte zum Beispiel gleich die Auslage von Theos Lakritsbutik, die statt Kitsch allerdings stilvolle Nostalgie zu bieten hatte: hohe Bonbongläser und Metalldosen im Vintage-Look, übervoll mit edlen Süßigkeiten, dazwischen Spielzeug von anno dazumal, alles erleuchtet von einer Hängelampe aus geschliffenem Glas. Ich hätte es zwar nie zugegeben, aber ich liebte diesen Laden mit seiner heimeligen Atmosphäre. Und vor allem das sauteure dänische Schokolakritz, das aussah wie Goldkugeln. Mmmm … Diese Geschmackskombination aus herb und süß und …
»Guter Wurf, Alter!« Das Gegröle einer Jungsgruppe an der nächsten Ecke riss mich aus meinen Gedanken.
Ich kannte die meisten der Typen vom Sehen – sie waren zwei Klassen unter mir, machten aber schon auf Gang und zogen auf Befehl ihres Anführers Noah gern Jüngere ab. Richtige Engelchen. Ich ging ihnen sonst aus dem Weg, wer brauchte schon den Stress – zumal Noah ausgerechnet bei uns im Haus wohnte. Nur hatten er und seine Freunde heute Nachmittag ein Opfer gefunden, das noch schwächer als ein Sechstklässler war.
Es war eine Möwe, eine der typischen Stockholmer Stadtmöwen, deren silberweißes Gefieder und aufmüpfiges Gekreisch ich schon immer gemocht hatte und die stets so wirkten, als gehörte die Stadt ihnen.
Noah und seine Kumpel sahen das offenbar anders, denn sie taten ihr Bestes, den armen Vogel zu erledigen, der bereits einen Flügel nachzog und panisch flatternd versuchte zu entkommen. Eine Energydrink-Dose knallte auf das Pflaster, verfehlte das Tier nur knapp, zerbarst und verspritzte eine rosa Schaumfontäne. Bevor der Nächste ausholen konnte, hatte ich die Gruppe erreicht und drängte mich dazwischen.
»Ey, new entry: Elvy die Irre!«, rief einer und alles lachte.
Ärger zuckte in mir hoch: Vor einem Jahr hätten selbst die keinen Spruch in meine Richtung gewagt, aber mittlerweile war ich wohl auch bei ihnen in die Kategorie Opfer gerutscht. Zeit, ihnen zu zeigen, wie falsch sie lagen.
»Hört sofort auf!«, fuhr ich sie an, so richtig von oben herab, denn ich war locker zwei Köpfe größer als der Älteste von ihnen. Die Möwe nutzte die Gelegenheit und humpelte in Richtung Rinnstein davon.
»Oder was, Stockinsekt?«, feixte Noah zu mir herauf, ganz der große Macker.
Ich zuckte nicht mal mit der Wimper. »Oder ich erzähle Frau Svensson, dass du neulich Nacht im Treppenhaus ihren Kinderwagen vollgekotzt hast.«
»Das kannst du nicht beweisen«, zischte er.
»Muss ich auch nicht«, erwiderte ich lässig. »Frau Svensson glaubt mir. Und weißt du, wer Frau Svensson glaubt? Deine Mutter! Willst du’s drauf ankommen lassen?«
Sein Gesichtsausdruck war ein Fest. Ich blieb einfach stehen, ließ meine Größe wirken. Hier konnte sie mir mal etwas nützen.
»Komm, Alter, lass uns abhauen.« Noahs bester Kumpel Oscar zupfte ihn nervös am Ärmel. »Wir wollten doch noch …«
Die anderen vier Helden waren eh schon ein paar Schritte weiter gezockelt und guckten neugierig, ob ihr Anführer mit intakter Coolness aus der Sache rauskam.
Noah entschied sich für die »Ich gucke Gangster-Serien auf Netflix«-Variante und knurrte mir drohend zu: »Wir sehen uns noch, Stockinsekt!«
»Aber erst mal sieht dich Mami!«, rief ich ihm spöttisch hinterher, als er mit seinen Kumpels den Rückzug antrat.
Kleine Mistfliegen. Ich wette, die versuchen noch, mir eins reinzuwürgen.
Tja, würde ich ab sofort halt doppelt aufpassen müssen, nicht nur, um die Urheber des Wichtel-Hoax zu erwischen.
Wo war jetzt der arme Vogel? Ich starrte in den einsetzenden Nieselregen, zog sogar mein Handy hervor und schaltete die Taschenlampenfunktion ein, um die dunklen Ecken jenseits der Straßenbeleuchtung abzusuchen – keine Spur. Die erschreckte Möwe hatte sich versteckt. Aber obwohl sie dadurch erst einmal vor Noah oder Autos sicher war – mit ihrer Verletzung würde sie nicht lange überleben, machte ich mir beklommen klar. Mein toller Auftritt hatte absolut nichts gebracht. Verdammt. Zu Batman fehlte mir entschieden mehr als das Cape.
Natürlich machte ich vor meinem Treffen wie immer einen Abstecher zu Sundbergs Konditorei in der Gamla Stan, um zwei der leckeren Kanelbullar zu kaufen. Vielleicht nicht die besten der Stadt, aber für mein Date ein Muss. Außerdem gefiel mir der Laden mit seiner altmodischen Kaffeehaus-Einrichtung und den großen Glitzerklunker-Kronleuchtern fast so gut wie die Lakritsbutik, daran änderten auch die begeistert fotografierenden Touristen und die redselige Verkäuferin hinter dem Tresen nichts. Ich war kein Fan von Small Talk – von Zimtschnecken aber schon. Als ich die Tüte herübergereicht bekam, musste ich einfach meine Nase hineinstecken und tief einatmen. Zimt und Zucker roch ich, saftigen Hefeteig, darunter dieser feine Hauch Kardamom. Es war ein wunderbarer Duft, ein Alles-wird-gut-Duft … eine von diesen unwichtigen Kleinigkeiten, die mich immer wieder aufrichteten.
Wenig später stapfte ich durch die Gassen der Altstadtinsel am Wasser entlang in Richtung U-Bahn, vorbei an den liebevoll restaurierten Fassaden der mittelalterlichen Häuser. Wenn man genau hinsah, erkannte man selbst im Dezemberdunkel, wie krumm und schief manche der Giebellinien verliefen oder wie die Wände sich trotz der schmiedeeisernen Hausanker nach außen neigten. Ich liebte solche Details, liebte es, wie intelligent und hartnäckig die Menschen in der Vergangenheit Bauwerke konstruiert hatten, die Jahrhunderte überdauerten. Nicht nachlassen, Leute, wir schaffen das! Und dann, bäm: Stockholm! Allein die Idee, eine Stadt auf einem Haufen felsiger Inseln zu errichten … Erik hatte das genauso begeistert wie mich. Manchmal hatten wir bei unseren Spaziergängen herumgesponnen, wie wir eines Tages unsere eigene Stadt konstruieren würden. Aber jetzt ging niemand neben mir und ich spürte die Leere an meiner Seite wie einen dumpfen Schmerz.
Vor mir tauchte das neueste Bauwerk der Gamla Stan auf: eine Stele aus Granit mit einer schlichten Bronzemarkierung – ein Kunstwerk zur Erinnerung an die rätselhafte Serie von Flutwellen, die letztes Jahr überall auf der Erde für Überschwemmungen gesorgt hatten. Ein weiteres Anzeichen für den Klimawandel, hieß es, aber bis heute konnte niemand schlüssig den Ursprung dieses Naturphänomens erklären.
Es wehte ein ziemlich unangenehmer, nasskalter Wind, der mich sofort wieder an diesen Nachmittag vor einem Jahr erinnerte, an dem ich besser zu Hause geblieben wäre. Wieder konnte ich die nagenden Fragen nicht unterdrücken: Wenn ich Erik zum Bleiben überredet hätte … Wenn wir gleich abgehauen wären, als die Eisblumen auftauchten …
Keine What-ifs, rief ich mich scharf zur Ordnung. Schließlich tu ich was. Ich bleibe dran.
Mit neuem Mut stapfte ich weiter, bog links ab und erreichte die Vasabron, diese Prachtbrücke aus Stein und Metall, die sich so lässig den hell erleuchteten Hochhäusern am anderen Ufer entgegenstreckte.
Genau, dranbleiben war das Motto. Schließlich hatte ich meinen Suchauftrag. Meine Karte. Den »Frozen Hearts Club«. Und ich hatte das Date mit meiner einzigen echten Verbündeten: Eriks Großmutter.
KAPITEL 2
»Zustand unverändert, sag ich doch. Laut Patientenakte nach wie vor stabil.« Der Krankenpfleger, der mir diese Auskunft gab, wirkte geradezu belästigt, vermutlich weil ich ihn bei seiner privaten Smartphone-Session gestört hatte. »Jenz« stand eingestickt auf seinem hellblauen Hemd. Musste neu sein, ich kannte ihn nicht – und dabei kam ich nun schon seit einem Jahr jede Woche hierher: in die Privatklinik Blom. Gelegen am westlichen Rand von Östermalm, umgeben von einem weitläufigen Park, war der Bau im modernen skandinavischen Stil derart schick mit seinem Holz, seiner Niedrigenergie und was nicht noch alles, dass er auch locker als Boutique-Hotel hätte durchgehen können.
Jenz wäre das eindeutig lieber gewesen, so gelangweilt professionell ließ er sich herab, mich zum Krankenzimmer 14 zu führen. Natürlich hätte ich auch allein hingefunden, aber so waren eben die Hausregeln. Auf dem Weg dorthin spulte er ein Infoprogramm ab, als ob er mich gleich als nächste Patientin anwerben wollte. Dass ich nicht antwortete, weil ich die eine Hälfte seiner Ausführungen bereits kannte und mich die andere Hälfte nicht interessierte, ging an ihm vorbei.
Was offenbar ebenfalls an ihm vorbeiging: dass inmitten dieser schicken Einrichtung ein hilfsbedürftiger Mensch lag. Stattdessen betonte er die veredelten Naturholzdielen und öffnete dann mit großer Geste die Vorhänge des bodentiefen Fensters, das sich über die gesamte Breite der Außenwand zog. Dahinter erstreckte sich der Park, die gepflegten Kieswege und immergrünen Büsche erhellt durch strategisch platzierte Designer-Leuchten. In ihrem Schein wirkten selbst die Regentropfen wie Goldstaub.
»Beeindruckend, nicht wahr?«, kommentierte Jenz, jetzt vollends im Maklermodus. »Dieser Blick!«
»Ja«, stimmte ich ihm trocken zu. »Und das ist es doch, was Komapatienten am meisten schätzen: eine schöne Aussicht.«
»Ähm. Nun ja.« Da ich seine Verkaufsshow abgewürgt hatte, fiel Jenz offenbar ein, dass er anderswo zu tun hatte; im nächsten Moment schloss sich die Tür aus Nussbaumholz hinter ihm.
Endlich Ruhe.
Ich gönnte mir ein kleines Grinsen, dann hängte ich meinen feuchten Anorak an den Kleiderhaken und zog mir einen Stuhl an das Bett heran, das die linke Seite des Raums dominierte.
Darin lag Karla Forsberg, Eriks Großmutter.
Ihr eisgraues, kurzes Haar wurde regelmäßig frisiert und saß wie immer perfekt, ihre Gesichtsfarbe war gesund und sie trug ein elegantes Nachthemd aus ihrer eigenen Garderobe. Ja, man kümmerte sich verdammt gut um sie, kein Zweifel. Ihre persönliche Bekanntschaft mit der Klinikgründerin, eine detaillierte Patientenverfügung und ein gut gefülltes Bankkonto stellten das sicher, Tag für Tag. Aber dass ihre früher so dynamischen Gesichtszüge jetzt in erschlafften Falten lagen und ihre kräftige Statur geradezu eingeschrumpelt wirkte, konnte auch die beste Medizin nicht ändern.
Das wird wieder, sagte ich mir, wie schon so oft. Genau. Sobald sie endlich aufwachte, sich von den Kabeln befreite und dieses Bett verließ, in dem sie nun seit einem Jahr lag.
Seit dem Tag, an dem Erik verschwunden war, um genau zu sein. Papa und ich hatten sie im Treppenhaus gefunden, direkt vor ihrer Wohnungstür, Smartphone und Schlüsselbund in den verkrampften Händen. Der Schock über die Entführung ihres Enkels – oder was auch immer passiert war – hatte Karla Forsberg einen so heftigen Schlaganfall verpasst, dass sie seitdem im Koma lag.
Es machte mich krank, sie so zu sehen, vollkommen hilflos und still. Ihr Leben lang hatte ich sie als die tatkräftigste, entschlossenste Frau gekannt, die mir je begegnet war. Sie war in meine Welt getreten, als die von Erik zersprang: damals, vor zehn Jahren, als ein Betrunkener auf dem Sveavägen mit seinem Transporter auf den Gehsteig geriet. Acht Verletzte, vier Tote, darunter Herr und Frau Forsberg. Klein-Erik, stolzer Erstklässler, war der Katastrophe entkommen, weil er vor dem Schaufenster einer Buchhandlung herumgetrödelt hatte. Bücher und die Geschichten darin hatten Erik schon immer gerettet, aber vor allem konnten sie ihn nicht bewahren …
Seine Großmutter hatte keine Sekunde gezögert: Sie verließ ihre Top-Stelle am nordamerikanischen MIT, zog in Eriks Zuhause ein und organisierte sich kurzerhand ein neues Leben in Stockholm, um ihren Enkel in seiner vertrauten Umgebung großzuziehen. Seitdem war sie seine einzige Familie und machte alles in allem einen tollen Job.
Was Bücher und Geschichten anging, hatte sie allerdings ihre ganz eigene Art, damit umzugehen: Sie erzählte und las vor, was immer Erik und ich wollten – aber wir bekamen jedes Mal einen laufenden Kommentar dazu, inwiefern die darin beschriebenen Dinge realistisch waren und was sie, Professorin Karla Forsberg, davon hielt. Unvergessen ihr Vortrag zur »Kleinen Meerjungfrau« – was für Umbauten ein Körper durchmachen müsste, der quasi vom Fisch zum Landbewohner werden wollte, komplett mit einem Kurztrip durch die Evolutionsgeschichte … Erik hatte gestöhnt und protestiert, weil er die Geschichte hören wollte, ich dagegen hatte Karla begeistert zugehört. Über die Jahre war sie auch für mich eine Großmutter und ein Vorbild geworden.
»Hej, Prof Karla«, begrüßte ich sie. Anders nannte ich sie nie, obwohl sie bestimmt tausendmal lächelnd den Kopf darüber geschüttelt hatte. »Tut mir leid, dass ich ein bisschen zu spät für unsere Fika bin.«
Schwer vorstellbar, aber niemand auf der ganzen Welt war schärfer auf Fikas – diese schwedische Version der Kaffeepause – als Eriks Großmutter. Ihre Arbeit als hochdotierte Professorin für Astrophysik hatte sie schon rund um die Welt geführt, wofür ich sie grenzenlos beneidete – und der erste Punkt ihrer Reiseberichte drehte sich immer darum, ob man dem ausländischen Gebäck und Kaffee trauen konnte.
In der Klinik Blom war der Kaffee natürlich hervorragend. Wie jeden Dienstag hatte ich zwei große Becher in der hiesigen Luxus-Kantine besorgt und zog jetzt die mitgebrachten Kanelbullar aus meinem Rucksack.
»Hier, für dich, Original Sundberg!« Vorsichtig hielt ich Karla eins der üppigen Gebäckstücke unter die Nase. Das war nicht bloß Nettigkeit, das war Therapie. Wie man mir gesagt hatte, war jede Art von Ansprache und Sinnesreiz gut für Komapatienten – und vielleicht brachte ja der Duft ihres Lieblingscafés irgendwann den entscheidenden Kick?
Wie immer tat sich leider auch diesmal nichts, und so legte ich die Zimtschnecke einfach auf der Bettdecke ab. Sollte Jenz sich später mit den Krümeln herumschlagen, das war es wert.
Nachdem ich meine eigene Zimtschnecke und die Hälfte des Kaffees eingesaugt hatte, war es Zeit für das Wichtigste: meinen wöchentlichen Bericht über den Fortschritt meiner – unserer – Suche.
»Leider immer noch kein Durchbruch«, informierte ich Eriks Großmutter und legte ihr meinen Laptop auf den Bauch – mit vorsichtigem Abstand zum Gebäck. Während der Rechner hochfuhr, murmelte ich: »Ich hatte übrigens wieder diesen Traum. Der, in dem ich Erik sehe, weißt du?«
Keine Antwort, nicht mal ein Zucken in dem langen Körper, der früher vor Energie schier gebebt hatte und der jetzt so viel kleiner wirkte.
»Meine Träume wünsche ich allerdings keinem. Immer das Gleiche. Und immer so … eisig.« Die Erinnerung ließ mich schaudern. »Aber das Gruseligste ist echt, dass ich nicht die Einzige bin.«
Fakten bitte, Elvy. Dieses Traumgerede bringt uns nicht weiter. Wie so oft stellte ich mir vor, dass Karla mich freundlich, aber streng zurechtwies.
»Das sind Fakten«, erwiderte ich also, genauso streng, und zeigte auf den Bildschirm, wo sich mittlerweile ein bestimmter Tab geöffnet hatte: das Chat-Forum des »Frozen Heart Clubs«. »Und wir dürfen sie nicht ignorieren, auch wenn es nur Träume sind. Ich meine, guck dir das doch an: schon wieder 18 Meldungen! Diesmal sogar eine aus den USA!«
Ich klickte mich in den Bereich »My story«, wo sich die meisten Beiträge befanden … und täglich neue hinzukamen. Den »Frozen Heart Club« hatte ich ein paar Wochen nach Eriks Verschwinden entdeckt, als ich begann, meine Recherchen im Netz weiter auszudehnen. Weil sich sonst nichts tat und weil ich einfach nicht mehr wusste, wie ich mit diesem Traum umgehen sollte, der wieder und wieder kam. Ich war fast vom Stuhl gefallen, als ich auf diese Website stieß. Nicht gerade professionell gemacht, dazu ein Logo, das an eine Liebeskummer-Hotline denken ließ: ein Herz mit Eiszapfen in einem blauen Kreis. Aber das Forum hatte es in sich. Jeder einzelne User hier berichtete haargenau von dem gleichen Traum, den auch ich hatte. Von dem vereisten Herz, das schlug. Das eine Botschaft zu sein schien, ein Hilferuf. Nur sahen die Forumsmitglieder in ihrem Traum nicht Erik, sondern jeweils einen anderen Menschen, der ihnen viel bedeutete. Eine Freundin oder einen Freund, die zweite Hälfte eines Liebespaars. Als ich dann entdeckte, was mit diesen Menschen geschehen war, wusste ich gar nicht mehr, was ich denken sollte: Denn keine dieser Personen war verschwunden. Erst recht nicht in einem eingebildeten Schneesturm oder nach einem Angriff durch eine leuchtende Eisblumenspur. Nein. All diese Leute lagen im Koma. Aus Gründen, die niemand kannte. Mein Blick flackerte vom Laptop zum eingesunkenen Gesicht von Eriks Großmutter.
Im Koma … wie du.
Ein Gedanke durchzuckte mich, den ich schon oft gehabt hatte und den ich genauso oft wieder zurück in meine geistige Rumpelkammer gestopft hatte: Was, wenn es gar kein »normaler« Schlaganfall gewesen war?
Elvy, BITTE: Fakten. Die Stimme von Eriks Großmutter in meinem Kopf klang jetzt leicht entnervt. Schließlich träumst du nicht von MIR, oder? Also, wo ist der Zusammenhang?
»Ich weiß es nicht«, sagte ich laut. »Aber es muss einen geben. Leute fallen ins Koma und ihre Liebsten träumen den gleichen Traum, überall auf der Welt! Und die sind alle jung, höchstens Ende 20. Selbst wenn ein paar von ihnen nur Trittbrettfahrer sein sollten und Storys aus dem Forum nachplappern … Ich hab so viele überprüft. IP-Adressen, Meldungen der Lokalpresse. Mann, ich hab sogar einen eigenen Algorithmus für die Suche programmiert. Die Komafälle sind Fakt!«
Und die Träume? Wieder stellte ich mir eine strenge Nachfrage vor.
»Die Träume sind auch Fakt«, erwiderte ich, sosehr es mir widerstrebte. Schließlich begab ich mich mit dieser Aussage auf ganz dünnes Eis in puncto Überprüfbarkeit. Ich lehnte mich in meinen Stuhl zurück und nahm einen großen Schluck des wirklich guten, aber leider erkalteten Kaffees. »Du weißt, ich stehe nicht so auf Gruppentherapie. Darum hab ich noch nie selber in diesem Forum gepostet. Aber ich hab die kontaktiert, die die Seite aufgebaut und die ersten Traumberichte gepostet haben. Die waren haargenau wie meiner! Bis in die Details. Das muss echt sein. Denn ich hab von diesen Eis-Träumen keinem erzählt. Nur dir.« Schließlich hatte ich im letzten Jahr gelernt, meine Klappe zu halten, wenn es um scheinbar Unerklärliches ging. Weder Papa noch meine Therapeutin und am wenigsten irgendwelche Leute im Internet wussten davon, dass Eriks Verschwinden erst der Anfang des Irrsinns in meinem Leben gewesen war.
Aber mit Eriks Großmutter konnte ich reden. Konnte mir ihre kritischen Nachfragen vorstellen, die mich zwangen, meine Suchmethoden und Erklärungsversuche immer wieder zu überprüfen. Und noch ein Vorteil: Natürlich störte es hier nicht, wenn ich jedes Mal die gleichen Dinge erzählte. Dinge, die nicht-komatöse Zuhörer nach einem Jahr und der hundertsten Wiederholung bestimmt die Wände hochgetrieben hätten. Gehörte alles zur Therapie. Mit Komapatienten zu sprechen war gut, das bestätigten alle Fachleute, also nutzte ich das ordentlich aus. Manchmal gestand ich mir sogar ein, dass ich unser Krankenbett-Fika-Ritual mindestens genauso sehr selbst brauchte.
»Weißt du, was mich fertigmacht?«, murmelte ich über den Rand meines Kaffeebechers hinweg. »Es werden mehr Fälle. Es breitet sich aus. Aber keiner tut was!«
Was sollte denn getan werden, deiner Meinung nach? Puh, jetzt klang Karla spöttisch statt kritisch. Wie immer, wenn ich selber nicht mehr weiterwusste.
»Keine Ahnung«, gab ich zu. »Bloß … mir kommt es vor, als ob das niemand ernst nimmt. Wenn ich was in den Medien dazu finde, läuft das immer unter so Stichworten wie ›Internet-Hype‹ oder ›Teenie-Hysterie‹. Aber keiner versucht, eine seriöse wissenschaftliche Antwort zu finden! Das kann doch nicht wahr sein!« Entnervt knallte ich meinen Becher auf den Beistelltisch, ließ den Laptop zuschnappen und fegte ihn zurück in meinen Rucksack.
Sehr dramatisch, Elvy. In wachem Zustand hätte Eriks Großmutter mich jetzt wahrscheinlich rügend über den Rand ihrer schicken Hornbrille angeschaut. Ich weiß, du fühlst dich, als ob du ganz allein dastündest. Aber das ist nichts Schlechtes, hörst du? Und vor allem ist es keine Entschuldigung dafür, den Mut zu verlieren. Denk dran: Failure is not an option.
Eines ihrer Lieblingszitate. Kein Wunder bei einer Astrophysikerin, denn genau diese Einstellung hatte den Astronauten der Apollo-13-Mission das Leben gerettet, als alles aussichtlos schien.
»Versagen kommt nicht infrage«, wiederholte ich und setzte mich gleich ein Stück gerader hin. »Du hast recht. Keine Sorge, ich gebe nicht auf.«
Eine Stunde später, nachdem ich auch den zweiten Kaffeebecher geleert hatte und die Zimtschnecken nur noch krümelige Erinnerung waren, stand ich wieder in Nieselregen und Dunkelheit, hinter mir die erleuchtete Front der Privatklinik Blom, vor mir der Weg durch den Park zur U-Bahn. Wie nach jedem meiner Besuche bei Eriks Großmutter fühlte ich mich zu gleichen Teilen traurig und gestärkt. Jawohl, so hoffnungslos auch alles aussah: Ich würde nicht aufgeben. Ich würde Erik aufspüren, heil und gesund, und obendrein eine vernünftige Erklärung für all das finden …
Und dann sah ich den Wichtel schon wieder.
Er saß auf einer Bank im Schein der modernen Bogenlampe, halb verdeckt durch den daneben stehenden Papierkorb. Die ausladenden Äste einer Kiefer boten ihm Regenschutz, den der Wichtel trotz der tief in die Stirn gezogenen roten Mütze und des hochgestellten Kragens seines Umhangs zu schätzen schien.
Ich blieb stehen wie vom Blitz getroffen, starrte ihn einfach nur an – für etwa eine Sekunde. Dann riss ich mein Handy heraus und schoss eine ganze Serie von Beweisfotos.
Diesmal nicht! Diesmal verschwindet das Ding nicht wieder spurlos und ich bin die Dumme!
Aber das »Ding« unternahm überhaupt keine Anstalten zu verschwinden. Stattdessen sah es direkt zu mir herüber und sagte dann klar und deutlich: »Was stehst du da im Regen und glotzt?« Dabei klopfte es einladend auf die Bank neben sich. Seine Stimme war erstaunlich laut für den knapp handgroßen Körper, dazu tief und volltönend.
Ich schoss mit Blicken um mich. Okay, wo hatten sich die Idioten versteckt, denen ich diese Nummer verdankte und die bestimmt gerade alles filmten? Doch wohin ich auch sah, jenseits des Lichtkegels der Laterne gab es nichts als nasskalte Dunkelheit und kahle Blumenbeete. Der Klinikbau lag schon zu weit entfernt, die nächsten Büsche boten keine Deckung.
Und der Wichtel vor mir auf der Bank … der wirkte so echt wie ich selbst. Vorsichtig, mein Handy jetzt im Videomodus, näherte ich mich.
Ein ungeduldiges Schnaufen erklang. »Pack das Ding weg und setz dich endlich. Wir haben zu reden, Menschlein.«
Ich gehorchte, blieb aber auf Abstand. Nebenbei registrierte ich, wie feucht mein Po trotz des Kieferndachs über der Bank wurde. Ein Zeichen, dass ich zumindest nicht träumte … oder?
»Okay. Was wird das hier?«, fragte ich – mehr in den Park hinein als an das winzige Wesen neben mir gerichtet.
»Wie ich schon sagte, Elvy Astrid Andersson«, kam die Antwort, und ich war nicht einmal schockiert, dass es mich mit vollem Namen anredete, »wir haben zu reden. Ich bin Tomte Teda.«
Tomte … ein Wichtel? Ich beugte mich herunter, um die kleine Gestalt vor mir besser betrachten zu können. Da hatte sich jemand so richtig Mühe gegeben. Allein die Details der Klamotten, unglaublich! Der Zwergenumhang, vermutlich grauer Filz, wirkte lang getragen und wies zahlreiche feine Flicknähte auf. Die Mütze über den halblangen grauen Locken war gestrickt, winzige Maschen, am Rand schon etwas abgewetzt. Darunter funkelten scharfe, dunkle Augen in einem – allerdings bartlosen – Gesicht, so rund und faltig wie ein Winterapfel. Das war keine Puppe, niemals. Verdammt.
»Du bist wirklich ein Wichtelmännchen?«, fragte ich ungläubig.
»Männchen?« Das Wesen vor mir schnaubte. »Männchen, pah! So weit kommt’s noch, dass ich ein Kerl sein soll!«
Ich zwinkerte, sah noch einmal genau hin und kapierte: Tomte Teda war kein Wichtelmännchen, sondern ein Wichtelfrauchen! Gab es so was überhaupt? In den Märchen und Bildern waren das doch immer Typen mit Zottelbart, oder? Aber jetzt saß da eine weibliche Version neben mir und hatte offenbar vor, meine ganze Weltsicht zu erschüttern.
»Kennst du dich mit Tomtes aus, Menschlein?« Eine strenge Stimme unterbrach meinen wirren Gedankenstrom.
»Ich kenne den Jultomte«, antwortete mein Mund wie auf Automatik. »Den Weihnachtswichtel. Mein Vater hat früher immer eine Schüssel Grütze für ihn aufgestellt.«
»Guter Mann«, nickte Tomte Teda. »Wahrt die alten Bräuche. Aber wenn mir einer mit Grütze kommt, kann er sie am Tag drauf aus seinen Schuhen kratzen. Da lob ich mir das hier.« Die Wichtelfrau hob ihre linke Hand. Darin hielt sie, wie ich erst jetzt bemerkte, einen To-go-Pappbecher in Zwergengröße mit mir wohlbekanntem Logo.
Ich konnte mich nicht zurückhalten. »Wo kriegt man denn einen so winzigen Starbucks-Kaffee?«
»Natürlich bei Starbucks. Dem in der Hamngatan, wenn du es genau wissen willst.« Sie sah mich mit hochgezogener Augenbraue an, als ob ich die dümmste Frage der Welt gestellt hätte, und nahm einen langen, genießerischen Schluck. »Ah, Kaffee! Eins der wenigen guten Dinge, die ihr hergebracht habt, das muss ich euch lassen.«
Unfähig, etwas Intelligentes zu erwidern, glotzte ich sie an, die kleine Gestalt in dem grauen Filzumhang, dem dunklen Wams und der roten Mütze. Dann hob ich den Arm und tippte gegen ihre Schulter. Ich musste es tun, musste prüfen, ob das, was ich sah, wirklich real war.
Oh, es war real, wie mir ein scharfer Klaps auf die Finger klarmachte. Unglaublich, was für eine Kraft in so einer winzigen Hand steckte!
Also auch keine Projektion. Mist.
Mein letzter bodenständiger Erklärungsversuch schlurfte peinlich berührt aus dem Raum. Übrig blieb eine vollkommen verwirrte Elvy, die ihre schmerzenden Finger schüttelte und ärgerlich schnappte: »Kann ich jetzt mal erfahren, was das alles soll? Kleiner Kaffeeklatsch im Regen, oder was?«
Tomte Teda ließ sich durch meinen Ton nicht aus der Ruhe bringen. Nach einem weiteren gelassenen Schluck sagte sie: »Nun, ich wollte mir einmal anschauen, wer da in meiner Stadt Möwen rettet. Wir Tomtes kümmern uns gern um Tiere, weißt du? Vor allem, wenn ihr Menschen es nicht tut.«
»Ich hab die Möwe nicht gerettet«, entgegnete ich mürrisch.
»Nein?« Sie sah nach oben.
Ich folgte ihrem Blick – und riss überrascht die Augen auf. Denn dort, auf der Spitze der Bogenlaterne, saß ein großer Vogel mit charakteristisch weiß-grauem Gefieder und stierte herausfordernd zurück. »Ist das etwa … aber wie …? Ihr Flügel war doch verletzt!«
»Ich hab ihn geheilt. Zum Dank hat sie mich hierhergebracht.« Tomte Teda gönnte mir ein spöttisches Zwinkern. »Was? Dachtest du, unsereins fliegt nur mit den Wildgänsen?«
Ärgerlich schüttelte ich den Kopf. Verdammt, ich durfte mich nicht so aus der Fassung bringen lassen! »Nein, ich dachte, ihr reitet auf streunenden Katzen«, gab ich also zurück. »Tu bloß nicht so, ich hab dich schon früher bemerkt!«
»Ja, das hast du. Weil ich es so wollte.« Das Wichtelwesen ließ den Becher sinken und sah mich an, sein Blick dunkel und scharf. »Ich bin eine Unterirdische. Eine von den Unsichtbaren. Ihr seht von uns nur, was wir euch zeigen.« Ihre Worte klangen jetzt wie fernes Rauschen. »Hör mir gut zu, Menschlein: Es braut sich etwas zusammen. In unserer Welt. In deiner. Der Schneesturm war erst der Anfang.«
Wovon redest du? Ich wollte es laut fragen, brachte aber keinen Ton heraus. Keinen Muskel konnte ich plötzlich mehr rühren, konnte nur dasitzen, stumm und atemlos, festgebannt an meinen Platz. Das Licht der Parklaterne schien zu flackern, schwächer zu werden. In meinen Ohren nur das ferne Echo meines eigenen Herzschlags … und Tomte Tedas Stimme.
»So viele sind schon eingeschlafen, doch es werden noch mehr werden. Weil sie es so will. Und du, Menschlein … du hast Eis an den Händen. Sieh dich vor.«
Was meinst du damit?, schrie ich ihr stumm entgegen. Was passiert hier?
Die Schatten ringsum wuchsen, legten sich um mich wie ein alter, schwerer Mantel. Eine Last, die ich fast körperlich spürte, die auf meine Kehle drückte. Die Luft wurde mir knapp, mein Herz raste, doch noch immer bannten mich die Wichtelaugen, ließen mich nicht los …
Und dann, urplötzlich, schaute Tomte Teda weg. Der Zauber, die Hypnose, was auch immer, brach ab, paff! Schon kehrte das Lampenlicht zurück und die Dunkelheit war erneut nichts als ein Dezemberabend in Stockholm. Ich konnte wieder atmen und spürte das feuchte Holz der Parkbank durch den Stoff meiner Hose. Unangenehm real.
Aber neben mir saß noch immer ein leibhaftiger Wichtel, nein, eine Wichtelfrau, die mir gerade einen Haufen kryptisches Zeugs an den Kopf geworfen hatte. Wollte sie mich dadurch einschüchtern?
Nicht mit mir.
Ich holte tief Luft, ballte die Hände zu Fäusten und fauchte: »Schluss jetzt! Ich will Antworten, und zwar echte, nicht so einen Märchen-Orakel-Scheiß!«
Tomte Teda zwinkerte mir lässig zu. »Antworten willst du, Elvy Astrid Andersson? Aber sicher. Hier, halt mal kurz.«
Damit drückte sie mir ihren winzigen Kaffeebecher in die Hand. Völlig überrumpelt ließ ich es geschehen.
Moment, was … wieso ist der so schwer?
Einen Augenblick lang kämpfte ich damit, das Ding in den Griff zu bekommen, das trotz seiner Fingerhutgröße erstaunlich viel wog. Als ich wieder hochsah, war Tomte Teda weg. Spurlos verschwunden, in Luft aufgelöst, wie die Male davor.
Ich sprang auf, wobei mein vergessenes Handy auf den Kiesweg schlidderte. Suchte mit meinen Blicken die Umgebung ab. Vergeblich.
Während ich noch dastand, schäumend vor Wut, dass ich auf so eine billige Ablenkung hereingefallen war, ertönte ein feines Klingeln und zack!, wurde der Mini-Kaffee in meiner Hand zu einem XL-Pappbecher. Vor Schreck verkrampften sich meine Finger, der Plastikdeckel sprang ab und lauwarmer Kaffee klatschte in hohem Bogen über meinen Anorak, die Hose und Schuhe.
»Shit!!!«
Ich pfefferte den Becher in den Mülleimer und versuchte, mich mit ein paar Papiertaschentüchern notdürftig abzuputzen.
»Du Mistzwerg, das kriegst du wieder!«, brüllte ich in die Dunkelheit hinein.
Aber die antwortete nicht.
KAPITEL 3
Welt, warum machst du so was mit mir?
In mir schäumte es noch immer, als ich später, sehr viel später, die Eingangstür unseres Mietshauses aufschloss. Statt die U-Bahn zu nehmen, war ich den ganzen Weg zurück zu Fuß gegangen, um mich zu beruhigen. Trotzdem zitterten meine Hände, als ich den Schlüssel wieder einsteckte und unter dem ornamentalen Schnitzwerk hindurch das Treppenhaus betrat. Immer noch hatte mich die Wut im Griff, die Verwirrung und, am schlimmsten … die Angst.
Was ich da im Park vor der Klinik erlebt hatte, war echt gewesen. Kein Trick, keine Einbildung, kein psychotischer Schub, da war ich mir sicher. Auch wenn ich wieder keine Beweise hatte, verdammter Mist, denn die Handyaufnahmen zeigten nichts als graue Schleier und Störgeräusche. Also keine Chance, irgendjemanden um Rat zu bitten. Genauso gut könnte ich gleich zum Treffen der »Anonymen Vollspinner« gehen.
Hallo, ich bin Elvy, und ich sehe Wichtel.
Hallo, Elvy!
Aber wenn es wirklich passiert war … Ich würgte einen neuen Angstwirbel hinunter. Wenn es Wichtel gab, Zauberkräfte, Magie … Das bedeutete: Alles war möglich. Und nichts war mehr sicher. Wenn die Naturgesetze nicht mehr galten – dann musste ich der Tatsache ins Auge blicken, dass Erik sich wirklich in einem Schneesturm aufgelöst hatte. Dass er vielleicht sogar tot war … An was sollte ich mich noch festklammern, wenn meine Welt zu einem Spiel ohne Regeln geworden war? Ein Jahr lang hatte ich versucht, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, hatte mit den Waffen der Wirklichkeit um Erik gekämpft – und um mich selbst! Jetzt verlor ich den Halt und wusste nicht mehr, was tun.
Verbissen umfasste ich den Handlauf des hölzernen Treppengeländers. Schritt für Schritt erklomm ich mit meinen langen, schweren Beinen die Stufen, zwang mich zur Ruhe, wenigstens äußerlich. Auf keinen Fall durfte ich Papa Anlass zur Sorge geben. Und so hielt ich nicht einmal inne, wie sonst immer, als ich den ersten Stock erreichte und an der Tür vorbeikam, auf deren Messing-Klingelschild die Aufschrift »Forsberg« stand. Es war die Wohnung, in der Erik erst mit seinen Eltern und dann mit seiner Großmutter gewohnt hatte und die noch immer auf ihn wartete. Karla nämlich hatte in ihrer Gründlichkeit nichts dem Zufall überlassen, voller Sorge, dass ihre Gesundheit sie eines Tages vor der Zeit im Stich lassen könnte. Wie sich herausgestellt hatte, gab es für den Ernstfall einen Haufen Verfügungen und Daueraufträge – von medizinischen Kontaktpersonen und Mietüberweisungen über Putzfrau bis Postdienst. Papa und ich besaßen einen Zweitschlüssel, und deshalb wusste ich, dass hinter der Forsberg-Tür tatsächlich kein einziges Staubkorn quersaß.
Hinter der Andersson-Tür ein Stockwerk höher war das leider nicht der Fall. Ich schob mich in einen Flur, den ich erst gestern aufgeräumt hatte und in dem mein Vater jetzt bereits wieder einen kniehohen Stapel Noten abgestellt hatte, gekrönt von zwei vergessenen Haferkeksen. Ich schnappte sie mir und schob sie in meinen Mund. Auch ein Weg, Ordnung zu schaffen.
Aus dem Wohnzimmer klang das melancholische Summen eines Cellos in Meisterhand. Die Melodie erkannte ich nicht, vielleicht improvisierte Papa, aber der vertraute Klang holte mich endgültig auf den Boden der Tatsachen zurück. Endlich hörten meine Hände auf zu zittern.
Ich stapfte direkt ins Bad, wo zum Glück keine Noten herumlagen, dafür die Wäsche von zwei Wochen, schmiss meine von Zwergenkaffee und Regen durchweichten Klamotten in die Badewanne und streifte mir ein paar Sachen über, die für zu Hause noch frisch genug waren.
Dann folgte ich den Cellotönen ins Wohnzimmer – oder besser, Papas Arbeitszimmer, denn wohnen konnte in diesem Labyrinth aus Instrumentenkoffern, dem Klavier, Notenständern und Bergen von Papier echt niemand mehr.
»Hej Papa.« Ich trat hinter ihn und wuschelte ihm durch die wilde Mähne, die die Leute wahlweise an Einstein oder Beethoven denken ließ. Beides weltfremde Genies: passt!
»Elvy!« Mein Vater ließ den Bogen sinken und strahlte mich an. Der letzte Ton schwebte weiter durch den kleinen Raum, über das zugestellte Sofa und den Esstisch, vorbei an den zahllosen gerahmten Auszeichnungen und Konzert-Plakaten. »Da bist du ja, meine Große! War’s gut in der Schule?«
»Wie immer. Hast du heute schon was gegessen?« Außer Haferkeksen, setzte ich im Kopf hinzu.
»Aber ja, deine leckere Fischpfanne.«
»Papa, die hatten wir gestern.«
»Oh.« Verlegen kratzte er sich am Kopf, aber ohne den Bogen loszulassen – ich entkam nur knapp einem Stich ins Auge. »Dann wohl nicht.«
Ich seufzte.
Zehn Minuten später hatte ich ihn vom Wohnzimmer in die Küche gelockt und uns einen Stapel Sandwiches gemacht.
Während wir mampften, schwebte mein Vater weiter in seinen musikalischen Höhen und erzählte begeistert von der Konzertreise, die ihm bevorstand. »Endlich wieder Monteverdi, zwei Wochen lang im Advent, ist das nicht wunderbar? Und stell dir vor, der Organisator übernimmt die kompletten Kosten für Fahrt und Übernachtung …«
»Wäre ja auch noch schöner, wenn du da draufzahlen müsstest!«, warf ich ein, aber wie immer hatte er keinen Kopf für dieses Thema.
Genie und Geld gingen längst nicht immer Hand in Hand, erst recht nicht in der Welt klassischer Musik, das hatte ich früh kapiert. Unsere Wohnung auf Östermalm hätten wir wohl kaum ohne die finanzielle Unterstützung meiner Mutter halten können. Die hatte das mit dem Geld kapiert. Und vor allem hatte sie kapiert, dass ihre Karriere als international gefeierte Sopranistin deutlich einfacher zu managen war, wenn sie sich nicht mit einem zerstreuten Cellisten und einer halbwüchsigen Tochter herumschlagen musste. Also sahen wir von Sigrid Andersson seit acht Jahren im Wesentlichen nur Konzertkritiken und Überweisungen.
Mittlerweile konnte ich ihr dafür nicht mal mehr wirklich böse sein – sie wusste halt, wofür sie lebte, und das war die Musik. Um diese absolute Sicherheit in puncto Lebensziel beneidete ich sie direkt. Klein-Elvy hatte das allerdings anders gesehen. Was war ich damals für eine Heulsuse gewesen! Zum Glück hatte das nur Erik mitbekommen.
Ich nahm einen Riesenhapps Sandwich, um diese bitter-banalen Gedanken herunterzuschlucken. Schließlich hatte ich viel dringendere Probleme. Probleme, bei denen mir auch deutlich präsentere Eltern nicht hätten helfen können.
Wobei … einen Versuch ist es wert.