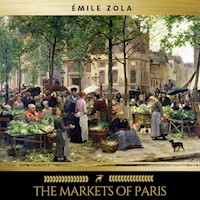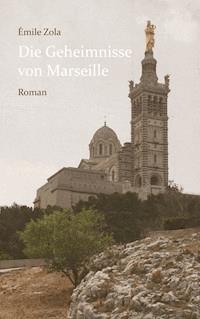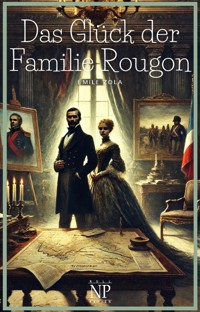Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der erste Roman aus Zolas Zyklus "Die vier Evangelien."
Das E-Book Fruchtbarkeit wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1145
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fruchtbarkeit
Emile Zola
Inhalt:
Emile Zola – Biografie und Bibliografie
Fruchtbarkeit
Erstes Buch
1
2
3
4
5
Zweites Buch
1
2
3
4
5
Drittes Buch
1
2
3
4
5
Viertes Buch
1
2
3
4
5
Fünftes Buch
1
2
3
4
5
Sechstes Buch
1
2
3
4
5
Fruchtbarkeit, Emile Zola
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849618131
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Emile Zola – Biografie und Bibliografie
Namhafter franz. Romanschriftsteller, geb. 2. April 1840 in Paris, gest. daselbst 28./29. Sept. 1902, Sohn eines italienischen Ingenieurs, der den Bau des »Kanals Zola« in der Provence leitete, aber schon 1847 in Aix starb, verbrachte seine Jugend in Aix, besuchte seit 1858 das Lycée St.-Louis in Paris und trat dann, um sich dem Buchhandel zu widmen, in das Geschäft von Hachette ein. Seine Mußestunden zu schriftstellerischen Arbeiten benutzend, schrieb er literarische und theatralische Kritiken für verschiedene Zeitungen und versuchte sich bald auch auf dem Gebiete des Romans mit: »Les mystères de Marseille« und »Le vœu d'une morte«. Mehr Beachtung als diese Werke fanden schon seine »Contes à Ninon« (1864) und die »Confession de Claude« (1865), während »Thérèse Raquin« (1867) die Richtung des Autors sowie sein Talent, die Nachtseiten der menschlichen Natur mit grausamer Wahrheit zu schildern, unzweifelhaft bekundete. Nachdem er darauf »Madeleine Férat« (1868), eine Studie über die Fatalität der ererbten Anlagen, gleichsam als Vorspiel vorausgeschickt, begann er 1869 seinen berühmten, dasselbe Thema in systematischer Weise behandelnden Romanzyklus »Les Rougon-Macquart«, den er selbst als die »psychologisch-soziale Geschichte einer Familie unter dem zweiten Kaiserreich« bezeichnet. Derselbe umfaßt 20 Bände, nämlich: »La fortune des Rougon« (1871), »La curée« (1872), »Le ventre de Paris«, »La conquête de Plassans«, »La faute de l'abbé Mouret«, »Son Excellence Eugène Rougon«, »L'Assommoir«, die Folgen der Trunksucht in Pariser Arbeiterkreisen meisterhaft schildernd und Zolas Weltruhm begründend (1876), »Une page d'amour«, »Nana« (1880), »Pot-Bouille«, »Au Bonheur des dames«, »La joie de vivre«, »Germinal«, Roman der Kohlenminen (1885), »L'Œuvre«, »La Terre«, »Le Rêve«, »La bête humaine«, »L'Argent«, »La Débâcle«, Kriegsgeschichte von 1870 (1892), und »Le Docteur Pascal« (1893). Vom »Assommoir« an erlebten alle Romane der Serie erstaunliche Auflagen, die stärksten der eben genannte (162,000 Exemplare bis 1908 verkauft), »Nana« (203,000 Exemplare), »La Terre« (150,000 Exemplare) und »La Débâcle« (224,000 Exemplare). Über den leitenden Gedanken, der durch das Werk hindurchgehen soll, spricht sich Z. in der Vorrede zum ersten Band selbst aus. Er wolle, sagt er, durch Lösung der doppelten Frage des angebornen Temperaments und der umgebenden Welt den Faden zu verfolgen suchen, der mit mathematischer Genauigkeit von einem Menschen zum andern führe. Wie die Schwerkraft, so habe auch die Erblichkeit ihre bestimmten Gesetze. Die Art, wie Z. diese Aufgabe gelöst, hat ihm ebenso heftige Angriffe wie unbegrenzte Bewunderung eingetragen und ihn jedenfalls zum Chorführer der Naturalisten gemacht. Allein er hat die Anwendung des Grundsatzes der Realisten, daß der Schriftsteller alles solle darstellen dürfen, was die menschliche Handlungsweise bestimmt, daß er es der Wahrheit schuldig sei, nichts zu verschweigen und nichts zu beschönigen, fast mit jedem neuen Gliede der Kette gesteigert. Bei der Kurtisanengeschichte »Nana« glaubte man, er sei jetzt an der äußersten Grenze des Widerwärtigen angelangt; aber man irrte sich, wie »Pot-Bouille«, »Germinal« und namentlich »La Terre« bewiesen; im »Rêve« machte der Verfasser immerhin einige Anstrengung, um eine »weiße Symphonie« für sein junges Patenkind, die Tochter seines Verlegers Charpentier, zu schreiben. 127,000 abgesetzte Exemplare zeigen, daß Z. auch ohne Naturalismen im engern Sinne des Wortes zu interessieren versteht. Der Kritiker Z., der für den »Voltaire«, den »Figaro« und den in Moskau erscheinenden »Europäischen Boten« schrieb, solange der Roman ihm nicht ein hinreichendes Auskommen bot, zeichnete sich durch Rücksichtslosigkeit gegen alle anerkannten Größen und etwas einseitige Empfehlung der eignen neuen Richtung aus. Charakteristisch genug nannte er den ersten Band seiner gesammelten Abhandlungen über lebende Schriftsteller und ihre Werke »Mes haines« (1866, neue Ausg. 1879). Die übrigen Bände sind: »Le roman expérimental« (1880), »Les romanciers naturalistes«, »Le naturalisme an theâtre«, »Nos auteurs dramatiques«, »Documents littéraires« (1881), »Une campagne« (1880–81), »Nouvelle campagne« (1896). Z. hielt sich für berufen, wie dem Roman, so auch dem Theater neue Bahnen zu weisen, drang aber damit nicht durch, ob er seine Romane allein für die Bühne zustutzte oder mit Hilfe William Busnachs dem großen Publikum abschwächende Zugeständnisse machte. »Thérèse Raquin« und »Bouton de rose«, die er ohne fremde Mitwirkung ausführen ließ, wurden ausgezischt; »L'Assommoir« hingegen, »Le ventre de Paris« und »Nana« behaupteten sich lange auf dem Theaterzettel, während »Germinal«, bei dem Z., wie er hatte verkündigen lassen, das meiste tat, nach 17 Vorstellungen einging und »Renée« (Bearbeitung der »Curée«), für die er ganz allein verantwortlich war, nicht einmal einen Achtungserfolg erzielte. Als Z. sein Hauptwerk, die Geschichte der »Rougon-Macquart«, vollendet hatte, unternahm er die Städtetrilogie: »Lourdes«, »Rome«, »Paris« (1894 bis 1898), worin ein schwärmerischer junger Priester zum Sozialisten und Freidenker wird. 1898 griff Z. durch den Artikel »J'accuse« in der »Aurore« mit Wucht in die Dreyfusaffäre ein. Er wurde deshalb als Verleumder des Kriegsgerichts, das den wahren Verräter Esterhazy freigesprochen, von den Pariser Geschwornen verurteilt, appellierte und wurde in Versailles nochmals verurteilt, entzog sich aber durch die Flucht nach England der Haft. Er kehrte 1899 nach dem Revisionsbeschluß des Kassationshofes nach Paris zurück, lebte meist auf seinem Landgut in Médan und starb in Paris im Schlafe durch Kohlenoxydvergiftung, da der Ofen seines Schlafzimmers beschädigt war. Seine Leiche wurde 4. Juni 1908 im Panthéon beigesetzt und ein großes Denkmal wird in Paris 1909 enthüllt werden. Infolge der Dreyfusaffäre nahm auch Zolas Dichtung einen politisch lehrhaften, meist optimistischen Charakter an. Er kündigte »Les quatre Evangiles« an, vollendete aber nur drei: »Fécondité« (1899), »Travail« (1901), »Vérité« (1902). »Justice« blieb Projekt. Die Artikel zur Dreyfusaffäre vereinigte der Band »La Véritéen marche« (1899). Nachdem der Komponist A. Bruneau aus »Le Rêve« eine erfolgreiche Oper (1891) gemacht, schrieb Z. eigens für ihn die Opernbücher »Messidor« (1897), »L'Ouragan« (1901) und »L'Enfant-Roi« (1905 ausgeführt), die geringern Erfolg hatten. Drei Bände »Correspondance« erschienen 1907–08. Zu dem Sammelwerk »Les Soirées de Médan« (1882), das die Namen von Céard, Hennique, Huysmans, Alexis und Maupassant vereinigte, steuerte Z. die Novelle »L'attaque du moulin« bei, aus der Bruneau ebenfalls eine Oper (1892) machte. Zolas Bildnis s. Tafel »Medaillen VI«, Fig. 6. Vgl. P. Alexis, Émile Z., notes d'un ami (Par. 1882); J. ten Brink, Emil Z. und seine Werke (deutsch, Braunschw. 1887); die Schmähschrift von Ant. Laporte, Z. contre Z. (Par. 1896); Toulouse, Emile Z., enquête medico-psychologique (das. 1896); »Les personnages des Rougon-Macquart«, mit Vorrede von Ramond (1901); Vizetelly, Emile Z., novelist and reformer (Lond. 1904; deutsch, Berl. 1905); Brulat, Histoire populaire d'Émile Z (Par. 1907); Massis, Comment Émile Z. composait ses romans (das. 1906); M. G. Conrad, Émile Z. (Berl. 1906); Grand-Carteret, Z.en image (Par. 1908).
Fruchtbarkeit
Erstes Buch
1
In dem kleinen Pavillon am Waldesrande, den sie seit nun bald einem Monat bewohnten, machte sich Mathieu diesen Morgen in Eile fertig, um in Janville den Siebenuhrzug zu erreichen, der ihn jeden Tag nach Paris zurückbrachte. Es war bereits halb sieben, und Janville war gute zwei Kilometer von dem Pavillon entfernt. Die Fahrt nach Paris dauert drei Viertelstunden, und weitere drei Viertelstunden mindestens nahm der Weg vom Nordbahnhofe nach dem Boulevard de Grenelle in Anspruch, so daß er kaum je vor halb neun Uhr sein Bureau in der Fabrik erreichte.
Er hatte eben die Kinder geküßt, die glücklicherweise noch schliefen; denn wachend ließen sie ihn vor Umarmungen, Küssen und Lachen kaum fortkommen. Und er trat nun eilig wieder ins Schlafzimmer, wo er seine Frau, Marianne, noch im Bette, aber wach und halbsitzend fand. Sie hatte eine Gardine aufgezogen, und der herrliche Maimorgen flutete herein, die gesunde und frische Schönheit ihrer vierundzwanzig Jahre in einer Welle frühlichen Lichtes badend. Er war um drei Jahre älter als sie, und er betete sie an.
»Also, mein Schatz, ich eile, sonst versäume ich den Zug. Sieh zu, daß du dich einrichtest, du hast noch dreißig Sous, nicht wahr?«
Sie lachte, reizend mit ihren nackten Armen und ihrem aufgelösten prachtvollen braunen Haar. Die fortwährende Knappheit ihres jungen Haushaltes nahm ihr nichts von ihrem Mut und ihrer Lebensfreude, die mit siebzehn Jahren den Zwanzigjährigen geheiratet hatte, und nun bereits für vier Kinder zu sorgen hatte.
»Heute ist ja der Letzte, und du bekommst ja abends dein Gehalt. Morgen werde ich die kleinen Schulden in Janville bezahlen. Mir ist übrigens nur die Schuld bei den Lepailleur für Milch und Eier unangenehm, denn die Leute glauben immer, man will sie um ihr Geld bringen. – Dreißig Sous, mein Schatz! Aber da können wir ja liederlich sein!«
Immer noch lachend, streckte sie ihm ihre festen weißen Arme entgegen, um wie alle Morgen von ihm Abschied zu nehmen.
»Geh nun, da du Eile hast. Ich erwarte dich abends an der kleinen Brücke.«
»Nein, nein, ich will, daß du schlafen gehst! Du weißt, daß ich heute, wenn ich nicht etwa auch noch den Dreiviertelelfuhrzug versäume, nicht vor halb zwölf in Janville eintreffe. Das wird ein hübscher Tag heute! Ich habe den Morange versprechen müssen, bei ihnen zu Mittag zu essen, und am Abend bewirtet Beauchêne einen Kunden, ein Geschäftsdiner also, bei dem ich mittun muß. Also sei ein braves Kind und leg dich schön schlafen, ohne mich zu erwarten.«
Sie nickte leicht mit dem Kopfe, ohne sich zu etwas zu verpflichten.
»Und vergiß nicht,« sagte sie dann, »beim Hauseigentümer vorzusprechen und ihm zu sagen, daß es ins Kinderzimmer hineinregnet. Wenn diese Séguin du Hordel, diese Millionäre, uns für diese miserable Hütte sechshundert Franken jährlich abnehmen, so folgt daraus noch nicht, daß wir uns müssen durchnässen lassen, als ob wir auf freiem Felde kampierten.«
»Richtig, das hätte ich vergessen! Ich gehe bestimmt hin.«
Aber nun war er es, der sein Fortgehen verzögerte, sie in den Armen haltend. Wieder lachte sie fröhlich und erwiderte herzhaft seine kräftigen, schallenden Küsse. Zwischen ihnen bestand eine starke Liebe der blühenden Gesundheit, die Freude der innigen und vollkommenen Vereinigung, des Bewußtseins, ein Leib und eine Seele zu sein.
»Geh nun, geh nun, mein Schatz! – Und höre, vergiß nicht, Constance zu sagen, daß sie, ehe sie aufs Land geht, auf einen Sonntag mit Maurice zu uns kommen sollte.«
»Gut, gut, ich werde es ihr sagen. Also, auf heute abend, Schatz.«
Er kehrte wieder um, schloß sie kräftig in seine Arme und drückte ihr einen langen Kuß auf den Mund, den sie aus ganzem Herzen erwiderte. Dann eilte er fort.
Gewöhnlich bestieg er am Nordbahnhofe den Omnibus. Aber an den Tagen, wo es nicht mehr als dreißig Sous im Hause gab, machte er den Weg rüstig zu Fuß. Es war übrigens ein schöner Weg: durch die Rue de Lafayette, an der Oper vorbei, über die großen Boulevards, die Rue Royale; dann Place de la Concorde, Cours de la Reine, den Pont de l'Alma und den Quai d'Orsay.
Die Beauchênesche Fabrik lag ganz am Ende des Quai d'Orsay, zwischen der Rue de la Fédération und dem Boulevard de Grenelle. Sie bedeckte ein großes, rechtwinkliges Terrain, dessen eine Ecke, am Quai, von einem schönen Wohnhause eingenommen wurde, einem Hotel mit Ziegel- und Steinfassade, das Léon Beauchêne, der Vater Alexandres, des gegenwärtigen Chefs, hatte bauen lassen. Von den Balkonen erblickte man, jenseits der Seine, an den Hängen von Passy hohe Häuser in Grün gebettet, während sich zur Rechten die beiden Türme des Trocadero erhoben. Seitwärts sah man auch, an der Rue de la Fédération gelegen, ein kleines Haus und einen Garten, den ehemaligen bescheidenen Wohnsitz Léon Beauchênes in der heroischen Zeit fieberhafter Arbeit, in der er sein Vermögen begründete. Die Maschinenhäuser und Arbeitsstätten der Fabrik, ein Komplex grauer Gebäude, von zwei riesigen Schornsteinen überragt, bedeckten den übrigen Teil des Terrains bis zurück zum Boulevard de Grenelle, gegen welchen dieses durch eine hohe, fensterlose Mauer abgeschlossen war. Das bedeutende und wohlbebekannte Fabriketablissement stellte hauptsächlich landwirtschaftliche Maschinen her, von den mächtigsten dieser Art angefangen bis zu den feinsten Instrumenten, welche besondere Sorgfalt der Ausführung erfordern. Und außer den einigen hundert Arbeitern, die hier täglich beschäftigt waren, befand sich dort auch eine Werkstätte mit etwa fünfzig Frauen, Schleiferinnen und Poliererinnen.
Der Eingang zu den Werkstätten und Bureaux lag in der Rue de la Fédération, ein gewaltiges Tor, durch das man den weiten Hof mit seinem geschwärzten Pflaster sah, über welches häufig kleine Bäche dampfenden Wassers rieselten. Dichter Rauch drängte sich aus den hohen Schornsteinen, scharf zischende dünne Dampfsäulen fuhren oberhalb der Dächer heraus, während ein dumpfes Vibrieren, das den Boden fortwährend erbeben machte, die im Innern tätigen Kräfte, das unaufhörliche Pulsieren der Arbeit verriet.
Die große Uhr des Hauptgebäudes zeigte acht Uhr fünfunddreißig Minuten, als Mathieu den Hof durchschritt, um sich in das Bureau zu begeben, das ihm, dem ersten Zeichner, eingeräumt war. Seit acht Jahren schon stand er im Dienste der Fabrik, in welchen er, nach außerordentlich erfolgreichen Fachstudien, als Hilfszeichner mit hundert Franken Monatsgehalt eingetreten war. Sein Vater, Pierre Froment, den seine Frau Marie mit vier Söhnen beschenkt hatte, Jean, dem ältesten, sodann Mathieu, Marc und Luc, hatte sich, obgleich er ihnen die Wahl ihres Berufes freiließ, bemüht, jeden seiner Söhne einem Handfertigkeitserwerbe zuzuführen. Léon Beauchêne, der Gründer der Fabrik, war seit einem Jahre tot, und sein Sohn Alexandre hatte eben seine Nachfolge angetreten und Constance Meunier, die Tochter eines sehr reichen Buntpapierfabrikanten aus dem Marais, geheiratet, als Mathieu in das Haus eintrat, unter den Befehl dieses jungen Chefs, der knapp fünf Jahre mehr zählte als er. Hier hatte er Marianne kennen gelernt, eine arme Cousine Alexandres, damals sechzehn Jahre alt, und sie ein Jahr später geheiratet.
Seit ihrem zwölften Jahre war Marianne der Fürsorge ihres Onkels Léon Beauchêne anheimgefallen. Ein Bruder des letzteren, Felix Beauchêne, ein unruhiger und abenteuerlicher Kopf, war, nach Mißerfolgen aller Art, mit Frau und Tochter nach Algier gegangen, um dort das Glück aufs neue zu versuchen; und diesmal gedieh die Farm, die er da drüben anlegte, vortrefflich, als bei einem plötzlichen Wiederaufflackern des Räubertums Vater und Mutter massakriert und die Gebäude zerstört wurden, so daß das Mädchen, welches durch ein Wunder gerettet ward, keine andre Zuflucht hatte, als das Haus ihres Onkels, der sich während der zwei Jahre, die er noch lebte, sehr liebevoll gegen sie zeigte. Aber da war Alexandre, ein junger Mann von etwas täppischer Kameraderie, und besonders dessen jüngere Schwester, Sérafine, ein großes, wildes Mädchen von bösen Instinkten, die glücklicherweise fast unmittelbar danach, achtzehn Jahre alt, das Haus verließ, unter einem schrecklichen Skandal, einer Flucht mit einem gewissen Baron de Lowicz, einem echten Baron, aber Betrüger und Fälscher, mit dem man gezwungen war, sie zu verheiraten, indem man ihr eine Mitgift von dreimalhunderttausend Franken gab. Als sodann, nach dem Tode seines Vaters, Alexandre sich seinerseits verheiratete, eine Geldehe mit Constance einging, die ihm eine halbe Million mitbrachte, sah sich Marianne fremder und vereinsamter als je neben ihrer neuen Cousine, einer mageren, dürrherzigen, rechthaberischen Frau, welche absolute Gebieterin des Hauses war. Mathieu war da, und einige Monate genügten: eine schöne, starke, gesunde Liebe erwuchs zwischen den beiden jungen Menschen, nicht der Blitzstrahl, der die Liebenden einander in die Arme schleudert, sondern die gegenseitige Achtung, die Zuneigung, der Glauben aneinander, die Gewißheit des Glückes in der gegenseitigen Hingabe, aus welchen die unlösliche Ehe entsteht. Und sie waren beglückt, sich ohne einen Sou zu vereinigen, einander nichts mitzubringen als ihre ganzen Herzen. Mathieu wurde auf zweihundert Franken monatlich gestellt, und sein neuer angeheirateter Cousin ließ ihn lediglich, für eine viel spätere Zeit, auf die Möglichkeit einer Association hoffen.
Im übrigen machte sich Mathieu Froment nach und nach unentbehrlich. Der junge Herr der Fabrik, Alexandre Beauchêne, hatte eine nicht ungefährliche Krise zu bestehen gehabt. Die Mitgift, die sein Vater aus der Kasse des Unternehmens hatte ziehen müssen, um Sérafine zu verheiraten, sowie andre bedeutende Ausgaben, welche diese verderbte und rebellische Tochter verursachte, hatten ihn gezwungen, sein Betriebskapital zeitweilig zu verringern. Als er dann starb, fand man, daß er sich die ziemlich häufige Sorglosigkeit hatte zu schulden kommen lassen, kein Testament zu machen; was zur Folge hatte, daß Sérafine, geldgierig, und ohne Rücksicht für ihren Bruder, ihren Anteil begehrte, ihn zwingen wollte, die Fabrik zu verkaufen, um ihre Ansprüche zu befriedigen. Das Vermögen war in Gefahr, zerstückelt zu werden, die Fabrik gelähmt, die ganze Zukunft des Unternehmens vernichtet. Mit gewaltiger Anstrengung ermöglichte es Beauchêne, ihr ihren Anteil, und einen reichlich bemessenen obendrein, hinauszubezahlen. Noch jetzt erbebte er vor Zorn und Schmerz, wenn er sich der Kämpfe jener Zeit erinnerte. Denn die Lücke, die die Kapitalsentziehung in seine Fonds gerissen, gähnte fürchterlich, und nur um sie zu füllen, hatte er die halbe Million Constances geheiratet – des häßlichen Mädchens, dessen Besitz für seinen Appetit des schönen Mannes einen bitteren Geschmack hatte, und die er so reizlos, so trocken fand, daß er sie selbst »diese Besenstange« genannt hatte, ehe er eingewilligt, sie zu seiner Frau zu machen. In fünf oder sechs Jahren war alles wieder hergestellt, die Geschäfte der Fabrik verdoppelten sich, das Unternehmen entwickelte sich zu außerordentlicher Blüte. Und Mathieu, der einer der tätigsten und nützlichsten Mitarbeiter geworden, war schließlich zum Posten des ersten Zeichners aufgestiegen, mit einem Gehalte von viertausendzweihundert Franken.
Morange, der erste Buchhalter, dessen Bureau an das seinige stieß, erhob den Kopf, als er den jungen Mann eintreten und sich an seinen Zeichentisch begeben hörte.
»Mein lieber Froment, Sie vergessen nicht, daß Sie heute bei uns zu Tische sind, nicht wahr?«
»Gewiß, gewiß, mein lieber Morange, ich vergesse es nicht. Ich hole Sie um Mittag ab.«
Und Mathieu begann mit Sorgfalt den Aufriß einer Dampfdreschmaschine zu überprüfen, eine Konstruktion seiner Erfindung, von großer Einfachheit und bedeutender Leistungsfähigkeit, an welcher er seit langem arbeitete, und welche diesen Nachmittag einem Großgrundbesitzer aus der Beauce, Mr. Firon-Badinier, vorgelegt werden sollte.
Da öffnete sich weit die Tür des Bureaus des Chefs, und Beauchêne trat heraus, ein Mann von großer Gestalt, mit starkgefärbtem Gesichte, schmaler Stirn und großen braunen, vorquellenden Augen. Er hatte eine kräftige Nase, volle Lippen, und trug einen Vollbart, den er sehr pflegte, ebenso wie seine Haare, die sorgfältig nach der Seite gescheitelt waren, um einen schon stark merkbaren Ansatz von Kahlheit bei dem kaum Zweiunddreißigjährigen zu verdecken. Zur frühen Morgenstunde rauchte er bereits eine dicke Zigarre, und seine laute Stimme, seine geräuschvolle Heiterkeit, seine lebhafte Beweglichkeit verrieten die noch kräftige Gesundheit eines Egoisten und Genußmenschen, dessen einzige und souveräne Macht das Geld, das durch die Arbeit andrer sich mehrende Kapital, bildete.
»Ah, Sie sind fertig, wie? Mr. Firon-Badinier hat mir neuerlich geschrieben, daß er um drei Uhr hier sein wird. Und Sie wissen ja, daß Sie heute mit ins Restaurant müssen. Man kann diese Gattung Leute nur zu einem Auftrag bringen, wenn man sie mit gutem Wein begießt. Zu Hause mag Constance derlei nicht, und ich bewirte daher lieber auswärts, – Sie haben Marianne vorbereitet?«
»Jawohl. Sie weiß, daß ich erst mit dem Dreiviertelelfuhrzuge komme.«
Beauchêne hatte sich auf einen Sessel fallen lassen.
»Ach, mein Freund, ich bin todmüde! Ich habe gestern auswärts diniert und bin erst um ein Uhr ins Bett gekommen. Und heute früh der Berg von Arbeit vor mir! Man braucht wahrhaftig eine eiserne Gesundheit, um das auszuhalten.«
Bis jetzt hatte er sich als ein erstaunlicher Arbeiter von ganz ungewöhnlicher Kraft und Widerstandsfähigkeit erwiesen. Außerdem hatte er Proben eines nie versagenden Instinktes für glückbringende Operationen gegeben. Des Morgens der erste in der Fabrik, sah er alles, sah alles voraus, durchdrang das ganze Getriebe mit seiner fortreißenden Energie, so daß sich die Ziffer der Geschäfte von Jahr zu Jahr fast verdoppelte. Aber seit einiger Zeit überkam ihn manchmal eine Ermüdung, Er war stets gewohnt gewesen, stark zu genießen, neben seinem arbeitsvollen Leben einen breiten Raum den Freuden zuzuteilen, denen, die er eingestand, und denen, die er nicht eingestand; so daß gewisse Vergnügungen ihn nun, wie er sagte, kaputt machten.
Er betrachtete Mathieu.
»Sie sind wie ein Baum. Wie stellen Sie es an, daß Sie nie ermüdet aussehen?«
Der junge Mann schien in der Tat, wie er da vor seinem Zeichentische stand, die unverwüstliche Gesundheit einer Eiche zu besitzen. Groß und schlank, hatte er die hohe und breite Stirn der Froment. Er trug sein dichtes Haar kurz geschnitten, fein spitzgeformter Bart kräuselte sich ein wenig. Und was seinem Gesichte hauptsächlich das Gepräge gab, das waren seine Augen, tief und klar, lebhaft und nachdenklich zugleich, und fast immer lächelnd. Ein Mann des Gedankens und der Tat, einfach und heiter, und gut dabei.
»Oh, ich.« erwiderte er lachend, »ich führe mich brav auf.«
Aber Beauchêne protestierte.
»Ah, nein. Sie führen sich nicht brav auf! Man ist nicht brav, wenn man mit siebenundzwanzig Jahren schon vier Kinder hat. Und zwei davon, Ihr Blaise und Ihr Denis, Zwillinge auch noch, gleich als Anfang! Und dann Ihr Ambroise, und Ihre kleine Rose! Ohne das Mädchen zu rechnen, welches Sie vor dieser letzten bei der Geburt verloren haben. Das würde schon fünf machen. Unglücklicher! Nein, nein, ich bin der Brave und Kluge, ich, der ich nur eines habe und mich zu beschränken weiß, als vernünftiger und überlegender Mann!«
Das waren die gewohnten Neckereien, durch die aber eine wirkliche Aergerlichkeit schlug, mit welchen er das junge, sorglose Paar, die Fruchtbarkeit seiner Cousine Marianne überschüttete, die er als skandalös erklärte.
Mathieu, an diese Angriffe gewöhnt, die ihm nichts von seiner Heiterkeit nahmen, fuhr fort zu lachen, ohne auch nur zu antworten, als ein Arbeiter eintrat, Vater Moineaud, wie man ihn in der Fabrik nannte, obgleich er kaum dreiundvierzig Jahre zählte, kurz und stämmig, mit rundem Kopf, einem Stiernacken, Gesicht und Hände von mehr als viertelhundertjähriger Arbeit durchfurcht und gegerbt. Er war Monteur, und er kam, um dem Chef über eine Schwierigkeit zu berichten, die sich bei der Aufstellung einer Mähmaschine ergeben hatte. Aber dieser ließ ihm keine Zeit, den Zweck seines Kommens zu erklären, so hitzig war er dabei, sich gegen die zu zahlreichen Familien zu ereifern.
»Und Sie, Vater Moineaud, wieviel Kinder haben Sie?«
»Sieben, Monsieur Beauchêne,« erwiderte der Arbeiter ein wenig verdutzt. »Drei sind mir gestorben.«
»Das würde also zehn machen. Das ist ja recht hübsch. Wie sollen Sie denn da nicht alle miteinander verhungern?«
Auch Moineaud hatte zu lachen angefangen, als richtiger leichtherziger, sorgloser Pariser Arbeiter, dem kein andres Vergnügen erreichbar war, als das seine Frau ihm bot. Die Kleinen, das wuchs so eins nach dem andern hervor, ohne daß er es gar bemerkte, und er fand sogar viel Freude an ihnen, solange sie nicht aus dem Nest ausgeflogen waren. Und dann, das arbeitete auch, das verdiente einiges. Aber er zog es vor, sich mit einem Scherzworte zu entschuldigen.
»Ja, Monsieur Beauchêne, nicht ich kriege die Kinder, sondern meine Frau.«
Alle drei lachten, und nachdem der Arbeiter endlich sein Anliegen vorgebracht hatte, folgten ihm die beiden andern, um zu untersuchen, woran die Schwierigkeit liege. Sie waren im Begriff, in einen Gang einzubiegen, als es dem Chef, der die Tür zu der Frauenwerkstätte offen sah, einfiel, den Weg durch diese zu nehmen, um in gewohnter Weise einen prüfenden Blick in den Arbeitsraum zu werfen. Es war ein langer und weiter Saal, in welchem die Poliererinnen in schwarzen Wollblusen in zwei Reihen vor ihren kleinen Arbeitstischen saßen und die Stücke mit Bimsstein abrieben, um sie dann an die Schleifmühlen weiterzugeben. Fast alle waren jung, manche hübsch, die meisten mit unschönen und gewöhnlichen Gesichtern. Und ein animalischer Geruch vermengte sich mit dem ranzigen Oeles.
Die Hausordnung verlangte absolutes Schweigen während der Arbeit. Alle schwätzten jedoch. Als sie den Chef bemerkten, verstummten sie plötzlich. Nur eine, die, nach der andern Seite blickend, nichts sah, fuhr fort, sich wütend mit einer andern zu zanken. Es waren die zwei Schwestern, gerade die Töchter des Vaters Moineaud: Euphrasie, die jüngere, diejenige, welche schrie, ein siebzehnjähriges mageres Persönchen mit mattem blondem Haar, länglichem Gesichte und spitzen Zügen, unhübsch und boshaft aussehend; und die ältere, Norine, kaum neunzehn, ein hübsches Mädchen, auch eine Blondine, aber mit milchfarbener Haut, kräftig und üppig, mit Schultern und Armen und Hüften, einem leuchtenden Gesichte, verrückten Haaren und schwarzen Augen, von der ganzen sonnigen, reifen Schönheit der Pariserin.
Schadenfroh ließ Norine ihre Schwester weiterzanken, glücklich darüber, daß sie bei einem Vergehen ertappt wurde. Beauchêne mußte dazwischentreten. Er zeigte sich in der Regel sehr streng in der Frauenwerkstätte, ließ keinerlei Nachgiebigkeit walten, denn er hatte bisher an dem Grundsatze festgehalten, daß ein Chef, welcher sich herbeiläßt, mit seinen Arbeiterinnen zu scherzen, verloren ist. Und in der Tat, trotz seines großen Mannsappetits, den er, wie man sagte, außer dem Hause befriedigte, wußte man auch nicht das kleinste Geschichtchen über eine seiner Arbeiterinnen und ihn zu erzählen, er hatte noch keine berührt.
»Nun, Mademoiselle Euphrasie, werden Sie endlich schweigen? Das ist unanständig! Sie werden zwanzig Sous Strafe zahlen, und wenn ich Sie noch einmal höre, so werden Sie auf acht Tage ausgeschlossen.«
Das Mädchen hatte sich erschrocken umgedreht; und halb erstickend vor Wut warf sie ihrer Schwester, welche sie leicht hätte warnen können, einen haßerfüllten Blick zu. Aber diese fuhr fort zu lächeln, mit ihrer diskreten Miene des begehrenswerten hübschen Mädchens dem Chef gerade ins Gesicht sehend, als ob sie sicher wäre, daß sie nichts mehr zu fürchten habe. Ihre Augen trafen sich, vergaßen sich zwei Sekunden lang ineinander; und er fuhr fort, mit geröteten Wangen und zorniger Stimme, an alle gewendet:
»Sowie die Aufseherin den Rücken wendet, schnattert ihr wie die Elstern. Hütet euch, oder ihr habt es mit mir zu tun!«
Moineaud, der Vater, war während der ganzen Szene unbewegt geblieben, als ob die beiden Mädchen, die, welche der Chef ausschalt, und die, welche er verstohlen anblickte, nicht seine Töchter wären. Die drei Männer nahmen ihren Rundgang wieder auf und verließen die Frauenwerkstätte inmitten einer Totenstille, in welcher man nur das Knirschen der kleinen Schleifmaschinen hörte.
Nachdem die Schwierigkeit bei der Montierung behoben war und der Arbeiter seine Weisungen erhalten hatte, ging Beauchêne zu seiner Wohnung hinauf und nahm Mathieu mit sich, welcher Constance die Einladung überbringen wollte, mit der Marianne ihn betraut hatte. Ein Verbindungsgang führte von den schwarzen Fabrikgebäuden hinüber zu dem luxuriösen Wohnhause am Kai. Sie fanden Constance in einem kleinen gelben Atlassalon, den sie bevorzugte, neben einem Sofa sitzend, auf welchem Maurice, der verhätschelte einzige Sohn, der eben sieben Jahre alt geworden, ausgestreckt lag.
»Ist er krank?« fragte Mathieu.
Der Knabe war seinem Vater sehr ähnlich, ziemlich plumpen Körpers, mit breiten Kinnladen. Aber er war blaß und hatte schwere, ein wenig geränderte Augenlider. Und die Mutter, »diese Besenstange«, eine kleine Brünette, ohne Teint, gelb und welk mit ihren sechsundzwanzig Jahren, betrachtete ihn mit einem Ausdruck egoistischen Stolzes.
»O nein, er ist nie krank,« erwiderte sie. »Nur fühlt er eine Müdigkeit in den Beinen, daher habe ich ihn sich hinlegen lassen und habe gestern abend an Doktor Boutan geschrieben, er möge heute früh kommen.«
»Bah!« rief Beauchêne mit lautem Lachen, »die Frauen sind doch alle gleich. Ein Bursch, der stark ist wie ein Bär! Das möchte ich doch sehen, daß der Kerl da nicht solid gebaut sei!«
Gleich darauf trat Doktor Boutan ein, ein kleiner, beleibter Mann in den Vierzigern mit sehr klugen Augen in seinem vollen, glattrasierten Gesichte, aus welchem große Güte sprach. Er wandte sich sogleich dem Knaben zu, klopfte und horchte ihn ab und sagte dann in seiner wohlwollenden, ob auch ernsten Weise:
»Nein, nein, es ist nichts. Es ist das Wachstum. Der Pariser Winter hat den Knaben ein wenig blaß gemacht, und einige Monate auf dem Lande, in der frischen Luft, werden ihn wiederherstellen,«
»Ich hab' es ja gesagt!« rief Beauchêne wieder.
Constance hatte die kleine Hand ihres Sohnes in der ihrigen behalten, der sich nun wieder auf das Sofa hinsinken ließ und müde die Augen schloß; und sie lächelte glückselig, was ihrem reizlosen Gesichte einen beinahe anziehenden Ausdruck verlieh. Der Doktor hatte Platz genommen. Er war gewohnt, in den befreundeten Häusern plaudernd zu verweilen. Als Geburtshelfer, Frauen- und Kinderarzt war er der natürliche Beichtiger seiner Patienten, kannte alle Geheimnisse, war in den Familien wie zu Hause. Er war es, der Constance von diesem einzigen, so verhätschelten Sohne entbunden hatte, ebenso wie Marianne von den vier Kindein, die sie besaß.
Mathieu war stehen geblieben und hatte gewartet, um seine Einladung anzubringen.
»Da Sie nun also bald aufs Land gehen,« sagte er, »kommen Sie doch vorher auf einen Sonntag nach Janville. Meine Frau würde sich ungemein freuen, Sie bei sich zu sehen und Ihnen unsre Hütte zu zeigen.«
Und er scherzte über die Armseligkeit des abgelegenen Pavillons, den sie bewohnten, erzählte, daß sie nur zwölf Teller und fünf Eierbecher hätten. Beauchêne kannte den Pavillon, denn er jagte jeden Winter in der Gegend; er hatte einen Teil der Jagd in den ausgedehnten Wäldern gepachtet, die von dem Besitzer in Anteilen ausgegeben wurde.
»Séguin ist ja mein Freund, wie Sie wissen. Ich habe in Ihrem Pavillon schon gefrühstückt. Es ist eine miserable Hütte.«
Und Constance, deren Spottlust durch den Gedanken an diese Aermlichkeit erregt wurde, fügte ihrerseits hinzu, daß Madame Séguin, Valentine, wie sie sie nannte, ihr von der Verwahrlosung dieses ehemaligen Jagdhauses erzählt habe. Der Arzt, der lächelnd zuhörte, fiel nun ein:
»Madame Séguin gehört zu meinen Patienten. Gelegentlich ihrer letzten Entbindung, habe ich ihr geraten, für eine Weile ihren Wohnsitz in diesem Pavillon aufzuschlagen. Die Luft ist dort ausgezeichnet, und die Kinder müssen da aufschießen und gedeihen wie Kresse.« Sogleich nahm mit einem lauten Lachen Beauchêne seinen gewohnten Scherz wieder auf.
»Na denn, mein lieber Mathieu, nehmen Sie sich in acht! Wann kommt das fünfte?«
»Oh,« sagte Constance mit beleidigter Miene, »das wäre eine wahre Torheit. Ich hoffe, daß Marianne es dabei bewenden lassen wird. Wahrhaftig, diesmal wäre es unentschuldbar, unverzeihlich!«
Mathieu verstand wohl, was hinter all dem sich barg. Sie verfolgten sie beide, Marianne und ihn, mit ihrem Spotte, einem Mitleide, dem viel Zorn beigemischt war, weil sie nicht begreifen konnten, wie man sich leichten Herzens, freudig der Natur nachgebend, so einzwängen konnte. Das Hinzukommen ihres letzten, der kleinen Rose, hatte ihre Ausgaben schon so vermehrt, daß sie sich hatten aufs Land, in diese Proletarierwohnung flüchten müssen. Und sie wären wohl imstande, den Leichtsinn auf die Spitze zu treiben und noch ein Kind zu bekommen, sie, die nichts besaßen, keinen Heller, keinen Quadratzoll Bodens!
»Außerdem,« fuhr Constance mit der Prüderie ihrer strengen Erziehung fort, »wird das schließlich geradezu unanständig. Wenn ich Leute sehe, die eine Schar von Kindern hinter sich her schleppen, so wirkt das abstoßend auf mich, als ob ich eine Familie Betrunkener sähe. Das ist ebenso widerlich, ja womöglich noch mehr.«
Beauchêne brach wieder in schallendes Lachen aus, obwohl er über diesen Punkt wohl andrer Meinung sein mußte. Im übrigen blieb Mathieu sehr gelassen. Marianne und Constance hatten sich nie vertragen können, sie waren in allen Punkten zu verschieden, und er nahm die Angriffe heiter auf, vermied es, sich zu erzürnen, um es nicht zu einem Bruche kommen zu lassen.
»Sie haben recht,« sagte er einfach, »es wäre eine Torheit. Gleichwohl, wenn ein fünftes kommen sollte, so kann man es wohl nicht gut dahin zurückschicken, woher es gekommen ist.«
»Oh, es gibt Mittel!« rief Beauchêne.
»Was die Mittel betrifft.« sagte Doktor Boutan, der mit seiner väterlichen Miene zugehört hatte, »so kenne ich nicht eines, das nicht schädlich und verwerflich wäre.«
Beauchêne erhitzte sich; diese Frage der Nachkommenschaft und der Entvölkerung war eine von denen, welche er von Grund auf zu beherrschen meinte und über welche er sich gern in tönender Rede erging. Er bestritt vorerst die Kompetenz Doktor Boutans, den er als überzeugten Apostel zahlreicher Familien kannte, indem er scherzend sagte, daß ein Geburtshelfer in dieser Frage kein unbefangenes Urteil haben könne. Dann brachte er vor, was er oberflächlich von Malthus wußte, die Theorie von der geometrischen Progression der Geburten und der mathematischen Progression der Lebensmittel, von der in zwei Jahrhunderten übervölkerten Erde und der der Hungersnot überlieferten Menschheit. Es sei die Schuld der Armen, wenn sie Hungers stürben; sie brauchten bloß sich zu beschränken, nur die Anzahl von Kindern hervorzubringen, die sie ernähren können. Die Reichen, die man fälschlicherweise der sozialen Uebeltat beschuldige, seien, weit entfernt für das Elend verantwortlich zu sein, im Gegenteil die einzig richtig Handelnden, diejenigen, welche, indem sie ihre Familie beschränkten, ihre Bürgerpflicht erfüllten. Und triumphierend wies er darauf hin, daß er sich nichts vorzuwerfen habe, daß das stetige Wachsen seines Vermögens ihn ruhig im Gewissen lasse: um so schlimmer für die Armen, wenn sie arm bleiben wollen! Vergebens erwiderte ihm der Doktor, daß die Malthusische Theorie längst hinfällig sei, daß sie sich auf die mögliche Vermehrung, anstatt auf die wirkliche Vermehrung stütze; vergebens bewies er ihm, daß die gegenwärtige ökonomische Krise, die ungleiche Verteilung der Güter unter der Herrschaft des Kapitalismus die verwerfliche und die einzige Ursache des Elends sei und daß an dem Tage, wo eine gerechte Verteilung der Arbeit vollzogen sei, die fruchtbare Erde mit Leichtigkeit eine vermehrte und glückliche Menschheit ernähren werde; der andre weigerte sich, darauf zu hören, verschanzte sich gleißnerisch hinter seinem Egoismus, indem er erklärte, daß dies alles ihn nicht kümmere, daß er über seinen Reichtum keine Gewissensbisse empfinde und daß diejenigen, welche auch reich werden wollten, eigentlich nichts andres zu tun hätten, als seinem Beispiel zu folgen.
»Das wäre also das wohlüberlegte Ende Frankreichs, wie?« sagte Boutan ironisch. »Die Ziffer der Geburten steigt in England, in Deutschland, in Rußland kontinuierlich, während sie sich bei uns erschreckend vermindert. Wir nehmen der Zahl nach schon jetzt nur noch einen verhältnismäßig untergeordneten Rang in Europa ein; und die Zahl ist heutzutage mehr als je die Macht. Man hat berechnet, daß im Durchschnitt jede Familie vier Kinder haben muß, um jene Vermehrung der Bevölkerung zu bewirken, welche nötig ist, damit die Nation wachse, gedeihe und ihre Machtstellung behaupte. Sie haben nur ein Kind, Sie sind ein schlechter Patriot.«
Beauchêne ereiferte sich, geriet außer sich, überschrie sich.
»Ich ein schlechter Patriot? Ich, der sich zu Tode arbeitet, ich, der ich Maschinen sogar ins Ausland verkaufe! Gewiß, ja, ich sehe Familien um mich, unter unsern Bekannten, welche sich erlauben könnten, vier Kinder zu haben, und ich gebe zu, daß diese sehr zu tadeln sind, wenn sie sie nicht haben. Aber ich, mein Lieber, ich kann nicht! Sie wissen, daß ich, in meiner Lage, absolut nicht kann!«
Und er entwickelte zum hundertstenmal seine Gründe, er erzählte, wie die Fabrik nahe daran gewesen war, zerstückelt, vernichtet zu werden, weil er das Unglück gehabt habe, eine Schwester zu besitzen. Sérafine habe schändlich gehandelt, zuerst die Mitgift, und dann, nach dem Tode ihres Vaters, die erzwungene Teilung, welche bewirkte, daß die Fabrik durch ein bedeutendes Geldopfer hatte gerettet werden müssen, wodurch ihr Gedeihen eine Zeitlang schwer beeinträchtigt wurde. Und man bilde sich ein, daß er die Unklugheit seines Vaters wiederholen, sich der Gefahr aussetzen würde, seinem kleinen Maurice einen Bruder oder eine Schwester zu geben, damit dieser eines Tages sich in derselben entsetzlichen Lage sähe, in welcher das väterliche Erbe damals hätte vom Untergang ereilt werden können! Nein, nein! Er werde ihn nicht in diese Situation bringen, da das Gesetz nun einmal so schlecht, gemacht sei. Er wolle, daß er alleiniger Herr dieses Vermögens sei, das er von seinem Vater übernommen habe und das er ihm vermehrt übergeben werde. Er wolle für ihn den gewaltigen Reichtum, das kolossale Vermögen, welches allein heute die Macht bedeute.
Constance, welche die Hand des Knaben mit dem bleichen Gesicht nicht losgelassen hatte, betrachtete ihn mit außerordentlichem, leidenschaftlichem Stolze, jenem Stolze des Reichtums bei dem Industriellen und Financier, welcher ebenso ehrgeizig und streitbar ist wie der Stolz des Namens bei dem Abkömmling eines altadligen Geschlechtes. Er sollte der einzige sein, einmal König werden, einer der Fürsten der Industrie, Herr der neuen Welt! »Ja, mein Herzblatt, sei ruhig, du wirst weder Bruder noch Schwester haben, darüber sind wir ganz einig. Und wenn dein Papa sich vergessen sollte, so ist deine Mama da, welche dafür sorgen würde.«
Dies gab Beauchêne seine laute Heiterkeit wieder. Er kannte seine Frau als viel eigensinniger als er, viel entschlossener, die Familie zu begrenzen. Er, derb und sinnlich, bestrebt, das Leben zu genießen, tat das Seine ziemlich ungeschickt für die Unterschlagung im ehelichen Alkoven und entschädigte sich im übrigen auswärts; und sie wußte es vielleicht, duldete es, drückte die Augen zu gegen etwas, was sie nicht hindern konnte.
Er bückte sich nun seinerseits und küßte das Kind.
»Hörst du, Maurice? Es ist so, wie Mama sagt: wir werden uns beim Storch kein zweites bestellen.«
Und sich gegen Boutan wendend:
»Sie wissen, Doktor, die Frauen haben schon ihre Mittelchen.«
»Ach!« erwiderte dieser sanft. »Ich habe kürzlich eine behandelt, die daran gestorben ist.«
Beauchêne brach wieder in tolles Gelächter aus; während Constance, verletzt, sich stellte, als verstände sie nicht. Und Mathieu, der keinen Anteil am Gespräch genommen hatte, blieb ernst, denn diese Frage des Nachwuchses besaß für ihn ein furchtbares Gewicht, schien ihm die Mutter aller Fragen, diejenige, welche über das Schicksal der Menschheit und der Welt entscheidet. Kein großer Fortschritt ist gemacht worden, ohne daß ein Uebermaß des Nachwuchses ihn hervorgerufen hätte. Wenn die Völker sich entwickelt haben, wenn die Zivilisation sich verbreitet hat, so ist es, weil jene sich an Zahl vervielfachten, um sich dann über alle Länder der Erde zu ergießen. Und die Entwicklung von morgen, die Wahrheit. die Gerechtigkeit, wird sie nicht erzwungen werden durch die fortwährende Vermehrung der größten Zahl, die revolutionäre Fruchtbarkeit der Arbeiter und der Armen? Alles dies sagte er sich freilich nicht ganz deutlich, schämte sich sogar bereits ein wenig seiner vier Kinder, verwirrt durch die unleugbare Klugheit der Ratschläge, welche die Beauchénes ihm gaben. Aber in ihm kämpfte ein unbesiegbarer Glauben an das Leben, das angeborene Gefühl, daß die größtmögliche Menge von Leben das größtmögliche Glück herbeiführen müsse. Ein jedes Wesen wird nur geboren, um zu zeugen, um Leben zu übertragen und zu verbreiten. Und es gibt auch eine Freude des Werkzeuges, des Arbeiters, der reichlich sein Teil geleistet hat.
»Also Marianne und ich, wir rechnen auf Sie in Janville, nächsten Sonntag?«
Er hatte noch keine Antwort erhalten, als ein Diener eintrat und meldete, daß eine Frau mit einem Kinde auf dem Arm Madame zu sprechen wünsche. Beauchêne, der die Frau Moineauds, des Monteurs, erkannt hatte, ließ sie eintreten. Boutan, der sich bereits erhoben hatte, blieb neugierig.
Die Moineaude war kurz und dick wie ihr Mann, etwa vierzig Jahre alt, vorzeitig verwelkt, mit einem fahlen Gesichte, wässerigen Augen, schwachem und entfärbtem Haar, einem schlaffen Munde, in welchem schon viele Zähne fehlten, Ihre zahlreichen Entbindungen hatten sie entstellt, und sie vernachlässigte sich.
»Nun, liebe Frau, was wünschen Sie?« fragte Constance.
Aber die Moineaude war betreten, in Verlegenheit gebracht durch alle diese Leute, welche sie hier zu finden wohl nicht erwartet hatte. Sie hatte gehofft, mit Madame allein zu sprechen, und sie schwieg.
»Das ist Ihr Jüngstes?« fragte Beauchêne, indem er das bleiche und schwächliche Kind ansah, das sie auf dem Arme trug.
»Ja, Monsieur, das ist mein kleiner Alfred; er ist zehn Monate alt, und ich habe ihn entwöhnen müssen, weil die Milch ausblieb. Vor dem hatte ich neun, von denen drei gestorben sind. Mein Aeltester, Eugène, ist Soldat, da drunten, wo der Teufel gute Nacht sagt, in Tongking. Meine großen Mädchen, Norine und Euphrasie, arbeiten in Ihrer Fabrik. Und zu Hause habe ich noch drei, Victor, der fünfzehn Jahre alt ist, dann Cécile und Irma, zehn und sieben Jahre alt. Dann war's aus, und ich habe nun geglaubt, ich hätte es für alle Zeit überstanden mit dem Kinderhaben. Ich war froh. Aber da ist dieser kleine Balg noch gekommen – mit vierzig Jahren, ob das wohl recht ist! Der liebe Gott muß uns verlassen haben, meinen armen Mann und mich.«
Eine Erinnerung erheiterte Beauchêne.
»Wissen Sie, was er sagt, Ihr Mann? Er sagt, nicht er ist es, der die Kinder kriegt, sondern Sie.« »Ach ja, er hat gut scherzen. Ihn kostet es nicht viel, das Kinderkriegen! Aber Sie werden mir glauben, daß ich es lieber anders möchte. Die erste Zeit wurde mir ganz angst und bang. Aber was wollen Sie? Man muß sich wohl fügen, und ich gab nach, denn ich wollte natürlich nicht, daß mein Mann zu andern Weibern gehe. Dann ist er auch kein schlechter Mann, er arbeitet, er trinkt nicht zuviel, und wenn ein Mann nur dieses Vergnügen hat, so wäre es doch wirklich nicht schön von seiner Frau, nicht wahr, wenn sie ihm das Leben sauer machte.«
Doktor Boutan wendete sich jetzt in seiner ruhigen Weise an die Frau.
»Sie wissen also nicht, daß man, auch wenn man sich vergnügt, vorsichtig sein kann?«
»Ach, mein Gott, Monsieur, das ist nicht immer so leicht. Wenn ein Mann ein bißchen lustig nach Hause kommt, nachdem er mit den Kameraden einen Liter getrunken hat, weiß er nicht so genau, was er tut. Und dann sagt Moineaud, daß ihm das die Freude verdirbt. Und ich, ich gebe nach.«
Nunmehr fuhr der Doktor fort, sie auszufragen, wobei er es vermied, Beauchêne anzusehen. Aber in seinen kleinen Augen blitzte der Spott, und es war offenbar, daß er sich das Vergnügen machte, sich die Beweisführung des Fabrikanten gegen die zu große Fruchtbarkeit anzueignen. Er stellte sich, als ob er sich erzürne, warf der Moineaude ihre zehn Kinder vor, zum Unglück Geborene, Fleisch für die Kanonen oder die Prostitution, machte ihr klar, daß, wenn sie im Elend lebe, dies ihre Schuld sei; denn wenn man sein Glück machen wolle, so hänge man sich nicht einen Pack Kinder auf. Und die arme Frau erwiderte traurig, daß er sehr recht habe; aber sie könnten nicht einmal daran denken, ihr Glück zu machen, Moineaud wisse gewiß, daß er nie Minister werden würde, und so wäre es nun gehauen wie gestochen, ob sie mehr oder weniger Kinder auf dem Halse hätten; es helfe sogar ein wenig, wenn man mehr hätte, wenn die Kinder einmal das Alter erreicht hätten, wo sie arbeiten können.
Beauchêne war verstummt und schritt langsam auf und ab. Eine leichte Kälte, ein unbehagliches Gefühl verbreitete sich, und Constance beeilte sich, wieder zu fragen:
»Nun, meine liebe Frau, was kann ich für Sie tun?« »Ach Gott, Madame, es wird mir so schwer. Es ist etwas, worum Moineaud nicht gewagt hat, Monsieur Beauchêne zu bitten. Ich selbst habe gehofft. Sie allein zu treffen und Sie zu bitten, für uns ein gutes Wort einzulegen. Nämlich, wir wären Ihnen sehr, sehr dankbar, wenn man unsern kleinen Victor in die Fabrik nehmen wollte.«
»Er ist aber erst fünfzehn Jahre alt,« sagte Beauchêne. »Warten Sie, bis er sechzehn ist, die Vorschrift ist streng.«
»Ich weiß, ich weiß. Aber man könnte vielleicht ein kleines bißchen lügen. Es wäre uns eine so große Hilfe!«
»Nein, es ist unmöglich.«
Große Tränen stiegen in den Augen der Moineaude auf. Und Mathieu, der mit leidenschaftlichem Anteil zugehört hatte, war tief erregt. Ah, dieses elende Arbeiterfleisch, das sich anbietet, ohne nur abzuwarten, daß es reif für die Anstrengung sei! Diese Proletarier, welche zur Lüge ihre Zuflucht nehmen wollen, welche der Hunger antreibt, sich gegen das Gesetz zu stellen, das sie beschützt!
Nachdem die Moineaude trostlos fortgegangen war, sprach der Doktor weiter über die Frauen- und Kinderarbeit. Von der ersten Entbindung angefangen, kann eine Frau nicht mehr in der Fabrik bleiben: die Schwangerschaft, das Stillen des Kindes fesseln sie an das Haus, wenn sie sich und das Kind nicht schweren Krankheiten aussetzen will. Und was die Kinder betrifft, so werden sie durch zu frühe Arbeit anämisch, häufig selbst krüppelhaft, abgesehen davon, daß ihre Ausnutzung dazu dient, die Löhne der Erwachsenen zu drücken. Dann kam er wieder auf die Fruchtbarkeit des Elends, auf die Vermehrung des Proletariats, welches nichts zu verlieren, nichts zu erhoffen hat. Ist es nicht die entsetzlichste Fortpflanzung, jene, welche die Verhungernden und sich verzweifelt Empörenden in die Unendlichkeit vermehrt?
»Ich verstehe Sie wohl,« sagte endlich, ohne sich zu erzürnen, Beauchêne. »Sie wollen mich in Widerspruch mit mir selbst setzen, mich zu dem Geständnis bringen, daß ich mir die sieben Kinder Moineauds gefallen lasse und ihrer bedarf, während ich mit meinem festen Vorsatz, bei einem einzigen Sohn zu bleiben, die Familie verstümmele, um das Vermögen nicht zu verstümmeln. Frankreich, das Land der einzigen Sühne, wie man es jetzt nennt, nicht wahr? Nun denn, es ist so! Aber, mein Lieber, die Frage ist so kompliziert, und wie sehr recht habe ich im Grunde!«
Und er setzte seinen Standpunkt auseinander, schlug sich an die Brust, indem er ausrief, er sei liberal, er sei Demokrat, er sei Anhänger eines jeden wirklichen Fortschrittes. Er erkenne bereitwillig an, daß Kinder hervorgebracht werden müßten, daß die Armee Soldaten brauche und die Fabriken Arbeiter. Nur aber trete er auch für die Pflicht der Klugheit der höheren Klassen ein, er stehe auf dem Standpunkt des Reichen, des Konservativen, welcher sich in dem erworbenen Vermögen stabilisieren wolle.
Und Mathieu begriff schließlich die brutale Wahrheit: des Kapital ist gezwungen, auf die Vermehrung des Heeres des Elends zu rechnen, es muß die Fruchtbarkeit der besoldeten Klassen befördern, um die Fortdauer seines Gewinnes zu sichern. Das Gesetz ist, daß zuviel Kinder da sein müssen, damit genug billige Arbeiter da seien. Ueberdies entkleidet die Spekulation mit den Arbeitspreisen die Arbeit aller ihrer Würde, und sie wird als das ärgste aller Uebel betrachtet, die in Wirklichkeit das edelste aller Güter ist. Und dies ist daher das fressende Krebsgeschwür: Im Lande der politischen Gleichheit und der ökonomischen Ungleichheit wirkt das kapitalistische Regime, der schlecht verteilte Reichtum dahin, die Fortpflanzung zugleich einzudämmen und zu befördern, dergestalt die Ungleichheit der Verteilung immer noch vergrößernd: auf der einen Seite die Reichen mit einzigen Söhnen, welche, indem sie gierig ihren Besitz vor jeder Schmälerung schützen, denselben immer vermehren; auf der andern Seite die Armen, deren untergeordnete Fruchtbarkeit das Wenige, das sie haben, immer noch mehr zerbröckelt. Es sei morgen die Arbeit geehrt, eine gerechte Verteilung des Reichtums vollzogen, und das Gleichgewicht wird sich von selbst ergeben. Andernfalls steuern wir der Revolution zu, und daher das stündlich sich mehrende Grollen, die Krämpfe, von denen die alte, in Auflösung begriffene Gesellschaft geschüttelt wird.
Aber Beauchêne spielte sich triumphierend auf den umfassenden Geist hinaus, erkannte den beunruhigenden Fortschritt der Entvölkerung an, wies auf ihre Ursachen hin, den Alkoholismus, den Militarismus, die Sterblichkeit der Neugeborenen und zahlreiche andre. Dann gab er die Heilmittel an, Herabsetzung der Zölle fiskalischer Hilfsmittel, an denen er keinen Gefallen finde, weiteste Freiheit der Testierung, Revision der Ehegesetze, nicht zu vergessen die Konstatierung der Vaterschaft.
Boutan unterbrach ihn endlich.
»Alle diese Maßregeln würden nichts nutzen. Es sind die Sitten, die man ändern muß, und den Begriff der Moral, und den Begriff der Schönheit. Wenn Frankreich sich entvölkert, so ist es, weil es dies will. Es ist daher einfach nötig, daß es dies nicht mehr wolle. Aber welch eine Aufgabe, eine ganze Welt neu zu schaffen!«
Worauf Mathieu mit heiterem Stolze ausrief:
»Nun denn, wir werden sie neu schaffen! Was mich betrifft, ich habe schon angefangen!«
Constance lachte ziemlich widerwillig und antwortete endlich auf seine Einladung, daß sie ihr mögliches tun werde, daß sie aber sehr fürchte, daß sie nicht imstande sein werde, einen Sonntag für Janville zu erübrigen. Ehe er ging, gab Boutan Maurice einen leichten freundschaftlichen Schlag auf die Wange, worauf der Knabe, der unter dem Geräusche der Konversation geschlummert hatte, die schweren Augenlider hob. Und Beauchêne scherzte noch zum Schluß:
»Also, Maurice, du hast gehört, es ist beschlossene Sache. Mama geht morgen zum Storch, um dir ein Schwesterchen zu bestellen.«
Aber das Kind protestierte, fing zu weinen an.
»Nein, nein, ich will nicht!«
Mit einer leidenschaftlichen Gebärde umschlang ihn Constance, die sonst so steife und kalte Frau, und küßte ihn aufs Haar.
»Nein, nein, mein Liebling! Du siehst ja, Papa macht nur Spaß. Niemals, niemals, ich schwöre es dir!«
Beauchêne begleitete den Doktor. Er fuhr fort, zu scherzen, voll Lebensfreude, zufrieden mit sich und den andern, in der Sicherheit, sein Leben nach seinem Vergnügen und seinen Interessen aufs beste einzurichten.
»Auf Wiedersehen, Doktor. Nichts für ungut. Und dann, sagen Sie einmal, wenn man eines will, ist es immer noch Zeit, ein Kind zu haben, wie?«
»Nicht immer,« erwiderte der Arzt im Hinausgehen.
Das Wort fiel klar und schneidend wie ein Beilhieb. Und die Mutter, die das Kind aufgehoben hatte, stellte es nun auf die Füße und sagte ihm, es möge spielen gehen. Eine Stunde später, einige Minuten nachdem es zwölf geschlagen hatte, kam Mathieu, der sich in den Werkstätten verspätet hatte, herab, um Morange abzuholen, wie er es ihm versprochen hatte, und nahm den Weg, um ihn abzukürzen, durch die Frauenwerkstätte. Und hier in dem großen Saale, der bereits leer und still war, bot sich ihm unerwartet eine Szene, die ihn verblüffte. Norine, die unter irgendeinem Vorwande zurückgeblieben war, lag, den Kopf zurückgeworfen, mit schwimmenden Augen im Arm Beauchênes, der sie heftig an sich drückte und seine Lippen auf die ihrigen preßte. Es war der unterschlagende Gatte, der hungrige Mann, welcher seine Kraft an andre Stelle trug. Sie flüsterten zusammen, zweifellos irgendein Stelldichein bestimmend. Dann sahen sie Mathieu und blieben erstarrt. Und er eilte davon, höchst peinlich berührt, daß er dieses Geheimnis entdeckt hatte.
2
Morange, der erste Buchhalter, war ein Mann von achtunddreißig Jahren kahlköpfig, schon etwas angegraut, mit einem sehr schönen, fächerförmigen Vollbart, auf den er stolz war. Seine runden, hellen Augen, seine gerade Nase, sein hübschgeformter, ein wenig großer Mund hatten ihm in jüngeren Jahren den Ruf eines schönen Mannes verschafft; und er verwendete viel Sorgfalt auf sich, trug stets Zylinder und war sehr darauf bedacht, in seiner Erscheinung die Korrektheit des höhergestellten und gewissenhaften Bureaumannes zu zeigen.
»Sie kennen unsre neue Wohnung noch nicht,« sagte er zu Mathieu, als sie miteinander die Fabrik verließen. »Sie werden sehen, wie schön sie ist. Ein Schlafzimmer für uns, eines für Reine. Und zehn Schritte von der Fabrik entfernt; ich bin in vier Minuten zu Hause, nach der Uhr konstatiert.«
Er war der Sohn eines kleinen Handelsangestellten, welcher nach vierzig Jahren engen Bureaulebens auf seinem Schreibtischsessel gestorben war. Und er hatte die Tochter ebenfalls eines Angestellten geheiratet, Valérie Duchemin, deren Vater die Ungeschicklichkeit begangen hatte, vier Töchter zu haben, was den Haushalt zu einer wahren Hölle gemacht hatte, mit allen unvermeidlichen Drangsalen, allen demütigenden Entbehrungen der Armut. Die älteste, Valérie, schön und ehrgeizig, die das Glück gehabt hatte, ohne Mitgift diesen hübschen Mann zu bekommen, welcher obendrein brav und arbeitsam war, hatte seither stets davon geträumt, eine soziale Stufe höher zu steigen, dieser Welt der kleinen Angestellten, die ihr verhaßt war, zu entrinnen, indem sie ihren Sohn zum Arzt oder Advokaten machte. Unglücklicherweise war aber das so sehnsüchtig erwartete Kind ein Mädchen, und sie wurde von Angst erfaßt, sie sah sich, wenn sie so fortfuhr, mit vier Töchtern auf dem Halse, wie ihre Mutter. Da änderte sie das Ziel ihrer Träume, beschloß, sich unbedingt auf dies eine Kind, auf ihre kleine Reine zu beschränken, ihren Mann zu den höchstbezahlten Posten vorwärtszubringen, um ihr eine große Mitgift geben und endlich in jene höhere Sphäre aufsteigen zu können, nach welcher sie ein verzehrendes Verlangen trug. Er, eine schwache und zärtliche Natur, der sie vergötterte, machte sich bald ihren Ehrgeiz zu eigen, dachte unaufhörlich daran, rasch zu steigen, und war voll von stolzen und weitschauenden Projekten. Er befand sich nun seit acht Jahren in der Beauchêneschen Fabrik, sein Gehalt betrug nicht mehr als fünftausend Franken, und das Ehepaar war im höchsten Grade ungeduldig und unzufrieden, denn in dieser Weise würde der Mann nie sein Glück machen.
»Sehen Sie,« sagte Morange, als sie etwa zweihundert Meter weit den Boulevard de Grenelle hinabgeschritten waren, »das neue Haus dort an der Ecke ist es. Sieht es nicht vornehm aus?«
Mathieu sah eines jener hohen modernen Gebäude, geziert mit Balkonen und Skulpturen, welches grell gegen die armseligen, kleinen Häuser der Umgebung abstach.
»Das ist ja ein wahres Palais!« rief er, um Morange Freude zu machen, der sich in die Brust warf.
»Sie sollen nur erst die Treppe sehen. Wissen Sie, es ist im fünften Stock. Aber auf einer solchen Treppe steigt man so angenehm, daß man oben ist, ehe man es merkt.«
Er ließ seinen Gast in das Vestibül wie in einen Tempel eintreten. Die Stuckmauern glänzten, die Stufen waren mit einem Teppich belegt, die Fenster bestanden aus bunten Glasscheiben. Im fünften Stock angelangt, öffnete er die Tür mit seinem Schlüssel, immerfort strahlenden Gesichtes wiederholend: »Sie werden sehen, Sie werden sehen!« Madame Valérie und Reine mußten nach ihnen gespäht haben, und sie eilten sogleich herbei. Valérie, jetzt zweiunddreißig Jahre alt, sah reizend und noch sehr jung aus: eine liebenswürdige Brünette, mit rundem und lächelndem Gesicht, welches von schönem Haar eingefaßt war, die Brust schon etwas zu stark, aber mit prachtvollen Schultern, auf welche Morange stolz war, wenn sie sich dekolletierte. Reine, zwölf Jahre alt, war das frappante Ebenbild ihrer Mutter, mit demselben lächelnden, vielleicht ein wenig länglicheren Gesichte, unter demselben schwarzen Haar.
»Wie liebenswürdig von Ihnen, daß Sie unsrer Einladung gefolgt sind!« sagte Valérie lebhaft, indem sie Mathieu beide Hände schüttelte. »Und wie schade, daß Madame Froment nicht mit Ihnen kommen konnte! Reine, nimm dem Herrn doch den Hut ab.«
Dann sogleich:
»Sie sehen, wir haben ein sehr helles Vorzimmer. Wollen Sie vielleicht, während die Eier ins Wasser gelegt werden, die Wohnung besichtigen? Sie haben es dann hinter sich, und Sie werden wenigstens wissen, wo Sie essen.«
Das alles war in so liebenswürdigem Tone gesagt, und Morange selbst lachte mit so viel gutmütiger Befriedigung, daß Mathieu sich gern zu dieser unschuldigen Schaustellung der Eitelkeit hergab. Sie betraten zuerst den Salon, welcher die Ecke des Hauses bildete, mit perlgrauer, goldgeblümter Tapete bekleidet und mit nach dem Dutzend erzeugten, weißlackierten Möbeln im Stile Ludwigs XIV. ausgestattet, in welche das Piano aus Palisander einen dicken schwarzen Fleck brachte. Sodann, nach dem Boulevard de Grenelle zu, das Zimmer Reines, blaßblau tapeziert, mit einem vollständigen Mädchenmeublement in Pitchpine-Imitation. Das sehr kleine Schlafzimmer der Eltern befand sich am andern Ende der Wohnung, vom Salon durch das Speisezimmer getrennt, war gelb ausgeschlagen und mit einem Doppelbett, einem Spiegelschrank und einem Toilettetisch in Zypressenholz möbliert. Endlich im Speisezimmer triumphierte das klassische Alteichen, inmitten dessen eine sehr stark vergoldete Hängelampe, oberhalb des blendend weißen Gedeckes, wie ein Feuerstrahl erglänzte.
»Das ist ja reizend!« wiederholte Mathieu, um liebenswürdig zu sein. »Das ist ja wunderhübsch!«
Vater, Mutter und Tochter waren freudig erregt, konnten sich nicht genugtun, ihn herumzuführen, ihm zu erklären, ihn die Sachen berühren zu lassen. Aber was ihm besonders auffiel, das war ein gewisses schon Gesehenes, eine Anordnung des Salons, welche er kannte, eine Art, die verschiedenen Dinge zu verteilen, die ihn an etwas erinnerte. Und dann sah er, daß die Morange in ihrer tiefen Bewunderung, in ihrem geheimen Neide versucht hatten, die Beauchêne nach Möglichkeit zu kopieren. Sie, mit ihren beschränkten Mitteln, konnten sich nur einen imitierten Luxus verschaffen, und auch diesen nur unter beträchtlichen Opfern; aber trotzdem waren sie darauf stolz, bildeten sich ein, sich dieser höheren und heißbeneideten Klasse zu nähern, indem sie sie von weitem nachahmten.
»Und endlich,« sagte Morange, das Fenster des Speisezimmers öffnend, »haben wir das da.«
Ein Balkon lief der ganzen Wohnung entlang. Von dieser Höhe war die Aussicht wirklich sehr schön, mit der Seine in langem Lauf und den Hügeln von Passy jenseits der Dächer – dieselbe Aussicht, die man von den Fenstern des Beauchêneschen Wohnhauses genoß, nur erweitert.
Valérie verfehlte auch nicht, ihn darauf aufmerksam zu machen.
»Wie? Ist das nicht großartig? Das ist etwas andres als die vier Bäume, die man vom Kai aus sieht!«
Das Dienstmädchen brachte die Eier, und man setzte sich zu Tische, während Morange triumphierend sagte, dies alles koste ihn nicht mehr als sechzehnhundert Franken jährlich. Es sei halb umsonst, sagte er, obgleich die Summe schwer auf dem Budget des Haushaltes lastete. Mathieu, der nunmehr begriff, daß man ihn hauptsächlich eingeladen hatte, um ihm die neue Wohnung zu zeigen, sah mit stiller Heiterkeit, wie glücklich diese guten Leute waren, vor ihm zu stolzieren. Selbst ohne jeden berechnenden Ehrgeiz, ohne Neid für den Luxus andrer Leute, zufrieden damit, in aller Einfachheit mit seiner Marianne und seinen Kindern zu leben, verwunderte er sich lediglich über diese von der Sucht zu scheinen und sich zu bereichern gefolterte Familie, betrachtete sie ohne Zorn, lächelnd und doch ein wenig traurig.
Valérie trug ein hübsches Kleid aus leichtem Foulard mit gelben Blumen, während ihre Tochter Reine, welche sie kokett zu kleiden liebte, in blauem Leinenkleide war. Und auch die Mahlzeit war zu reichlich: Seezungen nach den Eiern, sodann Koteletten, dann Spargel. Das Gespräch drehte sich um Janville.
»Ihre Kinder befinden sich also wohl? Es sind so reizende Kinder! – Und es gefällt Ihnen auf dem Lande. Es ist merkwürdig, ich glaube, ich würde mich da langweilen, es fehlt zu sehr an Zerstreuung. – Sicherlich werden wir uns das Vergnügen machen, Sie da zu besuchen, da Madame Froment so liebenswürdig ist, uns einzuladen.«
Aber unabwendbar geriet das Gespräch wieder auf die Beauchêne. Es war eine Manie bei den Morange; sie lebten in einer fortwährenden Bewunderung, welche nicht frei von versteckter Kritik war. Valérie, sehr stolz darauf, von Constance an ihrem Jour empfangen zu werden und von ihr zweimal zum Diner eingeladen worden zu sein, hatte sich ebenfalls einen Jour bestimmt, den Dienstag, gab intime Abendgesellschaften, ruinierte sich in kleinen Luxusausgaben. Sie sprach auch mit großer Ehrerbietung von Madame de Séguin du Hordel, von dem prächtigen Palais in der Avenue d'Antin, wohin Constance sie einmal gefälligerweise zu einem Ball hatte laden lassen. Und sie zeigte sich noch eitler auf die Freundschaft, welche ihr Sérafine, die Schwester Beauchênes, zuteil werden ließ, die sie nie anders als die Frau Baronin de Lowicz nannte.
»Sie ist einmal zu meinem Jour gekommen, sie ist so liebenswürdig und so heiter! Sie haben sie früher gekannt, nicht wahr, nach ihrer Heirat, nachdem sie sich mit ihrem Bruder wieder aussöhnte, mit dem sie sich infolge ihrer bedauerlichen Geldstreitigkeiten entzweit hatte. Das ist eine, die Madame Beauchêne nicht ins Herz geschlossen hat!«
Und sie kam wieder auf diese zu sprechen, fand, daß der kleine Maurice, so dick er war, kein gesundes Aussehen hatte, ließ durchblicken, welch schrecklicher Schlag es für die Eltern wäre, wenn sie diesen einzigen Sohn verlören. Sie hätten sehr unrecht, ihm nicht einen kleinen Bruder zu geben. Aber sie tat, als habe sie ganz im Vertrauen aus kompetentestem Munde erfahren, daß es die Frau sei, welche sich, mehr noch als der Mann, widersetze. Sie zwinkerte mit den Augen, Reines wegen, die unbefangen auf ihren Teller blickte, erzählte aber gleichwohl von einer Freundin, welche keine Kinder wolle, während der Mann deren wolle: also richte diese Freundin sich ein. »Aber,« sagte Mathieu lachend, »es scheint mir, daß auch Sie sich einrichten.«
»Oh!« rief Morange, »wie können Sie uns arme Leute mit Monsieur und Madame Beauchêne vergleichen, die so reich sind! Sie sollen mir ihr Vermögen, ihre Stellung geben, und ich bin einverstanden, ein Dutzend Kinder zu haben!«
»Und dann,« sagte Valérie mit einem leichten Schauder, »noch eine Tochter zu haben, ich danke! Ja, wenn wir sicher wären, einen Knaben zu bekommen, würden wir uns vielleicht dazu verleiten lassen. Aber ich habe zuviel Angst, ich glaube, daß ich wie meine Mutter bin, die vier Mädchen gehabt hat. Sie können sich nicht vorstellen, was das heißt, das ist ein Fluch!«
Sie schloß die Augen, sie sah den schrecklichen Haushalt wieder, die vier mageren, verschüchterten Mädchen, die monatelang auf Schuhe, Kleider, Hüte warten mußten, die sich Jahr um Jahr älter werden sahen, von der Furcht gequält, keinen Mann zu bekommen. Für Mädchen muß man eine Mitgift haben.