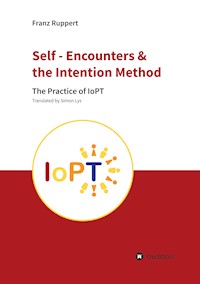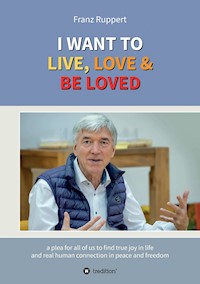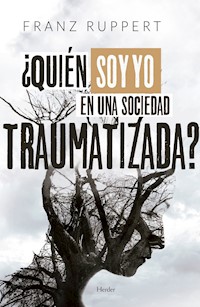34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Leben Lernen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Bereits durch vorgeburtliche Einflüsse oder Ereignisse rund um die Geburt und unmittelbar danach kann die Seele Schaden nehmen: so z.B. durch Abtreibungsversuche, Tod eines Zwillings im Mutterleib, schwierige Geburt, Operationen im Säuglingsalter oder eine Wochenbettdepression der Mutter. Diese und viele andere Störungen der frühren Lebenszeit sind der Erinnerung normalerweise nicht zugänglich. Durch das von Franz Ruppert entwickelte Verfahren "Aufstellen des Anliegens" können auch früheste Traumata rekonstruiert und damit auflösbar werden. In 16 Autoren-Beiträgen, die jeweils ein Thema aus dem prä-, peri- und postnatalen Bereich praxisnah darstellen, erschließt sich die ganze Bandbreite der frühesten Entwicklungsrisiken und auch ihre Heilungschancen. In einem ausführlichen Einleitungs- und Schlusskapitel führt Franz Ruppert in die Methode ein und gibt eine Zusammenschau des Anwendungsfeldes. »Es bleibt ein Verdienst von Franz Ruppert, einen Baustein zur Aufklärung über vielfältige Leiden von Menschen mit chronisch-frühkindlicher Traumatisierung beigetragen zu haben.« Margret Dörr, socialnet.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Ähnliche
Franz Ruppert
Frühes Trauma
Schwangerschaft, Geburt und erste Lebensjahre
Co-Autorinnen:Birgit Assel, Vivian Broughton, Doris Brombach, Annemarie Denk, Christina Freund, Gabriele Hoppe, Liesel Krüger, Petra Lardschneider, Manuela Specht, Andrea Stoffers, Dagmar Strauss, Cordula Schulte, Alice Schultze-Kraft, Marta Thorsheim, Margriet Wentink
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2014 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Umschlag: Jutta Herden, Stuttgart
Titelbild: Wassertropfen auf Grünes Blatt / © ThomasVogel – Stockfoto
Printausgabe: ISBN 978-3-608-89251-2
E-Book: ISBN 978-3-608-10751-7
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20254-0
Dieses E-Book entspricht der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Inhalt
Vorwort
1. Frühe Traumatisierungen und das »Aufstellen des Anliegens« (Franz Ruppert)
1.1 Mehrgenerationale Psychotraumatologie
1.2 Traumatisierung durch Naturgewalten
1.3 Traumatisierung durch Menschengewalt
1.4 Traumatisierung der Liebe
1.5 Traumatisierung der Sexualität
1.6 Quellen früher Traumatisierungen
1.7 Traumatisierte und traumatisierende Mütter
1.8 Väter und frühes Trauma
1.9 Das traumatisierende Potenzial der Geburtshilfe und -medizin
1.10 Assistierte Reproduktion
1.11 Frühe Gewalterfahrungen
1.12 Das »Aufstellen des Anliegens« – eine traumatherapeutische Option
1.13 Was macht das »Aufstellen des Anliegens« zuverlässig?
1.14 Schritte zur Traumaintegration
1.15 Trauma-Überlebensstrategien erkennen
1.16 Frühes Bewusstsein?
2. Die Zeugung als Ausgangspunkt für frühe Traumatisierungen (Marta Thorsheim)
2.1 Die Zeugung bei Eltern mit gesunden psychischen Strukturen
2.2 Die Zeugung bei Eltern mit Traumaanteilen und Überlebensanteilen
2.3 Das sexuelle Verhältnis zwischen den Geschlechtern früher und heute
2.4 Traumatisierte Eltern – eine historische Konstante
2.5 Zeugung als Vergewaltigung
2.6 Zeugung als Ersatzkind
2.7 Zeugung, um die eigenen Eltern zu ersetzen
2.8 Hineingezeugt in eine Familie von Opfern und Tätern
3. Mütterliche Ambivalenz in der Schwangerschaft (Alice Schultze-Kraft)
3.1 Die Gesichter mütterlicher Ambivalenz
3.2 Folgen mütterlicher Ambivalenz
3.3 Das eigene Symbiosetrauma der Mutter
3.4 Folgen für die therapeutische Arbeit
4. Unerfüllter Kinderwunsch (Annemarie Denk)
4.1 Statistische Daten
4.2 Was steht hinter dem Kinderwunsch?
4.3 Blockaden und Störungen für den Kinderwunsch
4.4 Der Beginn des Fühlens und der Wahrnehmung
4.5 Künstliche Befruchtung als mögliche Quelle für die Entstehung von Traumata
4.6 Samenspende/Eizellspende/Leihmutterschaft
4.7 Folgen der künstlichen Befruchtung für die Kinder
4.8 Alternativen zur künstlichen Reproduktion
5. Abtreibungen und Trauma (Gabriele Hoppe)
5.1 Häufigkeit von Abtreibungen
5.2 Rechtliche Regelungen
5.3 Abtreibungsmethoden
5.4 Folgen von Abtreibungen für die Frauen
5.5 Die Rolle der Väter
5.6 Die gesellschaftliche Situation der schwangeren Mütter
5.7 Psychische Folgen und Möglichkeiten ihrer Bearbeitung
5.8 Kinder, die Abtreibungen überlebt haben
5.9 »Aufstellen des Anliegens« bei überlebten Abtreibungen
6. Traumatische Erfahrungen in der Gebärmutter (Doris Brombach)
6.1 Die Gebärmutter als Sinnbild von Weiblichkeit
6.2 Aufstellungen mit Kindern
7. Schwangersein und Gebären aus Sicht der mehrgenerationalen Psychotraumatologie (Birgit Assel)
7.1 Vorsorgeuntersuchungen erzeugen Sorgen
7.2 Pränataldiagnostik erschwert die Mutter-Kind-Beziehung
7.3 Frauen in der Opferhaltung
7.4 Medizinische Geburtshilfe
7.5 Die Entwicklung der medizinischen Geburtshilfe im historischen Kontext
7.6 Geburt und sexuelle Gewalt
7.7 Gewalterfahrungen von Frauen während des Geburtsprozesses
7.8 Gebären und die Frauenbewegung der 80er-Jahre
7.9 Geburten im 21.Jahrhundert
7.10 Routinemaßnahmen und Stress während der »normalen« Geburt
7.11 Hausgeburten
7.12 Kaiserschnittgeburten
7.13 Der geplante Kaiserschnitt
8. Frühgeburten als Folgen und Ursachen von Traumatisierungen (Manuela Specht)
8.1 Frühgeburten aus medizinischer Sicht
8.2 Die Känguru-Methode als Überlebenshilfe
8.3 Stress und Frühgeburten
8.4 Trauma und Frühgeburt
8.5 Frühgeburt und Symbiosetrauma
8.6 Persönliche Erfahrungen mit der Methode der Aufstellungsarbeit
9. Abnabelungs- und Wiederanbindungsprozess als letzte Phase der Geburt (Dagmar Strauss)
9.1 Die erste Begegnung von Mutter und Kind außerhalb des Mutterleibes
9.2 Die Rolle des Vaters beim Geburts- und Bindungsprozess
9.3 Ein gelungener Abnabelungs- und Neuanbindungsprozess
9.4 Traumatisierung während der letzten Phase der Geburt
9.5 Eine traumatisch unterbrochene Anbindung
9.6 Hilfe für symbiosetraumatisierte Kinder
10. Fehl- und Totgeburten als Trauma (Cordula Schulte)
10.1 Der Tod eines Kindes – ein Verlusttrauma
10.2 Zahlen – Daten – Fakten
10.3 Die therapeutische Praxis
10.4 Fehl- und Totgeburten in der Familie
10.5 Der Bindungsprozess während der Schwangerschaft
10.6 Folgekinder und Störungen der Bindungsbereitschaft
10.7 Sogenannte »Schreikinder«
10.8 Aufstellungen bei einem Verlusttrauma
10.9 Zurück zum »Bauchgefühl«
11. »Psychosen« nach der Geburt (Petra Lardschneider)
12. Mütter zwischen Karrierewünschen, Geldnöten und Zeit für ihre Kinder (Christina Freund)
12.1 Wie lange können Kinder ohne Mutter sein?
12.2 Stress-Studien zu Kinderkrippen und Kindertagesstätten
12.3 Geben traumatisierte Mütter ihre Kinder leichter in Kinderkrippen und Fremdbetreuung?
12.4 Spaltung als notwendiger Überlebensmechanismus der Kinder
13. Aufwachsen bei den Großeltern als frühes Trauma (Andrea Stoffers)
14. Gewalt statt Liebe von Anfang an (Margriet Wentink)
14.1 Frühe Gewalt
14.2 Verborgene Gewalt
14.3 Die Folgen früher Gewalt für die Persönlichkeitsentwicklung
14.4 Schritt für Schritt die Wahrheit zulassen
14.5 Explizites und implizites Gedächtnis
15. Frühes Trauma, Adoption und Pflegeeltern (Liesel Krüger)
15.1 Eigene Statistik
15.2 »Arbeit am Tonfeld®«
15.3 »Arbeit am Tonfeld®« mit Pflege- und Adoptiveltern
16. Essstörungen als Folgen früher Traumatisierungen (Andrea Stoffers)
17. »Magersucht« und frühes Trauma (Franz Ruppert)
18. Symbiotisches Trauma in der Einzelarbeit (Vivian Broughton)
18.1 Trauma und Einzelsetting
18.2 Das »Aufstellen des Anliegens« im Einzelsetting
18.3 Herausforderungen und Vorteile
19. Heilung und Prävention von frühen Traumata (Franz Ruppert)
19.1 Schrittweise Heilungsprozesse
19.2 Vorbeugen ist effektiver als heilen
Anhang
Glossar von Fachbegriffen
Literatur
Informationen aus Tages- und Wochenzeitungen
Internetlinks
Autorenverzeichnis
Vorwort
Dass wir in der Regel bereits neun Monate alt sind, wenn wir »auf die Welt kommen«, wissen wir. Dass auch unser psychisches Leben bereits vor der Geburt beginnt, ist noch nicht zum allgemeinen Wissen geworden. Sonst würden wir uns dem werdenden Leben gegenüber anders verhalten – in der Partnerschaft, innerhalb der Familie, in der Schwangerschaftsvorsorge, Geburtshilfe oder auch in der sogenannten assistierten Reproduktion.
Ungeborene sind wahrnehmende, fühlende und erkennende Wesen. Was sie während der Schwangerschaft und während des Geburtsprozesses erleben, hat eine prägende Wirkung auf ihre weitere körperliche wie psychische Entwicklung. Es können gute und liebevolle Erfahrungen sein, die ein solides Fundament legen für eine stabile und in sich ruhende Persönlichkeit. Es können aber auch Erfahrungen von Stress bis hin zu traumatisierenden Erlebnissen sein, die dann möglicherweise ein ganzes Leben negativ prägen.
Die verschiedenen Möglichkeiten, ein »frühes Trauma« zu erleiden, sind daher auch im Rahmen psychotherapeutischer Behandlungen in Betracht zu ziehen. Wenn Menschen an Symptomen leiden, die man als »Ängste«, »Depressionen«, »Persönlichkeitsstörungen« oder gar »Psychosen« bezeichnet, ist deren Ursache möglicherweise schon vor der Geburt eines Patienten zu finden.
»Frühes Trauma« ist die Fortsetzung des Projekts, eine umfassende Theorie einer mehrgenerationalen Psychotraumatologie zu entwickeln. Begonnen habe ich dieses Vorhaben mit dem Schreiben der »Verwirrten Seelen«, erschienen 2002 im Kösel Verlag München. Diesem Buch folgten »Trauma, Bindung, Familienstellen«, »Seelische Spaltung und Innere Heilung« und »Symbiose und Autonomie«, jeweils 2005, 2007 und 2010 im Klett-Cotta Verlag Stuttgart veröffentlicht. Danach kam noch »Trauma, Angst und Liebe«, 2012 wiederum beim Münchner Kösel Verlag herausgebracht.
Das »Aufstellen des Anliegens« auf der Grundlage der mehrgenerationalen Psychotraumatologie ist mittlerweile zu einer eigenständigen traumatherapeutischen Methode geworden. Sie kann bei einem breiten Spektrum von psychischen wie körperlichen Symptomen eingesetzt werden, um deren Ursachen in der Tiefe zu erkennen und adäquate Hilfestellungen zu entwickeln.
Wie die zahlreichen Fallbeispiele in diesem Buch zeigen sollen, eignet sie sich besonders, um Zugang zu den implizit gespeicherten Erinnerungen aus der vorsprachlichen Zeit zu bekommen.
Für die mehrgenerational angelegte Traumatherapie ist es wichtig, den Blickpunkt nicht nur auf die aktuelle Situation von Zeugung, Schwangerschaft, Geburt und frühe Säuglings- und Kinderzeit zu legen. Da auch Menschen psychotherapeutische Hilfe suchen, die ab ca. 1930 geboren sind und deren Eltern und Großeltern noch Ende oder Anfang des 20.Jahrhunderts gelebt haben, müssen auch diese historischen Zeiträume mit ihren jeweiligen Rahmenbedingungen für Schwangersein und Gebären in den Blick genommen werden.
Inzwischen sind Therapeutinnen und Therapeuten durch Weiterbildungen in meiner Theorie und Methode und durch die Arbeit an den eigenen Themen mitgewachsen. Es war daher nicht schwer, Autorinnen zu finden, die aufgrund persönlicher und aus Erfahrungen als Therapeutinnen die Themen bearbeiten konnten, die beim »Frühen Trauma« von Relevanz sind. Ihre Beiträge in diesem Buch sind in erster Linie aus der Perspektive von Praktikerinnen geschrieben.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Birgit Assel, Vivian Broughton, Doris Brombach, Annemarie Denk, Christina Freund, Gabriele Hoppe, Liesel Krüger, Petra Lardschneider, Manuela Specht, Andrea Stoffers, Dagmar Strauss, Cordula Schulte, Alice Schultze-Kraft, Marta Thorsheim und Margriet Wentink für die spontane Bereitschaft, ihr Wissen, ihre Gefühle und ihr therapeutisches Engagement in die jeweiligen Beiträge einfließen zu lassen.
Eine Autorin, Doris Brombach, ist am 25.Januar 2014 für uns alle unerwartet gestorben. Wir sind davon tief betroffen und hoffen, dass der Beitrag von Doris in diesem Buch zeigt, mit welcher Intensität sie sich ihrer therapeutischen Arbeit gewidmet hat. Mit ihrem Beitrag in diesem Buch wird sie uns in ganz besonderer Weise in Erinnerung bleiben.
Mein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klett-Cotta Verlags. Frau Dr. Christine Treml hat dieses Buch in gewohnt souveräner Weise als Lektorin begleitet und seine Veröffentlichung auf den Weg gebracht.
München, im Mai 2014
Franz Ruppert
1. Frühe Traumatisierungen und das »Aufstellen des Anliegens«
Franz Ruppert
Den Lebensmotor in Gang setzen
Manfred1 kommt zu seiner dritten Aufstellung2. In den vorangegangenen beiden Aufstellungen hatte er sich mit einer Herzsymptomatik auseinandergesetzt, die ihn schon lange quält und ängstigt. Er hat mitunter hohe Blutdruckspitzen und Herzrasen. Er ist vierzig Jahre alt und das einzige Kind seiner Eltern. Seinen Vater hat er erst vor zwei Jahren kennengelernt, da sich seinen Eltern trennten, als seine Mutter mit ihm schwanger war. Er wuchs in der Familie seiner Mutter auf, die seinen Vater als »unpassend für ihre Tochter« abgelehnt hatte. Bei seiner ersten Aufstellung wählte er in einer größeren Gruppe eine Frau als Stellvertreterin für sein Anliegen. Auf diese Weise wurde seine symbiotische Verstrickung mit seiner Mutter deutlich sichtbar. Er konnte innerlich noch nicht deutlich zwischen sich und ihr unterscheiden. Auch bei seiner zweiten Aufstellung wählte er erneut eine Frau als Stellvertreterin für sein Anliegen. Diesmal wurde für ihn klar erkennbar, wie wenig seine Mutter für ihn da gewesen und auch nicht bereit war, Mutter für ihn zu sein. Bei seinem dritten Termin ist außer mir noch eine Hospitantin anwesend. Sein Anliegen ist es herauszufinden, warum er so oft kalte Hände und Füße hat und was er daran ändern könnte. Bei einem vor Kurzem durchgeführten Belastungs-EKG auf dem Fahrradergometer stellte sich heraus, dass seine Hände paradoxerweise umso kälter wurden, je mehr er sich anstrengte. Seine Vermutung dazu ist, dass dies mit einer Ohnmachtsituation zu tun haben könnte. Auf meine Frage, an welche Situation er dabei denke, fällt ihm seine Geburt ein. Diese war schwierig und dauerte sehr lange. Die Nabelschnur war um seinen Hals gewickelt, und er wurde per Not-Kaiserschnitt entbunden. Sein Gesicht war bei der Geburt bereits bläulich, und er wurde sofort in eine Kinderklinik gebracht. Dort verbrachte er mehrere Tage allein ohne seine Mutter.
Dieses Mal wählt er für seine Aufstellung bewusst mich als Mann für sein Anliegen, die Ursachen für seine kalten Hände und Füße zu ergründen. Mein erster Eindruck als dieses Anliegen ist, dass ich einen klaren Kopf habe und alles um mich herum gut wahrnehmen kann. Ich komme mir ganz schlau vor, als hätte ich den vollen Durchblick oder zumindest den Überblick. Den Rest meines Körpers fühle ich nicht. Ich bin wie hingestellt. Die Füße stehen eng beieinander, und die Hände hängen bewegungslos herunter. Nach einer Weile merke ich, dass ich mich gar nicht bewegen kann, auch wenn ich es möchte. Die Befehle vom Kopf dringen nicht bis zum Körper durch, die Bewegungsimpulse von oben kommen unten nicht an. Ich teile Manfred dieses mit, und er bestätigt, dass er oft eine Blockade im Hals-Nacken-Schulter-Bereich fühle. Ja, so fühlt es sich für mich auch an: als ob es hier einen großen, dicken Block gäbe, der den Kopf vom Rest des Körpers isoliert.
Ich muss jetzt immer mehr an die Geburtssituation denken, die Manfred zuvor geschildert hat. Ich fühle mich zwar hellwach, aber wie abgelegt. Man hat mich einfach nach der Geburt hingelegt, und nun liege ich da und warte und kann nichts machen. Als ich Manfred meine Empfindungen mitteile, bestätigt er das und möchte jetzt gerne seinen Vater in die Aufstellung dazunehmen. Er habe nämlich erst vor ein paar Tagen eine Bergwanderung mit ihm gemacht und dabei sei es ihm sehr gut gegangen. Auch seine Hände und Füße seien dabei warm gewesen.
Mir als Vertreter seines Anliegens leuchtet dieser Vorschlag wenig ein. Offenbar hat der Kontakt mit »unserem Vater« das Problem ja nicht dauerhaft gelöst. Damit sind wir immer auf Hilfe von außen angewiesen, auf jemanden, der für uns da ist. Die Lösung für unser Problem müssen wir wohl eher von innen her finden. Manfred lässt sich davon überzeugen. Er fragt mich nun, was ich denn bräuchte, damit es mir besser gehen könnte. Diese Frage von ihm kommt langsam bei mir an. Ich bin gerührt, dass sich jemand tatsächlich dafür interessiert, wie es mir geht und was ich bräuchte, damit es mir besser gehen könnte. Von unten im Körper steigt nun immer mehr eine Lawine von Traurigkeit in mir hoch, die schließlich in einem heftigen Tränenausbruch mündet. Manfred, der bisher in einem Abstand von einem halben Meter vor mir stand, kommt nun auf mich zu, und ich kann meinen Kopf auf seine Schulter legen. Es schüttelt mich heftig, und unterdrückte Traurigkeit bricht sich nun in mir Bahn. Ich höre mit meinem rechten Ohr an Manfreds Brustkorb sein Herz wild und heftig schlagen. Er umarmt mich, legt seinen Kopf auf meine Schultern und fängt nun auch an zu weinen.
Nach einer Weile bemerke ich, wie sich meine Beine bewegen wollen. Ich ziehe zuerst das eine Bein hoch und dann das andere. Aus der Perspektive des kleinen Babys erlebe ich das wie ein Strampeln. Manfred macht diese Bewegung in den Beinen spontan mit. Nach einer Weile fühle ich mich erschöpft vom Strampeln, und ich möchte mich von dieser Anstrengung ausruhen und eine Weile schlafen. Dabei geht mir durch den Kopf, dass ich auf diesen Babybeinen ja noch gar nicht selbst stehen kann. Dieser Gedanke aktiviert meine Arme, und ich hebe sie hoch, um mich in Manfreds Pullover festzukrallen. Nun fühle ich mich sicherer. Ich kann mich selbst festhalten.
Ich merke nach einer Weile, wie ich innerlich aufgeregt werde. Es ist aber keine Übererregung, wie Manfred zunächst meint, sondern eine gute Art der Aufregung. Ich bin aufgeregt darüber, dass um mich herum etwas passiert und dass ich gefordert bin, meinerseits darauf zu reagieren. Es ist so etwas wie Vorfreude, Bereitsein und Lebenslust zugleich. Ich bin bereit zu leben!
Der Kontakt mit Manfred fühlt sich angenehm warm an. Ich habe den Eindruck, immer mehr eins mit ihm zu sein und in ihn hineinzusinken. Ich kann mir gut vorstellen, von dort aus, in seinem Inneren jetzt wie ein Lebensmotor zu funktionieren.
Wir beenden diese Aufstellung. Manfred ist sichtlich bewegt und energetisch aufgeladen. Auch ich habe gerade eine sehr tief greifende Erfahrung gemacht, wie es sich für ein neugeborenes Baby vermutlich anfühlt, wenn es eine komplizierte Geburtssituation erlebt, sich dabei aufspaltet und ein Anteil in eine passive Beobachterhaltung gerät. Es war faszinierend zu erleben, wie der Lebensmotor in einem solchen Kind wieder anspringen und die Gefühle ins Fließen kommen können. Nach dem Zulassen von Schmerz und Trauer hat sich Lebensfreude ausgebreitet.
Einige Woche später teilte mir Manfred mit, dass er nun keine Probleme mehr mit kalten Händen und Füßen hätte und er diese Woche erfahren habe, dass er bald Vater werde.
1.1 Mehrgenerationale Psychotraumatologie
Kalte Füße und Hände – eine Traumafolgestörung? In Manfreds Fall offenkundig ja. Trotz vieler Maßnahmen, die er dagegen unternommen hat (dicke Socken, warme Schuhe, heiße Bäder, wärmende Salben), stellte sich keine dauerhafte Besserung ein, und körperliche Anstrengungen, welche normalerweise die Blutzirkulation anregen, bewirkten sogar das Gegenteil. Die körperlichen wie psychischen Symptome, unter denen wir Menschen leiden, sind mannigfaltig wie alltäglich. Wir haben Ängste, die nicht verschwinden, leiden an Schlaflosigkeit und Albträumen, wir fühlen uns energielos und sehen wenig Hoffnung für die Zukunft, wir stecken in konflikthaften Beziehungen fest oder fühlen uns innerlich leer, einsam oder verwirrt. Hinzu kommen oft körperliche Krankheiten, die sich trotz Medikamenten, Massagen oder Operationen nicht verbessern. Manche dieser Krankheiten, wie Krebs und Autoimmunerkrankungen, werden sogar zunehmend lebensbedrohlich.
Ich komme mehr und mehr zu der Überzeugung, dass ein rein naturwissenschaftliches, scheinbar »objektives« Theoriekonstrukt wie »Krankheit« der Subjektivität unseres menschlichen Daseins nicht gerecht wird. Denn oft ist das, was sich als vermeintliche »Krankheit« in unserem Körper manifestiert, die Folge zwischenmenschlicher Beziehungserfahrungen, die uns nicht guttun und in denen wir uns hilflos, ohnmächtig und gefangen erleben. Nach meiner Erfahrung sind die meisten Symptome, derentwegen Klienten3 meine Hilfe suchen, Traumafolgestörungen, selbst wenn manches Symptom zunächst einmal ganz undramatisch erscheint. Die Frage ist dann, welches Trauma wird hier in einem körperlichen oder psychischen Symptom widergespiegelt? Das herauszufinden, scheint mir die größte Herausforderung für eine effektive Psychotherapie. Wie gelangt man an den Punkt des ursprünglichen Traumas, welches das jeweilige Symptom verursacht und weiterhin bewirkt? Wenn man verstanden hat, dass Menschen nicht nur von einem Lebensereignis traumatisiert sein können, stellt sich eine weitere Frage: Wie können die unterschiedlichen Traumata, die sich bei vielen Ratsuchenden gegenseitig überlagern und aus unterschiedlichen Phasen ihres Lebens stammen, sinnvoll voneinander getrennt und je für sich gezielt therapeutisch angegangen werden?
Die Lehre von den Traumata, die »Psychotraumatologie«, ist eine wissenschaftliche Disziplin, die in den letzten Jahren einen enormen Wissenszuwachs erfahren hat (u.a. Fischer und Riedesser 1998, Levine 2010, Seidler, Freyberger und Maercker 2011, Huber 2013, Heller und Lapierre 2013, Rauwald 2013). Das Spezifitätskriterium für ein »Trauma« ist meines Erachtens die Tatsache, dass die menschliche Psyche traumatische Lebenserfahrungen nicht verarbeiten und in die Lebensbiografie integrieren kann, sondern sich aufspalten muss, um das Erinnern der traumatischen Erfahrung aus dem Bewusstsein fernzuhalten. Eine traumatisierte Psyche kann daher nicht unbefangen dem Strom der Realitätseindrücke begegnen. Sie befindet sich grundsätzlich in einer Position der Realitätsabwehr, was sich im Verleugnen, Verdrängen und Nicht-wissen-Wollen der traumatisierenden Erfahrungen ausdrückt. Von traumatisierenden Erlebnissen kann man sich auch nicht einfach erholen, wie das bei stressvollen Erfahrungen durchaus der Fall ist. Sie bleiben so lange psychisch aktiv, bis sie gezielt aufgearbeitet werden.
Aus den Basiserkenntnissen der Psychotraumatologie heraus habe ich die Theorie der »mehrgenerationalen Psychotraumatologie« Schritt für Schritt entwickelt (Ruppert 2001, 2002, 2005, 2007, 2010, 2012). Das Kernkonzept dieser Theorie ist das »Symbiosetrauma«. »Symbiosetrauma« bedeutet, dass ein Kind, das auf die psychische und körperliche Fürsorge seiner Mutter für sein Überleben existenziell angewiesen ist, von dieser nicht ausreichend mit Wärme, Kontakt, Nahrung, Zuwendung und vor allem Liebe versorgt wird, sodass es in Zustände des völligen Ausgeliefertseins, der Ohnmacht und Hilflosigkeit gerät und deshalb seine damit verbundenen Todesängste, Wut-, Trauer- und Schmerzzustände psychisch abspalten muss. Es kommt daher nicht zu einer integrierten und stabilen psychischen Entwicklung des Kindes. Es fällt ihm schwer, gesunde Ich-Strukturen aufzubauen, es bleibt in seiner Autonomieentwicklung zurück, weil es aufgrund seiner Hauptüberlebensstrategie, die Liebe der Mutter und den Kontakt zu ihr doch noch zu erreichen, ein Leben lang auf seine Mutter fixiert ist. Die psychischen Vorgänge, die sich als Überlebensstrategien aus einem Symbiosetrauma ergeben, bezeichne ich »symbiotische Verstrickungen« (Ruppert 2010, S.128ff.).
Da sich diese Theorie aufgrund der zahlreichen Aufstellungen, die ich leite, und der vielen Klienten, die ich therapeutisch begleite, fortlaufend weiterentwickeln und verfeinern lässt, stelle ich dem bisherigen Schema, vier Kategorien von Traumatisierungen zu unterscheiden – Existenztrauma, Verlusttrauma, Symbiosetrauma und Bindungssystemtrauma –, ein weiteres daneben. Dieses betont vor allem den Aspekt der Traumatisierung durch Lieblosigkeit und Gewalt. Es rückt das Vorhandensein von Tätern und Opfern in Beziehungen in den Mittelpunkt. Bei den meisten Ratsuchenden, die mich aufsuchen, sehe ich zwei Formen von Traumatisierungen im Vordergrund stehen:
die Traumatisierung ihrer Liebesbedürfnisse und -fähigkeiten und
die Traumatisierung ihrer Sexualität.
Ich bette diese beiden Formen von Traumatisierungen in den größeren Zusammenhang von Traumata ein, die aufgrund von menschlicher Gewalt geschehen. Im weiteren Umfeld davon haben wir noch die Traumata, die durch Naturgewalten hervorgerufen werden (Abbildung 1).
Abbildung 1: Traumatisierungen unter dem Aspekt von Lieblosigkeit und Gewalt
1.2 Traumatisierung durch Naturgewalten
Naturgewalten, die uns Menschen traumatisieren können, gibt es viele: Feuer, Wasser, Hitze, Kälte, Wind, Steinschlag, Erdbeben, Blitze oder virale und bakterielle Erreger. Oft sind ganze Menschenansammlungen, Dörfer oder Städte von einer Naturkatastrophe betroffen, und vor allem jene werden traumatisiert, denen in solchen Situationen keine Handlungsmöglichkeiten mehr geblieben sind, ihre Gesundheit und ihr Leben zu schützen. Naturkatastrophen aktivieren in der Regel gegenseitige Hilfe und Unterstützung und führen eher zu einer Solidarisierung zwischen den Menschen, die schwerer betroffen sind, und denen, die noch Lebensressourcen zur Verfügung haben. Naturkatastrophen aktivieren im Regelfall auch das Bemühen, sich zukünftig besser vor solchen Gefahren zu schützen, Vorsorgemaßnahmen zu treffen und effektive Rettungs- und Hilfepläne zu entwickeln, auch wenn politische und finanzielle Interessen dabei oft im Wege stehen. Wir können der »Natur« nicht unterstellen, dass sie uns Menschen mit Absicht »Gewalt« antut. Wir können uns mit den Naturkräften sachlich auseinandersetzen, sie für uns nutzen und uns vor ihnen, so gut es geht, schützen.
1.3 Traumatisierung durch Menschengewalt
Menschen können sich in vielfältiger Form gegenseitig Gewalt antun: durch die Anwendung von körperlicher Kraft, durch den Einsatz von Waffen, durch Beleidigungen und Beschimpfungen und durch den Entzug von lebenswichtigen Ressourcen, seien diese materieller oder emotionaler Art. Auch das Unterlassen von notwendiger Hilfe für einen anderen Menschen, der akut in Not ist, kann eine Täterschaft bedeuten, z.B. wenn man einem anderen nichts zu trinken gibt, der gerade am Verdursten ist, obwohl man die Möglichkeit dazu hätte. Täter machen andere Menschen zu Opfern.
Es gibt individuelle wie kollektive Formen der Gewalt. Wenn ein Mann beispielsweise eine Frau schlägt, kann das für die Frau eine traumatisierende Erfahrung sein. Wenn die Regierung eines Landes einem anderen Land den Krieg erklärt, führt das zu massenhaften Traumatisierungen bei vielen Männern, Frauen und Kindern. Wenn zum Zweck der Kapitalvermehrung und aus persönlicher Profitgier ganze Landstriche unbewohnbar gemacht werden, Lebensräume zerstört, Bevölkerungen versklavt oder ausgebeutet werden, dann bedeutet dies unendliches Leiden für viele Menschen und ist Gewalt, auch wenn sich diese Form von Gewalt gerne hinter angeblichen ökonomischen Sachzwängen versteckt.
Gewalt kann zum Einsatz kommen, um persönliche Ziele zu erreichen, z.B. weil man in den Besitz des Körpers, des Geldes oder des materiellen Eigentums einer anderen Person gelangen möchte oder weil man seine eigenen Interessen rücksichtslos gegen die Bedürfnisse und Interessen anderer durchsetzt. Gewalt kann das Mittel sein, um dauerhaft Macht über andere Menschen zu erlangen und diese zu beherrschen.
Gewalt kann jedoch auch ein legitimes Mittel sein, um sich selbst vor Gewalt zu schützen. Es kommt also auch auf den Grund an, weshalb Gewalt zum Einsatz kommt. Die Gefahr beim Einsatz von Gewalt ist jedoch immer, dass sie zu Traumatisierungen aufseiten der Täter wie der Opfer führt und damit eine Gewaltspirale in Gang setzt.
Opfersein und Opferhaltungen
Die Opfer von Gewalt werden traumatisiert, wenn sie in einen Zustand der Ohnmacht und Hilflosigkeit kommen und die von ihnen aktivierten Stressprogramme diesen Zustand der Ohnmacht noch weiter verstärken, weil die Täter auf die Stressreaktionen ihrer Opfer mit noch mehr Gewalt oder der Verweigerung von Hilfe reagieren. Zum Beispiel kann das Schreien eines Kindes eine Mutter noch mehr dazu bringen, das Kind zu schlagen oder es allein zu lassen.
Ein Opfer kann eine solche Situation nur dann überleben, wenn es seine Stressreaktionen und sein Verlangen nach Hilfe unterdrückt, was durch den Prozess der psychischen Spaltung geschieht: Die Stressreaktionen und Hilfsbedürftigkeit hören zwar nicht auf, aber sie werden aus dem Bewusstsein gedrängt und nicht mehr in Handlungen umgesetzt. Dies bedeutet, dass eine innere Übererregung da ist, die nach außen nicht mehr gezeigt wird. Bleibt die Bedrohungssituation durch einen Täter dauerhaft bestehen, muss auch das Wahrnehmen der eigenen inneren Erregung vom Opfer unter Kontrolle gebracht werden, um eine solche Situation auszuhalten. Dies führt dazu, dass das Opfer schließlich selbst keinen bewussten Zugang mehr zu seinen Ängsten, Schmerzen, Scham- oder Wutgefühlen hat, deren Ursache in der fortdauernden Gewaltsituation liegt.
Um ein Gewalttrauma zu überleben, müssen die Opfer daher ihr Opfersein ausblenden und ignorieren. Sie nehmen stattdessen Zuflucht zu Überlebensstrategien, die ihnen suggerieren, sie seien gar kein Opfer von Gewalt und sie bedürften keiner Hilfe. Dazu dienen innere Haltungen wie »Was mich nicht umbringt, macht mich stark!«, »Mich wirft so schnell nichts um!«, »Ich kann viel ertragen, mehr als andere!«, »Ich schaffe es schon allein!«
Auch gegenüber dem Täter nimmt ein Gewaltopfer eine spezielle Haltung ein: Es darf den Täter nicht als Täter wahrnehmen. Daher idealisiert es ihn, sieht ihn möglicherweise sogar selbst als schwach und bedürftig an, nimmt seine aggressiven Ausbrüche in Schutz und beschäftigt sich mehr mit ihm als mit sich selbst, um möglichst frühzeitig vorherzusehen, wie der Täter sich verhält. Bei den Gewaltopfern können wir eine regelrechte psychische Fixierung auf die Täter feststellen. Diese von mir als »Opferhaltungen« bezeichneten Trauma-Überlebensstrategien setzen sich darin fort, das die Opfer zwar unter allen möglichen Symptomen leiden (Niedergeschlagenheit, Migräne, Schlaflosigkeit …), diese aber nicht bewusst in Zusammenhang bringen mit der Gewalt, die ihnen von einem Täter angetan wurde bzw. möglicherweise immer noch wird. Ihre Leidenssymptome werden für sie selbst zu rätselhaften »Krankheiten«, an deren Bewältigung sie sich ohne durchschlagenden Erfolg abarbeiten.
Diese über die Jahre verfestigte Opferhaltung, die Folgen zwischenmenschlicher Täter-Opfer-Beziehungen als »psychische Krankheiten« zu bezeichnen, wird auch durch soziale und gesellschaftliche Strukturen gefördert, welche geneigt sind, bestehende Gewaltverhältnisse auszublenden und Täter in Schutz zu nehmen. Daher können Menschen als »Patienten« auch wiederum sehr leicht zu Opfern von Personen werden, die sich als Behandler ihrer »Krankheiten« anbieten (Ärzte, Psychotherapeuten, Pflegekräfte, Sozialarbeiter …), es jedoch vermeiden, den tatsächlichen Ursachen der vermeintlichen »Krankheits«symptome auf die Spur zu kommen. Gewalt, die in erster Linie auf die psychische Zerstörung einer anderen Person ausgerichtet ist, wirkt am stärksten traumatisierend. Sie vermittelt in den Opfern die deutlichsten Gefühle von Ohnmacht und entfacht in ihnen die größten Hassgefühle gegenüber den Tätern. Daraus können nicht endende Spiralen der Gewalt werden: aus den Opfern werden dann Täter, die neue Opfer schaffen. Die Anwendung von Gewalt wird selbst zu einer Traumaüberlebensstrategie, die weitere Traumatisierungen bewirkt. Da der Hass der Opfer meist nicht unmittelbar an den Tätern ausgelebt werden kann, wird er unterdrückt und entlädt sich in der Folge bei Gelegenheit an anderen Menschen, die das eigene Opfersein zwar nicht hervorgerufen haben, aber nun eine Gelegenheit zur Entladung der Hassgefühle bieten, weil sie schwächer sind und sich nicht wehren können.
Gewalt kann auch als strukturelle Gewalt in den Gesetzen, Regeln und Normen einer Gesellschaft enthalten sein. Allein die Anwendung dieser Gesetze, Regeln und Normen tut dann bestimmten Menschen in der Gesellschaft Gewalt an, ohne dass sich die Hüter dieser Gesetze, Regeln und Normen als Täter erleben müssen. Ein Beispiel hierfür ist die ungerechte Verteilung von Land, die einigen wenigen Reichtum und Wohlstand beschert und viele andere verhungern lässt. Grundsätzlich sind Formen der Ökonomie, die auf der Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft beruhen, Täter-Opfer-Systeme. Wer in ein solches System hineingeboren wird, wird bei entsprechender Gelegenheit entweder selbst zum Täter, oder er verbleibt in der Opferposition. Auf der familiären Ebene gibt es z.B. Kinder, die unter Anwendung massiver Gewalt dazu gezwungen werden, ihrerseits zu Tätern zu werden, indem sie zu Diebstahl angehalten werden oder selbst körperliche Gewalt anwenden.
Gewalt kann bewusst eingesetzt, sie kann aber auch unbewusst ausgeübt werden und Menschen traumatisieren, ohne dass dahinter ein klarer Wille und eine böse Absicht stecken müssen. Das ist z.B. im Eltern-Kind-Verhältnis häufiger der Fall, wenn eine traumatisierte Mutter gar nicht mitbekommt, wie sehr sie mit ihrer Unfähigkeit, zu lieben und emotional präsent zu sein, ihr Kind schwer traumatisiert. Es hängt von der Sensibilität einer Menschengemeinschaft ab, was sie als Opfer- und Täterschaft anerkennt. Je mehr es in Gesellschaften nur auf das bloße Überleben und Sichdurchschlagen ankommt, desto geringer ist die Bereitschaft, Opfer als Opfer anzuerkennen und Täter als Täter wahrzunehmen. Die Untersuchung der Geschichte der Kindheit über die letzten 4000 Jahre, die der amerikanische Psychohistoriker Lloyd deMause vorgelegt hat (deMause 1980), weist eindrücklich darauf hin, wie unsensibel seit Urzeiten und bis heute Kinder behandelt und auf vielfältige Weise von ihren Eltern und anderen Erwachsenen traumatisiert werden.
Tätersein und Täterhaltungen
Ein weiteres Merkmal der Traumatisierung von Menschen durch Menschen besteht darin, dass auch die Täter sich durch ihre Taten selbst traumatisieren. Da bei einem gesunden Menschen die Tatsache, einen anderen Menschen so massiv geschädigt zu haben, dass dieser traumatisiert ist, Schuld- und Schamgefühle hervorruft sowie die Angst, von der sozialen Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, müssen Täter diese nagenden Gefühle abspalten und aus ihrem Bewusstsein verdrängen. Dennoch bleiben diese Schuld- und Schamgefühle und die Ängste, wegen der eigenen Tat zur Rechenschaft gezogen zu werden, psychisch weiterhin existent.
Täter entwickeln daher »Täterhaltungen«, um ihr Tätersein psychisch in den Griff zu bekommen. Zu den gängigen Täterhaltungen zählen: Taten verleugnen, Gewalt und Aggressionen herunterspielen, die Öffentlichkeit beschwichtigen, soziale Verantwortung demonstrieren, sich hinter gesellschaftlichen Strukturen verstecken (»Ich führe nur Befehle aus!«, »Ich mache nur meine Arbeit!«) oder mit Sachzwängen zu argumentieren. Täter machen auch oft ihre Opfer lächerlich, stigmatisieren sie als krank und verrückt und stellen sich selbst als (deren) Opfer dar. Täter benötigen Rationalisierungen für ihr Tun, daher haben sie einen enormen Bedarf an theoretischen Konstrukten, die ihre unsozialen Interessen rechtfertigen. Die Verschleierung von Täter-Opfer-Verhältnissen ist der Kern jeglicher Ideologie, gleich ob sie patriarchalisch, nationalistisch, rassistisch, sexistisch, religiös oder sogar wissenschaftlich eingefärbt ist. Solche Ideologien verschaffen Tätern das gute Gewissen, mit ihrer Gewalt fortzufahren und für ihr Tun Respekt und Achtung einzufordern. Auf dieser Basis können sie sogar Lustgefühle beim Ausagieren ihrer destruktiven Aktionen empfinden.
1.4 Traumatisierung der Liebe
Psychologisch gesehen ist »Liebe« ein Gefühl, das in einer zwischenmenschlichen Beziehung vorhanden ist oder nicht. Zwei Menschen können sich liebend zugetan sein. Es kann aber auch nur der eine den anderen lieben, während beim anderen dieses Gefühl nicht vorhanden ist. Liebe entsteht und entfaltet sich in konkreten zwischenmenschlichen Beziehungen. Zu lieben heißt, selbst über die Fähigkeit zu lieben zu verfügen. Es heißt auch, dass man ein Liebesbedürfnis hat und geliebt werden will. Weil ein Liebender selbst geliebt werden möchte, hat er auch das Bedürfnis herauszufinden, was sein Geliebter liebt. Wer auf sein Lieben keine Resonanz erfährt, kann nicht lernen, was wirkliche Liebe ist. Wer nicht geliebt wird, steht mit seinem Liebesbedürfnis allein und hängt in der Luft. Wer auf seine Liebe eine falsche Resonanz bekommt, lernt falsche Dinge über die Liebe.
Liebe kann als verinnerlichte Haltung auf anderes übertragen werden: z.B. auf die Tätigkeiten, die ein Mensch macht (Beruf, Hobby), auf andere Lebewesen (Tiere, Pflanzen) oder auf unlebendige Objekte (Berge, Meer, Autos, Häuser …).
Von wesentlicher Bedeutung ist auch die Selbstliebe. Selbstliebe ist das Wohlwollen und das Mitgefühl für sich selbst, auch und gerade wenn man Fehler im Leben gemacht hat. Sie bedeutet, gut für sich zu sorgen und nichts zu tun, was einem schadet.
Liebe, also die Tatsache des Liebens und des Geliebtwerdens, hat in der Mutter-Kind-Bindung seinen evolutionären Ursprung. Denn ohne das Gefühl und die Haltung der Liebe wäre das Mutter-Kind-Verhältnis nur ein Austragungsort für den Kampf um Lebensressourcen. Es wäre überwiegend von Angst, Aggression und Stress geprägt. Ein Kind, das sich aus der Vereinigung von einer Ei- und Samenzelle im Organismus der Mutter entwickelt, hat zweifelsohne Eigenschaften, welche die Mutter sehr belasten. Es nistet sich in der Gebärmutter ein, es nutzt den mütterlichen Organismus für seine Ernährung, es baut deren Stoffwechsel für seine Bedürfnisse um. Es drängt sich der Mutter von innen her auf. Wenn eine Mutter daher dieses in ihr heranwachsende Kind nicht haben möchte und zu lieben bereit ist, wird sie sich als dessen Opfer und das Kind als Täter an ihr erleben. Nur die Liebe zu einem eigenen Kind, das damit verbundene Wohlwollen und Mitgefühl mit dem neuen Leben in ihr ermöglichen es einer Frau, dieses Kind nicht nur zu tolerieren und zu akzeptieren, sondern ihm für seine Entwicklung den notwendigen Schutzraum zu gewähren und es als einen neuen Menschen willkommen zu heißen. Nur dann wird sie die Kraft und die Ausdauer aufbringen,
ein Kind zu füttern, zu windeln und zu pflegen,
geduldig dabei zu bleiben, wenn es im Spiel immer wieder Neues entdeckt,
in höchster Aufmerksamkeit zu sein, damit ihm nichts zustößt,
die eigenen Freiheiten preiszugeben, um für das Kind da zu sein, wenn es Zuspruch braucht oder wenn es krank ist.
Wie sollte das alles für eine Mutter über viele Jahre erträglich sein, wenn sie ihr Kind nicht liebt? Die Liebe einer Mutter für ihr Kind ist nicht nur für dessen Entwicklung von höchster Bedeutung. Die Fähigkeit, ihr Kind zu lieben, schützt auch die Mutter selbst vor Frustration und Überforderung. Ein Kind großzuziehen, das sie nicht liebt, ist für eine Mutter eine der größten Qualen. Es bedeutet für sie Dauerstress und das unerträgliche Gefühl von Sinnlosigkeit. Ebenso ist es für das Kind notwendig, dass es seiner Mutter nicht wie ein Parasit begegnet, der seinen Wirtskörper nur aussaugen möchte und eventuell sogar dessen Ableben in Kauf nehmen würde. Das Kind braucht seine Mutter für sein Leben, ohne sie ist es verloren. Seine größte Angst ist, von seiner Mutter nicht liebevoll angenommen, von ihr verlassen und im Stich gelassen zu werden. Breits das ungeborene Kind nimmt deshalb Rücksicht auf seine Mutter, damit es ihm selbst gut gehen kann. Es sorgt sich aktiv um ihren Lebenserhalt und ihr Wohlbefinden. Es liebt seine Mutter, weil sie seine Grundlage ist, damit es seine Lebensenergien entfalten kann. Die Liebe eines Kindes ist anfänglich nach außen gerichtet, hin zur Mutter und dann auch zu anderen Menschen, von denen es abhängig ist. Selbstliebe kann es erst dann entwickeln, wenn seine Liebe, die auf andere gerichtet ist, adäquat beantwortet wird und wenn ihm seine Mutter und sein Vater und sonstige Menschen widerspiegeln, wie liebenswert es ist.
Insofern sind alle Menschen, Männer wie Frauen, in diesen evolutionären Prozess des Entstehens der Liebe als einer Lebensnotwendigkeit eingeschlossen, weil wir alle als Kinder im Körper unserer Mutter unseren Anfang nehmen. Da Männer nicht die Erfahrung machen, ein Kind in ihrem eigenen Körper heranwachsen zu lassen, sind sie im späteren Leben weniger durch das Thema Liebe herausgefordert als Frauen, die zu Müttern werden. Für Männer ist die Konkurrenz mit anderen Männern oft eine Lebenserfahrung, die ihre Psyche bewusst mehr prägt als die Liebe. Unbewusst wirkt aber in jedem Mann die ursprüngliche Liebe zu seiner Mutter und die Art der Liebe seiner Mutter zu ihm fort.
Gesunde Liebe
Liebe, die als stimmig, adäquat und »gesund« erlebt wird, bedeutet u.a.,
den geliebten Menschen in seiner Besonderheit und Einzigartigkeit wahrzunehmen,
sich in ihn einfühlen zu können,
seine Einstellungen, Haltungen, Denkweisen zu verstehen,
mit ihm zusammen konstruktiv zu handeln,
ohne dabei den Kontakt mit sich selbst und seinen eigenen Bedürfnissen zu verlieren.
»Gesund« zu lieben heißt, einen anderen Menschen so zu nehmen, wie er ist, ihm wohlwollend zu begegnen, ihm gute Dienste zu erweisen und ihn in seiner Entwicklung zu fördern, seine Bedürfnisse nach Halt, Geborgenheit, Zugehörigkeit, Willkommensein, genährt, gewärmt, gesehen, berührt oder verstanden zu werden, in angemessener Weise zu befriedigen und seine autonomen Bedürfnisse nach eigenem Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Wollen und Handeln zu respektieren. Gesunde Liebe baut auf Vertrauen auf, sie ist wahr und echt. Liebe und Lüge, Liebe und Betrug, Liebe und Verrat schließen sich gegenseitig aus.
Gesunde Liebe unterscheidet sich deutlich vom Zustand des Verliebtseins, der, biologisch betrachtet, eher eine instinkthafte und hormonell bedingte Reaktion zur Erhöhung der Paarungsbereitschaft und zum partnerschaftlichen Engagement darstellt. Verliebtsein ist ein psychischer Zustand, bei dem die eigenen symbiotischen Bedürfnisse auf einen anderen Menschen projiziert werden, den man kaum kennt und dem man eigentlich nicht wirklich vertraut und sich ihm auch nicht wirklich öffnet. Man versucht stattdessen, sich dem Geliebten so positiv und attraktiv wie möglich darzustellen. Verliebte schaffen sich in ihren Fantasien ein Idealbild von einem anderen Menschen, sie haben die rosarote Brille auf ihrer Nase. Sie hoffen, dass dieser Mensch alle ihre schönen Erwartungen vom erträumten Liebesglück erfüllen wird (Precht 2009). Der Zustand des Verliebtseins ist ein Stresszustand, der zu »Schmetterlingen im Bauch«, Herzklopfen, weichen Knien und zu einer Verengung des Realitätsbezugs auf eine bestimmte Person führt.
Gesunde Liebe hingegen ist reale, gelebte Liebe, sie ist ein Bestandteil einer konkreten Beziehung. Sie gründet auf Offenheit, Vertrauen, Verantwortungsübernahme und Loyalität. Es ist offen, ob der Zustand der Verliebtheit in dauerhafte und konstruktive partnerschaftliche Liebe oder sogar Elternliebe übergeht.
Partnerschaftliche Liebe hat ihre Wurzeln in der Liebe, welche die Partner als Liebe von ihren Eltern erfahren haben. Denn alle Kinder sind für ihre gesunde psychische Entwicklung auf die Liebe ihrer Mutter angewiesen. Wenn sie zusätzlich auch von ihrem Vater geliebt werden, stellt das eine solide Basis für ihre gesunde psychische Entwicklung dar. Wenn Kinder ihre Liebesbedürfnisse auf eine angemessene Weise zeigen können, entwickeln sie auch ihre Fähigkeiten zu lieben so, dass sie für den Aufbau konstruktiver Beziehungen dienlich sind. Das Bedürfnis, geliebt zu werden, und die Fähigkeit, selbst zu lieben, bleiben in einem ausgewogenen Verhältnis. Die Liebe, die anderen gegenüber gezeigt wird, steht dann in keinem Widerspruch zur Selbstliebe. Auf diesem Wege werden aus geliebten Kindern Erwachsene, die in der Lage sind, sich ihren Partnern wie den eigenen Kindern gegenüber liebevoll zu verhalten und auf deren symbiotische Bedürfnisse wie deren Bestreben nach Autonomie adäquat zu reagieren. Psychisch gesunde Erwachsene können auch zwischen Liebe, Angst, Wut, Trauer, Schmerz und Sexualität deutlich unterscheiden und ihren eigenen Kindern gegenüber emotional klar auftreten. Das, was sie in ihrem sonstigen privaten wie beruflichen Leben machen, können sie ebenso eindeutig, liebevoll und mit freundlichen Gefühlen tun.
Zu lieben bedeutet, sich an einen anderen Menschen emotional zu binden. Damit werden zwei Lebenswege miteinander gekoppelt, im Guten wie im Schlechten. Daher kann die Liebe nicht nur glücklich machen, sondern einen gemeinsamen Leidensweg bedeuten. Daher müssen die Fähigkeit, zu lieben, und das Bedürfnis, geliebt zu werden, auch einen Entwicklungs- und Reifungsprozess durchlaufen. Liebe ist nichts Statisches, nur wenn sie sich verändert, bleibt sie lebendig. Daher kann die Liebe auch durchaus einmal zu Ende sein.
Krank machende Liebe
Eltern-Kind- und Paarbeziehungen sind ihrem Wesen nach Liebesbeziehungen. Fehlt in solchen Beziehungen die Liebe, fehlt daher das Wesentliche. Solche Beziehungen werden dann rein funktional. Die Konflikte in funktionalen Beziehungen können dann auch nicht mit Wohlwollen gelöst werden, sondern nur mit kalter Sachlichkeit, mit intellektuellen Wortgefechten und schließlich mit Aggression und Gewalt.
Unter Traumabedingungen wird auch das Lieben zu einer Überlebensstrategie. Das kann verschiedene Formen annehmen:
Fehlende Liebe wird oft gar nicht bemerkt.
Es wird geleugnet, dass keine Liebe vorhanden ist.
Liebe wird als »romantischer Unsinn, den man sich nicht leisten kann« oder als »psychologischer Firlefanz« abgetan.
Geld und Besitz werden als Kompensation für authentisches Lieben hergenommen.
Das süchtige Suchen nach dem Zustand des Verliebtseins soll reale Liebe ersetzen.
In der Fantasie, in religiösen, spirituellen oder esoterischen Welten wird die Sehnsucht nach der allumfassenden, immerwährenden und ewigen Liebe gelebt.
Durch Schöntun und Nach-dem-Mund-Reden wird der Anschein von Liebe erzeugt, wohinter sich in Wahrheit Ablehnung und Gleichgültigkeit verstecken.
Narzisstische Selbstbespiegelung wird als Liebe getarnt.
Im schlimmsten Fall wird sogar noch Gewalt als Liebe verkauft.
Sind Eltern traumatisiert, so leidet darunter ihre Bindungsfähigkeit und somit auch ihre Liebesfähigkeit. Das macht sich zunächst im Verhältnis zum Partner negativ bemerkbar und dann auch im Verhältnis zu den Kindern. Dass Mütter und Väter nicht liebesfähig sind, kommt Kindern gegenüber auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck:
als entschiedene Ablehnung mit oder ohne körperliche Gewalt,
als unberechenbares Schwanken zwischen Zu- und Abgewandtsein,
als Abladen von Traumagefühlen auf die Kinder,
als bedürftiges Sichanklammern,
als Hoffnung nach der reinen und unschuldigen Liebe von Kindern, die für alles andere entschädigen soll.
Von den eigenen Eltern nicht in dem Maße geliebt zu werden, wie es für die gesunde Entwicklung notwendig ist, kann für ein Kind Verschiedenes bedeuten: Ich werde nicht gesehen! Auf mich und meine Bedürfnisse kommt es nicht an! Ich werde körperlich und emotional missbraucht! Mich soll es eigentlich nicht geben! Ich soll nicht da sein! Ich soll ein ganz Anderer sein! Das sind für die kindliche Psyche unerträgliche Erfahrungen. Wird das kindliche Urbedürfnis nach Mutter- und Vaterliebe umfassend frustriert, kann sich das bis zu dem Punkt steigern, dass die Gefühle von Angst, Wut, Scham und Schmerz für das Kind unaushaltbar werden und es sich psychisch aufspalten muss, um die Bindungsbeziehung zu seiner Mutter und zu seinem Vater überhaupt zu ertragen und weiter in dieser Beziehung zu bleiben. Ein von seinen Eltern ungeliebtes bzw. mit Liebesillusionen und verstrickenden Liebesangeboten überfrachtetes Kind muss seine nicht mehr zu steuernden Gefühle unterdrücken und seine Liebesbedürfnisse, die weiterhin auf seine Eltern ausgerichtet sind, von seinen realen Erfahrungen abspalten.
Je nach den sonstigen Umständen, ihrem persönlichen Temperament, der Position in der Geschwisterreihe oder dem Geschlecht reagieren Kinder unterschiedlich auf diese traumatisierende Beziehung mit ihren Eltern:
Die einen werden krank und bringen ihre Not über körperliche Beschwerden zum Ausdruck.
Die anderen rebellieren, schreien ihre Ängste heraus und agieren ihre Wut ziellos aus.
Wieder andere ziehen sich in sich zurück und gehen auf innere Distanz zu ihren Eltern, ohne sich jedoch wirklich emotional von ihnen lösen zu können.
Nicht geliebte Kinder entwickeln verschiedene Überlebensstrategien der Liebe:
Sie kämpfen unablässig um die Aufmerksamkeit und den Kontakt mit ihren Eltern. Entweder indem sie besonders brav und artig sind oder indem sie durch destruktives Verhalten auffallen, durch Wutausbrüche, Provokationen oder Trotz.
Sie verleugnen ihre eigenen Bedürfnisse und kopieren die Überlebensstrategien ihrer Eltern. Sie unterdrücken ihre eigenen Gefühle und nehmen nicht wahr, was offensichtliche Realität ist.
Sie steigern ihre Anstrengungen, Mutter und Vater dennoch zu lieben – bis hin zur völligen Selbstaufgabe.
Sie stellen sich vollkommen in den Dienst ihrer Eltern, um deren psychische Stabilität zu gewährleisten.
Das Wohlergehen ihrer Eltern und deren Beziehung, oft sogar die gesamte Familie werden zu ihrem Hauptaugenmerk. Dafür nehmen sie die Einschränkung eigener Lebensimpulse in Kauf. Sie identifizieren sich mehr mit den Problemen ihrer Eltern oder Verwandten als mit ihren eigenen. Liebe bedeutet für sie fortwährende Opferbereitschaft.
Sie saugen sogar die Traumagefühle ihrer Eltern in sich auf, als wären es ihre eigenen und als könnten sie damit ihren Eltern die Last des Lebens abnehmen. Die Ängste der Mutter, die Traurigkeit des Vaters werden wichtiger als die eigenen kindlichen Sorgen und Nöte.
Selbst wenn die Eltern dem Kind gegenüber gewalttätig werden, kann das Kind das nicht wahrnehmen. Es nimmt stattdessen die Schuld auf sich, wenn die Eltern »böse« auf es sind. Je grausamer und brutaler traumatisierte Eltern ihre Kinder behandeln, umso anhänglicher und liebesbereiter zeigen sich diese auf der Ebene der Liebe.
Es findet dabei insgesamt eine Umkehrung der Verantwortung statt. Nicht die Eltern sind für die Existenz und das Wohlergehen des Kindes verantwortlich, sondern das Kind fühlt sich für seine Eltern und deren Wohlergehen zuständig. Es fühlt sich schuldig, wenn es seine Eltern leiden sieht. Es fühlt sich als eine Last für seine Eltern.
Kinder traumatisierter Eltern sind in der Regel in einem Trauma der Liebe, in einem extremen Prozess der Selbstverleugnung, der Selbstaufgabe, der Täter-Opfer- und Verantwortungsumkehr gefangen. Sie finden aus diesem Trauma der Liebe ohne Hilfe von außen nicht mehr heraus.
Der Begriff »Trauma der Liebe« bzw. »Traumatisierung der Liebe« wird von mir mittlerweile synonym mit dem Begriff »Symbiosetrauma« verwendet, um deutlich zu machen, welche weitreichende Folgen es hat, wenn ein Kind von Eltern nicht geliebt wird, die selbst traumatisiert sind, und daher ihr Kind fortlaufend traumatisieren, statt es zu lieben. Weil es zu einem Trauma der Liebe nur dann kommt, wenn bereits die Mutter des Kindes traumatisiert ist, die wiederum ihrerseits ein Opfer der Liebesunfähigkeit ihrer Eltern sein kann, müssen die Beziehungskonstellationen mehrgenerational betrachtet werden. Traumatisierten Müttern fehlen entscheidende psychische Fähigkeiten und Ressourcen, um ihrem Kind die Zuwendung und Liebe zu geben, die es vor allem in den frühen Phasen seiner Entwicklung braucht. Somit fließen in eine Traumatisierung der Liebe die Traumaerfahrungen der Vorgeneration und oft auch der Vorvorgenerationen mit ein.
Das wesentliche Merkmal bei einer Traumatisierung auf der Ebene der Liebe ist die fehlende Selbstliebe. Stattdessen ist ein Übermaß an Selbstkritik, Selbstverurteilung und Selbstablehnung vorhanden. Man hat das Gefühl, immer nur für andere da sein zu müssen, sich selbst nichts gönnen zu dürfen, es nie gut genug zu machen, ein schlechtes Kind, eine schlechte Mutter oder ein unfähiger Vater zu sein. Im Grunde können die Betroffenen bei einem »Trauma der Liebe« Liebe nicht von Gewalt und Angst unterscheiden und sich selbst nicht von den anderen.
Es kann auch für traumatisierte Eltern äußerst schmerzhaft sein, wenn sie sich ihrer Unfähigkeit, ihre Kinder zu lieben, gewahr werden. In den eigenen Überlebensstrategien gefangen und in der eigenen Unfähigkeit, zu fühlen, eingeschlossen zu sein, ist quälend. Der Elternrolle psychisch nicht gewachsen zu sein, potenziert das Liebestrauma, das traumatisierte Eltern in der Regel als Hypothek ihrer eigenen Kindheit in sich tragen. Das volle Ausmaß ihrer, meist nicht bewusst gewollten Täterschaft ihren Kindern gegenüber kann traumatisierten Eltern erst dann klar werden, wenn sie ihr eigenes kindliches Liebestrauma realisieren. Wenn sie Mitgefühl mit sich selbst als Opfer eines Traumas der Liebe bekommen. Dann können sie auch erkennen, dass ihnen die Selbstanklage und Selbstverurteilung ebenso wenig nutzen wie ihren Kindern. Was auch in Bezug auf die eigene Täterschaft einzig hilft, sind die Selbstannahme und Selbstliebe.
1.5 Traumatisierung der Sexualität
Liebe und Sexualität sind unterschiedliche Phänomene. Sie werden von unterschiedlichen körperlichen und psychischen Prozessen gesteuert, und es sind unterschiedliche Körperreaktionen und Verhaltensweisen, unterschiedliche Hormone und psychische Bedürfnisse im Spiel.
Biologie der Sexualität
Sexualität ist, biologisch betrachtet, eine von mehreren möglichen Formen der Fortpflanzung von lebenden Organismen. Andere Formen sind die Zellteilung, die Sprossung oder die ungeschlechtliche Vermehrung aus Eizellen heraus ohne die Verschmelzung mit einer Samenzelle. Zweigeschlechtliche Vermehrung hat den Vorteil, die Variantenvielfalt innerhalb einer Art zu erhöhen. Die Resistenz neu entstehender Lebewesen gegenüber ihren Konkurrenten um die vorhandenen Lebensressourcen (Bakterien, Viren, andere höher entwickelte Lebewesen) wird dadurch verbessert. Ein Schädling kann bei genetisch nicht differenzierten Arten leicht die gesamte Population auslöschen, was bei Lebewesen, die genetisch inhomogen sind, nicht so schnell der Fall ist.
Geschlechtliche Vermehrung tendiert zur Ausbildung von zwei Extremvarianten innerhalb einer Gattung:
Die eine Variante (»weiblich«) sind die Lebewesen, die über »Eier« verfügen, d.h. über einen Chromosomensatz, der von einer Nahrungshülle umgeben ist, in der eine befruchtete Eizelle unmittelbar weiterwachsen kann. Bei einigen Arten bieten die weiblichen Wesen diesen neu entstehenden Lebewesen zeitweise sogar ihren ganzen Körper an, in dem sich »das Junge« bis zu seiner Geburt weiterentwickeln kann. Der weibliche Organismus, der die Eier-Urzellen zur Verfügung stellt, braucht daher nur einen begrenzten Vorrat an Geschlechtszellen, um das Fortpflanzungsziel zu erreichen. Bei Frauen wird ein Vorrat von 300000 bis 400000 Eizellen angelegt, der sich dann bis zur Geschlechtsreife auf ca. 400 Eizellen reduziert.
Die andere, »männliche« Variante ist darauf spezialisiert, einen Chromosomensatz zu diesen Eizellen zu bringen. Dazu bedarf es eines speziellen Befruchtungsorgans (des »Penis«) und einer großen Menge selbstbeweglicher Chromosomenpakete (»Samenzellen«), um an ein befruchtungsbereites Ei zu gelangen. Um ihren Fortpflanzungserfolg sicherzustellen, müssen die Träger der Samenzellen diese in großen Mengen (300 Millionen Spermien pro Ejakulat bei Menschen) immer wieder neu herstellen.
Es gibt in der Natur zahlreiche Varianten der geschlechtlichen Fortpflanzung, der Art und Weise, wie geschlechtsspezifisches Verhalten praktiziert und wie nach einer geglückten Fortpflanzung weiter mit der Nachkommenschaft umgegangen wird. Die menschliche Form der Sexualität ist eine von mehreren möglichen, wie der Blick auf nahe biologische Varianten, die sogenannten Menschenaffen, belegt. Schimpansen, Bonobos, Gorillas oder Orang-Utans zeigen unterschiedliche Formen sexueller Aktivitäten, entwickeln verschiedene Geschlechtsrollenmuster und Brutpflegeverhaltensweisen.
Das Hauptziel der biologischen Evolution ist das Überleben der Einzelindividuen, damit sie sich fortpflanzen und vermehren. Evolutionäre biologische Strategien sind Anpassungs- und Neueroberungsversuche, sie testen Grenzen aus, innerhalb derer Leben möglich ist. Dadurch werden den einzelnen Lebewesen teilweise Grenzerfahrungen zugemutet:
Weil die Strategie der sexuellen Fortpflanzung eine maximale Differenzierung der Geschlechter befördert, werden beide Geschlechter extrem vereinseitigt. Frauen sind darauf festgelegt, die hohen körperlichen Risiken und Kosten von Schwangerschaft und Geburt allein zu tragen, die manchmal sogar tödlich für sie enden können. Sie werden sowohl biologisch wie psychisch und psychosomatisch darauf programmiert, sich weitgehend mit dem Wohl und Wehe ihrer Kinder zu identifizieren und ihre eigenen Interessen dafür hintanzustellen.
Männer sind eher darauf fixiert, sich in der Konkurrenz um den Sex mit den Frauen gegen andere Männer durchzusetzen. Sie sind einer sexuellen Triebhaftigkeit unterworfen, die sie in den Hochphasen ihrer Männlichkeit zwischen 18 und 30 Jahren häufig kaum steuern können, sodass sie für Sex hohe soziale und gesundheitliche Risiken eingehen, die auch für sie tödlich enden können.
Während für Frauen die Fähigkeit zur Empathie einen Evolutionsvorteil bedeutet, weil sie sich damit besser in die Bedürfnisse und Nöte ihre Kinder einfühlen können, bedeutet die Fähigkeit zum Mitfühlen für Männer tendenziell sogar einen Evolutionsnachteil, weil zu viel Empathie sie gegebenenfalls vom Sichdurchsetzen gegenüber anderen Männern zurückschrecken lässt.
Weil das Gehirn in der menschlichen Entwicklung immer wichtiger und damit der Kopfschädel als sein Aufbewahrungsgefäß immer größer geworden ist, kann die Passage des Kindes durch das weibliche Becken und den Geburtskanal für die gebärende Frau zu einem äußerst schmerzhaften Erlebnis werden. Eine Geburt kann für sie sogar zu einer lebensbedrohlichen Erfahrung werden, wenn keine ausreichende Kooperation zwischen dem Ungeborenen und seiner Mutter stattfindet. Eine Geburt kann für eine Frau andererseits jedoch auch der ultimative Orgasmus sein und einen hohen emotionalen Belohnungswert haben.
Da Mehrlingsschwangerschaften bei Menschen eher eine Belastung für die Eltern darstellen, enden Mehrfachbefruchtungen und Zwillings- und Drillingsschwangerschaften oftmals schon im Uterus. Es entsteht früh eine Auseinandersetzung auf Leben und Tod zwischen den Lebewesen, die neu ins Leben kommen wollen. Existenztraumata können daher schon vorgeburtlich auftreten.
Es wäre eine Illusion zu meinen, wir Menschen könnten uns außerhalb der Vorgaben der biologischen Evolution bewegen. Wir müssen sie als Voraussetzungen annehmen, um auf der psychischen, sozialen und kulturellen Ebene das jeweils Beste daraus zu machen. Je mehr wir unsere unbewussten psychosomatischen Vorprägungen akzeptieren, umso besser können wir die Spielräume nutzen, die sich für uns öffnen. »Die Natur« macht uns Menschen keine Vorschriften oder erlegt uns »Gesetze« auf, wie wir unser Zusammenleben zu gestalten haben. Sie macht uns Angebote, die wir nutzen können oder auch nicht. Die Kenntnis natürlicher Abläufe ist von großem Vorteil, weil sie ideologischer Voreingenommenheit die Glaubwürdigkeit nimmt.
Psychosoziale Bedingungen der Sexualität
Die sexuelle Entwicklung beginnt bei uns Menschen bereits während der Schwangerschaft. Ab dem 3. Lebensmonat werden die Geschlechtsorgane angelegt. Bei den Menschen, die zu Frauen werden, entstehen die Ovarien und später die Gebärmutter, die Eileiter und die Vagina. Um männlich zu werden, muss der werdende Organismus vor allem Testosteron ausgesetzt werden, damit die Hoden als Keimdrüsen entstehen. Bereits in dieser Phase können unvollständige Entwicklungsprozesse dazu führen, dass die geschlechtlichen Körperformen nicht oder nur unzulänglich entwickelt werden und sich möglicherweise Zwischenformen (»Zwitter«) ausbilden, bei denen beide Geschlechtsorgane in Ansätzen vorhanden sind.
Zur Ausbildung gesunder Geschlechtlichkeit braucht es bei uns Menschen in der Regel noch weitere 10–14 Jahre, ehe der Gesamtorganismus in der Lage ist, selbst für die Aufgaben der Fortpflanzung zur Verfügung zu stehen. In der Zwischenzeit reifen die Geschlechtsorgane weiter heran, formen sich die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale bei Mädchen wie Jungen aus, und es findet eine Vorbereitung auf die spätere Rolle als Frau oder Mann, Mutter oder Vater statt. Bereits vor der Fortpflanzungsfähigkeit sind die erogenen Zonen erregbar und können Orgasmen und Lustgefühle vermitteln.
Die Zeit bis zur Geschlechtsreife ist auch ein Sozialisationsprozess für die kindliche Sexualität. Mädchen wie Jungen können bis zur eigenen Geschlechtsreife die Spielregeln für sexuelles Verhalten bei den Erwachsenen beobachten. Sie erleben die geschlechtsbezogenen Normen, Werte und Tabus der Gesellschaft, in die sie hineinwachsen. Für die Entwicklung einer gesunden Sexualität von Kindern braucht es demnach eine Gesellschaft von Erwachsenen, die mit dem Thema Sexualität eindeutig und angemessen umgehen kann. Nur so können die Kinder selbst die Verantwortung für die in ihrem Körper verinnerlichte Urkraft der Fortpflanzung übernehmen. Kinder müssen lernen, welche Formen sexueller Betätigung ihre körperliche, psychische und soziale Reife fördern und welche nicht. Die Selbstbestimmung in Bezug auf die eigene Sexualität ist eine zentrale Voraussetzung für eine gesunde individuelle Entwicklung wie für das Entstehen gesunder zwischenmenschlicher Beziehungen.
Wie wenig klar soziale Gruppen und ganze Gesellschaften oft in Bezug auf das Phänomen Sexualität sind, zeigt sich an der großen Häufigkeit von sexuellem Kindesmissbrauch, Prostitution, Pornografie, sexueller Ausbeutung, sexueller Gewalt in Paarbeziehungen und daran, wie oft geschwängerte Frauen durch die zeugenden Männer im Stich gelassen werden. Diese Geschehnisse wirken sich psychisch und sozial verheerend aus. Die Versuche, über rigide Sexualnormen und Moralvorstellungen der menschlichen Sexualität den Impuls zum blinden, triebhaft animalischen Ausagieren zu nehmen, sind in der Regel eher hilflos als erfolgreich. Auch liberale Sexualvorstellungen und -praktiken ignorieren oft die psychischen Nöte und Konflikte, die Sexualität in zwischenmenschlichen Beziehungen auslösen kann. Nach wie vor ist es für jede Generation eine bedeutende Herausforderung, einen angemessenen Umgang mit der weiblichen wie männlichen Form der Sexualität und den sich daraus ergebenden zwischenmenschlichen Beziehungen zu finden. Es ist noch immer ein Prozess der Aufklärung unseres eigenen Bewusstseins notwendig, damit wir Menschen einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Sexualität lernen und »den Prozess der Zivilisation« (Elias 1976) auf eine gute Weise fortführen.
Der Sexualakt, d.h. das Eindringen des männlichen Penis in die Scheide der Frau, ist, rein körperlich gesehen, eigentlich ein roher Vorgang, sofern er nicht durch zärtliche Berührungen und liebende Gefühle in eine wohlwollende Vereinigung zwischen den Geschlechtern verwandelt wird. Der Orgasmus als Höhepunkt der gegenseitigen geschlechtlichen Stimulation ist oft nur für den Mann als schnell erreichbare Belohnung vorhanden. Frauen brauchen im Allgemeinen etwas länger, um im Körperkontakt mit einem Mann zu einer orgastischen Entladung ihres Körpers zu gelangen. Sie brauchen dazu das Bewusstsein, den Geschlechtsakt selbst zu wollen, sie benötigen das Vertrauen in ihre eigenen Körpergefühle und eine emotionale Offenheit für den Mann, mit dem sie sich vereinigen. Nur so können sie die gedankliche Hemmung ihrer Körperreaktionen und Gefühle aufgeben und sich fallen lassen. Vor allem die Angst, beim Sexualakt ungewollt schwanger zu werden und dann auch noch vom Mann »sitzen gelassen« zu werden, kann bei Frauen die Lust an der Sexualität erheblich einschränken oder sogar völlig ausbremsen. Für Frauen in patriarchalen Gesellschaften, die ihre Sexualität nicht zumindest gegen ein Eheversprechen eintauschen können, besteht ein hohes Risiko, dass sie nicht nur die körperlichen und emotionalen Lasten des Großziehens von Kindern allein tragen müssen, sondern auch sozial stigmatisiert und als »unehrenhafte Frauen« gebrandmarkt und kriminalisiert werden (Metz-Becker 1997).
Sexuelle Gewalt
Wie bei der Liebe können auch in der Sexualität die entsprechenden Bedürfnisse und Fähigkeiten traumatisiert werden. Dies geschieht insbesondere in der Zeit der Kindheit,
wenn sexuelle Gefühle zu früh angesprochen und nicht vom Kind selbst, sondern von anderen stimuliert werden,
wenn sexuelle Erregung in Beziehungen stattfindet, in denen das heranwachsende Kind von Erwachsenen eigentlich liebevoll geschützt und gefördert werden sollte,
wenn sexuelle Handlungen gegen den Willen des Kindes und Heranwachsenden eingefordert und mit Drohungen, Erpressungen und Gewalt erzwungen werden.
In solchen Fällen findet bei einem Kind oder Jugendlichen eine umfassende Verwirrung der körperlichen Reaktionen, der emotionalen Antworten und der geistigen Einordnung der Beziehungssituationen statt. Das Kind weiß nicht, ob seine Körperreaktionen angemessen sind, es kann seine wahren Gefühle nicht mehr spüren, und es ist völlig durcheinander in der Einschätzung der Personen, die es zu sexuellen Handlungen missbrauchen. Meint es der Vater, die Mutter, der Bruder, die Schwester, der Opa, die Oma etc. gut mit ihm, oder ist das, was es da gerade an seinem Körper und seinen Geschlechtsorganen erlebt, verkehrt, schmerzhaft, eklig und verboten?
Dem Kind, vor allem wenn es keinen Erwachsenen in seiner Umgebung gibt, der ihm aus seiner Verwirrung heraushelfen könnte, bleibt daher nichts anderes übrig, als sich psychisch zu spalten. Es muss seine Wahrnehmungen verdrängen und so tun, als sei nichts geschehen. Es muss seine Ängste, seine Wut, seine Scham, seinen Ekel und zuweilen auch seine aufkommenden Lustgefühle unterdrücken. Es muss vergessen, dass diese Personen, die es gerade sexuell missbraucht und ihm Gewalt angetan haben, jetzt wieder so tun, als sei nichts gewesen. Es muss mit diesen Menschen weiter zusammenleben und ist von ihnen abhängig – materiell wie emotional. Daraus entwickeln sich dann die vielfältigen Überlebensstrategien bei einem Trauma der Sexualität:
Versuche, eigene sexuelle Impulse zu unterdrücken,
Abstumpfung der Gefühle für den eigenen Körper,
Verwirrung in Bezug auf die eigene Identität,
Ausblenden des Bewusstseins, wer der Täter ist,
Verschiedene Formen sogenannter Essstörungen (»Magersucht«, »Bulimie«, sich fett essen),
Drogenkonsum zur Unterdrückung negativer Gefühle und zur Überwindung der eigenen Gefühl- und Empfindungslosigkeit,
Weitergabe der eigenen schmerzlichen Erfahrungen an andere (jüngere Kinder, später dann die eigenen Kinder),
Grundsätzliches Misstrauen oder sogar Verachtung des anderen Geschlechts (Frauenverachtung bei Männern, Männerhass bei missbrauchten Frauen),
Illusionäre Versuche der Kontrolle sexueller Gewalt, z.B. durch Promiskuität oder in der Prostitution oder in sexsüchtigem Verhalten,
Kontrolle der Sexualität bei den eigenen Kindern (z.B. sehen sexuell traumatisierte Mütter oft in ihren Söhnen die Täter und versuchen daher, die Sexualität ihrer Söhne mit Gewalt oder mit erstickender Liebe zu unterdrücken).