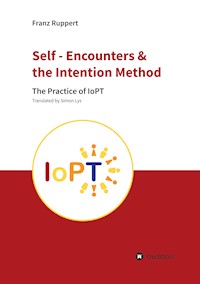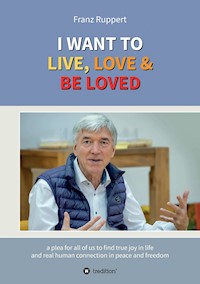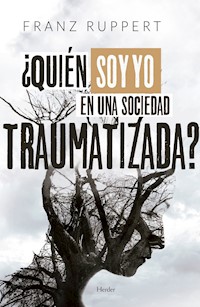29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Leben Lernen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Frühkindliche Symbiose-Autonomie-Konflikte sind Franz Ruppert zufolge Ursache für viele seelische Verstrickungen. Das Buch zeigt an zahlreichen Beispielen aus der Praxis, wie diese Symbiosetraumata erkannt und - mit einer neu entwickelten Form der Aufstellungsmethode - erfolgreich behandelt werden können. Sowohl der Wunsch nach Nähe als auch der Wunsch nach Abgrenzung begleitet Menschen durch das ganze Leben. Nicht selten jedoch werden die vitalen symbiotischen Bedürfnisse in der frühesten Kindheit von den Eltern nicht befriedigt. Die Bindung an die Mutter kann dann zu einem Symbiosetrauma für das Kind werden. In den seelischen Verstrickungen, die sich daraus ergeben, sieht Franz Ruppert die Quelle für die meisten Beziehungsprobleme, die Neigung zu Suchtverhalten, zu Ängsten, Depressionen und sogar zu Schizophrenien. An zahlreichen Beispielen aus der Praxis zeigt er, wie Symbiosetraumata erkannt und behandelt werden können. Seine neu entwickelte Form, mit der Aufstellungsmethode zu arbeiten, hat sich hier als besonders erfolgreich erwiesen. Zielgruppe: - PsychotherapeutInnen aller »Schulen« - TraumatherapeutInnen - Betroffene
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Ähnliche
Franz Ruppert
Symbiose und Autonomie
Symbiosetraumaund Liebe jenseits von Verstrickungen
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2013 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Roland Sazinger
Unter Verwendung eines Fotos von © Vera Kuttelvaserova / fotolia.com
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-89215-4
E-Book: ISBN 978-3-608-10404-2
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20025-6
Dieses E-Book entspricht der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorbemerkung
Danksagung
Anmerkung zum Wortgebrauch
Vorwort zur 6. Auflage
1. Für immer Dein – oder immer allein?
Kinderlieder
Symbiose-Autonomie-Konflikte
Arbeitshypothesen
2. Was ist »Symbiose«?
2.1 Gegenseitiger Nutzen
2.2 Jäger und Beute
2.3 Konkurrenz und Arbeitsteilung
2.4 Urgefühle
2.5 Spiegelneurone und Symbiose
3. Symbiose als psychologisches Konzept
Erich Fromm
Margret Mahler
Martin Dornes
Weiterführende Überlegungen
4. Was ist Autonomie?
4.1 Masse oder Einzigartigkeit?
4.2 Entwicklung von Individualität und Subjektivität
4.3 Freiheit von Abhängigkeiten
4.4 Äußere und innere Freiheit
4.5 Ich-Bildung
4.6 Pseudoautonomie
4.7 Wahre Autonomie
5. Konstruktive und destruktive Symbioseformen
5.1 Konstruktive Formen von Symbiose
5.2 Destruktive Formen von Symbiose
5.3 Konstruktivität und Destruktivität der Eltern-Kind-Beziehung
5.4 Wachstumsspirale
6. Traumata als Ursachen psychischer Störungen
6.1 Bindungstheorie und Traumatheorie
6.2 Ein Modell für seelische Spaltungen
6.3 Trauma und Symbiose
7. Symbiose zwischen Eltern und Kindern
7.1 Mutter-Kind-Symbiose
7.2 Kind-Mutter-Symbiose
7.3 Traumatisierte Mütter und traumatisierte Kinder
7.4 Traumatisierte Väter und traumatisierte Kinder
8. Das Symbiosetrauma
9. Symbiotische Verstrickungen
9.1 Symbiotische Verstrickungen bei Geschwistern
9.2 Symbiotische Verstrickungen bei Paaren
9.3 Symbiotische Verstrickung mit der ganzen Familie
9.4 Symbiotische Verstrickungen auf nationaler Ebene
9.5 Symbiotische Verstrickungen mit (Sport-)Vereinen
9.6 Wirtschaft, Geld und symbiotische Verstrickungen
9.7 Symbiotische Verstrickungen von Tätern und Opfern
9.8 Sucht und symbiotische Verstrickungen
9.9 »Psychose«, »Schizophrenie« und symbiotische Verstrickungen
9.10 Körperliche »Krankheiten« und symbiotische Verstrickungen
10. Bindungsorientierte Traumaaufstellungen
10.1 Zuhören ohne zu werten
10.2 Vertrauen erwerben
10.3 Von der Familien- zur Traumaaufstellung
10.4 Arbeit mit dem Anliegen
10.5 Die Rolle des Therapeuten
10.6 Arbeit mit Aufstellungen in Einzelsitzungen
10.7 Hintergrundtheorie und Arbeitshypothesen
11. Lösung aus symbiotischen Verstrickungen
11.1 Therapeutische Begleitung
11.2 Therapeutische Irrwege
11.3 Aufstellungen und Symbiosetrauma
11.4 Symbiotische Verstrickung verstehen
11.5 Traumata verstehen und anerkennen
11.6 Seelisch am Trauma arbeiten
11.7 Illusionen einer schnellen Heilung aufgeben
11.8 Auf symbiotisch übernommene Gefühle verzichten
11.9 Gesunde Anteile in den Vordergrund holen
11.10 Ein gesundes Körpergefühl entwickeln
11.11 Einen gesunden Willen entwickeln
11.12 Mit sich sein können
11.13 Weder retten noch gerettet werden wollen
11.14 Verstrickende Partner verlassen
11.15 Auf Abstand zu traumatisierenden Eltern gehen
11.16 Weder Opfer noch Täter sein
11.17 Die eigene Kindheit abschließen
11.18 Gute neue Beziehungen eingehen
11.19 Gesunde Abgrenzungen finden
11.20 Zur sexuellen Selbstbestimmung finden
11.21 Unbestechliche Klarheit
11.22 Lieben jenseits von Trauma und symbiotischer Verstrickung
12. Hoffnung
Literatur
Vorbemerkung
Das vorliegende Buch stellt das fünfte in der Reihe meiner Bücher dar, in denen ich um Klarheit ringe, was die menschliche Seele in ihrem Innersten bewegt, was sie gesund sein lässt, was sie krank macht und wie dieses Wissen in eine wirkungsvolle psychotherapeutische Arbeit umgesetzt werden kann.
Begonnen habe ich diese Entdeckungsreise in das Innere unseres Menschseins im Jahr 1994. Da ich zu dieser Zeit beruflich noch mit der Arbeits- und Organisationspsychologie verbunden war, entstand 2001 als Erstes das Buch »Berufliche Beziehungswelten«. Bei der Darstellung von Arbeitsbeziehungen durch die Aufstellungsmethode wurde mir die große Bedeutung von familiären Beziehungsdynamiken deutlich, die hinter den Konflikten liegen, die im Arbeitsleben auftreten. Daher bedarf es bei Konflikten, die nicht durch die Anerkennung klarer Beziehungsregeln in der Berufswelt zu lösen sind, der Rückschau auf die frühen Lebenserfahrungen eines Menschen mit seinen Eltern. In den Problemen, die in Arbeitsbeziehungen verdeckt auftreten, spiegeln sich die nicht gelösten Themen der Eltern-Kind-Beziehungen wider. Bei alldem drängte sich mir die Vermutung auf, dass es bei uns Menschen einen eigenen Sinn für das Wahrnehmen von Beziehungen geben muss.
Mit dem Buch »Verwirrte Seelen«, erschienen 2002, habe ich den ersten Anlauf genommen, rätselhafte Erscheinungsformen menschlichen Verhaltens und Erlebens, die in der psychiatrischen Terminologie als »Psychische Erkrankungen« bezeichnet und als »Psychosen«, »Schizophrenien« oder »Borderline-Persönlichkeitsstörungen« diagnostiziert werden, auf seelische Verstrickungen in familiären Bindungssystemen zurückzuführen. Meine Grundthese dabei lautet: Nicht der Einzelne ist »krank«, das Problem sind die Beziehungen, unter denen Menschen leiden. Die zwischenmenschlichen Beziehungen werden besonders dann zu einem ernsthaften Problem, wenn sie unter dem Einfluss von Traumata stehen und selbst die Quelle von Traumatisierungen darstellen. Derart gestörte zwischenmenschliche Beziehungen tradieren sich über den Weg der Eltern-Kind-Bindung unweigerlich von einer Generation zur nächsten fort, wenn sie nicht anerkannt und aufgearbeitet werden. Bis zu vier Generationen können innerhalb einer Familie durch nicht aufgelöste Traumata miteinander verstrickt sein und manche Menschen in ihrer Identität so sehr verwirren, dass sie »psychotisch« und »schizophren« werden.
Dass die Phänomene »Bindung« und »Trauma« im Prinzip bei jeder psychischen Störung zusammenspielen und sie ursächlich erklärbar machen, wenn man die Übertragung von Traumagefühlen in Bindungsbeziehungen erkennt, versuchte ich 2005 in dem Buch »Trauma, Bindung und Familienstellen« herauszuarbeiten. Zum tieferen Verständnis der vier verschiedenen Formen von Traumata, die ich als »Existenz«-, »Verlust«-, »Bindungs«- und »Bindungssystem«-Trauma bezeichne, verwende ich hier allerdings noch ein zweidimensionales Modell von seelischer Spaltung, das die traumatisierten Persönlichkeitsanteile den übrigen Seelenanteilen gegenüberstellt. Bei der Überwindung der Traumatisierungen setzte ich teilweise noch auf Lösungen, die von außen kommen. Ich ging zu diesem Zeitpunkt noch davon aus, dass ein Bindungstrauma durch die Versöhnung mit den Eltern überwunden werden kann. Symbiotische Illusionen können dadurch jedoch genährt und die Vermeidungsstrategien hinsichtlich der Auseinandersetzung mit dem eigenen Trauma auf diese Weise gefördert werden.
In dem Buch »Seelische Spaltung und innere Heilung« (2007) wollte ich daher zwei wesentliche neue Erkenntnisse darstellen, welche sich durch die fortgesetzte intensive Arbeit mit Patienten ergeben hatten: erstens das dreidimensionale Modell der nach einer Traumatisierung gespaltenen Persönlichkeit, die aus »gesunden Anteilen«, »traumatisierten Anteilen« und »Überlebensanteilen« besteht; zweitens das Konzept der »inneren Heilung«, bei der Prozesse der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen eindeutig den Vorrang haben vor allen anderen Formen von therapeutischen Angeboten. Es geht bei der »inneren Heilung« in erster Linie darum, mit den eigenen abgespaltenen Gefühlen in Kontakt und den eigenen Traumata ins Reine zu kommen.
Trotz dieses Fortschritts im Verständnis seelischer Prozesse blieb für mich ein Rest an Unklarheit, der sich auf diejenigen seelischen Anteile bezog, die sich deutlich im Zusammenhang mit Bindungstraumata und Bindungssystemtraumata zeigten. Es gibt seelische Anteile, welche sich mit aller Kraft an solche Eltern klammern, die einem als Kind schweren Schaden zufügen. Diese Anteile erwiesen sich als weitgehend unbeeinflussbar gegenüber allen therapeutischen Bemühungen, sie zu einer Ablösung von ihren Eltern zu bewegen. Warum also sind gerade diejenigen Kinder, die am meisten von ihren Eltern vernachlässigt, geschlagen, missbraucht und gedemütigt werden, am wenigsten in der Lage, sich von diesen Eltern innerlich abzugrenzen?
Die Antwort auf diese Frage ergab sich, als ich immer besser verstand, dass bereits der ursprüngliche symbiotische Prozess zwischen Mutter und Kind zu einem Urtrauma für das Kind werden kann. Dieses Urtrauma ruft eine erste frühe Spaltung im Seelenleben eines Kindes hervor. Ich bezeichne diesen Vorgang nun mit dem Begriff des »Symbiosetraumas«. Weil ein »Symbiosetrauma« ein Kind schon so früh in seiner Entwicklung seelisch spaltet, verliert es den Bezug zu seinen ursprünglichen vitalen Impulsen und richtet einen Großteil seiner Aufmerksamkeit weg von sich auf das Außen und auf andere Menschen. Es kann daher keine eigene, in sich gefestigte Identität ausbilden. Es bleibt ein Leben lang abhängig und unselbstständig und verstrickt sich immer mehr. Selbst der erwachsene Mensch wird in seinem Kern von seinen kindlichen Ängsten gesteuert.
Wird das Symbiosetrauma in seiner fundamentalen Bedeutung für die gesamte psychische Entwicklung eines Menschen erkannt, werden alle anderen seelischen Probleme, die daraus entstehen, wesentlich besser erklärbar. Wir können als traumatisierte und bindungsgestörte Menschen erst dann an unserer eigenen inneren Heilung arbeiten, wenn wir in der Lage sind zu erkennen, wer wir selbst sind. Erst nachdem an der Integration der ursprünglichen Spaltung therapeutisch gearbeitet wird, können alle weiteren, möglicherweise noch zusätzlich erlebten Traumata überwunden werden. Aus destruktiven symbiotischen Verstrickungen können allmählich konstruktive symbiotische Beziehungen werden, Pseudoautonomie kann sich zu wahrer Autonomie wandeln. Das Schwergewicht der therapeutischen Arbeit kann sich dadurch weiter dahin verlagern, nicht die symbiotischen Abhängigkeitsbedürfnisse zu nähren, sondern die Autonomieentwicklung von Menschen zu unterstützen.
Der gesamte bisherige Erkenntnisprozess, den ich hier kurz geschildert habe, war begleitet durch meine Arbeit mit der Aufstellungsmethode. Ich begann zunächst Erfahrungen mit »Familienaufstellungen« im Sinne ihres Begründers, Bert Hellinger, zu sammeln. Doch je mehr Einsichten ich in die elementaren seelischen Vorgänge von »Bindung« und »Trauma« erlangte, desto mehr wurde mir klar, dass ich meinen eigenen Weg finden musste, mit der Aufstellungsmethode therapeutisch zu arbeiten. Ich bezeichne die Form der Aufstellung, mit der ich heute überwiegend arbeite, als »Traumaaufstellung«. Im Zusammenhang mit dem neuen Konzept des Symbiosetraumas habe ich wiederum eine neue Variante der Aufstellungsarbeit entwickelt, die ich als das »Aufstellen des Anliegens« bezeichne. Diese neue Methode und ihre Anwendungsmöglichkeiten werden im vorliegenden Buch zum ersten Mal detailliert beschrieben.
Ob die Entdeckungsreise in das Innere der menschlichen Seele damit schon an ihr Ende gelangt ist, weiß ich nicht. Ich vermute es eher nicht. Wie mir scheint, sind noch lange nicht alle Rätsel unserer menschlichen Psyche gelöst. Manches, was ich hier darstelle, ist noch im Stadium der Erprobung. Es werden zahlreiche Arbeithypothesen formuliert, deren weitere wissenschaftliche Erforschung noch ansteht.
Ich hoffe, die in diesem Buch zusammengetragenen Einsichten geben uns, ob als Betroffene oder als professionell Arbeitende, auch in ihrer Vorläufigkeit eine weitere Möglichkeit, die komplexen Zusammenhänge zwischen den vielfältigen Lebenssituationen und ihren körperlichen, emotionalen und geistigen Verarbeitungsmöglichkeiten zu begreifen und dieses Wissen für die Weiterentwicklung unserer persönlichen Autonomie sowie von gesunden gesellschaftlichen Strukturen zu nutzen.
Danksagung
Mein Dank gilt an erster Stelle den vielen Patientinnen und Patienten, die bereit sind und waren, mit mir zusammen einen unkonventionellen Weg zu gehen, um die tieferen Ursachen und Zusammenhänge für seelisches Leiden herauszufinden. Ihre Offenheit und ihr Vertrauen ermöglichen es mir, immer mehr und Genaueres darüber in Erfahrung zu bringen, was uns Menschen in der Tiefe unserer Seele bewegt. Ich habe Patientinnen und Patienten in diesem Buch möglichst oft direkt zu Wort kommen lassen, weil sie selbst am besten formulieren und ausdrücken können, was sie fühlen und denken. Die Namen aller in diesem Buch genannten Menschen sind selbstverständlich geändert worden.
Danke sage ich all meinen Wegbegleitern national wie international, welche die Entwicklungen meiner Arbeit mittragen und mitgestalten. Besonders erwähnen möchte ich Margriet Wentink, Wim Wassink, Vivian Broughton, Jutta ten Herkel, Thomas Riepenhausen, Ingrid Dykstra, Doris und Alexander Brombach, Birgit Assel, Radim Ress, Marina Bebtschuk, Patrizia Manukian, Svetlana Wrobej, Marta Thorsheim, Tore Kval, Ute Boldt, Petra Schibrowski, Alois Schwent, Barbara Spitzer, Rebecca Szeto, Kama Korytowska, Lena Gourskaja, Helmut A. Müller und Heribert Döring-Meijer. Ich erlebe mit einem jedem der Genannten auf eine besondere Weise einen kreativen und konstruktiven Austausch von Erfahrungen.
Vielen Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klett-Cotta Verlags, von denen ich mich jederzeit hilfreich unterstützt erlebe. Namentlich erwähnen möchte ich Frau Dr. Christine Treml als Lektorin und Herrn Roland Knappe als Koordinator der inzwischen zahlreichen Kontakte mit ausländischen Verlagen.
Anmerkung zum Wortgebrauch
Ich verwende im Text aus Gewohnheit meist die männliche Sprachform. Es sind dabei jedes Mal beide Geschlechter gemeint, falls im Text nicht ausdrücklich auf einen Mann oder eine Frau Bezug genommen wird. Ich spreche in der Regel von »Patienten«, wobei gleichwertig auch der Begriff »Klient« oder einfach »Mensch« verwendet werden könnte.
Vorwort zur 6. Auflage
Ich freue mich, dass »Symbiose und Autonomie« weiterhin eine große Leserschaft hat. Meine Entdeckungsreise ist seit dem ersten Erscheinen dieses Buches weitergegangen und hat viele Früchte getragen, die in folgenden weiteren Publikationen zu finden sind:
Trauma, Angst und Liebe (Erstauflage 2012): Hier findet sich die präzisere Definition dessen, was menschliche Psyche bedeutet.
Frühes Trauma (Erstauflage 2014): In diesem Buch werden die Erkenntnisse zusammengetragen, welche Traumata sich vor, während und kurz nach der Geburt ereignen und das gesamte weitere Leben beeinflussen können.
Mein Körper, mein Trauma, mein Ich (Erstauflage 2017): Welche enormen Auswirkungen Traumatisierungen auf den menschlichen Körper und unsere Gesundheit haben, wird in diesem Buch anhand zahlreicher Fallbeispiele verdeutlicht.
Wer bin Ich in einer traumatisierten Gesellschaft? (Erstauflage 2018): Wie durch Traumata hervorgerufene Täter-Opfer-Dynamiken persönliche Beziehungen und auch gesellschaftliche Verhältnisse vergiften können, zeigt dieses Buch in aller Deutlichkeit auf.
Liebe, Lust und Trauma (Erstauflage 2019): In diesem Buch geht es allgemein um menschliche Sexualität und welche tiefgreifende Folgen sexuelle Traumatisierungen für die Betroffenen und ihre soziale Beziehungssysteme haben. Es wird auch aufgezeigt, welche therapeutischen Interventionen hilfreich sind und wie eine sinnvolle Prävention möglich ist.
Ich bedanke mich bei meinen Lesern für Ihr Interesse und wünsche ihnen viele neue und für ihr Leben hilfreiche Einsichten.
München, im September 2019
Franz Ruppert
1. Für immer Dein – oder immer allein?
Kinderlieder
Die erste Strophe eines bekannten deutschen Kinderliedes lautet:
Hänschen klein / ging allein / in die weite Welt hinein.
Stock und Hut / steht ihm gut / ist gar wohlgemut.
Aber Mutter weinet sehr / hat ja nun kein Hänschen mehr.
Da besinnt / sich das Kind / läuft nach Haus geschwind.
Die 2. Strophe bekräftigt die Rückkehr von Hänschen zu seiner Mutter:
Lieb Mama / ich bin da / ich dein Hänschen hoppsassa.
Glaube mir / ich bleib hier / Geh nicht fort von Dir.
Da freut sich die Mutter sehr / und das Hänschen noch viel mehr.
Denn es ist / wie ihr wisst / gar so schön bei ihr.
Ob sich Kinder Gedanken über diesen Text machen? Wo in aller Welt soll es denn besser sein als zu Hause bei der Mama? Bei einer Mama, die ihr Kind vermisst, wenn es weggeht? Für Kinder gehören Mütter und Kinder zusammen.
Als erwachsener Mensch kann man sich zu diesem Kinderlied eine ganze Reihe von Fragen stellen:
Warum wollte Hans überhaupt hinaus in die weite Welt, wenn es bei der Mutter zu Hause viel besser ist?
Warum weint die Mutter und ruft ihm nicht einfach nach und fordert ihn auf, er solle sofort umkehren?
Soll er bei ihr bleiben, weil er sie noch braucht und viel zu klein ist, um allein in der Welt zurechtzukommen, oder braucht die Mutter ihren Sohn, damit sie nicht allein ist?
Oder steckt da noch eine ganz andere Geschichte dahinter, weshalb die Mutter weint?
Wann wäre der rechte Zeitpunkt für Hänschen, um seine Mutter zu verlassen? Braucht er dazu überhaupt ihre Erlaubnis?
Muss er gehen, auch wenn sie ihm nachweint?
Muss er möglicherweise gegen ihren Widerstand, ihn bei sich zu behalten, von zu Hause aufbrechen? Nützt ihm dafür eine Portion Wut?
Welche Rolle spielt sein Vater? Möchte auch der ihn länger behalten? Oder ihn vielleicht schon wesentlich früher in die weite Welt hinausschicken als die Mutter?
Was geschieht, wenn Hans nicht zu früh, sondern viel zu spät oder gar nicht das Haus seiner Eltern verlässt?
Wird Hans in der weiten Welt einmal traurig und einsam sein ohne seine Mutter?
Wird er sich möglichst schnell eine Frau suchen, die ihm seine Mutter ersetzt?
»Hänschen klein« ist das Hohelied auf die symbiotischen Bedürfnisse von Müttern und Söhnen: zusammen sein und zusammen bleiben, den anderen nicht verlassen, ihn nicht einsam machen, selbst nicht einsam sein müssen. Innigkeit und Geborgenheit, Treue und Loyalität scheinen die Garanten für ein immerwährendes Glück. Eine moderne Version der offensichtlich unauflösbaren Verbundenheit von Mutter und Sohn hat der holländische Kinderstar Heintje in seinem Lied »Mama« besungen:
»Ich werd’ es nie vergessen / was ich an dir hab’ besessen
Dass es auf Erden nur eine gibt / die mich so heiß hat geliebt.«
Kann man es sich wünschen, von so einer Liebe Abschied zu nehmen? Sich jemals voneinander zu lösen? Die Mutter muss nicht weinen, denn ihr Sohn ist in Gedanken immer bei ihr und sie trägt ihn allzeit in ihrem Herzen. Was aber hat das möglicherweise für Auswirkungen auf die anderen Beziehungen, die der Sohn in seinem Leben noch eingeht, wenn die Mutter die Einzige ist, von der er sich heiß geliebt fühlt?
Bei solchen Kinderliedern sind geschlechtsspezifische Aspekte nicht zu übersehen. Das Mutter-Sohn-Verhältnis erscheint besonders emotionsgeladen. Der Sohn muss trotz aller Mutterliebe nach gängigen Rollenvorstellungen irgendwann hinaus in die weite Welt, um sich im Lebenskampf zu bewähren. Unübersehbar ist die subtil erotische Komponente, weil der kleine Prinz in seinen kindlichen Fantasien der treueste und fürsorglichste Mann seiner Mutter ist. Heintje hat das in einem anderen Lied an die Mutter so zum Ausdruck gebracht: »Ich bau dir ein Schloss.« Die Grenzen zwischen Mutter und Sohn verschwimmen leicht im Nebel der symbiotischen Gefühle: Wer ist die Mutter und wer ist das Kind? Wer ist groß und wer ist klein? Ist der Sohn gar der ideale Mann seiner Mutter?
Bei Töchtern erscheint die Ablösethematik von der Mutter nicht so brisant. Zumindest gibt es kein Lied, in dem eine Tochter singt: »Mama, du wirst doch nicht um deine Tochter weinen …« In traditionellen Gesellschaften wird auch heute noch erwartet, dass Töchter ihrer Mutter ein Leben lang zur Seite stehen, sie im Alltag nach Kräften unterstützen, kleinere Geschwister großziehen und ihre Mutter bis zum Lebensende begleiten. Eher scheint es für die Väter ein größeres Problem zu sein, »ihre« Tochter eines Tages an einen anderen Mann hergeben zu müssen.
Doch zurück zu »Hänschen«: Zufällig bin ich im Internet auf eine weniger bekannte Version von »Hänschen klein« gestoßen. Dieses Lied hat drei Strophen:
Hänschen klein / ging allein / in die weite Welt hinein.
Stock und Hut / steht ihm gut / ist gar wohlgemut.
Aber Mutter weinet sehr / hat ja nun kein Hänschen mehr.
»Wünsch dir Glück!« / Sagt ihr Blick / »Kehr’ nur bald zurück!«
Sieben Jahr / trüb und klar / Hänschen in der Fremde war.
Da besinnt / sich das Kind / Eilt nach Haus geschwind.
Doch nun ist’s kein Hänschen mehr / Nein, ein großer Hans ist er.
Braun gebrannt / Stirn und Hand / Wird er wohl erkannt?
Eins, zwei, drei / geh’n vorbei / Wissen nicht, wer das wohl sei.
Schwester spricht: / »Welch Gesicht?« / Kennt den Bruder nicht.
Kommt daher die Mutter sein / Schaut ihm kaum ins Aug hinein,
Ruft sie schon: / »Hans, mein Sohn! / Grüß dich Gott, mein Sohn!«
Das ist ein Text, bei dem es um das Erwachsenwerden geht. Hänschen geht nicht wieder zurück, auch wenn die Mutter weint. Die Mutter ist zwar auch traurig und voller Sehnsucht, sie gibt dem Sohn zum Abschied aber ihren Segen. Hänschen macht seine guten und schlechten Erfahrungen in der weiten Welt. Er verändert sich so sehr, dass viele ihn nicht mehr als das Hänschen von früher erkennen, nicht einmal seine Schwester. Als er zu seiner Familie zurückkehrt, ist er für seine Mutter »der Hans« und damit ein erwachsener Mann geworden. Dennoch bleibt er für sie ihr Sohn.
Es gibt also neben der Symbiose- auch diese Autonomieversion von »Hänschen klein«. Sie ist weniger populär – vermutlich weil »Autonomie« wenig mit Sehnsucht und »Herz und Schmerz« zu tun hat. Was bedeutet »Autonomie« und wofür ist sie eigentlich gut? Autonom sein kann heißen:
etwas selbst zu machen,
sich auf sein eigenes Wissen zu stützen,
sich selbst zu versorgen und die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen,
eigene Entscheidungen zu treffen, auch wenn andere möchten, dass wir Rücksicht auf ihre Erwartungen nehmen,
sich durch den Kummer und Schmerz anderer nicht von den eigenen Zielen abhalten zu lassen,
sich nicht emotional erpressen zu lassen,
sich nicht finanziell bestechen zu lassen,
von den eigenen Wertvorstellungen nicht abzuweichen, auch wenn andere Druck ausüben,
an der eigenen Identität zu arbeiten, sich seiner Wurzeln, seiner familiären und kulturellen Herkunft bewusst zu sein, ohne damit zu verschmelzen,
Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen und nicht anderen die Schuld dafür zu geben, wenn dieses Leben nicht so ist, wie man es sich vielleicht einmal erträumt hat.
Symbiose-Autonomie-Konflikte
Wie es scheint, ist für uns Menschen beides gleich wichtig. Wir haben Symbiose- und Autonomiebedürfnisse. Beide begleiten uns durch das gesamte Leben. Es gibt Phasen, in denen die symbiotischen Bedürfnisse eindeutig überwiegen, und es gibt Lebensabschnitte, in denen wir vor allem frei und unabhängig sein möchten. Und es gibt immer wieder Zeiten, in denen in unserem Inneren ein heftiger Kampf tobt zwischen diesen beiden Grundbestrebungen. Man könnte in Symbiose-Autonomie-Konflikten sogar den Webstoff menschlicher Lebensdramen erkennen, etwa wenn
Kinder nicht in der Lage sind, ihr Elternhaus zu verlassen,
Eltern ihre Kinder nicht loslassen können,
Paare sich nicht trennen können, auch wenn sie sich mehr hassen als lieben,
Menschen glauben, aus Pflichtbewusstsein für »das Vaterland« oder »ihre Firma«, alle ihre eigenen Interessen zurückstellen zu müssen.
Symbiotische Bedürfnisse und Wünsche nach Autonomie sind einerseits getrennte Bestrebungen, wie hängen sie andererseits zusammen? Ist es ein Entweder-oder, oder gibt es ein Sowohl-als-auch? Lassen sich beide Grundbedürfnisse gleichermaßen zufriedenstellen und in Einklang miteinander bringen, oder geht das eine nur auf Kosten des anderen?
Es ist unter anderem eine Frage des Lebensalters, wann wir Menschen nicht allein existieren können und wann es an der Zeit ist, dass wir selbstständiger werden. Babys und Kleinkinder brauchen Eltern, die ihre symbiotischen Bedürfnisse vorbehaltlos befriedigen. Sie brauchen genauso Eltern, die sie darin bestärken, selbst zu fühlen, zu denken und zu handeln.
Was bedeutet es daher, wenn unsere kindlichen symbiotischen Bedürfnisse nicht vorbehaltlos befriedigt werden? Welche Folgen hat es, wenn sich unsere Eltern von uns abwenden, sich von uns zurückziehen, uns verlassen, uns nicht lieben und als Kind eigentlich gar nicht haben wollen, wenn wir noch ganz klein und bedürftig sind? Bleibt dann nur das Schicksal lebenslanger Frustration und innerer Einsamkeit? Oder müssen wir ein Leben lang unseren Eltern hinterherlaufen, auch noch ihr Leid mittragen in der Hoffnung, vielleicht doch eines Tages geliebt und anerkannt zu werden? Müssen wir wegen unserer Abhängigkeit von ihnen auf unser eigenes Glück verzichten? Üben wir Verrat an ihnen, müssen wir uns schuldig fühlen, wenn wir gehen, nicht länger bei ihnen bleiben wollen, ihnen nicht mehr mit unserer Liebe zur Verfügung stehen und sie nicht mehr trösten?
Oder wie ist es, wenn wir die Elternperspektive einnehmen: Wenn wir sehen, dass ein Kind partout nicht erwachsen werden will? Wenn es sich weigert, die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, seinen Eltern auf der Tasche liegt, sie verachtet, beschimpft und ausnutzt, Drogen konsumiert und gewalttätig ist? Müssen sich die Eltern das alles gefallen lassen, oder dürfen sie ein solches Kind einfach vor die Tür setzen? Muss Mutter- oder Vaterliebe alles verzeihen?
Dürfen wir als Erwachsene auch noch symbiotische Bedürfnisse haben? Ist die Liebe zu einem Partner ähnlich symbiotisch wie die Liebe zu Vater und Mutter? Wie viel an Liebe, Rückhalt, Unterstützung und Sicherheit brauchen wir in unserem Erwachsenenleben? Wie viel Verantwortung sollten wir für einen Partner übernehmen, wenn es ihm schlecht geht? Was sollten wir ihm abnehmen und was auf keinen Fall? Müssen wir es ein Leben lang erdulden, dass ein Ehe- oder Lebenspartner an uns hängt, der nicht eigenverantwortlich werden will? Dürfen wir mit unserer eigenen emotionalen Unselbstständigkeit Kinder oder Partner daran hindern, sich zu verändern und eigene Wege zu gehen?
Wir Menschen sind von Natur aus Gruppenwesen und ohne andere nicht überlebensfähig. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir brauchen und suchen den gegenseitigen Kontakt. Viele empfinden nichts schlimmer, als allein zu sein. Allein in einem Restaurant zu essen, im Urlaub allein an einem Tisch zu sitzen – wer wünscht sich da nicht früher oder später einen Gesprächspartner, ein menschliches Gegenüber?
Aber wie weit geht dieses Bedürfnis nach Kontakt? Wie weit muss man für einen anderen Menschen da sein? Wo beginnt das Recht auf Eigenständigkeit und zugleich die Pflicht, sich einem anderen nicht aufzudrängen? Wo hat das »wir« seine Grenzen? Wo beginnt das unverwechselbare »Ich«? Wann ist das symbiotische Bedürfnis konstruktiv und wann wird es (selbst)zerstörerisch, sich an andere zu klammern und das eigene Leben von anderen bestimmen zu lassen?
Das zu behalten, woran wir festhalten müssen, und loszulassen, was nicht länger trägt – das scheint die große Lebenskunst zu sein. Eine Kunst, in der wir Menschen uns von klein an üben müssen. Symbiose-Autonomie-Konflikte gehören zu jedem Lebenslauf dazu. Sie sind unvermeidbar. Warum gelingt es jedoch in manchen Fällen scheinbar ganz einfach und warum ist das Loslassen-Können in anderen Fällen unendlich schwer und schier unmöglich?
Arbeitshypothesen
Je länger ich als Psychotherapeut und Seelenforscher tätig bin, umso mehr wird mir klar, dass Symbiose-Autonomie-Konflikte ein zentrales Thema vieler Menschen sind, die psychologische Hilfe suchen:
Männer und Frauen kommen selbst im höheren Lebensalter innerlich nicht von ihren Eltern los, obwohl die Beziehung noch nie gut war oder die eigenen Eltern bereits gestorben sind.
Frauen leben mit Männern zusammen, für die sie keine Liebe und Achtung (mehr) empfinden.
Männer halten an ihrer Ehe fest, auch wenn die Beziehung zu ihrer Frau festgefahren ist.
Eltern beklagen, dass ihre Kinder keine Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen, das Haus nicht verlassen und sich lieber in ihren Fantasiewelten aufhalten.
Süchtige kommen von ihren Eltern oft ebenso wenig los wie von ihren Drogen.
Schwere psychische Erkrankungen sind ein Ausdruck dafür, dass jemand seine eigene Identität nicht lebt.
Bei zahlreichen Erkrankungen zerstört sich der Körper wie von selbst, und die Betroffenen fühlen sich diesen Vorgängen hilflos ausgeliefert.
Meine Arbeitshypothesen für dieses Buch lauten daher:
Der seelische Hintergrund sehr vieler Lebens- und Beziehungskonflikte sind symbiotische Verstrickungen.
Symbiotische Verstrickungen entstehen, wenn die ursprünglichen kindlichen Symbiosebedürfnisse nicht befriedigt werden. Die dauerhafte Frustration kindlicher Symbiosebedürfnisse stellt eine eigene Kategorie von Trauma dar: das Symbiosetrauma.
Das Symbiosetrauma bildet die Grundlage für das Entstehen psychischer Störungen wie Ängste, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, Süchte oder Psychosen. Es schlägt sich auch in zahlreichen körperlichen Erkrankungen nieder.
Die Ursache dafür, warum Eltern ihre Kinder nicht ausreichend symbiotisch versorgen können, sind ihre eigenen Traumaerfahrungen. Weil sie traumatisiert sind, können sie ihren Kindern weder den erforderlichen emotionalen Rückhalt bieten noch sie in ihrer Autonomieentwicklung unterstützen. Traumatisierte Eltern merken es nicht, wenn sie ihre Traumata auf ihre Kinder übertragen.
Traumata, Symbiosetraumata und symbiotische Verstrickungen erhöhen das Risiko weiterer Traumatisierungen und setzen sich über Generationen in den Eltern-Kind-Beziehungen fort, wenn diese Prozesse nicht erkannt und unterbrochen werden.
An diese Überlegungen schließt sich selbstredend die Frage an, welche Möglichkeiten es gibt,
sich aus symbiotischen Verstrickungen zu lösen,
Symbiosetraumata seelisch aufzuarbeiten und
gesunde Formen von Autonomie zu leben?
Wie können Menschen, die an einem Symbiosetrauma leiden und sich immer wieder symbiotisch verstricken, psychotherapeutisch sinnvoll unterstützt werden?
Ich habe versucht, auf all diese Fragen einige Antworten zu finden. Weil Symbiose und Autonomie zudem ein Thema ist, das sich nicht nur auf die persönlichen Beziehungen beschränkt, sondern nahezu alle Lebensbereiche durchzieht, werde ich ansatzweise auch einige Formen von symbiotischen Verstrickungen thematisieren, die nicht unmittelbar Gegenstand psychotherapeutischer Arbeit sind, deren Verständnis für unser soziales und gesellschaftliches Zusammenleben aber nützlich sein kann: insbesondere das symbiotische Verhältnis von (Ohn-)Macht und Geld.
2. Was ist »Symbiose«?
»Der Übergang vom Affen zum Menschen,
das sind wir.«
Konrad Lorenz (1903 – 1989)
2.1 Gegenseitiger Nutzen
»Symbiose« ist ein Wort aus dem Griechischen und heißt »Zusammenleben«. Symbiose ist ein Begriff, der in der Biologie wie in der Psychologie Verwendung findet. Er wird in verschiedenen Kontexten gebraucht und ist mit unterschiedlichen Wertungen belegt.
Als Fachbegriff fand das Wort »Symbiose« ursprünglich in der Biologie Verwendung. Anton de Bary (1831 – 1888) schlug auf einer Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte 1878 in Kassel erstmals vor, den Begriff »Symbiose« für eine besonders enge Beziehung zwischen zwei Arten von Lebewesen in die Biologie einzuführen. Symbiose bezeichnet in diesem Sinne das Zusammenleben artverschiedener, aneinander angepasster Organismen zum gegenseitigen Nutzen. In Naturfilmen lassen sich solche symbiotischen Beziehungen, die für beide Parteien nützlich sind, eindrucksvoll in Szene setzen, etwa
wenn eine Seerobbe sich von einer kleinen Echsenart geduldig auf der Nase herumtanzen lässt, weil diese ihr die lästigen Fliegen von der Haut fernhält,
wenn das Krokodil seinen Rachen aufreißt und ein kleiner Vogel in seinen Zähnen ungestört nach den Resten der Krokodilsmahlzeit herumstochern darf.
Man geht in der Biologie heute davon aus, dass der größte Teil der Biomasse auf der Erde aus symbiotischen Systemen besteht. Pilze und Pflanzen, Pflanzen und Tiere, Pflanzen und Menschen, Menschen und Tiere, Mikro- und Makroorganismen ermöglichen es sich, gegenseitig zu wachsen und zu gedeihen. Die jeweiligen Lebenspartner sind in ihren Aktivitäten eng miteinander verflochten und leben entweder nebeneinander her (»Ektosymbiose«), oder der eine lebt im Körper des anderen (»Endosymbiose«). Es gibt zahllose Beispiele für symbiotische Lebensformen in der Natur:
Meerestiere wie Quallen, Feuerkorallen oder Riesenmuscheln leben mit Algen zusammen, die sie mit Zucker und Stärke versorgen.
Beim Zusammenleben von Mykorrhizapilzen und Pflanzen ergänzen diese sich gegenseitig in ihren Eigenschaften. Pflanzen sind mit ihren Wurzeln in der Lage, Wasser, Mineralstoffe und Nährsalze aus dem Humus zu lösen. Diese sind für die Pflanzen lebenswichtig. Pilze sind in der Lage, durch ihr, im Vergleich zu den Pflanzen, viel feineres Wurzelgeflecht Wasser und mineralische Stoffe besser aus dem Boden herauszulösen. In der Symbiose mit Pflanzen umgeben die Pilze die Wurzeln ihrer Wirtspflanzen und helfen den Pflanzen bei der Aufnahme dieser Stoffe. Sie erhalten dafür Glukose (Stärke, Kohlenhydrate) von den Pflanzen, welche diese mithilfe des Chlorophylls und des Sonnenlichts erzeugen. Dies hat für die Pflanze den gleichen Effekt, wie wenn man sie düngen würde. Zudem ist der Pilz in der Lage, gewisse toxische Stoffe zu dämmen, ähnlich wie der Einsatz von Antibiotika beim Menschen. Diese beiden Effekte kräftigen die Pflanze und machen sie widerstandsfähiger. Beide Partner profitieren auf diese Weise von ihrer Lebensgemeinschaft.
Magen- und Darmbakterien ermöglichen es wiederkäuenden Tieren, zellulosereiche Pflanzennahrung aufzuschließen, und dürfen deswegen dort leben und werden nicht vom Immunsystem als Fremdkörper bekämpft.
Bäume und Sträucher sind auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen, die als Gegengabe dafür Nektar erhalten.
Einsiedlerkrebse und Seeanemonen, Ameisen und Blattläuse bilden Lebensgemeinschaften zum gegenseitigen Vorteil.
Generell lässt sich daher sagen: Leben befördert auf vielfältige Art und Weise anderes Leben, und alle lebenden Organismen sind in ihrer Existenz wechselseitig mehr oder weniger voneinander abhängig. Sie überleben gemeinsam oder gehen gemeinsam zugrunde. Symbiose scheint ein zentrales Grundprinzip des Lebens und der Evolution zu sein. Das von der Biologie des 19. Jahrhunderts entdeckte Prinzip des Zusammenlebens verschiedener Arten zum gegenseitigen Vorteil ist nur die Spitze des Eisbergs einer weit allgemeineren Gesetzmäßigkeit der Evolution.
2.2 Jäger und Beute
Das Jäger-Beute-Verhältnis stellt im biologischen Sinn das Gegenteil des Prinzips der wechselseitig vorteilhaften Symbiose dar. Beim Jäger-Beute-Verhältnis verleibt sich ein Organismus den anderen ein und vernichtet ihn dadurch in seiner Existenz. Unterschiedliche Lebewesen werden so zu extremen Konkurrenten um ihren Selbst- und Arterhalt. Zahlreiche Arten haben sogar die Fähigkeit entwickelt, andere Spezies auszurotten. Sie beschwören damit zugleich die Gefahr herauf, ihre eigene Existenzgrundlage zu zerstören. Der Bestand ihrer Art ist nur so lange gewährleistet, wie das Verhältnis zwischen ihnen und ihrer Beute nicht kippt. Manche Arten leben zuweilen so ausgiebig auf Kosten anderer Lebewesen, dass diesen der Lebenssaft abhanden kommt. In der Biologie spricht man von »Parasiten« oder von »Schmarotzertum«, z. B. wenn Bakterien oder Viren den Körper, in den sie eingedrungen sind, so stark schwächen, dass dieser stirbt.
Das Verhältnis zwischen Jäger und Beute ist in der Natur deshalb nicht statisch, sondern ein sensibles Fließgleichgewicht. Die Konkurrenz um Lebensräume und Lebensressourcen ist ein mächtiger Motor der natürlichen Evolution. Diese Konkurrenz findet ebenso zwischen den verschiedenen Arten wie innerhalb der gleichen Art statt. Es finden auch innerhalb der gleichen Art Kämpfe statt, wer sich in seiner eigenen Gruppe am besten durchsetzen kann und wer den höchsten sozialen Rang hat.
Zusammenleben, ob in einem freundschaftlichen Nebeneinander oder feindlichen Gegeneinander, ist so gesehen das fundamentalste Prinzip der Evolution. Das freundliche wie feindliche Verhältnis der Arten zueinander fördert die Evolution immer neuer Formen von Lebewesen und Lebensweisen. Es scheint so, als ob es entweder eine Lebensfülle und eine Vielzahl von Lebensarten gibt oder gar kein Leben. Die belebte Natur entfaltet sich in den zahllosen Varianten des Mit- und Gegeneinanders. In jeder nur erdenklichen Nische unserer Erde sucht sich eine Art von Lebewesen ihren besonderen Lebensraum. Die Eigenschaften der einen Art sind immer auch eine Widerspiegelung der Eigenschaften der anderen Arten, mit denen sie sich den gemeinsamen Lebensraum teilt.
2.3 Konkurrenz und Arbeitsteilung
In einer Erweiterung der ursprünglich engen Fassung des Symbiosebegriffs in der Biologie (»Zusammenleben verschiedener Arten zum gegenseitigen Nutzen«) kann man dieses symbiotische Phänomen auch auf das Zusammenleben von Individuen der gleichen Art beziehen, sofern diese in ihren Lebensäußerungen existenziell voneinander abhängig sind. Dies betrifft in erster Linie das besondere Verhältnis der Eltern- zur Kindergeneration, wenn sich die Eltern für eine gewisse Zeit um den Nachwuchs kümmern müssen, damit dieser nicht verhungert, verdurstet oder von Feinden aufgefressen wird.
Besondere symbiotische Verhältnisse bestehen auch dort, wo das Einzelwesen für sich nicht existenzfähig wäre und sich aus einer arbeitsteiligen Organisation des gemeinsamen Überlebens und der Fortpflanzung der Art die Unterschiedlichkeit der Individuen ergibt.
Als Beispiel kann der Bienen»staat« angeführt werden mit »Königin«, »Drohnen« und »Arbeitsbienen«. Hier kann man unter anderem erkennen, dass das Überleben der Art Vorrang vor dem Überleben des Einzelindividuums hat. »Arbeitsbienen« opfern ihre Fortpflanzungsfähigkeit zugunsten der Fortpflanzung der »Königin«. »Drohnen« opfern ihr Leben, um das Eindringen von Räubern in einen Bienenstock zu verhindern.
Auch wir Menschen sind unserer Natur nach keine Einzelgänger. Als Einzelwesen sind wir weder besonders stark noch schnell noch instinktsicher. Was uns zu einer überlegenen Gattung von Lebewesen macht, ist unsere Fähigkeit, das Zusammenleben in Gruppen zu organisieren. Das Leben in einer Gruppe wird zu einem erheblichen Vorteil in der Evolution. Daher wird das Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Menschengruppe für uns zu einem Urbedürfnis. Und je größer die eigene Gruppe ist, desto mehr kann sie sich gegen andere Gruppen durchsetzen. Daher wird die Gruppengröße zu einem entscheidenden Evolutionsvorteil. Es ist dann weiterhin eine wesentliche Frage, ob es innerhalb dieser Gruppen eine für alle vorteilhafte Arbeitsteilung gibt oder ob Konkurrenz und Ausbeutung vorherrschen und ob die verschiedenen Gruppen friedlich nebeneinander koexistieren können oder sich gegenseitig befehden und bekämpfen. Betrachtet man die Menschheitsgeschichte, so trifft eher Letzteres zu. Wo immer sich bislang eine Gelegenheit dazu geboten hat, haben überall auf dieser Erde die stärkeren, die zahlenmäßig und technologisch überlegenen Gruppen die schwächeren unterworfen und sich deren Menschen und ihr Territorium einverleibt. Ob das auch in Zukunft so sein muss und ob wir immer erst Kriege brauchen, um zu erkennen, dass Kooperation besser ist als Konkurrenz, ist auch eine Frage, wie weit sich menschliche Intelligenz weiterentwickeln kann.
In unseren gruppenbezogenen Verhaltensweisen ähneln wir stark Tiergattungen wie Pferden oder Wölfen, die in Herden oder Rudeln leben. Herdentiere grasen oder jagen zusammen, setzen sich gemeinsam gegen äußere Feinde zur Wehr, legen gemeinsame Ruhepausen ein, machen gegenseitige Fellpflege, konkurrieren um Geschlechtspartner, paaren sich mit Lust, ziehen die Jungtiere gemeinsam auf und haben bestimmte interne Rangordnungen, die durch Rangordnungskämpfe ausgefochten werden. Die Jungtiere spielen und trainieren viel miteinander, um sich auf das Leben als Erwachsene vorzubereiten.
Herden- und Rudeltiere benötigen ein ausgeprägtes Sensorium für die Stimmungen und Verhaltensweisen ihrer Artgenossen. Ihre Wahrnehmung ist in einem hohen Ausmaß sozial geprägt, d. h. ausgerichtet auf die körpersprachlichen, geruchlichen und lautlichen Ausdrucksformen der anderen. Die Körpersprache verrät Kontaktbedürfnisse und Angriffsbereitschaft, Gerüche weisen auf Krankheiten oder Paarungsbereitschaft hin, lautliche Äußerungen befördern ein Bedürfnis nach Hinwendung oder rufen Angst und Fluchttendenzen hervor.
Menschen, die mit Nutz- oder Haustieren zusammenleben, wissen, wie sich eine Kommunikation ohne Möglichkeiten wortsprachlicher Unterscheidungen und Verfeinerungen anfühlt. Je »sozialer« manche Gattungen sind, desto komplexer werden die Spielregeln der innerartlichen Symbiose. Eines ihrer wesentlichen Hilfsmittel sind Sprachsysteme, deren volle Ausgestaltung wir bei der menschlichen Art bewundern können.
2.4 Urgefühle
Betrachten wir zwischen- und innerartliche symbiotische Verhältnisse unter einem emotionalen Aspekt, der bei höher entwickelten Lebewesen eine immer wichtigere Rolle spielt, so bringen sie zwei gegensätzliche Arten von Gefühlskomplexen hervor:
Angst und Aggression,
Mitgefühl und Empathie.
Angst und Aggression
Jagen können, um sich einen anderen Organismus einzuverleiben, beruht auf emotionalen Erregungen, die darauf ausgerichtet sind, ein anderes Lebewesen zu vernichten. Wir bezeichnen diese Gefühls- und Handlungskomplexe als Aggressionen. In diesem Sinne dient Aggression dem Überleben von Art und Individuum und ist bei den Lebewesen, die eher als »Jäger« auftreten, besonders stark ausgeprägt. Die Fähigkeit zur Aggression braucht aber auch der »Beute« organismus, um sich, so gut es geht, gegen den Räuber zur Wehr setzen zu können.
Andererseits bedeutet dies, dass es einen zur Aggression komplementären Erlebenszustand gibt: die Angst. Die Furcht, von anderen aufgefressen zu werden, ist ein ebenso universelles Reaktionsmuster vieler Organismen und besonders extrem ausgeprägt im Verhältnis von Beute und Jäger, Opfer und Täter. Aggression und Angst sind untrennbar miteinander verbunden. Ängstlich und aggressiv nimmt jedes Einzelwesen seine Umgebung unter dem Aspekt von Jäger und/oder Beute wahr.
Im Modus des unmittelbaren Selbsterhalts reagieren Lebewesen auf die Ängste und Aggressionen eines Gegenübers ebenso mit Angst und Aggression. Wer Ängste schürt, erntet Aggressionen. Dadurch entsteht eine eskalierende Situation, in der sich Ängste und Aggressionen gegenseitig hochschaukeln und in Richtung Kampf tendieren. Wird diese Eskalation nicht unterbrochen, kommt es zu Auseinandersetzungen auf Leben und Tod und zu Sieg oder Niederlage des Einzelnen oder einer Gruppe.
Mitgefühl und Empathie
Inner- und zwischenartliche Symbiose bedeutet auch, dass, zumindest zeitweise, die Angst- und Aggressionsimpulse des Einzelnen zurückgestellt werden können zugunsten der Arterhaltung und des Erhalts der Gruppe, mit der man zusammenlebt, sowie den anderen Lebewesen, die für den Selbst- und Gruppenerhalt wesentlich sind. Das Zusammenleben erfordert es also auch, den anderen nicht nur als potenzielle Beute oder bedrohlichen Jäger zu sehen, sondern als grundsätzlich freundlich und möglicherweise hilfebedürftig, eventuell sogar dann, wenn er sich aggressiv zeigt.
Dies ist eine Anforderung von hoher Komplexität. Wir bezeichnen sie als Empathie, als die Fähigkeit, sich in ein anderes Lebewesen hineinzuversetzen, die Welt nicht nur mit den eigenen Augen, sondern auch mit den Augen eines anderen zu sehen und zu erleben. Empathie bedeutet weiterhin, Abstand nehmen zu können von den eigenen Sichtweisen, Bedürfnissen und Interessen, um die Sichtweisen, Bedürfnisse und Interessen eines anderen Lebewesens zu verstehen, zu akzeptieren und zu befördern.
Im Zustand der Empathie beginnt eine fundamental andere Form der Auseinandersetzung mit den Mit-Lebewesen als im Zustand von Angst und Aggression. Im Modus der Empathie kann ein Lebewesen die Ängste und Aggressionen eines Gegenübers durch sein Verständnis für dessen Gefühle und inneren Zustände sogar mildern. Dadurch wird Angst abgebaut, der Druck anzugreifen lässt beim Gegenüber nach. Es besteht die Chance, dass der Zustand von Angst und Aggression im Gegenüber verblasst und auch er möglicherweise in den Modus der Empathie überwechselt. Der positive Effekt der Empathie ist es, dass auch beim Gegenüber empathisches Verhalten aktiviert wird.
Es gibt somit grundsätzlich zwei hochdynamische emotionale Prozesse:
die Eskalation von Angst und Gewalt oder
die gegenseitige Beförderung von Empathie.
Betrachtet man es unter dem Aspekt der Evolution wie der individuellen Entwicklung, so gibt es prinzipiell die folgenden beiden Alternativen:
Entwicklung von individueller Größe, Stärke, Dominanz und Macht, um sich alles zu holen, was zum eigenen Überleben und zum Überleben der Gattung notwendig ist. Dies schließt das Ignorieren von eigener Angst und Schwäche mit ein und führt tendenziell zu einem hemmungslosen Ausnutzen der Ängste und Schwächen anderer. Dominanz und Macht können über den Zusammenschluss der Individuen der gleichen Art weiter gesteigert werden. Die gesamte Art ist dann aggressiv und feindselig und bedroht nicht nur ihre Umwelt, auch ihre eigenen Mitglieder behandeln sich gegenseitig aggressiv und feindselig.
Die Alternative dazu ist, Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer zu nehmen, damit diese sich ebenso verhalten. Dieses Prinzip der Gegenseitigkeit von Geben und Nehmen kann sich bei Lebewesen, die in Gruppen existieren, bis hin zu dem Zustand entwickeln, dass ein Individuum in der Befriedigung der Lebensbedürfnisse anderer seine eigenen Bedürfnisse erfüllt sieht. Und dies auch dann noch, wenn ihm dafür ein hoher Preis an eigenen Opfern abverlangt wird.
Diese beiden Entwicklungslinien sind bei den verschiedenen Arten von Lebewesen unterschiedlich ausgeprägt. Sie existieren bei jeder Art in der Regel parallel nebeneinander in der Gattung wie in jedem Einzelwesen. Elterntiere verhalten sich im Normalfall gegenüber ihrem eigenen Nachwuchs durchaus liebevoll, unter Stress kann es jedoch dazu kommen, dass sie ihre eigenen Jungen auffressen, wie es z. B. bei den Tupajas, eine Erdhörnchenart, der Fall ist.
Stress
»Erhöhte Populationsdichte erhöht bei den Tupajas auch prompt die Stressdauer pro Tag, zum Beispiel durch die häufigeren Begegnungen mit überlegenen Tieren. Überschreitet sie bei Weibchen zweieinhalb Stunden, so ändert sich ihr Verhalten ins Anormale. Sie versuchen zum Beispiel, andere Weibchen zu begatten. Die Tiere bekommen zwar noch Junge, aber erstaunlicherweise sind die Jungen nicht mehr tabu. Die Weibchen sind nicht mehr fähig, die Duftmarkierung anzubringen. Nicht selten werden diese Jungen von anderen Tupajas gefressen. Manchmal sogar von der eigenen Mutter. … Bei noch höherem Dichtegrad nimmt die Zahl der Begegnungen mit ranghöheren, also überlegenen Tieren weiter zu und damit die Angst. So häufen sich die Stresssituationen mit zunehmender Dichte, bis schließlich Dauerstress eintritt.
Ab sechs Stunden Stress pro Tag tritt so nach kurzer Zeit ein völliger Verfall der Gruppe ein. Werden die Tiere weiter gestresst, so sterben sie in wenigen Wochen. Die unterlegenen Tiere ängstigen sich buchstäblich zu Tode. Männchen und Weibchen werden in wenigen Tagen steril, apathisch und magern immer mehr ab. … Diejenigen, die noch gebären, verlieren den Brutpflegeinstinkt, die Mütter fressen ihre Neugeborenen auf.« (Vester 1991, S. 54 ff.) Bei Tigern und Löwen kann man z. B. beobachten, dass ein männliches Tier die von einem Rivalen gezeugten Nachkommen tötet, um sich dadurch des Weibchens zu bemächtigen.
Es zeigt sich deutlich, dass die Fähigkeiten, empathische Formen der Symbiose zu gestalten, bei den verschiedenen Arten von Lebewesen unterschiedlich ausgeprägt sind. Die Fähigkeit und Bereitschaft zur Empathie kann durch den Durchbruch der Angst-Aggressions-Dynamik immer wieder in Frage gestellt werden.
Lebewesen, die unmittelbar zusammenleben, müssen sich deshalb gegenseitig gut wahrnehmen können. Sie müssen Aggressions- und Angstsignale bei anderen Lebewesen ebenso differenziert erfassen wie Angebote der Empathie. Es ist überlebensnotwendig, Freund und Feind bzw. freundliche und feindselige Zustände bei anderen Lebewesen schnell und sicher zu identifizieren.
Empathie ist also keine rein menschliche Regung oder gar Erfindung. Sie gehört zu den emotionalen Grundprinzipien des Lebens ebenso wie Angst und Aggression. Professorin Pumla Gobodo-Madikizela, die in Südafrika maßgeblich an der Etablierung der Wahrheitsund Versöhnungskomitees beteiligt war, bringt dies so zum Ausdruck: »Die Kraft der zwischenmenschlichen Verbundenheit, der Identifikation mit dem anderen als ›Fleisch von meinem Fleisch‹, aufgrund der Tatsache seiner bloßen menschlichen Existenz, führt uns dazu, andere von ihrem Leid retten zu wollen, als wäre dies eine reflexartige Reaktion, die tief in unserer genetischen evolutionären Vergangenheit verankert ist. Wir können nichts dagegen machen. Wir fühlen uns hingezogen zur Empathie, weil es da etwas im anderen gibt, das wir so empfinden, als wäre es Teil von uns selbst, und weil es etwas in uns selbst gibt, das wir als Teil des anderen fühlen.« (Gobodo-Madikizela 2003, S. 42)
2.5 Spiegelneurone und Symbiose
Wie andere Gruppenwesen auch lassen wir Menschen uns leicht von den Verhaltensweisen und Stimmungen anderer anstecken. Man braucht nur in ein Fußballstadion zu gehen, um zu sehen, wie Zehntausende von Menschen wie ein gemeinsamer Organismus mitfiebern, rufen, wenn die anderen rufen, sich freuen, wenn sich die anderen freuen, oder bei Niederlagen der eigenen Mannschaft gemeinsam tief betrübt sind. Es ist schwer, nach einem emotional aufwühlenden Fußballspiel aus dem Zustand dieser kollektiven »Affektansteckung« wieder herauszukommen.
Seit die sogenannten Spiegelneurone zunächst in den Gehirnen von Affen und dann auch in menschlichen Gehirnen entdeckt wurden (Rizzolatti, Fadiga, Fogassi & Gallese 2002; Rizzolatti, Fadiga & Gallese 2007), kennen wir zumindest eine wesentliche neurobiologische Grundlage für diese enorme Fähigkeit, mit anderen emotional mitzuschwingen und andere Menschen bis in ihr Innerstes hinein intuitiv zu erfassen. Es sind nicht in erster Linie die gedanklichen Auseinandersetzungen mit einem Gegenüber – diese kommen noch hinzu –, die uns in die Lage versetzen zu verstehen, was mit ihm los ist. Wir nehmen seinen Zustand wahr, so wie wir anderes sehen, hören, riechen, schmecken – also eher unwillkürlich und unbewusst. Wir verfügen über eine eigene Form der Wahrnehmung für die äußeren wie inneren Zustände anderer Menschen. Wir imitieren ihre Verhaltensregungen und Gefühlsbewegungen mit Hilfe der Spiegelneurone in uns. Wir brauchen dazu nicht die Sprache, mit der uns der andere mitteilt, wie es ihm geht, woran er denkt und was er zu tun beabsichtigt. Die Spiegelneurone helfen, ein Abbild eines anderen Menschen in uns zu simulieren. Wir erkennen uns als Menschen gegenseitig, indem wir uns wechselseitig spiegeln. Auf diesem Wege wird
das bessere Verstehen eines Gegenübers befördert,
können wir Erfahrungen eines anderen Menschen wie eine eigene Erfahrung intuitiv übernehmen,
gibt es einen umfassenden Erfahrungsaustausch, der individuelle Lernprozesse abkürzt,
haben wir die Möglichkeit zur Selbsterkenntnis im Spiegel eines anderen Menschen.
Diese spontane »symbiotische Verschmelzung« mit unseren Artgenossen hat für uns enorme Bedeutung. Denn für Gruppenwesen stellt es ein hohes Risiko dar, den Kontakt zu ihrer »Herde« zu verlieren und sich von ihr zu isolieren. Die Spiegelneurone können als neurologisches Korrelat für die Fähigkeit zur Empathie angesehen werden (Bauer 2005). Empathisches Wahrnehmen, Denken und Fühlen als die Voraussetzung für ein soziales Miteinander ist tief in unseren Gehirnstrukturen verankert (Hüther und Krens 2006).
Man kann es auch so sehen: Ein wichtiger Teil unserer Wahrnehmung und unseres subjektiven Erlebens ist in hohem Maße unbewusst symbiotisch. Wir fühlen uns genauso wie die anderen Menschen, die wir beobachten und mit denen wir zusammenleben, ohne dass wir das bewusst wollen. Die Unterschiede zwischen uns und den anderen verschwimmen, wenn die Spiegelneurone aktiv sind. Wir verziehen z. B. unser Gesicht, wenn ein anderer Mensch in eine Zitrone beißt. Wir weinen im Kino, wenn wir Schauspieler sehen, die traurig sind. Wir geraten unwillkürlich immer wieder in Zustände, in denen wir nicht bei uns, sondern ganz bei den anderen sind. Das kann gut für uns sein, wenn die anderen in guter Verfassung sind, das kann aber auch sehr schlecht für uns sein, wenn die anderen voller Angst, Wut, Scham oder Schmerz sind. Nicht nur das Glücklichsein, auch Verwirrung kann hoch ansteckend sein.
Es stellt sich unter diesem Gesichtspunkt daher die Frage: Wie schaffen wir es, uns dennoch abzugrenzen? Wo bleibt angesichts solcher Verschmelzungstendenzen unsere unverwechselbare Individualität? Wie es scheint, ist ein Identitätsgefühl, das mehr als nur gruppenbezogen ist, und ein auf das eigene Wissen und Können bezogenes Selbstbewusstsein darstellt, keine Selbstverständlichkeit. Jeder kann das daran überprüfen, wie schwer es ist, in einer Gruppe, zu der man gehört, einen abweichenden Standpunkt zu vertreten und dabei zu bleiben, selbst wenn es Kritik hagelt. Möglicherweise ist die Fähigkeit, sich von den anderen abzugrenzen und zu unterscheiden, ein späteres Produkt der Evolution. Die Zweiteilung unseres Gehirns in eine rechte und linke Großhirnhemisphäre könnte die notwendige organische Voraussetzung dafür geschaffen haben, dass wir Menschen beides können: symbiotisch mitschwingen (rechte Gehirnhälfte) und eine eigene Identität erleben (linke Gehirnhälfte). Wie schwer das Leben wird, wenn es kein Mitschwingen gibt, zeigt das Phänomen »Autismus«; wie unmöglich es ist zu leben, wenn sich jemand gar nicht mehr abgrenzen kann, zeigt das Zustandsbild der »Psychose«. Wer sich selbst nicht kennt, wer nicht weiß, wer er ist, kann kein wirkliches Verständnis für andere haben. Wahre Empathie für andere kann nur aufbringen, wer ein gutes »Mit«-Gefühl für sich selbst entwickelt hat.
3. Symbiose als psychologisches Konzept
Erich Fromm
Erich Fromm (1900 – 1980) hat den Symbiosebegriff in die psychologische Literatur eingebracht. Er definiert Symbiose folgendermaßen: »Symbiose im psychologischen Sinn heißt die Vereinigung eines individuellen Selbst mit einem anderen Selbst … wobei jeder die Integrität seines eigenen Selbst verliert und einer vom anderen abhängig wird.« (Fromm 1941, S. 157) Nach Fromms Auffassung steht hinter der symbiotischen Vereinigung ein Bedürfnis nach der Auflösung des eigenen Selbst in einer anderen Person, um aus Isolations- und Ohnmachtgefühlen herauszukommen. In Familien könne es daher so sein, dass Eltern ihre Kinder symbiotisch verschlingen, aber auch Kinder ihre Eltern.
In der Blut- und Bodenmythologie des Nationalsozialismus sieht er ein inzesthaftes Verbleiben in der ursprünglichen Symbiose mit der Mutter. »Mit inzesthafter Symbiose meine ich die Tendenz, an die Mutter und ihre Ersatzfiguren – das Blut, die Familie, den Stamm – gebunden zu bleiben, der unerträglichen Bürde der Verantwortung, der Freiheit und des Bewusstseins zu entfliehen und in einem Hort von Sicherheit und Abhängigkeit Schutz und Liebe zu bekommen. Dafür bezahlt der einzelne mit dem Ende seiner eigenen menschlichen Entwicklung.« (Fromm 1999, S. 594) Im Kontext von Sadismus und Masochismus findet nach Fromm die symbiotische Verschmelzung zweier Menschen ihre perversen sexuellen Ausformungen.
Margret Mahler
Das Symbioseverständnis innerhalb der Psychoanalyse wurde in den Jahren zwischen 1950 und 1970 weitgehend von Margret Mahler und ihren Mitautorinnen geprägt. Margret Mahler, geboren 1897 in Österreich und gestorben 1985 in New York, war Psychoanalytikerin und Forschungsleiterin am Masters Children’s Center in New York. Dort führte sie mit ihren Mitarbeitern intensive Beobachtungsstudien zum Mutter-Kind-Verhältnis durch. Sie versuchte, ihre von der Freud’schen Psychoanalyse geprägten Grundannahmen über die kindliche Entwicklung empirisch zu untermauern.
Margret Mahler verwendet den Symbiosebegriff nicht im biologischen Ursprungssinne: »Die Bezeichnung ›Symbiose‹ stellt in diesem Zusammenhang eine Metapher dar. Sie beschreibt nicht – wie dies beim biologischen Begriff der Symbiose der Fall ist –, was tatsächlich zwischen zwei getrennten Individuen vor sich geht (…). Sie wurde gewählt, um jenen Zustand der Undifferenziertheit, der Fusion mit der Mutter, zu beschreiben, in dem das ›Ich‹ noch nicht vom ›Nicht-Ich‹ unterschieden wird und in dem Innen und Außen erst allmählich als unterschiedlich empfunden zu werden beginnen.« (Mahler 1998, S. 14 f.)
In Margret Mahlers Entwicklungstheorie lebt der Säugling unmittelbar nach der Geburt in einem Zustand weitgehender Weltabgeschlossenheit und der Abwehr von Außenreizen, den sie als den »primären Autismus« bezeichnet. Erst ab dem 2. Lebensmonat zerbreche diese »autistische Schale« des Säuglings, er öffne sich mehr seiner Umwelt und trete in die symbiotische Phase ein. »Das wesentliche Merkmal der Symbiose ist die halluzinatorisch-illusorische, somatopsychische omnipotente Fusion mit der Mutterrepräsentanz und insbesondere die ebenso illusorische Vorstellung einer gemeinsamen Grenze der beiden in Wirklichkeit getrennten Individuen.« (a. a. O., S. 15) Der Säugling verleibe sich seine Mutter quasi psychisch ein und erlebe sich wie seine Mutter und diese wie sich selbst.
Diese Phase dauert nach Mahlers Ansicht bis zum 5. Lebensmonat. In diesem frühen Lebensabschnitt diene die Mutter dem Kind als »Hilfs-Ich«, als Durchgangsphase zur Entwicklung eines eigenen Ichs. Je mehr der Säugling in der Lage sei, sich von seiner Mutter zu lösen, z. B. indem er sich aus eigenen Kräften von ihr wegbewegen könne, desto mehr strebe er nach seiner Individuation und seine Ich-Werdung schreite voran.
Dieser Prozess der Ich-Reifung des Kindes und seiner psychischen Loslösung müsse von der Mutter unterstützt werden: »Je mehr sich die Symbiose, die ›emotionale Bereitschaft‹ der Mutter, dem Optimalzustand angenähert hatte, je besser der symbiotische Partner dem Kind behilflich war, reibungslos und allmählich dem symbiotischen Umkreis zu entschlüpfen – d. h. ohne unangemessene Beanspruchung seiner eigenen Hilfsquellen –, desto besser ist das Kind ausgerüstet, seine Selbstrepräsentation aus den bisher miteinander verschmolzenen Repräsentanzen von Selbst-plus-Objekt herauszulösen und zu differenzieren.« (a. a. O., S. 24)
Zu Mahlers Theorie der Individuation gehört die Vorstellung einer stufenweisen Ablösung mit der Wegbewegung von der Mutter und der Wiederannäherung an sie. Das Kind beachte die Mutter nach dem Heraustreten aus der symbiotischen Phase bis zu 18 Monate nicht mehr sonderlich, weil es deren Anwesenheit als selbstverständlich annehme. Erst dann trete es wieder in eine aktive Auseinandersetzung mit der Mutter ein: »Die vorübergehende relative Nichtbeachtung der Anwesenheit der Mutter wird allmählich durch ein Verhalten aktiver Annäherung auf einer weit höheren Stufe ersetzt. In dem Maße, wie ihm seine Macht und Fähigkeit, sich von der Mutter zu entfernen, klar wird, scheint das Kleinkind nun ein gesteigertes Bedürfnis und den Wunsch zu haben, dass seine Mutter jede neue Erwerbung von Geschicklichkeit und Erfahrung mit ihm teile.« (a. a. O., S. 31)
In dieser Wiederannäherungsphase passe sich das Kind extrem an die Wünsche und Bedürfnisse der Mutter an, um von ihr Bestätigung zu erhalten. Dadurch entstehe die Gefahr, dass das Kind auch problematische Charakterzüge der Mutter verstärkt in sich integriere. Am Beispiel des Kindes Jay schreibt Mahler z. B.: »Jays primäre Identitätsbildung im Alter von 30 Monaten zeigte – wie in einem Zerrspiegel – die nicht integrierten mütterlichen Verhaltensweisen, ihre schizoiden Persönlichkeitsmerkmale.« (a. a. O., S. 31)
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: