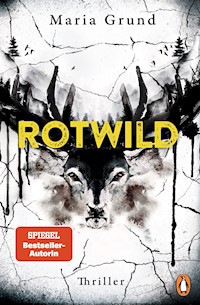9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Berling-und-Pedersen-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
7 Masken. 7 Todsünden. Ein Mörder ohne Reue.
Eisige Kälte herrscht an jenem Sonntag auf der Insel vor der Küste Schwedens, als man die Leiche eines jungen Mädchens in einem verlassenen Kalksteinbruch entdeckt. Das Verstörende an dem Fall: Die Tote hat eine unheimliche Fuchsmaske bei sich. Ermittlerin Eir bleibt nichts anderes übrig, als sich auf die Zusammenarbeit mit ihrer neuen Kollegin Sanna einzulassen. Denn nur Tage später ist eine weitere Frau tot – und auch in ihrer Wohnung finden sich Hinweise auf eine Maske. Ein eiskalter Serienmörder hinterlässt eine blutige Spur auf der Insel und muss gestoppt werden. Doch mit Schrecken erkennt Eir, dass nicht nur das nächste Opfer vor dem Killer retten muss – auch Sanna birgt ein dunkles Geheimnis und droht, vom Strudel ihrer Vergangenheit in den Abgrund gerissen zu werden …
»Ein begnadetes Debüt mit einer ganz einzigartigen Stimme.« Dagens Nyheter
Die Berling-und-Pedersen-Reihe geht weiter:
1. Fuchsmädchen
2. Rotwild
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Ähnliche
Maria Grund wurde in einem Vorort von Stockholm geboren. Sie arbeitete viele Jahre als Drehbuchautorin in London und New York und lebt heute auf der schwedischen Insel Gotland. Ihr großes Thriller-Debüt Fuchsmädchen wurde für den Crimetime Award nominiert sowie von der Swedish Academy of Crime Fiction als bestes Debüt des Jahres ausgezeichnet.
Fuchsmädchen in der Presse:
»Einer der fesselndsten Thriller des Jahres. Mit gekonnter Sprache baut Maria Grund Spannung auf. Man kann dieses Buch kaum aus der Hand legen.«Aus der Begründung der Swedish Crime Fiction Academy zum Preis für das beste Debüt des Jahres
»Ein begnadetes Debüt mit einer ganz einzigartigen Stimme.« Dagens Nyheter
»Maria Grund führt dynamische und interessante Figuren ein und liefert einen originellen Plot. Ein nervenaufreibender und filmischer Ermittlerkrimi, der Startschuss einer vielversprechenden Autorin.«Aus der Nominierung für den Crimetime Award
»Ein beeindruckendes Debüt!« Uppsala Nya Tidning
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Maria Grund
Fuchsmädchen
Thriller
Aus dem Schwedischen von Sabine Thiele
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Dödssynden bei Modernista, Stockholm.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen
Copyright © 2020 by Maria Grund
Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe by Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Published by arrangement with Partners in Stories.
Cover: bürosüd GmbH
Covermotiv: www.buerosued.de; Mauritius Images / Volodymyr Burdiak / Alamy
Redaktion: Marie-Sophie Kasten
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27068-1V003
www.penguin-verlag.de
Der Nebel hüllt ihn ein. Auf dem weichen Moos kommt der Junge schnell voran. Er weicht den Dornen aus, die seine Haut ritzen, und den Ästen, die sich nach seinen Augen und seinem Haar strecken. Die nackten Beine und Füße sind eiskalt. Ohne die schützende Baumwolle der Unterhose hätten die Peitschenhiebe der Wurzelschösslinge ihn schon längst zu Fall gebracht.
Verzweifelt springt er über Sturmholz und rennt zwischen den eng stehenden Kiefern und vermodernden Eschen hindurch. Immer schneller schlägt sein Herz, bis es den Schmerz beinahe übertönt. Und die Stimmen, die ihn aus den Schatten hinter ihm jagen.
Hätte sich nicht vor ihm das Loch aufgetan, seinen Fuß umklammert und ihn zu Fall gebracht, wäre er vielleicht entkommen. Doch als er mit dem Gesicht auf dem bemoosten Stein aufprallt, die Arme ausgestreckt wie am Kreuz, und sich seine Augen nach hinten verdrehen, hört er sie immer näher kommen:
»Tötet den Wolf, tötet den Wolf, tötet den Wolf …«
KAPITEL EINS
Sanna Berling sieht sich in dem leeren, ausgebrannten Zimmer um. Die Sonne fällt durch die salzverkrusteten, staubigen Fenster und taucht alles in schmutziggelbes Licht. Der durchdringende Geruch nach Rauch und Schimmel setzt sich im Rachen fest. Bei jedem Besuch erscheint ihr der Raum noch dunkler. Vielleicht weil die Bäume vor dem Haus ungehindert wachsen dürfen, vielleicht kommt es ihr aber auch nur so vor, weil sie so unerträglich müde ist.
Vorsichtig streicht sie mit den Fingern über eine rußige Stelle, und eine vergilbte Kindertapete kommt zum Vorschein. Mit geschlossenen Augen streift sie mit der Hand an der Wand entlang, während sie zur Tür geht. Im Türrahmen bleibt sie wie immer bei den Buchstaben stehen, die darin von ungelenker Kinderhand eingeritzt sind, und berührt sie mit den Fingerspitzen: »HAUAB«.
Als sie ins Freie tritt, steigt ein Schwarm kleiner Vögel aus dem großen, absterbenden Baum vor dem Haus. Ihre Flügelschläge erfüllen die Luft, während sie hektisch davonflattern, als müssten sie vor einem Unwetter fliehen.
Vor ihr erstreckt sich eine weite Landschaft. Dieser ganze Teil der Insel – von den angrenzenden Feldern und Wiesen, die bis zum Weg reichen, über die Kirche und noch weiter bis zur kargen Küste – ist Ödland. Da klingelt ihr Handy. Sie nimmt den Anruf an, lauscht der Stimme am anderen Ende.
»Ich bin gerade hier«, antwortet sie. »Lehn ab. Ich verkaufe nicht. Noch nicht.«
Sie erntet lautstarken Protest, verzieht jedoch keine Miene, während sie zu ihrem schwarzen Saab geht. Beim Wegfahren folgt ihr der Hof im Rückspiegel, als würde er sie mit seinen verkohlten, blinden Fenstern beobachten.
Aus dem Autoradio ertönt knackend die Stimme eines Vertreters der Kommunalverwaltung: »… die harten Restriktionen und Maßnahmen der letzten Jahre haben die Region vor große soziale Herausforderungen gestellt und unser Sicherheitsempfinden auf vielfältige Weise beschädigt. Dennoch haben sie nicht zu einem ausgeglichenen Budget geführt … Wir müssen an einem Strang ziehen und weitere Einsparungen vornehmen, ohne gleichzeitig noch mehr Unterkünfte, Einrichtungen und andere wichtige Institutionen zu schließen, auf die die wachsende Gruppe von der Gesellschaft Ausgestoßener und Bedürftiger angewiesen ist …«
Sie schaltet das Radio aus und den CD-Spieler ein und gibt Gas. Robert Johnson and Punchdrunks’ »Rabbia Fuori Controllo« dröhnt aus den Lautsprechern, während vereinzelte Höfe und Häuser neben der Straße vorbeiziehen. Sonst besteht die Landschaft aus Wiesen, Feldern und dunklen Waldabschnitten. Dann wird der kleine Hauptort der Insel sichtbar, bevor Sanna schließlich in ein Industriegebiet einbiegt. Vor ihr erstrecken sich rissiger Asphalt und Container hinter hohen, mit Stacheldraht verstärkten Zäunen.
Ein junger Mann in einem T-Shirt-Kleid mit Puffärmeln, weitem Kragen und dicken Schulterpolstern bewegt sich ruckartig an einer Ampel. Eine Augenbraue fehlt, die andere ist mit Filzstift hoch auf der Stirn aufgemalt. Seine Füße stecken in schmuddeligen Badeschlappen, und jedes Mal, wenn er den rechten Fuß aufsetzt, zuckt er wie ein verletzter Hund. Als sie an ihm vorbeifährt, scheint er sich für ein paar Sekunden zu entspannen. Er sieht sie schüchtern an, erkennt sie wieder. Sie bremst ab, holt etwas vom Rücksitz, lässt das Fenster herunter und wirft ihm eine Strickjacke aus Wolle zu. Er wickelt sich hastig darin ein und murmelt etwas, vielleicht einen Dank.
Sie fährt auf eine schmale Schotterstraße und an einem Grundstück mit Wohnwagen und Zelten vorbei. Ein Hund bellt irgendwo im Dunkeln, als sie rechts abbiegt und auf das unansehnliche Schild mit der Aufschrift »Garage« zurollt.
Die Tür schleift knarzend und quietschend über den Betonboden. Sie schaltet eine Lampe in der Ecke ein, die ein weiches Licht auf das Feldbett mit der Decke und dem Kissen wirft. Über dem Bett ist der Raum niedriger als in der restlichen Garage, wo sie den Saab ein wenig schief abgestellt hat, mit dem Schlüssel in der Zündung.
Sie wirft ein paar Rechnungen und Werbeflyer auf einen Stuhl, schlüpft aus dem kurzen schwarzen Wollmantel und lässt ihn auf den Boden fallen, bevor sie ihre Hose auszieht. Dann streift sie sich ein Paar Kopfhörer über die Ohren.
Den Schlüssel zur Garage und ihre Polizeimarke wirft sie auf den Campingtisch, der gleichzeitig als Nachttisch fungiert. Sie landen auf einem Gegenstand, einem kleinen runden Handspiegel, auf dem »Erik« steht. Dann drückt sie drei kleine lilafarbene Tabletten aus einem Blister und schluckt sie.
Ihr Blick wird bereits verschwommen und geht ins Leere, als sie sich auf das Feldbett legt.
»Ich komme«, flüstert sie und versinkt in der Dunkelheit.
Die Türglocke der diensthabenden Apotheke läutet laut und vernehmlich, als Eir Pedersen über die Schwelle tritt. Sie bewegt sich rasch und leicht nach vorn gebeugt, die Schultern hochgezogen, die Augen voll nervöser Energie. Sie sieht, wie die Apothekerin hinter dem Tresen sie beobachtet, als sie mit der Hand in die Innentasche der engen Lederjacke greift. Diskret, aber beunruhigt. Eir erkennt diesen Blick, sie ist ihn gewohnt. Die Frau in dem weißen Kittel hat auch bestimmt eine Hand am Alarmknopf. Sie könnte etwas sagen, um die Situation zu entspannen, doch dafür hat sie nicht die Energie. Sie geht einfach nur zum Tresen und legt zwei Ausweise darauf. Mit dem Zeigefinger tippt sie leicht auf einen der beiden.
»Es müsste ein Rezept für Tabletten und Tropfen vorliegen. Ich bekomme die Tropfen.«
Die Apothekerin betrachtet die Ausweise, tippt etwas in den Rechner und sieht Eir unter ihrem Pony hervor an.
»Finden Sie es nicht?«, fragt Eir. »Gibt es ein Problem? Falls ja, dann können Sie folgende Nummer anrufen …«
»Nein, alles in Ordnung«, antwortet die Frau rasch und verschwindet in den Nebenraum zu den Medikamentenschubladen.
Eir sieht sich in dem kleinen Laden um. Alles steht ordentlich an seinem Platz. Der hübsche alte Steinboden ist sauber, die Beleuchtung ungewöhnlich sanft für eine Apotheke. Vom Festland her kennt sie Apotheken, die großen klinischen Containern mit kaltem Neonlicht an der Decke und vollgestellten Regalen ähneln. Hier fühlt sie sich dagegen an einen altmodischen Süßigkeitenladen erinnert.
»Bitte sehr«, unterbricht die Apothekerin ihren Gedankengang. »Haben Sie sonst noch einen Wunsch?« Sie legt ein Fläschchen Methadon in eine Tüte und schiebt diese über den Tresen.
Eir liest den Preis auf dem Kassendisplay ab und bezahlt. »Gibt es noch einen kürzeren Weg nach Korsparken als den an der Trabrennbahn entlang?«
»Sie meinen, Korsgården?«, korrigiert die Apothekerin sie.
»Ja, genau.«
»Von dem Platz hier vor der Tür gehen Sie die Anhöhe da drüben hinauf. Hinter der Stadtmauer folgen Sie der Hauptstraße und gehen dann über den Sportplatz bei der früheren Eishockeyhalle.«
»Vielen Dank.«
Eir wendet sich zur Tür.
»Ich würde allerdings trotzdem den Weg über die Trabrennbahn nehmen«, sagt die Apothekerin noch. »Um diese Uhrzeit.«
Die kleine, von einer Mauer umgebene Stadt liegt still im Herbstdunkel. Die Gassen winden sich wie Schlangen um den schräg abfallenden Platz. Das Kopfsteinpflaster ist feucht, und einige hartnäckige Blätter glänzen im Dunkeln an den verholzten Rosenbüschen.
Es beginnt zu regnen. Eir hat Gewitter schon immer geliebt, sie fühlt sich dann ruhig und befreit und rundum entspannt. Doch jetzt fallen nur ein paar magere Tropfen zu Boden.
Schon wenige Schritte hinter der hübsch beleuchteten Stadtmauer verändert sich die Umgebung. Mehr Schaufenster sind vernagelt, immer öfter sieht sie schrottreife Autos und mit Graffiti beschmierte Straßenschilder. Die Straßen werden weniger. Sie nimmt eine Abkürzung über eine Straßenbaustelle und einen Sportplatz, bis sie zu einem heruntergekommenen Wohngebiet mit älteren Reihenhäusern und dicht aneinandergedrängt stehenden, niedrigen Mietshäusern kommt. Gartenmöbel stehen verloren herum, die Mülltonnen quellen über. Ein Stück weiter vorne besprühen gerade zwei junge Mädchen ein Garagentor mit Farbe.
Eines hebt den Kopf, als Eir sich nähert, sprüht dann aber gleichgültig weiter. Auf dem Garagentor leuchtet in grellpinker Schrift das Wort »STIRB«.
»Wohnt ihr hier?«, fragt Eir ruhig.
»Was?«, sagt das Mädchen. Sie hat pechschwarze Locken, trägt große Ringe in den Ohren, an ihrem Hals prangt eine Totenkopftätowierung.
Eir stopft die Tüte mit dem Methadon in die Innentasche ihrer Jacke und zieht den Reißverschluss hoch.
»Ist das eure Garage?«, fragt sie weiter.
Die Mädchen sehen einander an, versuchen, die Situation einzuschätzen. »Ja, das ist unsere Garage«, erwidert die eine.
Eir holt ihr Handy hervor, doch der Akku ist leer. Sie seufzt resigniert. »Wenn ich also an dem Haus dahinten klingele, wird eure Mutter aufmachen?«
Das andere Mädchen – mager und durchtrainiert mit rasiertem Kopf und einem großen Drachen auf dem Pulloverärmel – geht langsam um sie herum. Aus dem Augenwinkel sieht Eir, dass sie ein Messer gezogen hat und es hinter dem Handgelenk versteckt.
»Kümmer dich nicht darum, wenn du nicht eins auf die Fresse willst, du verdammte …«, zischt sie und kommt einen Schritt näher.
Eir beendet den Satz, indem sie dem Mädchen ihren Ellbogen ins Gesicht rammt. Die Angreiferin stolpert nach hinten, lässt das Messer fallen und greift sich an die Nase. Da wirft sich ihre Freundin mit der Totenkopftätowierung auf Eir und zieht sie nach hinten. Ein Schlag trifft ihren Mund, doch dann bekommt Eir den Arm des Mädchens zu fassen und bringt es zu Fall, sodass es mit dem Kopf gegen die Gehsteigkante prallt.
»Du hast mir meine verdammte Nase gebrochen …«, knurrt das Drachenmädchen.
Eir dreht sich um. Die andere steht vornübergebeugt da und presst den Pullover gegen die Nase.
»Du bist ja völlig irre!«, kreischt sie.
Eir packt ihren Arm und will sie gerade zum Gehsteig zerren, als sich das Totenkopfmädchen von hinten auf sie stürzt und wild mit der Spraydose fuchtelt. Eir duckt sich und krallt sich in den Locken der Tätowierten fest. Währenddessen hat das Drachenmädchen sich das Messer wieder geschnappt, doch Eir packt sein Handgelenk so fest, dass es die Klinge fallen lässt. Schnell tritt Eir das Messer unter ein Auto.
Sie schleift das Drachenmädchen über den Asphalt zum Garagentor, merkt dabei jedoch, dass sie beobachtet wird. Hinter einer Gardine in dem dunklen Haus neben der Garage steht ein junges Mädchen im selben Alter wie diejenigen, mit denen Eir gerade gerungen hat. Das Licht wird eingeschaltet, und eine ältere Frau im Morgenmantel erscheint am Fenster.
Sie scheucht das Mädchen fort und wählt eine Nummer auf ihrem Handy. Anhand der Lippenbewegungen erkennt Eir, dass sie mit der Polizei sprechen möchte, wobei sie nervös die Straße hinunterschaut.
Eir richtet sich auf, atmet tief durch und versucht sich zu beruhigen. Sie wischt das Blut von dem Riss in ihrer Lippe, schiebt die Hände in die Taschen und geht weiter.
KAPITEL ZWEI
Alles ist mit Raureif überzogen, als Sanna am nächsten Morgen zu dem alten Kalksteinbruch auf der Ostseite der Insel fährt.
Das türkisfarbene Wasser in dem riesigen Krater liegt still da. An der Kante steht ein Krankenwagen, der Pick-up der Polizeitaucher und ein Streifenwagen, dessen Türen offen stehen. Die Taucher rollen gerade ihre Neoprenanzüge zusammen und verstauen sie auf der Ladefläche des Pick-ups. Ein Mädchen liegt auf einer Bahre in einem offenen Leichensack. Behutsam schiebt jemand ihre langen roten Haare hinein.
Sanna stellt den Wagen ab und steigt aus. Der Boden ist fest unter ihren Stiefeln und voller Wurzeln, Steine und Kaninchenlöcher. Hier und da liegt Müll, den Badegäste zurückgelassen haben; Plastikbesteck, Eisverpackungen und eine leere, gesprungene Weinflasche. Sie hört das Meer in einigen Kilometern Entfernung an die Steinstrände schlagen, wie fast überall auf der Insel.
Der Kalksteinbruch ist ein beliebter Badeplatz. Verglichen mit den überfüllten Buchten, in denen man endlos ins Meer hinauswaten muss, kann man hier einfach ins Wasser springen und sich abkühlen. Doch zu dieser Jahreszeit ist der Ort verlassen. Die einzigen Anzeichen, dass sich hier sonst Menschen aufhalten, sind außer dem Müll auf dem Boden ein rostiger Badesteg und zwei kleine Umkleideschuppen hinter einem Gehölz.
Niedergeschlagen betrachtet sie die Leiche auf der Bahre. Aus der Ferne sieht sie klein und mager aus, die Füße sind abgespreizt wie bei einem toten Vogel.
Kriminalkommissar Bernard Hellkvist steigt aus seinem Wagen und wirft ihr einen Blick zu. Sanna denkt daran, wie verärgert er am Telefon geklungen hat. Der große, kräftige und breitschultrige Mann war morgens schon immer schlecht gelaunt gewesen, und heute ist es nicht anders. Jetzt wippt er auf und ab und schlingt die Arme gegen die Kälte um den Brustkorb. Eine Zigarette hängt zwischen seinen schmalen Lippen, und nach einem letzten Zug lässt er den Stummel auf den Boden fallen. Wie immer sieht er aus, als hätte er einen Kater. Er kneift die Augen zusammen und nickt ihr knapp zu.
»Und das alles an einem Sonntag«, knurrt er. »Heute hätte ich mir das Spiel angeschaut.«
»Wo sind die anderen?«, fragt Sanna.
»Jon war schon hier, ist aber wieder gefahren. Gibt nicht mehr viel zu tun. Ich hätte dich nicht anrufen sollen, du müsstest eigentlich gar nicht hier sein. Aber bevor wir sie hochgeholt haben, wusste ich ja noch nicht, ob es Selbstmord war.«
»Ich hatte sowieso nichts vor.«
Er lächelt und sieht dann auf seinem Handy nach der Uhrzeit.
»Wissen wir, wer sie ist?«, fragt Sanna.
»Mia Askar, vierzehn Jahre, fast fünfzehn. Offiziell haben wir sie noch nicht identifiziert, aber ihre Mutter war vor ein paar Tagen auf dem Revier und hat sie als vermisst gemeldet. Sie hatte ein Foto dabei und sie sehr detailliert beschrieben. Deshalb weiß ich, dass es sich um das verschwundene Mädchen handelt. Die Jugend von heute ist so verdammt selbstsüchtig.«
Sanna wirft ihm einen scharfen Blick zu.
»Okay, okay«, rudert er zurück. »Tut mir leid. Aber ein bisschen wütend darf ich doch wohl sein? Es geht schließlich um meinen jüngsten Enkel und außerdem sein erstes Auswärtsspiel.«
»Bald kannst du den ganzen Tag Fußball schauen. Jetzt sind es ja nur noch zwei Wochen.«
»Ich weiß. Es kann mir gar nicht schnell genug gehen.«
Sanna seufzt. »Was ist mit der Spurensicherung?«, fragt sie.
»Es war doch Selbstmord.«
»Aber die Techniker sind auf dem Weg?«
»Sie sind im Norden, dort gab es einen Einbruch in eine alte Kaserne. Und auch wenn sie nicht beschäftigt wären, weißt du doch, dass sie wegen so einem Scheiß längst nicht mehr kommen.«
Sanna schluckt ihre Verärgerung hinunter. Bernard nennt Selbstmord immer »Scheiß«. Vielleicht weil Selbstmord auf der Insel immer öfter vorkommt, oder weil die Polizei mittlerweile nur noch »aufräumt und wegschafft«.
»Wenn du wirklich willst, dass wir uns mit ihnen anlegen, damit sie herkommen …«, fügt er trotzig hinzu.
»Handschuhe?« Sie streckt ihm die Hand entgegen, ohne ihn anzusehen.
Er angelt nach einer Schachtel im Wagen und wirft ihr das Gewünschte zu. »Wie willst du eigentlich ohne mich zurechtkommen?«, meint er grinsend.
Sanna antwortet nicht. Bernard rückt den abgewetzten Gürtel in seiner Cordhose zurecht und folgt ihr zur Bahre.
»Ein Hundespaziergänger hat sie gefunden«, berichtet er. »Sie trieb da draußen, wo das Wasser am tiefsten ist. Hat den armen Kerl fast zu Tode erschreckt. Er dachte, er hätte eine Wassernymphe gesehen.«
»Wohnt er hier in der Nähe?«
»Nein. Hier wohnt doch niemand in der Nähe. Er hat gesagt, dass er manchmal mit seinem Hund hierherfährt und spazieren geht.«
Das Mädchen auf der Bahre trägt nur eine löchrige Jeans. Das wellige rote Haar klebt an ihren Wangen, den Schultern und den Brüsten, fast wie eine zweite Haut. Sie hat etwas Friedliches an sich. Wären da nicht die blauen Lippen und die krampfhaft gespreizten Zehen, hätte sie auch einfach nur tief schlafen können.
Sanna zieht sich mit einem schnappenden Geräusch die Latexhandschuhe über, umrundet die Leiche und betrachtet die Hände des Mädchens. Keine Kratzer, die Nägel sind sauber und ordentlich geschnitten. Vorsichtig dreht sie die Hände nach außen und sieht die Schnittwunden an den Handgelenken.
»Du, ich habe gehört, dass du gestern schon wieder ein fettes Angebot abgelehnt hast«, bemerkt Bernard. »Jons Schwester arbeitet doch bei dem neuen Maklerbüro«, fährt er fort, als sie nicht antwortet. »Alle wissen daher, dass du wieder Millionen Kronen für den Hof ausgeschlagen hast …«
»Die Leute reden zu viel.«
»Möglich. Aber wäre es nicht trotzdem schön?«
Sanna sieht ihn wütend an.
»Loszulassen, meine ich.«
»Das habe ich.«
»Ja, aber du weißt ja, dass du immer noch …«
»Ich habe alles, was ich brauche«, unterbricht sie ihn.
Er blinzelt in das bleiche Sonnenlicht. »Na ja, du weißt ja, wie ich darüber denke.«
Die Schnitte an den Handgelenken des Mädchens sind gerade und tief. In einer Wunde scheint sich Rost zu befinden, doch als Sanna die Substanz berührt, zerkrümelt sie wie Sand.
»Bald ist Eriks Geburtstag«, sagt sie und merkt sofort, wie sich Bernards Laune verschlechtert.
»Ja, stimmt. Er wäre wie alt geworden …? Vierzehn?«
»Fünfzehn.«
Bernard lächelt unbeholfen. Vorsichtig legt sie die Hände des Mädchens wieder an den Körper.
»Wir haben immer gesagt, dass wir ihm da draußen auf dem Hof Mopedfahren beibringen wollen, damit er dann zu diesem Geburtstag seinen Führerschein machen kann«, erzählt sie. »Patrik hatte schon zu Eriks Geburt ein Dakota-Motorrad gekauft und es selbst auf Vordermann gebracht.«
»Puch Dakota? Ein Klassiker.«
Sie schweigt.
Bernard versucht es erneut. »Ja, ich weiß, dass es beschissen ist. Aber er kommt nicht zurück. Und Patrik auch nicht. Du bist ja noch keine alte Frau und auch nicht total hässlich, du könntest noch mal jemanden kennenlernen. Glaubst du nicht, dass dein Mann das gewollt hätte? Dass du dein Leben weiterlebst?«
Sie untersucht weiter schweigend die Leiche des Mädchens.
»Eins ist auf jeden Fall sicher«, fährt Bernard fort. »Er ist nicht mehr auf dem Hof. An dem Grundstück festzuhalten, damit die beiden noch länger bleiben, ist nur eine Lüge. Wenn du meinen Rat willst, tu dir einen Gefallen und verkauf. Sieh nach vorne.«
Sie mustert aufmerksam das Gesicht des Mädchens, kann jedoch keine Spuren von Gewalt entdecken. Dann lässt sie den Blick über den Boden um sie herum schweifen. Nichts, nicht einmal ein Insekt.
»Habt ihr Rasierklingen gefunden oder etwas anderes, mit dem sie sich umgebracht hat?«
Bernard sieht langsam ungehalten aus. »Hier gibt es nichts mehr zu tun. Außer dem Papierkram und dass wir die Familie benachrichtigen müssen. Oder willst du persönlich ins Wasser gehen und nach Rasierklingen suchen?«
Einer der Polizeitaucher nähert sich, bleibt stehen und weiß offensichtlich nicht, an wen er sich wenden soll.
»Was gibt es?«, fragt Sanna.
»Ich wollte nur sagen, dass wir das so gelassen haben.« Er deutet auf die Haare des Mädchens.
In den dichten roten Wellen ist ein fester Strick zu sehen. Er ist dick, aus Baumwolle und um etwas gewickelt, das wie ein schwarzes Gummiband aussieht. Auch wenn es nur etwa einen halben Meter lang ist, hat es sich in den Haaren im Nacken verfangen.
»Ich meine nur, dass so etwas wie Algen und Müll, was sich an den Leichen im Wasser verfängt, von allein abfällt, wenn wir sie rausholen«, erklärt er. »Aber das hier sitzt fest. Und nachdem ja keine Spurensicherung da ist …«
»Darüber müsst ihr euch keine Gedanken machen«, sagt Bernard.
»Habt ihr etwas im Wasser gesehen, von dem der Strick stammen könnte?«, fragt Sanna.
»Nein«, antwortet der Mann. »Aber in dem See treibt alles Mögliche herum. Es lässt sich nicht sagen, woher die Schnur stammen könnte.«
»Danke«, erwidert Sanna. »Ist der Leichenwagen auf dem Weg?«
»Ja.«
»Eine Obduktion ist doch nur Zeit- und Ressourcenverschwendung«, murmelt Bernard, als der Taucher davoneilt.
»Du weißt, dass sie in solchen Fällen immer durchgeführt wird.«
Er sieht zur Hüfte des Mädchens. Über dem Jeanssaum hat jemand eine Zahl auf die Haut geschrieben: 26. Die blaue Farbe ist verblichen, als ob sie schon lange auf der Haut war. Oder als ob jemand versucht hätte, sie abzuwaschen.
»Sagt dir das was?«, fragt Sanna.
Er schüttelt den Kopf. »Aber es sieht aus, als ob das von einem Edding stammt. Meine Enkelkinder malen sich damit an, sobald sie so einen Stift in die Finger bekommen. Und wenn man Pech hat, kriegt man die Farbe ewig nicht mehr runter. Sie hält sogar eine Wäsche bei fünfundneunzig Grad aus. So etwas hat sie wahrscheinlich auch gemacht.«
Sanna dreht noch einmal die Hände des Mädchens um. »Sie hat das nicht selbst getan.«
»Doch, das hat sie«, beharrt er müde. »Sie hat sich die Handgelenke aufgeschlitzt. Das siehst du doch. Und jetzt hör auf.«
»Nicht das. Ich meinte die Zahl. Die hat sie sich nicht selbst auf den Leib geschrieben.«
Sie stellt sich ans andere Ende der Bahre. Bernard folgt ihr.
»Jemand anders hat das aufgemalt, jemand, der vor ihr stand.«
»Okay, okay …«, erwidert Bernard. »Dann war es eben ihr Freund oder irgendeine Freundin. Trotzdem ist das ganz eindeutig Selbstmord.«
»Also, sind wir hier fertig?«, drängt er, als Sanna nicht antwortet.
»Wurde Eken informiert?«
»Ja.« Bernard lächelt hinterhältig. »Er hat sich total gefreut, dass ich ihn wegen eines Teenagerselbstmordes aufgeweckt habe.«
»Du weißt, dass wir ihn anrufen sollen.«
»Es ist seine letzte Ferienwoche, und er ist Tausende Kilometer weit weg.«
»Ich glaube, dort gibt es auch Telefone.«
»In ein paar Tagen ist er doch wieder da. Im Moment kann er ja sowieso nichts machen.«
Sanna schweigt. Ernst »Eken« Eriksson ist ihr Vorgesetzter. Geliebt. Gefürchtet. Respektiert. Vor einem Jahr war er an Arthrose erkrankt und kam nach einiger Zeit zurück in die Arbeit, doch manche Bewegungen fallen ihm immer noch schwer. Der Urlaub im Warmen, um die Beschwerden zu lindern, ist seine erste richtige Auszeit seit über zehn Jahren. Eigentlich sollen sie während seiner Abwesenheit jemanden vom Festland hinzuziehen, doch das macht niemand.
»Okay«, sagt Bernard und lächelt müde. »Was meinst du – sollen wir den Rest erledigen, damit wir dann noch etwas von unserem Sonntag haben?«
Er bietet keinen schönen Anblick, denkt Sanna. Milchige Augen, schlaffe Wangen. Er will nur von hier weg. So war es schon die ganzen letzten Jahre, er hat sein Feuer verloren und das Interesse an seinem Beruf.
Ein Fischadler erhebt sich von einem großen, länglichen Gegenstand auf einem hohen Holzpfahl auf der anderen Seite des Kalksteinbruchs.
»Das da drüben ist eine Überwachungskamera.«
Bernard kneift die Augen zusammen.
»Hat schon jemand den Code aufgeschrieben?«, fragt Sanna. »Überprüft, wo das Videomaterial gespeichert wird?«
»Was? Die ist wahrscheinlich von der Badesaison im Sommer übrig und jetzt nicht eingeschaltet.«
»Falls doch, kann sie uns aber genau zeigen, was passiert ist.«
»Aber was zum … Das meinst du nicht ernst, oder?«
»Ach ja, habt ihr einen Abschiedsbrief oder irgendwas in die Richtung gefunden? Wenn sie sich das Leben genommen hat, hat sie vielleicht etwas zurückgelassen, was man finden soll?«
»Nichts.«
»Auch kein Handy?«
Bernard seufzt und schüttelt den Kopf.
»Hast du oder jemand anders ihren Facebook-Account überprüft? Instagram? Irgendeine andere Plattform?«
»Wir haben uns die Social-Media-Profile angesehen, als die Mutter sie als vermisst gemeldet hat. Keine neuen Posts seit ein paar Tagen, keine Hinweise. Und auch fast keine Freunde. Traurig.«
Sanna überlegt. »Ist jemand aus der Familie im Strafregister aufgeführt? Habt ihr das gecheckt?«
Bernard seufzt wieder und klingt noch verärgerter. Dann drückt er ihr seinen Notizblock gegen die Brust, krempelt die Ärmel hoch und marschiert auf den Pfahl zu, auf dem die Kamera montiert ist. Dort angekommen mustert er die rostige Eisenleiter, die daran angebracht ist, bevor er sie packt und nach oben klettert.
»Also, ich habe ein Foto des Codes gemacht. Himmel, es wird so schön sein, wenn ich dich los bin«, sagt er mit einem schiefen Grinsen, als er zurückkommt.
»Entschuldigung?«
Beide drehen sich um. Eine Frau in den Dreißigern mit rissigen Lippen steht leicht gebeugt und fragend vor ihnen.
»Sanna Berling?« Sie streckt die Hand aus. »Eir Pedersen. Deine neue Partnerin.«
Bernards Nachfolgerin, wenn er in Rente geht. Sie sieht anders aus, als Sanna erwartet hätte. Sie hatte mit einer geschliffenen, tadellos gepflegten Bürokratin gerechnet. Eir hat eher das wettergegerbte Aussehen eines Menschen, der unter der Brücke auf einem zusammengefalteten Pappkarton schläft. Sie tritt aufgekratzt von einem Fuß auf den anderen und wirkt fast schon übermütig.
Sie mustert die Umgebung, während der Leichenwagen die Türen schließt und Mia Askar abtransportiert. Bernard folgt ihm in seinem Auto. Sanna überlegt, ob sie Eir fragen soll, warum sie heute schon auftaucht, wenn sie die neue Stelle doch eigentlich erst morgen antritt. Doch sie hat keine Lust, sich zu unterhalten. Bei einem Telefonat vor ein paar Wochen hatte Eir ruhig geklungen, doch jetzt wirkt sie alles andere als beherrscht. Sie geht hektisch umher, die abgestoßenen Schuhe sind nicht richtig zugeschnürt, und es sieht aus, als wäre Salzwasser oder etwas anderes darauf getrocknet.
Ihr Vorgesetzter auf dem Festland hatte zwar gesagt, dass Eir »nie mal runterfährt«, doch dass sie eigentlich eine Zwangsjacke bräuchte, hatte er nicht erwähnt. Stattdessen hatte er betont, dass ihr Vater ein bekannter Jurist und Diplomat ist. Vermutlich, um den Schock abzumildern, wenn man ihr das erste Mal begegnete und sie nicht dem Bild eines wohlerzogenen Mädchens in einem Arbeitszimmer mit teuren, dunklen Mahagonimöbeln und schweren Samtgardinen entsprach.
»Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich hergekommen bin«, sagt Eir. »Ich war erst auf dem Revier, und dort hat man gesagt, dass du hier bist. Man hat mir einen Wagen gegeben, und da dachte ich, was soll’s!«
»Bist du nicht gestern erst hergezogen?«
»Und?«
»Ist es nicht ein wenig seltsam, seinen neuen Job an einem Sonntag anzutreten und nicht bis zum nächsten Tag zu warten?«
Eir gibt keine Antwort.
»Bekommst du nicht erst eine Einweisung auf dem Revier?«, fragt Sanna.
»Das erledige ich morgen früh. Hm, keine Spurensicherung vor Ort«, bemerkt Eir. »Selbstmord?«
»Vermutlich.«
»Auf dem Revier hat man mir gesagt, es handele sich um ein junges Mädchen.«
Sanna nickt.
»Soll ich mich um irgendetwas kümmern?«
»Das können wir morgen machen.«
»Aber ich würde verflixt gerne jetzt etwas tun. Ich kann’s irgendwie kaum erwarten.« Eir scharrt mit dem Fuß. Sanna ignoriert sie.
»Ansonsten könntest du mir ja vielleicht Zugang zu deinen Unterlagen verschaffen, damit ich mich in deine anderen offenen Fälle einarbeiten kann?«, fährt Eir fort.
Sanna seufzt, genervt von der seltsamen, übereifrigen und verwirrenden Gestalt, die neben ihr Richtung Auto hereilt.
»Was denn?«, meint Eir mit herausforderndem Grinsen. »Hast du Angst, dass ich deine Arbeit besser als du erledige, oder was?«
»Nein. Aber ich habe gerade keine Zeit, für deine Unterhaltung zu sorgen.«
»Wie bitte?«
»Als man mir sagte, dass du Bernards Nachfolgerin wirst, habe ich dich überprüft. Wohlhabendes Elternhaus. Internat. Gelangweilt und aufmüpfig. Polizeiakademie. Gelangweilt und kaum irgendwo einzusetzen, trotz hervorragender Ergebnisse. Nationale operative Abteilung. Gelangweilt und nicht teamfähig.«
Nun seufzt Eir genervt. »Komm schon«, sagt sie. »Gehen wir einen Kaffee trinken und lernen uns ein wenig besser kennen.«
»Bis morgen.«
»Blöde Kuh«, knurrt Eir leise, als Sanna weiter zum Auto eilt.
»Was war das?« Sanna dreht sich um.
»Nichts.«
Während Sanna den Wagen aufsperrt, wiederholt sie im Kopf das Lob, mit dem Eirs Vorgesetzter sie angekündigt hat. Ignorier die Bemerkung, denkt sie.
»Ich frage mich nur, warum du ausgerechnet mich ausgewählt hast«, ruft Eir und eilt ihr nach. »Wenn du das alles schon über mich wusstest.«
»Das habe ich nicht.«
»Hm?«
»Ich habe dich nicht ausgewählt.«
»Ach so?«
»Nein. Es gab niemand anderen.«
Eir lacht.
»Was ist daran so lustig?«
»Weil ich mich hier überhaupt nicht beworben habe. Mein Chef ist dafür verantwortlich und hat auf eigene Faust meine Bewerbung hergeschickt. Na, das Arschloch hat mich sowieso nie leiden können.« Im selben Moment bereut sie ihre Worte.
Sanna verzieht die Lippen zu einem zufriedenen Lächeln. »Ach wirklich? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wieso.«
Eir klopft mit der Handfläche gegen ihren Schenkel. »Mir ist da etwas eingefallen«, sagt sie, ohne auf Sannas Bemerkung einzugehen.
»Und was?«
»Also, wenn es ein Selbstmord war, wie ist das Mädchen dann hierhergekommen? Ich sehe kein Fahrrad oder irgendwas anderes, und bis zur Hauptstraße ist es verdammt weit.«
Sanna nickt. Der Wald, der den Kalksteinbruch umgibt, wirkt plötzlich dunkel und bedrohlich. Vor allem ist er dicht und schwer zugänglich. Nur ein Weg führt hindurch, und zu Fuß wäre man da eine ganze Weile unterwegs. Sie holt ihr Handy aus der Tasche.
»Ja, ich bin’s«, sagt sie, als Bernard sich meldet. »Es tut mir leid, aber du musst leider wieder herkommen. Wir müssen die Umgebung ordentlich absuchen. Das Mädchen muss ja irgendwie in den Steinbruch gekommen sein. Jon soll noch mal kommen oder wen du sonst erwischst. Und ruf mich danach an.«
Sanna legt auf und sieht zu Eir, deren Wangen rot von der Kälte sind.
»Komm mit.«
»Wohin geht’s?«, fragt Eir überrascht und lächelt.
»Ich wollte das eigentlich selbst erledigen. Aber jetzt fahr mir mit deinem Auto hinterher.«
Es ist, als ob jemand Lara Askar in den Kopf schießt. Als ob ihr Körper in dem sauberen Flur einfach zerspringt, während Sanna und Eir sie bitten, mitzukommen und ihre Tochter zu identifizieren. Die Frau ist hochgewachsen und hübsch, mit denselben feuerroten welligen Haaren und stechend blauen Augen wie ihre Tochter. Doch die Nachricht lässt sie geradezu verblassen. Sie bricht auf dem Boden zusammen, und die beiden Polizistinnen bringen kein Wort mehr aus ihr heraus, bis die Sanitäter kommen. Als sie ihr in den Krankenwagen helfen, flüstert sie: »Nein, nicht die beiden.«
KAPITEL DREI
Um kurz nach fünf Uhr morgens klingelt das Handy. Sanna protestiert stöhnend, doch das Telefon kennt keine Gnade, weshalb sie schließlich danach tastet. »Ja?«, meldet sie sich schlaftrunken. »Okay, ich fahre hin.«
Sie steht auf, geht vorsichtig zu einer Kleiderstange und schaltet eine wacklige Bodenlampe ein. Auf der Stange hängen drei schwarze Hosen an Kleiderbügeln, auf dem Boden stehen drei Paar schwarze Stiefel. Aus einer Tüte holt sie ein frisches schwarzes T-Shirt, das noch eingepackt ist.
Auf einem Stuhl liegen ungeöffnete Rechnungen und Behördenschreiben, unter anderem von der Gemeinde. Sie weiß schon, was darin steht. Vor ein paar Monaten hat sie die erste Benachrichtigung bekommen. Die Garage darf nicht als Wohnraum genutzt werden, und sie muss bestätigen, dass das auch eingehalten wird.
Sie merkt, dass sie Eriks kleinen Spiegel anstarrt, eines der wenigen Dinge, die ihr nach dem Brand geblieben sind. Das Feuer hat nahezu alles vernichtet; der Hof, den sie und Patrik unter so großen Anstrengungen zusammen restauriert hatten, ist nur noch eine ausgebrannte Hülle. Der Täter, ein Pyromane namens Mårten Unger, hatte nicht zum ersten Mal ein Haus angezündet, in dem Kinder wohnten.
Sie reibt sich das Gesicht und dreht den Spiegel um, mit der Rückseite nach oben. Bei der Berührung überwältigt sie die Trauer. Bei Patrik war es anders, da ließ die Verzweiflung nach wenigen Monaten nach. Zu dem Zeitpunkt, als sie von der Garage erfuhr, hatte sie schon fast sein Gesicht vergessen. Irgendetwas war bei der Testamentsvollstreckung schiefgelaufen, und die Garage wurde erst einige Jahre nach seinem Tod entdeckt. Ein Anwalt gab ihr die Adresse. Weder von der Garage noch dem alten Saab darin hatte sie je gehört.
Bei ihrem ersten Besuch verstellten Mülltonnen die Tür. Sie entfernte das rostige Vorhängeschloss mit einem Bolzenschneider, zog die Tür auf und wurde von einem riesigen Mottenschwarm begrüßt, der ins Freie flatterte.
Es roch nach Benzin und Feuchtigkeit. Patrik hatte Parolen an die Wände gemalt: »Keine Götter, keine Herren« und »Anarchie ist Ordnung«. Daneben prangte eine schwarze Katze, deren Körper mit dem fauchenden Maul einen Kreis bildete und die Sanna sofort wiedererkannte. Die hatte Patrik überall hingekritzelt, auf Papierfetzen und Servietten.
Auf einem wackligen Schreibtisch lagen seine Skizzen, Zeichnungen, Notizen und Briefe an Gleichgesinnte. Außerdem einige lange, anklagende Schreiben an diverse Behörden, die zum Teil durch Nässe oder Insekten beschädigt waren. Wie die Parolen an der Wand waren auch sie Ausdruck seines Hasses auf das Establishment.
Seine anarchistische Seite hatte ihr nie gefallen. Nicht einmal, wenn sie versuchte, sie mit gewissem Humor zu sehen oder sich einzureden, dass sie für einen charmanten Gegensatz zwischen ihnen sorgte. Außerdem hatte er seinen Hass auf den Staat erst recht gepflegt, als er arbeitslos wurde und sie gerade mit Erik schwanger war, als sie ihn folglich am meisten brauchte. Das hatte zu heftigen Streits geführt.
Doch direkt nach Eriks erstem Geburtstag hatte Patrik plötzlich aufgehört, nachts zu zeichnen und zu schreiben und beim Abendessen mit ihr zu diskutieren. Sie hatte es einfach akzeptiert und geglaubt, dass sein neuer Job ihn ablenkte.
Als sie die Garage entdeckte, wurde ihr klar, dass er nie damit aufgehört, sondern sich seine eigene Höhle geschaffen hatte, weit weg von der Familie, wo er ungestört seine Fantasien ausleben konnte. So hatte sie es zumindest immer genannt. Fantasien.
Natürlich hätte sie wütend sein können, dass Patrik diesen Ort vor ihr geheim gehalten hatte. Stattdessen zog sie hier ein. Innerhalb eines Tages hatte sie die Jugendherberge, in der sie seit dem Brand gewohnt hatte, hinter sich gelassen, die Wände der Garage mit einem Hochdruckstrahler gesäubert, alles geputzt, eine Testfahrt mit dem alten Saab unternommen und ihr eigenes Auto verkauft. Sie hatte ihren mageren Besitz mitgebracht, das Bett und die Kleiderstange gekauft. Eine Toilette war schon in einer Ecke eingebaut, wahrscheinlich hatte sich Patrik als Klempner selbst darum gekümmert. An der Wand war ein Edelstahlbecken mit Wasserhahn. Warm duschen konnte sie auf dem Revier.
Am Anfang hatte sie sich gesagt, dass sie so lange bleiben würde, bis Patriks Auto den Geist aufgab. Doch es war unverwüstlich. Also blieb sie. Es war ganz einfach gewesen. Nun hoffte sie, dass man ihr noch ein paar Monate gewährte, bevor jemand von der Gemeinde kam und sie aus der Garage zwang. Nur noch ein bisschen mehr Zeit, bis sie die Kraft hatte, alles anzugehen. Dann würde sie auch den Saab verschrotten.
Sie denkt an den gestrigen Tag, an Mia Askar. An die Schnur in ihrem Haar, die um eine Art elastisches Gummiband gewickelt war. Sie fragt sich, wofür so ein dehnbarer Strick verwendet wird, weiß allerdings keine Antwort. Der aufgegebene Kalksteinbruch ist tief, und wie der Polizeitaucher ganz richtig gesagt hat, kann sich darin alles Mögliche verbergen.
Ihr Mobiltelefon vibriert. Sie wäscht sich das Gesicht am Wasserhahn, zieht das getragene T-Shirt aus und wirft es in einen Mülleimer zu einigen anderen, identischen Oberteilen.
Eir liegt im Bett und starrt an die Zimmerdecke, an der ein paar Leuchtsterne kleben. Die Vormieter hatten wohl Kinder. Sie wälzt sich eine Weile herum, kann jedoch nicht mehr schlafen. Sie setzt sich auf und fährt sich mit der Hand durchs Haar, das sich struppig und steif anfühlt.
Eine Umzugskiste steht in einer Ecke. Ein hoher Stapel Kleidung ragt aus einem schwarzen Müllsack, der auf einer ketchupfleckigen Papiertüte von einem Imbiss steht.
Vor dem Zimmerfenster steht ein Baum mit weit ausgreifender Krone. Ein Zweig hat die ganze Nacht gegen die Scheibe geschlagen, was sie aber nicht so gestört hat wie die anderen Geräusche, die offenbar zu dem Untermietvertrag gehören.
Das penetranteste dringt allerdings aus dem Nebenzimmer, in dem ihre Schwester wohnt. Sie weiß, dass sie Cecilia bitten könnte, die Tastentöne des Handys auszuschalten, doch sie hält sich zurück. Im Vergleich dazu, wie es vor einigen Jahren war, als Cecilia monatelang verschwand, um dann plötzlich wiederaufzutauchen und um Geld zu betteln – high, schweißüberströmt, mit zerkratzten Armen und Beinen –, war diese Art von Ärger völlig aushaltbar. Besser ein schlafloses, cleanes Gespenst, das nebenan mit dem Mobiltelefon herumspielte, als mitten in der Nacht von einem Messer an der Kehle aufzuwachen und einer kleinen Schwester mit riesigen Pupillen, die dringend Bargeld brauchte.
Niemand hatte Schuld daran, dass Cecilia drogensüchtig wurde. Irgendetwas ging in ihrer Kindheit schief, vielleicht hatte sie den Halt verloren, als ihre Mutter nach dem Unfall starb. Eir denkt an das Mädchen im Kalksteinbruch. So alt war Cecilia gewesen, als sie mit harten Drogen zu experimentieren begonnen hatte. Man kann seinen Dämonen auf vielen Wegen entfliehen.
Dann denkt sie an das Foto, das Sanna ihr gezeigt hat. Lara Askar hatte es aufs Revier mitgebracht, als sie ihre Tochter als vermisst gemeldet hat. Ein vergrößertes Klassenfoto. Mia Askars dichte rote Haare bilden einen Kontrast zu dem für diese Bilder üblichen hässlichen blaugrauen Hintergrund. Sie ist sehr hübsch und wirkt durch ihr halbherziges Lächeln abwesend. Am auffälligsten ist ihre Kleidung. Sie trägt eine grüne Boa, eine hellbraune Velourslederweste mit Fellfutter, einen sandfarbenen Sonnenhut, Cowboystiefel, eine Sonnenbrille mit blau getönten Gläsern sowie lange Ketten, Armbänder und Ringe. Sie scheint aus einer anderen Zeit zu stammen. Als würde sie in einer anderen Welt leben.
Eir recherchiert im Internet nach Mia Askar, findet jedoch wenig. Die Treffer konzentrieren sich hauptsächlich auf einen Artikel über einen Mathematikwettbewerb für Kinder, den Mia mit zehn Jahren mit großem Vorsprung gewonnen hat. Ihre Antworten auf die Fragen sind knapp. Ihre Mutter Lara hat eine eigene Firma. Sie hat keine lebenden Vorbilder in der Mathematik, denn: »Hypatia ist ja schon tot.« Ihr Vater Johnny hatte ihr Interesse für Wissenschaft und Mathematik geweckt. Er war Entomologe gewesen mit Spezialgebiet Apidologie, also Bienenforschung. Auf die Frage, ob ihr Vater Johnny heute stolz auf Mia sei, antwortet sie: »Nein, Papa ist tot.« Als der Interviewer wissen möchte, ob sie beim nächsten Mal, also in vier Jahren, wieder an dem Wettbewerb teilnehmen wird, erwidert sie nur: »Nein.«
Eir ruft Mias Social-Media-Accounts auf und scrollt durch einige Fotos. Viel gibt es nicht zu sehen. Mia hat nichtssagende Wasserfotos gepostet, meistens Meeresbuchten, manchmal aber auch Seen und Sümpfe. Anhand der Kommentare wird deutlich, dass sie nicht viele Freunde hatte. Ihre Follower scheinen Zufallsbekanntschaften aus Natur- und Outdoorvereinigungen zu sein, keine echten Freunde. Sie schrieben, wie schön die Orte auf den Bildern doch seien, wie fragil die Natur und wie abgeschieden die Stellen. Abgeschieden. Rasch scrollt Eir weiter durch die Bilder. Auf allen sind einsame Orte auf der Insel am Wasser zu sehen. Einsame Stellen am Wasser, an denen man sterben kann.
Das Piepsen im Nebenzimmer verstummt plötzlich, und Schritte bewegen sich durch die Wohnung. Der Wasserhahn in der Küche wird aufgedreht. Eir steht von der Matratze auf und öffnet das Fenster. Kühle Luft strömt ins Zimmer, und sie atmet tief durch. Sie trägt nur Unterhose und T-Shirt und bekommt eine Gänsehaut, als sie sich hinausbeugt. Mit der rechten Hand stößt sie auf dem Fensterblech gegen etwas Weiches, das sich wie Daunen anfühlt. Eine Amsel, die sich das Genick gebrochen hat. Vorsichtig berührt Eir den steifen, verdorrten Körper, der nie gelebt zu haben scheint.
In der Küche räumt Cecilia nicht zueinanderpassende Teller und Tassen aus der Spülmaschine. Sie ist hübsch, wenn auch mager und blass. Die Haare sind kurz geschnitten, fast schon geschoren. Es passt zu ihrem puppenartigen, niedlichen Gesicht. Zu ihren Füßen liegt Sixten, ein großer, kräftiger irischer Wolfshundmischling mit braun-schwarz gesprenkeltem Fell.
»Alles okay?«, fragt Eir, als sie in die Küche kommt.
Cecilia zuckt erschrocken zusammen, und Sixten setzt sich auf.
»Entschuldige, ich dachte, du hättest mich gehört.«
Cecilia hält einen zerkratzten und angeschlagenen Teller in die Höhe. »Hätten wir nicht ein paar eigene Küchensachen mitnehmen können? Auch wenn du glaubst, dass wir nicht lange hierbleiben werden, wäre es doch nicht zu aufwendig gewesen, ein paar Teller und Tassen einzupacken, oder?«
»Hast du geschlafen?«, fragt Eir statt einer Antwort und gähnt.
»Keine Ahnung. Nicht so richtig. Und du?«
»Ein paar Stunden.«
Sie lächeln einander an. Dieses Gespräch führen sie nicht zum ersten Mal.
»Eine Amsel ist gegen mein Fenster geflogen und hat sich das Genick gebrochen«, bemerkt Eir.
Cecilia seufzt. »Gestern habe ich auch eine tot vor der Tür gefunden. Ich dachte, sie ziehen weg, wenn es kalt wird?«
»Sind das meine Kleider?« Eir deutet auf die Waschmaschine, in der eine Jeans herumgewirbelt wird.
»Ja. Das ganze Badezimmer hat gestunken. Ich habe noch nie die Leute verstanden, die sagen, sie lieben den Geruch nach Meer. Dabei riecht es einfach nur eklig.«
»Tut mir leid, ich hätte sie direkt in die Maschine werfen sollen, als ich nach Hause gekommen bin.«
»Zwei Kilometer von hier ist ein Schwimmbad, das bis spätabends offen hat. Sogar spät genug für dich.«
Eir ignoriert sie, dreht den Wasserhahn an der Spüle auf und lässt das Wasser laufen, bis es kalt ist. Dann trinkt sie ein paar große Schlucke und trocknet sich Mund und Kinn ab. Cecilia stellt mit einem Knall ein zerkratztes Glas neben ihr ab.
»Wie lief es denn?«, fragt sie. »Hast du sie gesehen, diese Kommissarin? Mit ihr gesprochen?«
»Ja.«
»Und wie ist sie so?«
Eir zuckt mit den Schultern. »Keine Ahnung. Müde. Erschöpft.«
»Was habt ihr gemacht?«, fragt Cecilia weiter. »Ich meine, wenn ihr beide am Sonntag in der Arbeit wart.«
»Nichts Besonderes.«
»Ach ja?«
»Jemand hat sich ertränkt. Also, nicht direkt, eigentlich hat sie sich die Puls…«
Eir verstummt, als Cecilia sie aufgebracht ansieht.
»Ja«, sagt Eir, irritiert von dem starren Blick ihrer Schwester. »Die Welt ist voller Menschen, die sterben wollen. Was soll ich deiner Meinung nach sagen?«
»Vielleicht nicht unbedingt, dass es nichts Besonderes ist.«
Eir zuckt mit den Schultern. Sie hat keine Kraft für einen Vortrag oder einen Streit. Auf dem Tisch liegt immer noch die Tüte von der Apotheke. Sie holt das Fläschchen Methadon heraus.
»Von dem Mist bekomme ich Ausschlag«, protestiert Cecilia. »Schau!«
Sie zieht ein Hosenbein hoch und präsentiert die aufgekratzten Ekzeme auf dem Schienbein.
»Das ist so ein verdammtes Mistzeug.«
»Ich weiß …« Eir legt die Arme um ihre Schwester.
»Ich hasse es.«
»Aber du weißt, dass du es nehmen musst«, sagt Eir, bevor Cecilia sich schniefend freimacht und weiter die Spülmaschine ausräumt. Eirs Handy auf dem Küchentisch vibriert plötzlich. Cecilia zuckt zusammen und lässt einen Teller fallen, der auf dem Boden zerschellt.
Sanna steigt langsam aus dem Wagen und rückt ihre Kleidung zurecht. Blaulicht tanzt über ihr Gesicht, als sie Eir eine weitere Nachricht auf der Voicemail hinterlässt.
»Ich bin’s noch mal. Wo bist du?«
Das Wohnviertel liegt direkt hinter der Stadtmauer. Die Häuser sind beeindruckend, die Gärten professionell angelegt. Auch wenn die Gebäude aus verschiedenen Epochen stammen und in unterschiedlichen Architekturstilen erbaut sind, strahlen sie alle dieselbe Gediegenheit und gepflegte Sicherheit aus. In dem ansonsten pittoresken Städtchen mit den kleinen Häusern und engen Gassen sind diese Villen wegen ihrer großen Fenster, herrschaftlichen Eingänge, breiten Auffahrten und majestätischen Bäume mit den akkurat zugeschnittenen Kronen sehr begehrt.
Das Haus vor Sanna ist ein weiß verputzter Traum mit hübschem Rasen, der allerdings gerade abgesperrt ist. Einige Kollegen durchkämmen den Garten. Normalerweise hätte sie sich rasch zu ihnen gesellt, doch heute ist sie müde. Seit dem Aufwachen hat sie an das Mädchen im Kalksteinbruch gedacht. Sie würde sich lieber weiter damit beschäftigen, als in ein wohlhabendes Heim in einem reichen Stadtteil gerufen zu werden, in dem eine alte Frau ermordet wurde.
Während sie auf Eir wartet, trinkt sie den Kaffee aus, den sie an der durchgängig geöffneten Tankstelle gekauft hat. Der diensthabende Beamte auf dem Revier hatte vorhin am Telefon heiser gekrächzt, sie solle sich beeilen, und etwas von einem Einbruch und einem Todesfall gesagt. Jon Klinga sei mit einigen Kollegen bereits vor Ort.
Da taucht Jon auch schon neben ihr auf. Sein Aftershave verströmt einen beißenden Geruch nach Zitrus.
»Sieht aus wie in einem Horrorfilm dadrinnen«, sagt er keuchend, als wäre er außer Atem. »Was machst du hier draußen? Warum gehst du nicht hinein?«
Er ist drahtig und sieht recht gut aus, wenn er wie heute ordentlich gekämmt ist. Das weiß er auch. Obwohl er einen niedrigeren Rang hat als sie, begegnet er ihr mit einer gewissen Autorität. Höflich. Entschlossen. Die Art Polizist, nach der sich die Menschen sehnen, wenn sie glauben, ein Serienmörder würde frei herumlaufen und wahllos Leute foltern.
Die schwarzen Kampfstiefel sind der einzige Hinweis, dass seine Einstellung zu Recht und Gesetz extrem sein kann. Wenige wissen, dass sich unter seiner Uniform ein rotes Hakenkreuz auf seiner Brust verbirgt. Die Tätowierung stammt aus seiner Jugendzeit, und er hat versucht, sie entfernen zu lassen. Einmal hat sie sie gesehen, als er sich allein geglaubt und in einem Raum auf dem Revier umgezogen hat. Er hat Sanna entdeckt, doch bevor er etwas sagen konnte, war sie schon weg. Am nächsten Morgen hat er sie wie immer mit demselben freundlichen Lächeln begrüßt.
Jetzt lächelt er sie wieder an, höflich und nett, aber ohne Wärme. In der Hand hält er eine schwach leuchtende Taschenlampe.
»Wartest du auf Bernard?«, fragt er.
»Nein, meine neue Partnerin. Heute ist ihr erster Tag, aber ich fand, sie sollte mitkommen. Ich habe Bernard Bescheid gesagt, dass wir übernehmen.«
»Aha. Lederjacke und zerzauste Haare, ist sie das?«
Sanna sieht sich um, doch Eir ist immer noch nicht da.
»Ich glaube, ich habe sie gestern auf dem Revier gesehen«, sagt er träge und überheblich. »Sie stand am Empfang und hat irgendwas erledigt.«
Sanna schaudert innerlich vor Ekel. Bei seinem Tonfall weiß sie genau, worauf er hinauswill und dass sie ihn nicht mehr aufhalten kann.
»Als ich vor der Nachtschicht Pause gemacht habe, habe ich von ihr geträumt«, fährt er fort und legt die Hand an die Hüfte. »Ich habe ihr gezeigt, wie es ist, wenn man mit einem richtigen Mann zusammen ist …«
»Hör auf.«
»Lustig«, erwidert er grinsend. »In meinem Traum hat sie das auch gesagt. Und nicht nur einmal.«
»Also«, wechselt Sanna verärgert das Thema, »hier gab es einen Einbruch? Und eine Tote?«
»Ein Mordopfer.« Jon räuspert sich. »Es war definitiv Mord.«
»Aber der diensthabende Beamte hat doch am Telefon etwas von einem Einbruch gesagt?«
»Das dachte ich zuerst auch, bevor ich mich ordentlich umgesehen habe. Bei der Adresse habe ich es ganz eindeutig für einen Einbruch gehalten, aber …«
»Aber?«
»Du wirst es gleich selbst sehen. Dadrin hat ein Massaker stattgefunden.«
Sanna sieht zu der Villa und ärgert sich, dass sie nicht doch Bernard mitgenommen hat. »Wer ist das Opfer?«, fragt sie.
»Marie-Louise Roos, vierundsiebzig Jahre alt.«
»Familie?«
»Keine Kinder. Ein Ehemann, der aber nicht zu Hause ist. Wir fahnden gerade nach ihm.«
»Marie-Louise Roos …«, murmelt Sanna.
»Ja. Kennst du sie?«
»Den Namen zumindest.«
»Sie war oft in der Zeitung. Hat viel Geld für wohltätige Zwecke gespendet und unter anderem das neue Hospiz mitfinanziert. Du weißt schon, der kontroverse Neubau am Stadtrand, für den sie schließlich doch eine Baugenehmigung bekommen haben.«
Sanna erinnert sich. Marie-Louise Roos war die größte Geldgeberin in einer Gruppe aus privaten Spendern gewesen, die den Bau eines neuen, modernen Gebäudes ermöglicht hatte, und zwar auf einem Stück Land, das wegen kulturhistorisch bedeutsamer Überreste eines alten Hofes eigentlich geschützt war.
»Sie war stinkreich«, sagt Jon.
»Jetzt erinnere ich mich. Antiquarische Bücher. Bis vor ein paar Jahren hatte sie einen exklusiven Laden in der Stadt, nicht wahr?«
»Sie hat viel Geld damit verdient, indem sie alte Erstausgaben, Manuskripte und so was aufgetrieben und dann an reiche Sammler auf der ganzen Welt verkauft hat.«
»Aber das hat sie jetzt nicht mehr gemacht?«
»Nein, sie hat sich zurückgezogen, als sich der Handel ins Netz verlagert hat. Aber sie hat im Haus noch eine kleine Bibliothek.«
»Es könnte also trotzdem ein Einbruch gewesen sein? Wegen der Bücher?«
»Möglich, aber ich glaube es nicht.«
»Wurde aus der Bibliothek etwas gestohlen?«
»Der Raum wirkt unberührt. Aber die Versicherung wird es schon sagen, wenn etwas fehlt.«
»Und der Ehemann?«
Jon blättert in seinem Notizbuch. »Frank Roos, Frührentner.«
»Und davor?«
»Geologe.«
»Wissenschaftler?«
»Ja, ursprünglich schon. Später hat er als Berater gearbeitet, hauptsächlich für das Fornsalen-Museum.«
Er liest weiter in seinen Notizen. »Er war auch eine Weile in der Wirtschaft tätig, offenbar für Unternehmen, die auf Genehmigungen zum Kalkabbau aus waren.«
Sanna überlegt kurz. »In den letzten Jahren gab es ja einigen Wirbel und Proteste wegen der Genehmigungen.«
»Ja, aber nicht, als er in dem Sektor gearbeitet hat. Er ist vor zehn Jahren in Rente gegangen.«
Sanna kratzt sich am Kopf und sieht wieder zu der Villa. Aus dem Augenwinkel bemerkt sie, dass Jons Gesicht ausdruckslos wird, wie immer, wenn er nichts mehr zu berichten hat.
»Sollen wir reingehen?«, fragt sie. Mittlerweile ist sie richtig wütend auf Eir, weil diese immer noch nicht aufgetaucht ist.
»Was ist mit der Neuen?«
»Ach, wir sagen den Kollegen hier draußen, sie sollen sie aufs Revier schicken, falls sie doch noch kommt. Sie soll sich heute ihre Einweisung abholen. Wir gehen jetzt rein.«
Sie zerknüllt den Pappbecher von der Tankstelle und schiebt ihn in die Manteltasche.
»Okay«, erwidert er. »Du, wann ist sie noch mal auf die Insel gekommen, hast du gesagt?«
»Ich habe gar nichts gesagt. Warum?«
»Ich frage mich nur, ob sie Samstagabend schon hier war.«
»Sie ist mit der Fähre am Samstagmorgen gekommen. Wieso?«
»Ach, es ist sicher nichts. Aber hast du von den zwei Teenagermädchen gehört, die wir an dem Abend reinbekommen haben?«
»Die Sprayerinnen?«, fragt Sanna. »Die sich geprügelt haben und ins Krankenhaus mussten?«
»Sie behaupten, sie hätten sich überhaupt nicht geprügelt, sondern eine Frau mit einer Lederjacke hätte sie überfallen und fast umgebracht.«
Sanna lacht. »Soweit ich weiß, haben sie das Haus besprüht, in dem ihr altes Mobbingopfer wohnt. Sie waren wahrscheinlich high von den Farbdämpfen und haben dann vor lauter Aufregung die Fäuste fliegen lassen.«
Jon versteift sich.
Die Kälte in seinem Gesicht hat sie schon öfter gesehen, wenn jemand über ihn lacht. Vor allem, wenn es eine Frau ist.
»Der Vorfall war in Talldungen«, erwidert er. »Wo wohnt deine neue Partnerin eigentlich?«
In diesem Moment kommt Eir auf sie zu.
»Du bist zu spät«, sagt Sanna vorwurfsvoll.
»Ich weiß«, keucht Eir und fährt sich durch die Haare.
»Jon.« Er streckt ihr die Hand entgegen.
Sie schüttelt sie und sieht ihn dabei zurückhaltend an. Sucht nach irgendeiner Art Wärme in seinen Augen, doch da ist nichts.
»Du bist ja noch neu hier, da ist es nicht leicht, sich zurechtzufinden«, sagt er. »Aus welcher Richtung bist du gekommen?«
»Korsparken.«
»Du meinst Korsgården?« Er grinst abfällig und sieht zu Sanna. »Das ist doch gleich neben Talldungen. Sanna und ich haben nämlich gerade über das Viertel gesprochen.«
»Ach ja?« Eir sieht die beiden verständnislos an.
»Wollen wir dann?« Sanna geht auf die große, abgesperrte Villa zu.
Die anderen folgen ihr. Kamerablitze leuchten hinter einigen Fenstern auf. Eir wirft Jon einen Blick zu.
»Wann genau wurde der Einbruch gemeldet?«
»Um vier Uhr dreißig«, antwortet er. »Eine Nachbarin wollte die Zeitung reinholen und hat dabei gesehen, dass die Haustür offen stand. Dann hat sie nachgeschaut, ob alles in Ordnung ist.«
»Und wann habt ihr die Fahndung nach dem Ehemann rausgegeben?«
»Um fünf Uhr. Ich habe das selbst erledigt, sobald ich hier war.«
Eir dreht sich abrupt zu Jon. »Moment mal … Du hast eine halbe Stunde hierher gebraucht? Die Stadt ist doch so klein, dass man sie in dreißig Minuten umrundet hat.«
»Ich glaube nicht, dass das so eine große Rolle spielt. Sie war schon kalt, als die Nachbarin sie gefunden hat«, antwortet Jon abweisend.
»Das spielt sehr wohl eine Rolle – wenn man Nachtschicht hat und ein Mord gemeldet wird, macht man doch bitte schön seinen Porno aus und fährt an den Tatort. Oder?«
Sie ist nicht auf den Mund gefallen und fordert Jon offen heraus. Da ist sie wieder, diese Wildheit, denkt Sanna. Brutal, aufbrausend und völlig furchtlos ist ihre neue Kollegin. Könnte Jon recht haben? Wäre sie wirklich fähig, zwei Teenagermädchen zusammenzuschlagen?
»Falls nötig, stimmen wir uns noch mal mit dir ab, wenn wir drinnen fertig sind«, sagt sie zu Jon. »Ihr habt doch nichts angefasst, oder?«
»Wir haben nicht einmal ein Fenster geöffnet oder uns mit der Hand frische Luft zugefächelt. Was echt hart war, es stinkt bestialisch dadrin. Sudden und seine Leute von der Spurensicherung haben den Tatort vorläufig untersucht, soweit ich weiß.«
»Ist Sudden noch im Haus?«
»Nein, aber er wollte später noch mit dir sprechen. Ich sollte dich vielleicht noch warnen …«
»Wieso?«
»Die Nachbarin ist überall herumgetrampelt und hat alles Mögliche angefasst. Das hat die Arbeit für Sudden und seine Leute natürlich erschwert.«
Sanna seufzt.
»Und Fabian?«
»Ist auf dem Weg zurück auf die Insel. Er war auf dem Festland, um eine wichtige Obduktion zu überwachen, aber sein Flugzeug müsste jeden Moment landen«, berichtet Jon und wendet Eir den Rücken zu. Sie windet ihm dafür die Taschenlampe aus der Hand.
»Kann ich reingehen?«, fragt sie Sanna und geht nach einem knappen Nicken als Antwort ins Haus.
»Hatte die Polizei hier schon mal zu tun?«, erkundigt sich Sanna und sucht in ihrer Manteltasche vergeblich nach Latexhandschuhen. Bernard hat immer ein Extrapaar für sie, denkt sie traurig. Sie wird ihn vermissen.
»Nein.« Jon sieht zu der Haustür, durch die Eir gerade verschwunden ist.
Auf dem Gehsteig steht eine ältere Frau im Morgenmantel bei zwei Polizisten.
»Die Nachbarin?«, fragt Sanna.
»Ja.« Jon sieht auf die Uhr.
»Bin gleich wieder da.« Sie steuert auf die Frau zu. »Und beschaff mir in der Zwischenzeit zwei Paar Handschuhe.«
Die Nachbarin zittert und weint verzweifelt in ein Taschentuch. Sie bewegt sich steif, die Adern an Hals und Händen treten bläulich hervor. Sanna nimmt einen der Polizisten zur Seite.
»Sie ist ja schon ganz durchgefroren, besorgt ihr eine Decke und bringt sie ins Warme. Haben die Sanitäter nach ihr gesehen?«
»Ich weiß nicht, wo sie sind.«
»Was soll das heißen?«
»Dass ich nicht weiß, wo sie sind.«
»Na gut«, seufzt sie und wendet sich an die Frau.
»Mein Name ist Sanna Berling, ich bin Kriminalkommissarin. Sie haben Marie-Louise Roos gefunden?«
Die Nachbarin nickt und versucht zu lächeln. Sie trägt eine Prothese im Oberkiefer, die allerdings nicht richtig befestigt ist. Zwischen den blau gefrorenen Lippen sieht es aus, als hätte sie drei Zahnreihen.
»Ist Ihnen heute Morgen noch etwas aufgefallen, außer dass die Haustür offen stand?«
Die Frau schüttelt den Kopf.
»Und Marie-Louises Mann?«
»Frank?« Sie versucht, die Prothese mit der Zunge zurechtzuschieben, ohne dabei zu sehr zu lispeln. »Haben Sie ihn gefunden?«
»Wir suchen mit Patrouillen nach ihm.«
»Aber warum nicht mit einem Helikopter?«
»Den setzen wir hier selten ein, weil es sehr unübersichtlich ist.«
Die Frau nickt. Sie wirkt beunruhigt.
»Wissen Sie, wo er sich aufhalten könnte?«, fragt Sanna weiter. »Bei Freunden oder Familienangehörigen in der Nähe?«
»Was meinen Sie damit? Er kann sich doch allein kaum fortbewegen!«
Kurz darauf steht Sanna wieder bei Jon, nimmt ihm wortlos den Block aus der Hand und schreibt etwas hinein.
»Wusstet ihr, dass der Mann im Rollstuhl sitzt und Diabetiker ist?«, fragt sie verärgert.
»Was?«
»Setzt die Hundestaffel ein und durchsucht mit zusätzlichen Kräften noch mal die Büsche und Nachbarsgärten in der Gegend. Vielleicht steht er unter Schock oder liegt verletzt irgendwo.«
Jon nickt kühl, aber pflichtbewusst.
»Und hat schon jemand mit dem Zeitungsausträger oder der Zeitungsausträgerin gesprochen?«
»Ja, er hat nichts gesehen und nichts gehört.«
»Wissen wir, wann der Ehemann das letzte Mal gesehen wurde?«
»Nein.«
»Hängt euch da dran. Und sein Handy soll sofort geortet werden.«
»Okay.«
»Handschuhe?«