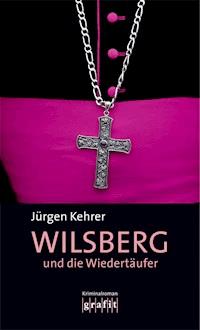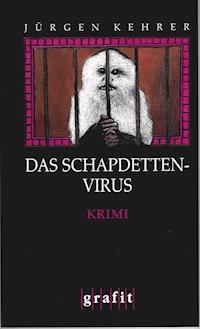Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Auf der Nordseeinsel Norderney soll ein internationales Gipfeltreffen stattfinden. Während die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, mehren sich jedoch merkwürdige Todesfälle: Offensichtlich führt eine Virusinfektion zu irrationalem Verhalten mit unkalkulierbaren Folgen. Den Betroffenen gemein ist, dass sie von Zecken gestochen wurden und sich in ihren Gehirnen mutierte FSME-Viren nachweisen lassen. Der Leiter der örtlichen Polizeistation Martin Geis fordert, die Öffentlichkeit vor der neuen Krankheit zu warnen, doch die Politiker wollen den Gipfel wie geplant stattfinden lassen und die Geschichte unter den Teppich kehren. In Berlin befasst sich die Zeckenforscherin Viola de Monti mit dem Fall und stellt fest, dass es an anderen Orten Deutschlands ähnliche Vorkommnisse wie auf Norderney gibt, aber unvermittelt werden ihr die Nachforschungen von oberster Stelle verboten. Heimlich recherchiert die Wissenschaftlerin, die auch ein persönliches Interesse an dem Fall hat, weiter: Ist das mutierte Virus ein Produkt menschlicher Forschung? Und kann es helfen, ihre eigenen Probleme zu lösen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Copyright
© 2010 by GRAFIT Verlag GmbH Chemnitzer Str. 31, 44139 Dortmund Internet: http://www.grafit.de E-Mail: [email protected] Alle Rechte vorbehalten. eISBN 978-3-89425-808-5
Der Autor
Jürgen Kehrer, geboren 1956 in Essen, lebt in Münster. Er ist der geistige Vater des Buch- und Fernsehdetektivs Georg Wilsberg. Neben bisher achtzehn Wilsberg-Krimis veröffentlichte er auch historische Kriminalromane sowie Sachbücher zu realen Verbrechen. Zuletzt erschien Todeszauber, der zweite Wilsberg-Roman, der in Zusammenarbeit mit der Autorin Petra Würth entstand. Außerdem verfasste Kehrer mehrere Wilsberg-Drehbücher für das ZDF.
Weitere Informationen unter: www.juergen-kehrer.de
Zitat
Vor uns saß auf einem riesengroßen, in romantischer Art schräg gestellten Bett die Herrin: die Angst. Sie hatte eine entfernte Ähnlichkeit mit einem Pferd, aber einem sehr hässlichen. Ihr Morgenrock bestand aus lebenden Fledermäusen, die an den Flügeln zusammengenäht waren.
Leonora Carrington
Prolog
Mit ihm war die Kraft und die Herrlichkeit. Er schwebte durch den Raum wie eine junge Gottheit, sein Herz schlug ruhig und gleichmäßig. Die Mission, die er zu erfüllen hatte, bedeutete nicht mehr und nicht weniger als das Ende der Welt, in die er hineingeboren, in der er aufgewachsen und an der er sich abgerieben hatte. Wenn die Mission gelingen würde – und daran zweifelte er keinen Moment –, begann ein neues Zeitalter, alles würde besser werden, der Menschheit stand eine Epoche der Freiheit bevor.
Es lag nicht an ihm allein, natürlich nicht. Aber seine Brüder und Schwestern, die in den anderen Hotels das Gleiche versuchten, waren ebenfalls gut vorbereitet. Letztlich stand jeder für jeden ein und so hatten sie gelost, und er hatte den britischen Premierminister gezogen. Es war ihm vollkommen egal, mit derselben Überzeugung hätte er den französischen Präsidenten oder den spanischen Ministerpräsidenten übernommen. Der Premierminister war – wie jeder seiner Amtskollegen – nur ein Mensch, ein fehlbarer, von Zwängen, Umfragen und falschen Einflüsterungen getriebener Mensch.
Die Sicherheitsleute am Eingang des Hotels hatten keinen Verdacht geschöpft, weil er sich nicht wie ein Attentäter verhielt. Attentäter konnten ihre Nervosität nicht verbergen, sie schwitzten und stanken nach Angst und Entschlossenheit. Geschulte Personenschützer – und die deutschen und britischen Beamten im Hotel gehörten zu den besten – erkannten einen Attentäter auf zehn Meter Entfernung.
Ihn nicht. Er war ruhig geblieben und hatte den Männern lächelnd seinen Ausweis gezeigt, der ihn als Kellner identifizierte, zugelassen für die höchste Sicherheitsstufe. Das gefälschte Dokument war nicht perfekt, aber gut genug für einen langen kritischen Blick. Der Mann, dessen Rolle er einnahm, lag gefesselt in seiner Dienstbotenkammer. Mit einem blutigen Daumen. Denn nicht der Ausweis, bei dem sie das Foto und einige Daten ausgewechselt hatten, sondern der Daumenabdruck in der Sicherheitsschleuse stellte das größere Problem dar. Vorsichtig drückte er seinen rechten Daumen, an dem die abgezogene Haut des echten Kellners klebte, auf den Scanner. Das grüne Lämpchen leuchtete auf, die Sicherheitsleute nickten ihn weiter zum Metalldetektor und tasteten ihn anschließend gründlich ab. Sie fanden nichts. Für das, was er vorhatte, brauchte er keine Waffen.
In den letzten Wochen hatte er gehungert und fünf Kilo abgenommen, unter seiner Nase wuchs ein kratziger Schnurrbart und die vormals aschblonden Haare klebten dunkelbraun und glänzend an seinem Schädel. Nicht den Sicherheitsleuten galt das Versteckspiel, die kamen von auswärts und hatten keinen blassen Schimmer von seiner wahren Identität. Aber einigen der Hotelangestellten war er sicher schon mal auf der Straße begegnet. Als freundlicher Polizist, stets bereit, Auskünfte und Ratschläge zu erteilen und für Ruhe und Ordnung zu sorgen, soweit das auf Norderney überhaupt nötig war. Eine sprechende Uniform, bei der man Hilfe suchen oder sich über die Idiotie der anderen beklagen konnte. Dass in der Uniform ein Mensch mit Gefühlen steckte, interessierte niemanden.
Die Arbeitskleidung des Kellners passte ihm wie angegossen. Vor dem Spiegel kontrollierte er den Sitz der Fliege und wischte ein paar Flusen von den Ärmeln. Dann stieg er in den Kühlkeller hinab und holte das, was er brauchte, aus dem markierten Fach. Früher als erwartet hatte sich eine günstige Gelegenheit ergeben. Jetzt durfte er nicht zögern. Doch Zweifel gehörten ohnehin nicht zu seinem neuen Leben.
Leichtfüßig näherte er sich dem Eingang zum Speisesaal. Seine ganze Erscheinung hatte eine Wandlung durchgemacht. Er ging aufrechter, straffer, voller Energie, die er seinem baufälligen Körper nicht mehr zugetraut hätte.
Vor dem Speisesaal fing er erstaunte Blicke von anderen Kellnern auf, die sich ihm entgegendrängten. Und dann stand er im Saal. Der Premierminister war die Sonne, um die herum sich konzentrische Kreise von wichtigen und weniger wichtigen Menschen bildeten. Sein bernhardinerhaftes Gesicht wirkte noch griesgrämiger als auf den Fotos, die der Expolizist kannte. Bellend stieß der Premier Kommentare aus, die von seiner Tischgesellschaft mit wohlwollendem Nicken aufgenommen wurden.
Den Kellner, der ein Tablett auf dem Tisch abstellte, beachtete er nicht mehr als die Tapete an der Wand.
Erster Teil Der Stich
1 Norderney, Alter Postweg
Martin Geis kam sich vor wie ein Inselführer. Nur waren es keine gewöhnlichen Touristen, die hinter ihm hertrotteten und alles Mögliche über die Strände, den Hafen und das Wattenmeer wissen wollten, sondern Anzugträger aus Berlin und Hannover. Ihr Interesse galt nicht der Fauna des Nationalparks oder der Geschichte der Badekultur, stattdessen musste Geis Zahlen referieren: Schiffsbewegungen, Hotelbelegungen, Länge der Strände und Entfernungen zum Festland und den nächsten Inseln. Natürlich hätte man das alles am Schreibtisch mit ein paar Klicks im Internet erfahren können, doch dann wäre den Herren der dreitägige Ausflug auf die Insel entgangen, Luxusversorgung in einem der besten Norderneyer Hotels inklusive.
Man wolle sich vor Ort ein Bild machen, das war die Formulierung, die Geis in den letzten Tagen ständig gehört hatte. Seine Reisegruppe bestand aus lauter Sicherheitsexperten, im Bundesinnenministerium und in verschiedenen Bundes- und Landesbehörden zuständig fürdie Abwehr von militanten Demonstranten und Terroranschlägen.
Geis graute vor den nächsten Monaten. Denn die Sicherheitsexperten waren erst die Vorhut. Bis zum sechsten September würde es jetzt so weitergehen. Bis zu dem Tag, an dem das Gipfeltreffen der europäischen Regierungschefs beendet war. Delegationen und Komitees aus allen EU-Ländern würden die Insel überrollen. Sein Chef in Aurich hatte ihn ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er sich jederzeit für Auskünfte und Führungen bereithalten müsse. Als hätte er nichts Besseres zu tun, als den Animateur für politische Spitzenbeamte zu spielen.
»Sie sind doch nicht ausgelastet«, hatte Fokke Janssen alle von Geis erhobenen Einwände abgeschmettert. »Mit den paar Kneipenschlägereien und Strandtaschendiebstählen werden Ihre Leute auch ohne Sie fertig.«
In der Woche vor dem Gipfeltreffen, so sahen die bisherigen Planungen vor, würden über tausend Polizisten auf der Insel stationiert werden. Janssen und ein paar hohe Tiere aus Hannover wollten dann selbst nach Norderney kommen und das Kommando übernehmen. Für Martin Geis, den Leiter der kleinen Norderneyer Polizeistation, war ab diesem Zeitpunkt nur noch die Rolle eines Parkwächters vorgesehen.
Nach den Erfahrungen vom G8-Gipfel in Heiligendamm war die Idee aufgekommen, die nächste Mammutkonferenz auf eine Insel zu verlegen, die sich viel leichter überwachen ließ als jeder Ort auf dem Festland. Doch warum musste es ausgerechnet Norderney sein? Warum nicht eine der anderen ostfriesischen Inseln oder, noch besser, Helgoland, der Felsbrocken mitten in der Nordsee?
Natürlich kannte Geis die Antwort. Norderney verfügte über die notwendige Infrastruktur. Die Staats- und Regierungschefs kamen ja nicht allein, sondern mit Horden von Beratern, Bodyguards und Journalisten, die alle angemessen logieren wollten. Und Norderney bot genügend Unterbringungsmöglichkeiten und Konferenzräume, um einen solchen Ansturm zu bewältigen.
Geis stapfte über den Alten Postweg in Richtung Dünen. Mit verhohlener Schadenfreude registrierte er, dass sich die Männer in seinem Schlepptau immer missmutiger gegen den Nordseewind stemmten. Trotz der giftigen gelben Sonne, die am fahlen Himmel hing, waren die Temperaturen alles andere als sommerlich. Und dünne Trenchcoats über Maßanzügen, die Uniform seiner Begleiter, eigneten sich für eine Dünenwanderung in etwa so gut wie ein Taucheranzug für die Durchquerung der Wüste.
Seit drei Stunden liefen die Männer mittlerweile hinter ihm her. Geis hatte die Sicherheitsexperten kreuz und quer durch den Ort und dann über die Strandpromenade bis zum Hafen geführt. Jetzt würde sich zeigen, ob sie es ohne Erfrierungen bis zum Flugplatz schafften.
»Warten Sie mal!« Lange, ein Abteilungsleiter aus dem Bundesinnenministerium und offenbar der Anführer der Reisegruppe, schnappte nach Luft. Sonne, Wind und Anstrengung hatten das Gesicht des korpulenten Mannes schweinchenrosa gefärbt. »Wohin kommen wir, wenn wir da geradeaus gehen?«
»Am Golfplatz vorbei zum Leuchtturm und dem Flugplatz.«
»Ist das Gebiet relevant?«
»Kommt darauf an, was Sie darunter verstehen«, gab Geis zurück.
Um den Leiter der Polizeistation bildete sich eine Traube. In einigen Gesichtern war die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Führung zu erkennen.
»Uns interessieren vor allem die sicherheitsrelevanten Bereiche«, erklärte ein Mann, dessen Glatze von einem Sonnenbrand glühte. »Östlich der Lippestraße ist die Insel doch weitgehend unbewohnt.«
»Richtig.«
»Und die Nord-Süd-Richtung der Straße eignet sich optimal, um einen Auffangzaun zu errichten. Wir müssten nur noch bis zum Wasser verlängern.«
»Sie wollen den gesamten Ostteil der Insel absperren?«, fragte Geis.
»Warum nicht?« Lange hatte sich erholt. »Wir können nicht jeden Meter Strand bewachen. Eine Auffanglinie vor dem Tagungskomplex spart eine Menge Einsatzkräfte.«
»Und wer soll aufgefangen werden?« Geis deutete auf die Dünenkette. »Dort gibt es keinen Hafen.«
»Unterschätzen Sie nicht, mit wem wir es zu tun haben«, sagte der Glatzenmann. »Schlauchboote können an jeder Stelle der Insel landen. Außerdem lässt sich das Watt bei Ebbe zu Fuß durchqueren.«
»Nur mithilfe eines erfahrenen Wattführers. Alles andere wäre Selbstmord.«
Lange lachte auf. »Nichts für ungut, Herr Hauptkommissar. Das sind fanatische Spinner. Wenn die Möglichkeit besteht, versuchen sie es. Und falls einer absäuft, schieben sie uns dafür die Schuld in die Schuhe.«
»Was Herr Dr. Lange damit sagen will«, mischte sich ein Dritter ein. »Wir gehen nicht vom Normalfall aus. Auch nicht von vernünftigen, die Risiken abwägenden Gegnern. Unsere Planungen sind immer auf den Worst Case ausgerichtet.«
Worst Case, dachte Geis. Mein Worst Case ist der verdammte Gipfel.
Lange fixierte den Mann, der es gewagt hatte, ihn zu interpretieren. »Was ich damit sagen will, ist ganz einfach: Die Insel wird zweigeteilt. Daran gibt es nichts zu rütteln.«
»Das wird den Urlaubern aber nicht gefallen.« Geis schob die Hände tiefer in die Taschen der Lederjacke. »Die Strände vor der Weißen Düne sind im Sommer sehr beliebt.«
»Welche Urlauber?« Lange guckte amüsiert. »Am ersten Septemberwochenende wird es keine Urlauber geben.«
»Die Stammgäste buchen meist ein Jahr im Voraus.«
»Sorry. Dann haben sie in diesem Jahr Pech gehabt. Alle Hotels sind für die Gipfelteilnehmer reserviert. Ebenso die Fähren und der Flugplatz. Gewöhnliche Sterbliche werden keinen Zutritt haben. Glauben Sie, der französische Präsident will den Frühstückssaal mit kreischenden Kindern teilen?«
Geis’ Handy fiepte. Er trat ein paar Schritte zur Seite und meldete sich.
»Gefährliche Körperverletzung«, sagte Britta Hartweg.
»Wer?«
»Hannah Berends vom Hotel Strandblick.«
»Ist der Täter bekannt?«
»Ihr Mann, Eiko Berends. Hat sie in der Küche verprügelt. Die Restaurantgäste haben uns gerufen. Der Hubschrauber ist bereits angefordert. Hannah muss so schnell wie möglich nach Norden ins Krankenhaus.«
»Hast du den Scheißkerl verhaftet?«
»Natürlich.«
Geis schaute zu den Sicherheitsexperten, die ihre Ohren aufstellten, um etwas von dem Telefonat mitzubekommen. Der Vorfall bot eine einmalige Gelegenheit, diesen Idioten zu entkommen.
Geis senkte die Stimme: »Hol mich ab! Ich bin an der Kreuzung Alter Postweg und Lippestraße. Und bring Thedinga mit. Er soll die Führung zu Ende machen.«
»Wir kommen auch ohne dich klar, Martin.« Hartweg klang ein wenig enttäuscht.
»Schon möglich. Aber ich will den Fall selbst übernehmen.«
Geis beendete das Gespräch. Vom Festland näherte sich der Hubschrauber, auch die Sicherheitsexperten hatten bereits das Motorengeräusch gehört.
»Was ist passiert?«, fragte Lange.
»Jemand ist schwer verletzt worden. Genaueres weiß ich noch nicht. Ich nehme an, es ist in Ihrem Sinn, wenn ich mich persönlich darum kümmere. Einer meiner besten Männer wird mich ersetzen.«
Der wortkarge Thedinga würde die Wichtigtuer hoffentlich noch eine Weile durch die Dünen scheuchen.
»Sollten Sicherheitsfragen auch nur am Rande …«
»… werde ich Sie unverzüglich unterrichten«, sagte Geis.
Eiko Berends war tatsächlich ein Sicherheitsrisiko. Hauptsächlich für die Menschen, die ihm am nächsten standen. Fast alle Einheimischen wussten, dass Berends seine Frau und sein Kind schlug. Geis selbst hatte Hannah Berends ins Gewissen geredet und ihr dringend geraten, Anzeige zu erstatten. Doch Hannah war, wie viele Ehefrauen in ähnlichen Fällen, stur geblieben. Der Bluterguss in ihrem Gesicht, behauptete sie, stamme von einem unglücklichen Zusammenprall mit einer Schranktür.
Diesmal würde er Berends drankriegen. Falls Hannah ihren Mann nicht belasten wollte, würden die Zeugenaussagen ausreichen, ihn für eine Weile ins Gefängnis zu schicken.
2 Berlin, U-Bahn
Es war eine idiotische Idee von ihr gewesen, die U-Bahn zu nehmen. Schon vor dem Einstieg hatte sie weiche Beine bekommen. Aber ihr Stolz hielt sie davon ab, einfach wieder umzukehren. Blöde, saublöde. Der Zug war voll. Natürlich. Was hatte sie erwartet? Um acht Uhr morgens? Zum Glück hatte sie einen Fensterplatz ergattert. Wenigstens eine Seite frei. Nur das kühle, glatte Glas. Sie lehnte sich so weit wie möglich zum Fenster. Stehend, eingezwängt zwischen anderen, hätte sie die Fahrt nicht überstanden. Höchstens eine Station. Neben ihr saß ein älterer Mann, nach abgestandenem Schweiß stinkend. Warum duschten die Menschen morgens nicht? Was gab es an dieser zivilisatorischen Errungenschaft auszusetzen? Sie duschte jeden Morgen, manchmal auch abends, um den Dreck des Tages abzuwaschen. Die Nützlichkeit von Deorollern war ebenfalls nicht zu verachten. Es boten sich eine Menge Möglichkeiten, die olfaktorische Belästigung seiner Mitmenschen zu vermeiden. Aber davon hatte der Typ neben ihr anscheinend keine Ahnung. Schob seinen breiten Arsch immer näher an sie heran. Den von langen Jahren sitzender Tätigkeit breit gewordenen Arsch. Herrgott noch mal, das war ihr Sitz! Was bildete der Kerl sich ein? Jetzt faltete er auch noch seine Zeitung auseinander, hielt ihr das Blatt direkt vor die Nase. Immerhin, es roch nach Papier und Druckerschwärze. Angenehm, im Vergleich zu seinen Körperausdünstungen.
Ihr Herz raste. Der verdammte Muskel strengte sich an, als würde sie einen Achttausender ohne Sauerstoffmaske erklimmen. Dabei hockte sie regungslos auf ihrem Sitz. Zugegeben, tief unter der Erde. Über ihr viele Meter Stein, Lehm, Beton. In einer Metallbüchse, die vollgestopft war mit Pendlern. Wieso konnten die anderen das ertragen? Warum gab es kein Grundrecht auf mindestens einen Meter Abstand zum nächsten Menschen? Die Kopfschmerzen wurden stärker, bohrten sich von den Schläfen aus in die Hirnlappen. Saure Übelkeit stieg vom Magen auf. Ablenken, nicht an den eigenen Körper denken. Sei brav, Viola, beschäftige dich! Was war mit den Frauen auf der Bank gegenüber? Die ältere mit der billigen blonden Perücke zählte die Monate bis zur Rente. Verhärmter, schmaler Mund, das Gesicht zerklüftet wie ein Alpenpanorama. Saß vermutlich im Supermarkt an der Kasse. Oder stand sich in einem Kaufhaus die Beine krumm. Gelenkschäden in den Knien und Wasser in den Füßen. Und das für ein paar Hundert Euro monatlich.
Ihr Magen rebellierte. Sie stieß auf, ein Schwall Magensäure schwappte in ihren Mund. Nur jetzt nicht kotzen. Kein brauner Strahl auf den Boden, keine Spritzer auf Hosenbeine und Schuhe, keine angeekelten Blicke. Das wäre der GAU. Dann lieber ohnmächtig werden, einfach umkippen, rausgetragen werden an die frische Luft, abgelegt auf den herrlich harten Steinplatten des Gehsteigs. Lassen Sie mich hier liegen. Ich komme schon zurecht. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Nur eine kleine Panikattacke. Passiert mir häufiger. Rein psychisch, verstehen Sie?
Woran hatte sie zuletzt noch gedacht? Richtig, an die Frauen gegenüber. Die junge wirkte ein wenig anämisch. Schwarz gefärbte Haare, weiße, fast durchscheinende Haut, unter der ein paar blaue Äderchen zu sehen waren. Ringe in der Nase, in der Unterlippe, in den Augenbrauen und wahrscheinlich auch im Schambereich. Die schlabberigen Klamotten ein paar Nummern zu groß. Mager, vielleicht magersüchtig. Das würde die Anämie erklären. Hätte sie heute Morgen etwas gegessen, würde sie vermutlich gleich mitkotzen.
Nein, das wollte sie jetzt nicht denken. Gestern Abend. Gestern Abend hatte sie sich stark gefühlt. So stark wie schon lange nicht mehr. Sie hatte sogar ihre Wohnung verlassen und war einmal um den Block gegangen. Vorbei an den Gestalten, die die Berliner Nacht in der Nähe des Ku’damms bevölkerten: Junkies, japanische Touristen, verwirrte alte Damen, türkische Jugendliche, Frauen mit großflächigem Make-up in osteuropäischen Farben, alternde Tunten und betrunkene Russen. Die Männer, soweit heterosexuell, über zwanzig und in der Lage, den Blick zu fokussieren, hatten sie taxiert, die Größe ihres Busens, die Grifffestigkeit ihres Hinterns, hatten darüber nachgedacht, wie sie wohl im Bett sein würde. Und ihr hatte das nichts ausgemacht, fast nichts. Sie war unantastbar gewesen. Wie ein schwarzer Engel, der unter Sterblichen wandelt. Kurz hatte sie überlegt, ob sie in eine Kneipe gehen und ein Bier bestellen sollte. Aber das wäre dann doch zu wahnwitzig gewesen.
Als sie wieder zu Hause war, hatte sie so etwas Ähnliches wie Zufriedenheit gefühlt. Ihr Körper, der sie so oft schmählich im Stich ließ, war angenehm locker und leicht gewesen. Die Sache mit Heiner schien endlich überwunden. Ein paar Wochen war das jetzt her, dass er seine Zahnbürste mitgenommen hatte. Dabei hatte sie von vornherein gewusst, dass die Beziehung zum Scheitern verurteilt war. Sie konnte nicht mit einem Mann zusammenleben, sie konnte es nicht ertragen, mit ihm in einem Bett zu liegen, seinen Atem im Nacken zu spüren. Seine Hände, die ihren Körper abtasteten. Sie hatte es wirklich gewollt. Sie mochte Heiner. Zum ersten Mal seit Jahren hatte sie für einen Mann Gefühle entwickeln können. Und Heiner gab sich Mühe. Er zeigte Verständnis, verlangte nicht viel von ihr. Doch das wenige war mehr, als ihr Körper geben konnte. Wenn Heiner in sie eindrang, verkrampfte sie. Danach kamen die üblichen Beschwerden, Vaginalpilz, Blasenentzündung, morgendliche Übelkeit. Sie wollte, aber ihr Körper wollte nicht. Schließlich hatte sie die Entscheidung ihres Körpers akzeptiert. Heiner musste gehen.
Gestern Abend war das fast vergessen. Gestern Abend. Verdammt lange her. Mehr als acht Stunden. Sie hatte Pläne geschmiedet. Mal wieder laufen. Nicht auf dem Stepper in ihrer Wohnung, sondern open air. In dem Park ganz in der Nähe. Jeden Morgen nach dem Aufstehen ein paar Runden drehen. So wie früher. Vor dem Tag X.
Verrückt! Genauso verrückt wie die Idee, mit der U-Bahn zur Arbeit zu fahren.
Der Mann neben ihr faltete seine Zeitung zusammen und stand auf. Endlich. Hansaplatz. Noch drei Stationen. Das würde sie überstehen. Das musste sie überstehen. Ein großer Dunkelhäutiger setzte sich neben sie. Sie spürte, wie sich ihre Kehle zusammenzog. Sie bekam keine Luft mehr. Das durfte doch nicht wahr sein! Sie würde hier ersticken.
»Alles in Ordnung?«
Der Farbige starrte sie mit weit aufgerissenen Augen an. Er meinte es freundlich.
Sie nickte. Alles in Ordnung. Bestens. Sprechen war nicht möglich.
Ihr Blick verengte sich. In der Mitte war noch alles scharf, aber an den Rändern verschwammen die Konturen. Tunnelblick. Sauerstoffmangel. Die Frauen auf der Bank gegenüber hatten mitbekommen, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Guckten sie an, mitleidig die alte, sensationslüstern die junge. Warum quietschte die U-Bahn wie eine ausgeleierte Luftpumpe? Nein, das war nicht die Bahn, das war sie selbst. Sie hyperventilierte. Kein Sauerstoffmangel, sondern zu viel Sauerstoff. Himmel noch mal, was für ein Schauspiel. Peinlich, entsetzlich peinlich! Junge, relativ gut aussehende Wissenschaftlerin hyperventiliert in U-Bahn. Komischerweise konnte sie nicht aufhören daran zu denken, wie sie auf andere wirkte. Nie. Noch im Sterben würde sie sich Gedanken über ihr Aussehen machen. Dabei waren alle Leichen hässlich.
Sie presste ihre linke Hand vor den Mund und tastete mit der rechten in ihrer Handtasche.
»Kann ich Ihnen helfen?« Der Farbige.
Sie schüttelte den Kopf. Wo war das verdammte Taschentuch? Da: Taschentuch vor den Mund und flach atmen. Sie musste raus. Raus, raus, raus. Sofort. Die U-Bahn wurde langsamer. Gott sei Dank. Aufstehen. Irgendwie. Sie schaffte es. Sie stand.
»Ihre Tasche!«
Was? Der Farbige hielt ihre Tasche hoch. Sie nahm die Tasche und zwängte sich durch die Menschen, stieß jemanden zur Seite, trat einem anderen auf den Fuß. Nur raus. Auf dem Bahnsteig noch mehr Menschen. Sie stieß durch die Menge, rannte jetzt, immer noch das Taschentuch vor dem Mund. Die Treppe hinauf. Sterne blitzten auf, rot, gelb, grün. Kometen rasten durch ihr Blickfeld. Endlich Licht. Tageslicht. Luft zum Atmen.
Sie taumelte ein wenig und lehnte sich gegen einen Laternenmast. Wartete darauf, dass sich ihr Atem beruhigte.
»Geht es Ihnen nicht gut, Fräulein?«
Noch jemand, der ihr helfen wollte. Ein alter Mann, weißes Hemd und Krawatte, schmaler, schwarz gefärbter Schnurrbart. Alte Schule.
»Danke.« Ihre Stimme klang belegt.
»Soll ich Ihnen etwas holen? Einen Kaffee vielleicht?«
»Nicht nötig. Mir war nur ein bisschen schlecht.«
Der alte Mann ging weiter. Wo war sie hier eigentlich? Sie schaute sich um. Zu Fuß würde sie eine gute Viertelstunde bis zum Institut brauchen. Allemal besser als ein neues Experiment mit dem öffentlichen Nahverkehr.
Mit jedem Schritt fühlte sie sich besser. Die Panikattacke war überwunden. Man musste das positiv sehen. Schlimmer konnte es heute kaum werden.
Als sie die Kanalbrücke überquerte, erblickte sie das Gebäude, in dem sie arbeitete. Bald würde sie bei ihren Zecken sein.
3 Norderney, Richthofenstraße
»Der Wichser tut so, als ginge ihn das nichts an.« Britta Hartweg starrte durch die Frontscheibe auf die Straße. »Wie tickt so ein Mensch? Schlägt seine Frau krankenhausreif und ist anschließend kalt wie ein Fisch. Als ich ihm sagte, dass er mitkommen muss, hat er mich nur dumm angegrinst. Ich hatte große Lust, ihm eine reinzuhauen.«
»Was du hoffentlich nicht getan hast?«
»Natürlich nicht. Ich habe bloß die Handschellen ein bisschen enger gestellt.«
So wütend hatte Martin Geis seine Stellvertreterin noch nie erlebt. Britta war normalerweise nicht aus der Ruhe zu bringen. Gab es Probleme mit randalierenden Jugendlichen oder Zechern, die über die Stränge schlugen – ein paar Worte von Britta genügten, um den Frieden wiederherzustellen. Ihre äußere Erscheinung erklärte einen Teil dieser Wirkung. Rund einhundert Kilo, auf einhundertachtzig Zentimeter Körpergröße verteilt, schüchterten die meisten männlichen Großmäuler ein. Den Rest erledigte ihre tiefe, raue Stimme.
Geis schätzte an Britta, dass sie ihre Arbeit kompetent und zuverlässig erledigte. Ansonsten wusste er nicht viel über die Frau, die vermutlich seinen Job bekommen hätte, wäre er nicht vor zwei Jahren von Hannover aus in die Wüste geschickt worden. Britta war in Ostfriesland geboren und hatte jedes ihrer neununddreißig Jahre, abgesehen von der Zeit, während der sie Lehrgänge besuchte, in diesem Landstrich verbracht. Sie lebte allein und schien diesen Zustand auch nicht ändern zu wollen. Ob sie auf Männer, Frauen oder etwas ganz anderes stand, Geis hatte nicht die geringste Ahnung. Am Anfang, als er neu auf der Insel gewesen war, hatte er Britta zu einem Bier eingeladen, weil er dachte, dass sie das von ihm erwartete. Nach einer halben Stunde war ihm klar geworden, dass sie aus dem gleichen Grund eingewilligt hatte. Von da an waren sie stillschweigend übereingekommen, ihre Gespräche auf das Dienstliche zu beschränken. Was sich vor allem im Winter schwierig gestaltete, wenn die Stammbesatzung der Norderneyer Polizeiwache aus lediglich fünf Beamten bestand, die viel Zeit miteinander verbrachten. Während der Sommersaison kamen sieben weitere Kolleginnen und Kollegen aus ganz Niedersachsen hinzu. Freiwillige, die unter chronischen Lungen- und Hautkrankheiten litten oder für ein paar Monate dem Stress der Straße entfliehen wollten. Denn die Arbeit auf Norderney bestand hauptsächlich darin, Präsenz zu zeigen – zu Fuß oder auf dem Fahrrad. Schwere Straftaten waren die absolute Ausnahme.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!