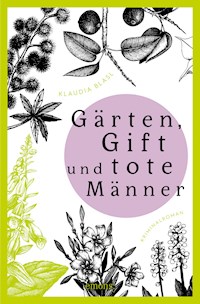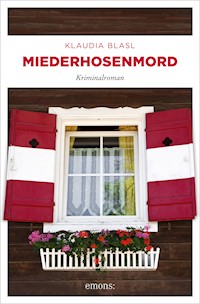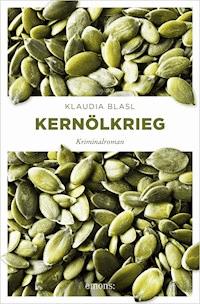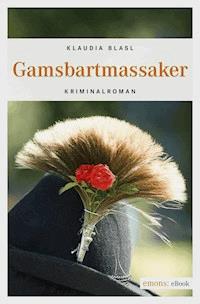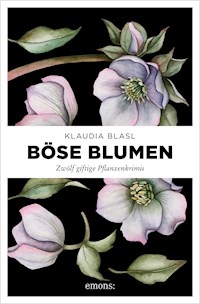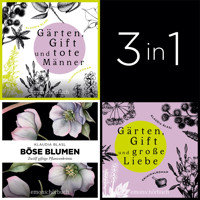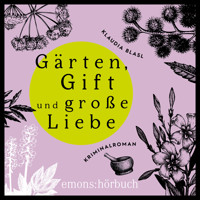Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Berta und Pauline ermitteln
- Sprache: Deutsch
Ein Gartenkrimi, der die Lachmuskeln trainiert. Weg mit dem Speck! Das sagt sich auch die Oberdistelbrunner Seniorenrunde und begibt sich zum Basenfasten in ein Wellnessresort. Doch statt Falten und Fettzellen verlieren zwei Teilnehmer ihr Leben, heimtückisch getötet durch Pflanzengift. Ein Fall für Berta und Pauline, die Hobbygärtnerinnen mit Miss-Marple-Gen. Gemeinsam verfolgen sie die mörderischen Spuren der mysteriösen »Liga zum Schutz pflanzlicher Gefühle« – und erkennen beinahe zu spät, dass die große Liebe oft ein Todesurteil ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman mit frei erfundenen Handlungen und Personen. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Die Pflanzenporträts wurden dem Buch »111 tödliche Pflanzen, die man kennen muss« (Klaudia Blasl, emons 2018) entnommen.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/Yevheniia Lytvynovych
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Abbildungen im Anhang: shutterstock.com/Morphart Creation, shutterstock.com/Yevheniia Lytvynovych, Wikimedia Commons
Lektorat: Dr. Marion Heister
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-148-5
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Autoren- und Verlagsagentur Peter Molden, Köln.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Danke an Ilse H., Franz P. und den Kater Boris. Dieses Buch ist auch euer Verdienst.
Verdrossen rührte Berta in ihrer gebundenen Gemüsesuppe herum. »Das Zeug sieht aus wie pürierter Kompost«, maulte sie und verzog angewidert das Gesicht, bevor sie den Löffel zögernd mit der trüben Brühe füllte.
Ich nickte ihr aufmunternd zu, während sie vorsichtig eine mikroskopisch kleine Menge kostete.
»Schmeckt auch wie pürierter Kompost«, seufzte sie kurz danach und ließ den Löffel laut klirrend in den Suppenteller fallen.
»Aber denk an die vielen Vitamine und Spurenelemente«, versuchte ich meine Freundin von den Vorzügen einer gesunden und figurfreundlichen Ernährung zu überzeugen, »die liefern deinem Körper Energien ohne Ende, und das ganz ohne Kalorien. Du wirst sehen, in ein paar Tagen fühlst du dich wie neu geboren.«
»In ein paar Tagen bin ich längst tot.« Resolut schob Berta den vollen Suppenteller von sich. »Dieser Fraß bringt einen ja um. Ich fühl mich jetzt schon sterbenselend. Was uns die da« – sie warf einen verächtlichen Blick auf die Organisatoren unserer Basenfasten-Kur – »als Essen verkaufen, das ist die reinste Folter, körperliche Nötigung, aktive Sterbehilfe, ach, was sag ich, das ist ein Fall für den Menschenrechtsgerichtshof.« Sie drosch mit geballter Faust derart fest auf den Tisch, dass sich ein Gutteil der Gemüsesuppe der Schwerkraft widersetzte und nach einem kurzen Flug schwungvoll auf der blassblauen Resopalplatte verteilte, die ähnlich wie wir schon recht mitgenommen aussah.
»Recht hat sie«, mischte sich nun auch die dicke Emma ein, die schräg gegenübersaß und mit Berta die Liebe zur ungebremsten Fettzellenvermehrung teilte. »Hier wird einem ja nicht mal das Salz in der Suppe vergönnt. Und dafür auch noch Geld verlangen. Eine grenzenlose Frechheit ist das!«
Die von unserem Oberdistelbrunner Seniorenbund in die Wege geleitete Gesundheitswoche schien definitiv nicht allen Anwesenden zu schmecken. Dabei versprach die hier gebotene rigoros basische Ernährung nicht nur eine heilsame Entschlackung und Darmsanierung, die in unserem Alter zunehmend an Bedeutung gewannen, sondern auch eine spürbare Gewichtsabnahme. Und davon würden einige unserer Gruppe sehr profitieren. Etwa Berta, meine Lieblingsnachbarin und beste Freundin, deren fassförmige Figur einer langfristig günstigen Pensionsprognose bestimmt schwer im Wege stand. Bei hundertzehn Kilo riskierte man nachweislich Gicht und Diabetes, verkalkte Arterien, verfettete Innereien und letztlich sogar einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und ich riskierte allein beim Gedanken, meine beste Freundin zu verlieren, eine unheilbare Dauerdepression.
Wild entschlossen, mit gutem Beispiel voranzugehen, löffelte ich die zugegebenermaßen etwas geschmacklose Suppe bis auf den letzten Tropfen aus. Dann wandte ich mich mit meinem bewährten Lehrerinnenblick an meine erboste Tischgenossin: »Wir sind freiwillig hier, vergiss das nicht! Niemand hat uns zu dieser Gesundheitskur gezwungen.« Gedanklich setzte ich noch zwei Ausrufzeichen hinterher.
Und bevor Berta protestieren konnte, fragte ich sie, ob sie denn überhaupt wisse, dass sie jedes Kilo Übergewicht zwei Monate ihrer Lebenszeit kosten könne.
»Ach was. Würde das stimmen, wär ich schon mit siebzehn gestorben«, wischte sie meinen Einwand gemeinsam mit der verschütteten Brühe vom Tisch. »Außerdem siehst du das viel zu einseitig. Kilos können auch Leben retten. Denk mal an Entführungen, an Windhosen, Hungersnöte oder eine angriffslustige Kuh. Da hättest du mit deinem Fliegengewicht gar keine Chance.«
»Ganz genau«, nickte Emma voller Überzeugung, was ihr Dreifachkinn in heftige Schwingungen versetzte. »Dich würde schon ein Laubbläser umpusten, so dünn, wie du bist.«
»Ich bin überhaupt nicht dünn, ich habe siebenundsechzig Kilo, trage Größe 38 und sollte bei meiner Größe sogar drei Kilo weniger wiegen«, konterte ich verärgert. Wobei ich mich hauptsächlich darüber ärgerte, den beiden im Grunde auch noch recht geben zu müssen. Immerhin hatte ich mein Leben nur Bertas Kampfgewicht und Emmas Schlagkraft zu verdanken, die mich vor nicht einmal zwei Jahren todesmutig aus den Fängen einer Serienmörderin befreit hatten. Doch daran wollte ich weder mich noch unsere Fastenkur-Gruppe erinnern.
»Aber das ist jetzt wirklich egal«, meinte ich daher konziliant und spülte meinen Groll mit einem großen Schluck lauwarmen Wassers hinunter, »lasst uns einfach auf die Hauptspeise warten. Davon können wir angeblich essen, so viel wir wollen.«
Emma und Berta blickten mich an, als hätte ich ihnen ein höchst unmoralisches Angebot gemacht, während sie nahezu synchron die Nasen rümpften.
»So viel wir wollen«, äffte Emma mich nach. »Du meinst wohl, so viel wir runterkriegen, ohne uns zu übergeben.«
»Aber du weißt doch noch gar nicht, was es überhaupt gibt«, fuhr ich sie an.
»Ich weiß, was es nicht gibt«, fauchte sie zurück und griff nach der Hochglanzbroschüre des neuen Unterdistelbrunner Gesundheitsresorts, das den klingenden Namen »Botanical Wellness« trug, unter dem wir alten Schachteln uns allerdings wenig vorstellen konnten.
»Also, hier steht, dass man beim Basenfasten keinen Fisch, kein Fleisch, keine Wurst, keinen Käse, keine Milch, keinen Kaffee, keinen Alkohol, keine Eier, kein Brot, keine Nudeln, keinen Reis, keine Fette und keine Süßigkeiten zu sich nehmen darf«, trug sie mit zitternder Stimme vor. Es klang, als hätte sie gerade ihr eigenes Todesurteil verlesen.
»Wovon zum Teufel sollen wir da überhaupt leben?«, fragte Berta sichtlich entsetzt.
»Und vor allem, wofür?«, merkte Emma fast schon philosophisch an.
»Damit dein Organismus entsäuert wird«, entgegnete ich.
»Aber ohne Mehlspeise werde ich erst recht sauer«, meinte Berta.
»Damit du deinen Darm sanierst.«
»Und gleichzeitig meine Nerven ruiniere.«
»Damit dein Körper entschlackt wird.«
Ich gab nicht auf, sie gaben nicht nach.
»Ich habe noch nie im Leben geschlackt. Also was sollte ich schon großartig zum Entschlacken haben?«, stellte Emma nun kategorisch fest.
Lebenslanges Lernen lag der pensionierten Postbeamtin eindeutig weniger am altersschwachen Herzen als die tägliche Kalorienzufuhr. Aber hier und jetzt war der falsche Moment für belehrende Aufklärungsgespräche. Widerwillig unterdrückte ich mein besserwisserisches Lehrerinnen-Gen und widmete mich der Frage, warum man an einer einwöchigen Fastenkur teilnahm, wenn man gar nicht fasten wollte. Ich buchte doch auch keinen Kletterurlaub, wenn ich nicht schwindelfrei war.
»Ihr habt euch angemeldet. Ihr habt bezahlt. Und ihr wusstet, was euch erwartet. Also reißt euch gefälligst zusammen! Ihr werdet schon nicht gleich tot vom Tisch kippen«, stellte ich so autoritär wie möglich fest.
»Es war von Fasten die Rede, nicht von Verhungern«, widersprach Berta.
»Der menschliche Körper kann bis zu dreißig Tage ohne Nahrung auskommen«, konterte ich.
»Aber …«, hob Emma an, doch der junge Mann, der bereits die Suppe serviert hatte und in seltsame weiße Gewänder gehüllt war, unterbrach unseren Disput, indem er ein voll beladenes Tablett mittig auf dem Tisch platzierte.
»Meine Damen, voilà«, säuselte er, »wünsche einen gesunden Appetit.«
Wir griffen nach den großzügig gefüllten Schüsseln und Platten und bedienten uns.
»Austernseitlingpüree mit gegrillten Pastinaken und gedünstetem Tschicko, äh, Schicko, also mit so gedünstetem Zeugs, das wie gerupfter Chinakohl aussieht«, verkündete die spindeldürre Elsbeth, die neben mir saß und bislang geschwiegen hatte, während sie abwechselnd die Menükarte und ihren Tellerinhalt studierte.
»Chicorée, das ist Chicorée, voller Vitamine, Bitterstoffe und gut für die Verdauung und den Stoffwechsel«, klärte ich sie auf, aber unsere Oberdistelbrunner Paradebetschwester hatte sich schon wieder abgewandt, um den Gesprächen am Nebentisch zu lauschen. Bislang hatte sie ohnedies kaum jemand wirklich essen sehen, sah man von Hostien, Haferschleim und Hustenbonbons einmal ab, dafür gierte sie nach Klatsch und Tratsch wie andere nach Schokokuchen.
Emma und Berta hingegen waren ausschließlich an ihrer kargen Mahlzeit interessiert. Mit bösem Blick und gerunzelter Stirn starrten sie auf den Tisch, als hätte man ihnen einen Kaktus in Kakerlakenpüree serviert.
»Austernseitlinge, Tschickoreh, Pastinaken, was soll ich mit diesem ausländischen Zeugs?«, schnaubte Emma. »Wollen die uns mit diesem Gemüsepampf auch noch vergiften.«
Ich seufzte. Mit ihren rassistischen Ansichten versprühte sie bereits ausreichend Gift, das einem schwer im Magen lag, da schien mir eine Diätmahlzeit, und wäre sie noch so pestizidverseucht, das weitaus geringere Übel zu sein. Aber da die Atmosphäre an unserem Tisch ohnedies einer einzigen geballten Gewitterzelle glich, verschluckte ich meine Moralpredigt und sagte stattdessen: »Stammt alles aus der Region. Austernseitlinge sind übrigens Schwammerln, die wachsen im Wald, Süßkartoffeln hat’s immer schon gegeben, und aus Zichorienwurzeln hat man zu Notzeiten Kaffee gemacht. Jahrhundertelang. Hier bei uns. Die kannst getrost als einheimisches Kulturgut betrachten.«
»Ich will mich aber nicht bilden, ich will was Gescheites essen«, fiel mir nun auch noch Berta, meine beste Freundin, in den Rücken. »Hätte die Menschheit sich nur von so einer geschmacklosen Hungerkost ernährt, wäre sie schon in der Steinzeit ausgestorben.«
Eine Vorstellung, die mich in diesem Moment nicht wirklich erschreckte. Dann würde ich zumindest nicht hier sitzen und mir Stimmung und Appetit von zwei unersättlichen Gierschlünden vermiesen lassen müssen. Dabei war heute unser erster Tag im Botanical Wellness Resort, einem etwas überdimensionierten Klotz aus Sichtbeton, in dem sich einst die gewerkschaftliche Kuranstalt für Eisenbahner und deren Angehörige befunden hatte. Wütend und gleichzeitig ziemlich betrübt spießte ich eine Pastinake auf und bekleckerte dabei meine neue blassrosa Bluse, die ich mir extra für diesen Anlass geleistet hatte. Auch das noch. Ich seufzte erneut.
Da fiel ein Schatten auf mich. Bobo, die Fünfte und Jüngste unserer Seniorenrunde, war unbemerkt an den Tisch getreten und reckte ihren faltigen Hals über meine Schulter. Eine Wolke aus Chanel No5 und Gin Tonic umwehte mich.
Auch Bobo, eine aufgetakelte Witwe mit einem Faible für christbaumschmuckartige Ohrgehänge und peinliche Wortmeldungen, war nicht wegen Darmsanierungen oder Blutfettwerten mit von der Partie. Ihr ging es seit dem mysteriösen Ableben ihres Gatten in der Badewanne ohnedies prächtig, doch die Putzfrau hatte sich am Knie verletzt, und da es Bobo allein beim Gedanken graute, sich mit Scheuerbürsten und Abwaschschwämmen das Nageldesign zu ruinieren, logierte sie lieber außer Haus, Hauptsache, sie musste sich die Hände nicht schmutzig machen.
»Du meine Güte. Was sitzt ihr denn so sauertöpfisch rum? Das schaut ja aus wie bei einem Leichenschmaus«, bemerkte sie nun mit gewohnt spitzer Zunge.
»Der Leichenschmaus ist morgen«, grunzte Berta, »heute gibt’s das letzte Abendmahl.«
»Versteh ich nicht«, meinte Bobo sichtlich irritiert, während sie sich einen Stuhl heranzog.
»Ganz einfach. Diesen Fraß überlebt keiner«, erklärte Emma mit weithin hörbarer Stimme.
Ich zuckte zusammen. Warum konnten diese beiden Furien nicht endlich den Mund halten? Oder zumindest flüstern. Derart lautstark vorgebrachte Lästereien grenzten schon an Rufmord. Nicht auszudenken, wenn die dem Koch zu Ohren kämen! Den treffsicheren Umgang mit Nudelhölzern, Fleischklopfern oder gar Tranchiermessern hatte so ein Küchenchef bestimmt im kleinen Finger. Und selbst wenn er statt mit Kochutensilien nur mit Worten um sich warf, würden Mengen an bösem Blut fließen, wir bekämen Hausverbot, der Aufruhr wäre groß und mein guter Ruf schwer beschädigt. Als ehemalige Lehrerin, die sich über vierzig Jahre lang abgemüht hatte, der Jugend von gestern Anstand, Disziplin und eine schöne Handschrift beizubringen, legte ich auch heute noch mehr Wert auf eine weiße Weste als auf ein sauberes Tischtuch. Allein der Gedanke, in einen Skandal verwickelt zu werden, fühlte sich schlimmer an als jede Darmspiegelung.
In vorauseilender Schwarzseherei sah ich mich bereits in Teufels Küche, als am Tisch hinter uns tatsächlich die Hölle losbrach. Ein ohrenbetäubend kakofonischer Chor aus kreischenden Hilferufen und bestialischen Würgegeräuschen erklang, Stühle fielen polternd zu Boden, Geschirr zerschellte, jemand übergab sich unter infernalischem Stöhnen, Elsbeth und ich rangen unseren arthritischen Knochen Höchstleistungen ab und sprangen beinahe gleichzeitig auf, während Bobo sich mit einem gewagten Satz aus der Gefahrenzone brachte. Dabei trat sie Emma allerdings mit einem ihrer High Heels versehentlich gegen das Schienbein, was diese mit einer Kanonade an übelsten Beschimpfungen quittierte, die selbst Weißkraut zum Erröten gebracht hätte. Nur Berta blieb einigermaßen ruhig an ihrem Platz sitzen. Ihre walrossförmige Statur hätte aber ohnedies keine sprunghaften Bewegungen zugelassen. Mit der Gemüsezange in der Hand saß sie einfach nur da und starrte fassungslos auf die groteske Szene, die sich uns bot.
Auf dem Boden, umrahmt von Dutzenden Pastinaken, einem Trockenblumengebinde und den Scherben der Servierplatte, lag ein Mann, der am ganzen Körper zuckte, als würde er unter Starkstrom stehen. Außerdem röchelte er wie mein kürzlich verstopfter Abfluss, als ich ihn mit dem Gummipömpel malträtierte. In seinem linken Nasenloch steckte ein Austernseitling, und ein Rinnsal grünlichen Schleims rann ihm aus dem Mund. Ein Anblick, bei dem einem wirklich der Appetit verging.
Um ihn herum, wenngleich in beachtlichem Sicherheitsabstand, schien sich mittlerweile der halbe Speisesaal versammelt zu haben.
Einige riefen nach wie vor um Hilfe, eine zierliche ältere Dame mit elegant gekringelten Lockenwicklerlöckchen fiepste mit zitternder Stimme nach einem Arzt, der weiß gewandete Kellner hatte sein Mobiltelefon ans Ohr gepresst, doch der Großteil der Menge stand einfach nur mit offenem Mund und aufgerissenen Augen herum und verfolgte das Geschehen gebannter als jede Mondlandung. Da der Mann auf dem Boden immer noch wild um sich trat, wagte sich allerdings niemand in seine unmittelbare Nähe.
Armer Kerl, er hatte offenbar einen epileptischen Krampfanfall erlitten, so wie er sich gebärdete. Ich hatte mal gelesen, dass man sich dabei sogar die eigene Zunge abbeißen konnte. Dann wäre lebenslanges Fasten mit Babybrei angesagt, ein Schicksal, das ich niemandem wünschte. Besorgt langte ich nach meiner Serviette, um sie dem geifernden Mann zwischen die Kiefer zu klemmen, als mich eine schnaufende Gestalt im Bademantel resolut zur Seite schob.
»Weg da«, schnauzte sie mich herrisch an, »ich bin Arzt.«
»Auf Model hätte ich eh nicht getippt«, ätzte Bobo nach einem zutiefst verächtlichen Blick auf den zerknitterten kotbraunen Cordbademantel, der aussah wie ein museales Relikt aus Zeiten des Warschauer Pakts. Das Kleidungsstück hatte seine beste Zeit wohl seit Jahrzehnten hinter sich, dessen Besitzerin allerdings auch. Dass es sich bei dem dürren, hochgewachsenen Wesen mit dem zu einem mickrigen Mäuseschwanz gebundenen Haar, den dicken Brillengläsern und der tiefen, rauchigen Stimme um eine Ärztin handelte, hatte ich überhaupt erst bemerkt, als die Gestalt sich neben den Tobenden kniete, wodurch unter dem Bademantel eine Perlenkette zum Vorschein kam, ein doch recht unmännliches Accessoire, das selbst mein exzentrischer schwuler Neffe niemals tragen würde. Offenbar war die Medizinerin einfach zu alt für neumodischen Genderkram, dachte ich gerade, als sie sich ruckartig aus ihrer gebückten Lage erhob.
»Wenn der Krankenwagen nicht bald hier ist, können Sie den Leichenwagen auch gleich rufen«, rief sie dem Kellner zu, der an einem der hinteren Tische lehnte und immer noch sein Mobiltelefon ans Ohr gedrückt hielt. Dann beugte sie sich erneut zu dem Kranken hinunter, der mittlerweile fast völlig reglos daniederlag und nur noch ganz verhalten stöhnte.
Dafür kam Bewegung in die Menge. Hände wurden gerungen, Haare gerauft, Handys gezückt und alle möglichen Hypothesen erstellt. Einige Gäste verließen fluchtartig den Speisesaal, andere drängten sich zitternd und verängstigt in kleinen Gruppen zusammen, als würden sie von einem Säbelzahntiger bedroht. Der Gedanke an eine Leiche zum Dessert gefiel wohl niemandem. Auch mir nicht. Die Toten, über die ich in den letzten Jahren gestolpert war, reichten meiner Ansicht nach für gefühlte drei Wiedergeburten aus. Bedrückt sandte ich ein Stoßgebet zum Himmel, während sich Elsbeth bekreuzigte und in Endlosschleife »Gott steh mir bei!« flüsterte.
»Ihm muss er beistehen, nicht dir«, zischte ich zurück. »Immerhin liegt er im Sterben, nicht du.«
»Was nicht ist, kann noch werden«, bemerkte Bobo betont süffisant. »Und außerdem ist einem Sterbenden mit göttlichem Beistand sowieso nicht geholfen. Auferstehungen gibt’s nur zu Ostern, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt haben wir September.«
Elsbeth schnappte empört nach Luft. In ihren Augen galt Gotteslästerei als weitaus schlimmeres Vergehen als Mord oder Totschlag.
»Ich frage mich, ob ihm das mit einer zünftigen Bratwurst ebenfalls passiert wäre?«, meldete sich nun auch Berta zu Wort, während sie auf ihren noch beinahe vollen Teller starrte.
»Nein. Ganz sicher nicht!«, entgegnete Emma. »Ich hab’s ja gesagt, diesen Fraß überlebt keiner.«
»Stimmt. Das hast du gesagt …«, meinte Bobo nachdenklich und legte ihre makellos gepuderte Stirn in weniger attraktive Plissierfalten.
Das war der Moment, in dem mir meine harmoniesüchtige und menschenfreundliche Grundstimmung abhandenkam. Zuerst führten sich diese nörglerischen Gesundheitskostverächter auf wie bei einer Protestaktion der vereinten Suppenkasper, und jetzt spannen sie auch noch abstruse Verschwörungstheorien, statt den todkranken Kerl zu bemitleiden.
»Ihr seid doch völlig verrückt«, fuhr ich sie an. »Ich hab fast alles aufgegessen. Und mir geht es gut. Allen hier geht es gut. Der arme Mann hatte einen epileptischen Anfall. Das ist schlimm, aber nicht ernährungsbedingt.«
Wirklich gut ging es mir allerdings nicht. Die Aufregung und der ständige Streit behagten mir nicht. Leider hatte ich meine Handtasche mit den selbst angesetzten Beruhigungstropfen auf dem Zimmer gelassen und mir stattdessen das warme Schultertuch unter den Arm geklemmt, was sich als eindeutig falsche Wahl erwies. Im Speisesaal gab es einen riesigen offenen Kamin, der derart stark befeuert wurde, dass ich mich in die wechselhafte Zeit meiner schweißtreibenden Hitzewallungen zurückversetzt fühlte. Ich hätte mich ohrfeigen können. In Momenten wie diesen kam mir mein halbes Leben wie eine endlose Serie verkehrter Entscheidungen vor. Meine Berufswahl, Lehrerin, ein jahrzehntelanges Martyrium, meine Partnerwahl, Alfred, ein jahrzehntelanges Jammertal, meine Liebe zum Garten, ein jahrzehntelanger Kampf gegen Giersch, Fingerkraut und Wühlmäuse – und selbst der von mir angeregte Gesundheitsurlaub unserer Seniorenrunde hatte sich in null Komma nichts als Fiasko entpuppt.
Doch bevor ich tiefer in einen Strudel aus Selbstmitleid und Selbstkritik versinken konnte, stürmte ein Rettungstrupp den Saal.
In perfekter Notfall-Choreografie stülpten sie dem Mann eine Sauerstoffmaske über, legten Infusionen, verpassten ihm mehrere Spritzen, und Sekunden später lag der Patient bereits gut verschnürt auf der Trage und wurde im Eilschritt hinausbefördert.
»Alle Achtung, das waren aber flotte Jungs«, meinte Emma anerkennend.
»Und knackig obendrein. Denen würde ich glatt freiwillig auf die Trage springen.« Bobo leckte sich die grell geschminkten Lippen.
»Ich fürchte, knackige Jungs stehen eher auf Frischfleisch im Minirock, nicht auf Dörrobst mit Alkoholfahne«, hielt Berta mit spitzer Zunge dagegen. Auch meine Freundin und Lieblingsnachbarin besaß die bedenkliche Gabe, gefühlte Wahrheiten so unverblümt auszusprechen, dass es einer verbalen Kriegserklärung gleichkam. Besonders mit leerem Bauch hielt sie viel zu selten den Mund. Im Grunde hatten wir zwar alle den Verdacht, dass Bobo bereits seit Jahren eine heimliche Liebschaft mit hochprozentigen Spirituosen pflegte, aber niemand hatte je gewagt, das auch offen zur Sprache zu bringen. Schließlich hatten wir alle ein paar Leichen im Keller.
Emma etwa hegte insgeheim eine schändliche Zuneigung zu tiefdunkelbraunem Gedankengut. Im hintersten Teil ihres Hofes befand sich ein unterirdisches Gewölbe, in dem seinerzeit unschuldige Kohlköpfe und Salatstauden eingelagert worden waren, die selbst im Winter noch ein paar appetitliche Seiten aufwiesen. Heute hingegen hortete sie dort angeblich jede Menge an ungustiösen Devotionalien aus dem Dritten Reich. Mutterkreuze aus der nahen und fernen Verwandtschaft, einen stets auf Hochglanz polierten Wehrmachtshelm ihres Großvaters, ein Sparschwein voller Reichsmark, Säbel, Dolche, Uniformmützen und angeblich sogar eine gusseiserne, mit Reichsadler und Hakenkreuz verzierte Hitlerbüste, die allerdings bis auf den alten Rauchfangkehrer noch niemand je zu Gesicht bekommen hatte. Was irgendwie seltsam war, denn bekanntlich befanden sich Kamine auf dem Dach, nicht unter der Erde …
Aber bevor ich diesen unerklärlichen Gedanken weiterverfolgen konnte, bekam ich eine Breitseite von Berta ab.
»Sag, träumst du, oder was?«, fuhr sie mich unfreundlicher als nötig an. »Du stehst seit geschlagenen zwei Minuten auf meinem linken Fuß. Und zwar mitten auf dem Hühnerauge.«
Ich sah zu Boden. Sie hatte recht. Betreten platzierte ich mein Bein etwas weiter rechts und konterte: »Na, in dem Fall ist mein Fliegengewicht wenigstens von Vorteil gewesen. Stell dir vor, du wärst dir selbst auf den Fuß gestiegen.«
Berta schnaubte. »Ich mag mir ja manchmal selbst im Weg stehen, aber auf den eigenen Fuß bin ich mir wirklich noch nie getreten.«
»Würdest du gar nicht schaffen«, meinte Bobo, die unseren Disput offenbar mitbekommen hatte, »das ist nämlich gar nicht so einfach. Dafür muss man ein gutes Gleichgewicht besitzen. Und ziemlich sportlich sein.«
»Hört, hört.« Emma bedachte Bobo mit einem abfälligen Blick. »Dann tritt dir das nächste Mal gefälligst selbst gegen das Schienbein, statt mich wie vorhin mit deinen Haxenbrechern zu durchbohren.«
Wenn das in diesem Tonfall weiterging, würden wir uns über kurz oder lang noch die Köpfe einschlagen. Dabei hatte ich unsere Seniorenrunde wirklich gern, und Berta, meine langjährige Nachbarin, war mir fast schon mehr ans Herz gewachsen als Alfred, mein Ehemann. Fred meinte es zwar meistens gut mit mir, aber gut gemeint war noch lange nicht gut gemacht. Um etwas auch zu machen, müsste er endlich seinen Energiesparmodus beenden und sich daran erinnern, nicht nur einen Kopf, sondern auch zwei Arme und zwei Beine zu besitzen. Mit denen man mehr tun konnte, als sie bequem aufs Sofa zu betten. Da war Berta ein ganz anderes Kaliber. Praktisch veranlagt, flott unterwegs, mit einem goldenen Herzen und Nerven aus Stahl, kurz gesagt, eine patente Personalunion aus Kummernummer und Kampfpanzer, jederzeit einsatzbereit, um Freunden aus der Bredouille zu helfen.
Dennoch stritten wir uns, seit der Kellner die Suppe serviert hatte. Ich begann, meine Sichtweise auf fetthaltige Nahrungsmittel zu revidieren. Vielleicht waren Fette nicht nur Geschmacksträger und Gesundheitssaboteure, sondern zugleich auch Friedensstifter. Im ungesättigten Zustand schien Berta jedenfalls mit allem und jedem auf Kriegsfuß zu stehen, wobei das Hühnerauge die Stimmungslage bestimmt noch zusätzlich verschlimmerte. Hätte sie nicht vor unserer Abreise etwas sagen können …? Daheim bewahrte ich stets einen Tiegel mit meiner handgerührten Hühneraugensalbe aus roten Zwiebeln, Schöllkraut, Arnika, einer wirklich mikroskopischen Menge Eisenhut und Lärchenpech auf, da auch mein Mann darunter litt.
Erstaunlicherweise gelang es ausgerechnet Elsbeth, eine Ausweitung der Kampfzone zu verhindern, indem sie mit dem Vorlegelöffel gegen den Wasserkrug schlug, als wollte sie eine Rede halten. Wobei unsere Vorzeigekatholikin ja eher zu Moralpredigten neigte, mit empört erhobenem Zeigefinger und entrüstetem Gesichtsausdruck.
So wie jetzt.
»Ihr solltet euch schämen«, fuhr sie uns an, »zankt euch ununterbrochen herum, während gerade ein Mann gestorben ist. Das ist nicht nur geschmacklos, das ist pietat… piätot… also das ist gottlos.«
Einen Moment lang hielten wir alle die Luft an, dann platzte Bobo als Erste heraus. »Was redest du da? Was für ein Mann?«
»Sag nicht, der Fallsüchtige ist tot?«, wollte Emma wissen.
»Wegen dem Fraß?«, erkundigte sich Berta und schob ihren unberührten Teller ein Stück weiter von sich.
»Woher willst du das überhaupt wissen?«, fragte ich. Man hatte den armen Mann doch noch während seines Anfalls ins kilometerweit entfernte Krankenhaus gebracht. Und als Hellseherin hatte Elsbeth bislang keinerlei Talent bewiesen.
»Ich weiß es von der Ärztin.«
Mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet.
»Wann hast du denn mit der Ärztin gesprochen?«
»Gesprochen? Gar nicht.«
»Einen Brief wird sie dir aber auch nicht geschrieben haben«, ätzte Bobo in gewohnt süffisanter Manier. »Außerdem würde der bei unserer Post eh erst in zwei Wochen ankommen. Da wär das Begräbnis auch schon vorbei.«
»Nun erzähl schon.« Ich rang mir mein mittlerweile etwas eingerostetes Lehrerinnenlächeln ab, das seinerzeit den besonders verstockten Schülern vorbehalten gewesen war. Gerade Elsbeth galt doch als eine der gefürchtetsten Klatschtanten vom ganzen Dorf. Mit ihrer minutiösen Berichterstattung völlig irrelevanter Episoden aus der dörflichen Gerüchteküche konnte sie einem stundenlang am Ohr kleben, aber nun, wo sie im Besitz einer wirklich bedeutsamen Neuigkeit schien, zeigte sie sich wortkarger als ein Baumarktberater.
»Mach endlich, spuck es aus«, wurde sie nun auch von Emma bedrängt, aber Elsbeth sagte noch immer nichts. Vermutlich die Rache dafür, dass Bobo sie bei unserer Ankunft als moralinsaure Betschwester bezeichnet hatte, eine üble Beleidigung, der keine von uns widersprochen hatte. Und wer schwieg, stimmte bekanntlich zu.
Erst Berta brachte sie zum Reden, indem sie ihr provokant unterstellte, zu lange am Weihrauchkessel geschnüffelt zu haben, was ihr die Sinne vernebelt habe.
»Macht vermutlich wenig Unterschied, ob man sich dann einbildet, mit der Jungfrau Maria zu sprechen oder mit einem Mannweib von Ärztin«, schloss sie ihre Überlegungen.
Empört schnappte Elsbeth nach Luft. »Wie kannst du es wagen!«, fauchte sie Berta an. »Auch dir würde es nicht schaden, öfter die Kirche zu besuchen, statt eine Konditorei. Weihrauch macht wenigstens nicht dick.«
Wir rechneten bereits mit einem erneuten verbalen Schlagabtausch, doch zu unser aller Erstaunen senkte meine Nachbarin betroffen den Kopf und murmelte versöhnlich: »Schon gut, war nicht so gemeint. Hast eh völlig recht. Ich war halt neidisch auf dich, weil du was weißt, das wir alle nicht wissen.« Sprach’s und blickte Elsbeth dabei so schuldbewusst an, dass jeder Dackel das Nachsehen hätte. Eine oscarverdächtige schauspielerische Leistung, um die ich wiederum meine Freundin beneidete.
Der Erfolg gab ihr jedenfalls recht, denn endlich begann Elsbeth zu erzählen.
»Ihr wart ja alle damit beschäftigt, euch gegenseitig anzugiften«, berichtete sie mit vorwurfsvoller Stimme, »da habe ich mir halt ein wenig die Beine vertreten und bin durch den Saal spaziert.« Was bei unserer ambulanten örtlichen Nachrichtenzentrale so viel wie »Mission Lauschangriff« bedeutete. »Und dann hab ich auf die Toilette gemusst. Die ist total weit weg, fast am Ende vom Gang, die vorletzte Tür links, also eine fürchterliche Hatscherei, bis man endlich dort ist. Da darfst du keine schwache Blase haben.« Aus ihrem Mund klang es, als hätte sie den Mount Everest bestiegen.
Ich gönnte ihr ein anerkennendes Nicken, Berta und Emma starrten sie erwartungsvoll an, und Bobo hielt ausnahmsweise ihr Lästermaul.
»Ja, und auf einmal ist die Ärztin auch reingekommen. In diesem furchtbaren Bademantel. Immer noch unfrisiert. Und nach Rauch hat sie auch gestunken.« Angewidert rümpfte sie die Nase. »Dabei sollten Ärzte mit gutem Beispiel vorausgehen und nicht daherkommen wie beim Perchtenlauf. Ich –«
»Jaja, sicher, und dann?« Wir wollten es endlich wissen.
»Dann hat das Telefon von dieser … na, von der halt geläutet. Sie hat eine Weile in den Taschen von dem grässlichen Bademantel herumgekramt und ist dann mit dem Telefon am Ohr in einer Kabine verschwunden.« Erneut hielt sie inne.
Bobo betrachtete entnervt ihr glitzerndes Nageldesign.
Emma malträtierte eine kalte Pastinake auf ihrem Teller.
Berta studierte den Wasserkrug, als hätte sie nie zuvor ein derartiges Objekt gesehen.
Ich hüstelte und wünschte Elsbeth insgeheim einen Kurzaufenthalt im Fegefeuer.
Erst nach einer gefühlten Ewigkeit erzählte sie den Rest.
»Zufällig war dann nur noch die Kabine nebenan frei. Und weil sonst alles ruhig war, also keine Musik oder so und keine kichernden Jugendlichen, da hab ich halt zuhören müssen.«
Wir verkniffen uns jedes anzügliche Grinsen. In der Reihe überlebenswichtiger Fähigkeiten kam Hören bei ihr bestimmt noch vor Atmen.
»Jedenfalls hat sie gesagt, dass der Mann gestorben ist. Das hat sie ein paarmal wiederholt. Er ist tot. Immer wieder hat sie das gesagt.« Unvermittelt begann Elsbeths Unterlippe, verdächtig zu zittern. »Und dann hat sie gemeint, dass sie an keinen natürlichen Tod glaubt.«
Jetzt wussten wir es – und bereuten im selben Moment, danach gefragt zu haben.
***
Nachdenklich kehrten wir in unsere Zimmer zurück, die alle nach heilsamen Kräutern benannt waren, und ließen uns schweigend auf die Betten fallen. Elsbeth hatte uns mit ihrem Bericht einen ziemlich bösartigen Floh ins Ohr gesetzt, wodurch die ohnedies bereits recht angespannte Stimmung eine neue, mörderische Dimension angenommen hatte. Ich wollte mir gar nicht vorstellen, welche Konsequenzen es für unseren Aufenthalt haben könnte, sollte unsere Ohrenzeugin richtig gehört haben, doch der bedrohliche Floh hatte sich bereits in meinen Denkapparat verbissen. Mit schlimmen Folgen für meinen Geisteszustand, der umgehend in akute Schwarzseherei verfiel. Vor meinem inneren Auge bauten sich in vorauseilender Panik schon äußerst beängstigende Szenarien auf, um die mich jeder Thrillerautor beneidet hätte.
Ein zischendes Geräusch, so als würde die letzte Luft aus einem Fahrradschlauch entweichen, riss mich aus meinen betrüblichen Gedanken. Es musste Berta sein, die zischte, denn außer einer üppigen Petersilienpflanzung auf dem Fensterbrett sowie drei Glückskastanien neben der Sitzgruppe befand sich niemand im Raum. Und Zimmerpflanzen zischten nicht.
»Was machst du da?«, fragte ich ihren Rücken.
»Ich messe meinen Blutdruck.«
»Warum? Geht’s dir nicht gut?« Was für eine bescheuerte Frage, dachte ich eine Sekunde später.
»Was für eine bescheuerte Frage«, sprach Berta es aus. »Ich kenne niemanden, der seinen Blutdruck aus sportlichen Gründen misst. Oder weil im Fernsehen grad kein guter Film läuft.«
»Hast eh recht«, musste ich ihr zustimmen. »Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich hatte mir unseren Urlaub so schön vorgestellt. Stattdessen läuft von Anfang an alles schief. Jede ist schlecht gelaunt, wir streiten ununterbrochen, sind gereizt, aggressiv, überempfindlich, und dann kriegt man auch noch einen toten Mann zum Abendessen serviert.«
»Einen getöteten Mann, wenn unsere Betschwester sich nicht verhört hat«, betonte meine Freundin. »Diese Fastenkost ist halt wirklich lebensbedrohlich, auch wenn du anderer Meinung bist. Elsbeth hat von Mord gesprochen.«
Allein beim Klang dieses Wortes erreichte auch mein üblicherweise zu niedriger Blutdruck ungesunde Höhen. Immerhin war ich vor etwa zwei Jahren aus meiner beschaulichen Pensionistenidylle in die Fänge einer Massenmörderin geraten. Und das in Oberdistelbrunn, einem Dreitausendfünfhundert-Seelen-Kaff in der österreichischen Provinz, wo außer Wirtshausschlägereien, Vorgartenvandalismus und vereinzelten Zusammenstößen zwischen motorsportlichen Jugendlichen und verkehrsbehindertem Braunvieh so gut wie nichts passierte. Hin und wieder, vor allem nach den Zeltfesten der Feuerwehr, lagen ein paar Schnapsleichen in der Landschaft herum, und während der Gemeinderatswahlen traf man vermehrt auf missionarisch eifernde Politikpropheten, aber mit echten Verbrechen wie in der Großstadt hatten wir kaum zu tun.
Und nun schon wieder ein Gewaltverbrechen. Das fünfte in knapp zwei Jahren. Direkt vor meinen Füßen.
»Ich bin längst allergisch gegen Mord«, jammerte ich. »Mir wird schon schlecht, wenn ich dieses Wort nur höre.«
»Wenn ich mir vorstelle, weitere sechs Tage diesen Fraß vorgesetzt zu kriegen, würde ich eher von Erlösung sprechen«, entgegnete Berta ungerührt, während sie ihre Blutdruckmanschette abnahm und achtlos zusammenknüllte. Dabei murmelte sie etwas, das wie »hundertachtundzwanzig zu neunundsiebzig« klang. Ein angesichts der Umstände hervorragender Wert.
»Sag mal, tut dir der Mann denn überhaupt nicht leid?«, wandte ich mich erneut an ihren Rücken. Gerade meine Nachbarin war einer der mitfühlendsten Menschen, die ich kannte. Ein derart kaltschnäuziges Verhalten passte überhaupt nicht zu ihr.
»Er tut mir leid. Sehr sogar.« Endlich sah sie mich an. »Aber wir tun mir noch mehr leid.« Und bevor ich nachfragen konnte, was genau sie damit meinte, fuhr sie bereits fort. »Wenn Elsbeth recht hat, wurde der Mann umgebracht. Er hat den Löffel also nicht freiwillig abgegeben, auch wenn ich das bei so einer Folterkost nur zu gut verstehen würde. Und genau dann, wenn hier einer unfreiwillig abkratzt, sitzen wir zufällig am Nebentisch.«
Sie stöhnte.
»Daher wette ich drei Cremeschnitten, dass der Tote vergiftet wurde. Weitere drei, dass es nicht bei einer Leiche bleiben wird. Und nochmals drei, dass wir über kurz oder lang wieder mitten in einer Mordermittlung stecken.«
Sie blickte mich herausfordernd an und pfiff erstaunlich treffsicher den berühmten Soundtrack des Films »Leichen pflastern seinen Weg«.
Ich seufzte.
Wenn tatsächlich ein Verbrechen vorlag, dann kam leider wirklich nur Gift in Frage. Ein gezücktes Messer oder eine geladene Schusswaffe hätten wir doch alle bemerkt. Und das Blut sowieso.
In Gedanken sah ich mich bereits beim Konditor anstehen, um Bertas Fettreserven aufzustocken, statt ihr beim Abnehmen zuzusehen, was schlimm genug wäre. Weitere Todesfälle oder gar lebensgefährliche Detektivarbeit mochte ich mir nicht einmal vorstellen müssen. Vor zwei Jahren hatte ich mich ja von Anfang an und gegen alle ärztlichen Einschätzungen in meine Giftmordhypothesen verbissen – und zu meinem Pech hatte sich jede einzelne bewahrheitet. Diesmal versuchte ich es andersrum und verbot mir im Interesse meines ohnedies schon arg ramponierten Seelenheils jeden Gedanken an eine mögliche Fremdeinwirkung.
»Glaub mir, es wird bei einem Toten bleiben«, sagte ich im Brustton geheuchelter Überzeugung. »Und ich werde bestimmt nicht mehr Miss Marple spielen.«
»Aus der Serie ›Berühmte letzte Worte‹«, entgegnete Berta.
Dann flog die Tür zu unserem Zimmer auf, und Elsbeth taumelte herein.
»Helft mir«, stammelte sie. »Es ist etwas Schreckliches passiert.«
***
Zehn Minuten später stürzten wir, eine zitternde Elsbeth im Schlepptau, in Bobos Zimmer.
»Wo ist dein Schnaps?«, brüllte Berta statt einer Begrüßung.
»Schon mal was von Anklopfen gehört?«, erklang Bobos Stimme aus dem Badezimmer. »Ich lieg in der Badewanne. Mit einem Arganöl-Peeling.«
»Lieg weiter. Dich brauchen wir eh nicht, nur deinen Schnaps«, präzisierte meine Freundin.
»Es ist ein Notfall«, fügte ich an.
»Ich hab keinen Schnaps«, erklang es aus dem Bad. »Aber ich hab ein Desinfektionsmittel.«
»Brauchen wir auch nicht. Wir wollen nichts desinfizieren, wir müssen Elsbeth narkotisieren.«
»Ich komme.« Es rauschte. Offenbar stieg Bobo aus der Wanne. Gegen die Neugierde hatte das beste Badeöl keine Chance.
Mit allen verfügbaren Handtüchern umwickelt wie eine Kohlroulade erschien sie Sekunden später im Raum.
»Was ist denn passiert?« Sie starrte erst Berta, dann mich und schließlich Elsbeth an, die sich immer noch zitternd an meinen mickrigen Busen drückte.
»Erst der Alk«, forderte Berta. »Und zwar hochprozentiger. Sie hat schon Paulines Beruhigungstropfen intus, aber« – meine Freundin warf mir einen vorwurfsvollen Blick zu – »die hatte wieder nur ein halb volles Fläschchen mit. Und das war klein.«
Als hätte ich ahnen können, dass ich meine bewährten Beruhigungstropfen aus Melisse, Hopfen, Baldrian und einer winzigen Prise Lerchensporn – bei Erdrauchgewächsen war die therapeutische Bandbreite zwischen Tiefenentspannung und Leichenruhe ja eher gering – im Fünf-Liter-Container benötigen würde.
Wenigstens schien Bobo nun den Ernst der Lage zu begreifen, denn statt weiterhin unnötige Fragen zu stellen, begann sie, ihren riesigen Koffer einhändig Richtung Bett zu schleifen, während sie mit der anderen Hand krampfhaft ihren Badetuchwickel zusammenhielt.
»Da sollte eine Flasche Whisky drin sein«, keuchte sie.
»Wohl eher ein Fass«, kommentierte Berta, nahm ihr das gewichtige Ding aus der Hand, wuchtete es schwungvoll aufs Bett und begann, am Reißverschluss zu zerren.
»Er klemmt«, murmelte sie gereizt.
»Sag, spinnst du? So pass doch auf«, herrschte Bobo sie an, »das ist ein nagelneuer Pegase von Louis Vuitton.«
»Ein verdammter verklemmter Franzose ist das. Mehr nicht.« Berta zerrte unbeeindruckt weiter, doch ein winzig kleines, knallrotes Stück Stoff zwischen den Zähnen des Reißverschlusses leistete hartnäckig Widerstand.
»Wart, ich helfe dir.« Behutsam befreite ich mich aus Elsbeths knöcherner Umarmung, manövrierte unsere verängstigte Gottesanbeterin zum Kopfteil des Bettes und drückte sie mit sanfter Gewalt auf die Kissen nieder.
Dann wandte auch ich mich dem Reißverschluss zu, da Bobo immer noch wie ein rouladenartig gewickeltes Mahnmal der Empörung neben Berta stand und sich mehr um ihren Koffer als um Elsbeth zu ängstigen schien.
Nach zwei abgebrochenen Fingernägeln und minutenlanger Fummelei kriegten wir das Ding wenigstens gewaltfrei auf.
Sofort fiel unser Blick auf das schwarze, seidig glänzende Negligé mit roter Spitzenborte, das zuvor zwischen die Zähne des Reißverschlusses geraten war. Für eine Woche Basenfasten erschien mir das reizende Stück allerdings so unpassend wie ein Abendkleid zur Morgenandacht.
Auch Berta begutachtete das edle Teil mit gerunzelter Stirn.
»Übst du schon für den Krampuslauf?«
»Na und? Zumindest ist es schick«, konterte Bobo. »Was man von deinem Zeltmacher-Outfit nicht behaupten kann.«
Ein explosiver Moment zwischenmenschlichen Dominanzgebarens. Zum Glück entdeckte ich in diesem Augenblick einen Flaschenhals zwischen Bobos Dessoussammlung. Rasch griff ich danach und zog den Whisky hervor.
Old Pulteney, aged 25 years, Single Malt. Die Flasche lag gut in der Hand und schien bislang unangebrochen zu sein. Damit würde ich nicht nur Elsbeth zur Vernunft bringen, sondern auch die beiden Querulantinnen ruhigstellen können. Zumindest kurzfristig.
Und tatsächlich ging mein Plan auf. Nach einer Runde Whisky, den Berta wenig stilgerecht in Zahnputzbechern servierte, was bei Bobo erneut zu größter Entrüstung führte, saßen wir letztendlich doch einigermaßen gesittet um Elsbeth herum. Bobo hatte sich sogar wieder vollständig angekleidet, angeblich aus Rücksicht auf Elsbeths erzkatholische Moralvorstellungen. Ein Vorwand, den ich ihr keinesfalls abnahm. Meiner Meinung nach war es ihr einfach zu umständlich gewesen, einhändig nach der Whiskyflasche zu greifen, um sich nachschenken zu können.
Nach etwa zehn Minuten tat der Alkohol schließlich seine erhoffte Wirkung. Elsbeths Gesichtsfarbe changierte von käsigem Kalk zu käsigen Shrimps, ihre krampfhaft in das riesige Daunenkissen gekrallten Finger entspannten sich, kurz darauf rülpste sie nahezu manierlich, ließ den leeren Zahnputzbecher auf den Boden und sich selbst in Bobos Bett fallen.
Berta und ich atmeten auf. Eine verschreckte Elsbeth war ebenso schwer zu ertragen wie eine moralinsaure Elsbeth.
Unsere zwangsbeglückte Gastgeberin hingegen wirkte weniger erleichtert. Ganz im Gegenteil.
»Ich erwarte eine Erklärung«, fuhr sie uns an. »Und ein anderes Bett. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich mich mit dieser Möchtegernmärtyrerin unter eine – übrigens in dem Fall meine – Decke kuschle!«
Das mit der Schlafgelegenheit war tatsächlich ein Problem. Bobo hatte als Einzige von uns auf einem Einzelzimmer bestanden, da sie ihren Schönheitsschlaf nicht durch senile Bettflüchtige, wie wir es ihrer Ansicht nach waren, gefährden wollte. Behauptete sie zumindest. In Wahrheit ging es ihr wohl eher darum, ihre spirituosige Zweisamkeit vor tadelnden Blicken und gut gemeinten Vorträgen über Leberzirrhose zu schützen. Und erstaunlicherweise befand sich in ihrem Einzelzimmer wirklich nur ein Einzelbett.
Doch damit würde ich mich später befassen. Jetzt klärte ich Bobo erst einmal über den Grund unseres Überfalls auf ihr Promilledepot auf.
»Du siehst, wir haben deinen Whisky einfach aus medizinischen Gründen gebraucht«, schloss ich meinen Bericht. »Zum Betäuben sozusagen.«
Elsbeth konnte von Glück reden, dass wir nicht in der angeblich so guten alten Zeit lebten. Da hatte das normale Fußvolk bestenfalls gepanschten Fusel zur Hand, während die Bessergestellten durch Bilsenkraut, Alraune, Schierling, Opium und Giftlattich ruhiggestellt wurden. Diese lebensgefährliche Mischung tröpfelten die Ärzte auf einen Badeschwamm und drückten ihn dem Narkoseopfer ins Gesicht. Manchmal funktionierte es, und die Patienten schliefen wirklich ein, manchmal nicht, und hin und wieder wachten sie auch nicht mehr auf. Wobei ohnedies nur Wohlhabende in den zweifelhaften Genuss dieses Bamberger Narkotikums kamen. Wer so arm war, dass er sich nicht einmal Branntwein leisten konnte, der wurde einfach ins Koma gewürgt.
»Das erzählst du erst jetzt?« Bobo betrachtete wehmütig ihren halb vollen Becher und meinte: »Da fülle ich Elsbeth mit meinem teuren Whisky ab, wenn ich sie stattdessen auch hätte würgen können.«
Sie nahm einen großen Schluck. »Aber egal. Du willst mir also weismachen, dass diese Hysterikerin heulend zu euch gekommen ist, weil jemand ein kleines Glasfläschchen mit einem Totenkopfsymbol in ihr Zimmer gestellt hat. Und dem Fläschchen giftige Dämpfe entstiegen sind.«
»Nicht nur. Auf dem Nachtkästchen hat außerdem ein Trauerbillet gelegen, hat sie gesagt. So eins zum Aufklappen, das man zum Kondolieren verschickt. Und drin stand etwas von baldigem Wiedersehen im Himmel. Da hat sie Angst um ihr Leben bekommen, weil auch Emma spurlos verschwunden zu sein scheint.«
»Verrückt. Völlig verrückt.« Die schwarze Witwe, wie wir Bobo insgeheim nannten, da ihr sehr begüterter Gatte unter doch recht mysteriösen Umständen verstorben war, nämlich ertrunken in der eigenen Badewanne, obwohl er einen Segelschein besessen hatte, schüttelte zweifelnd den Kopf. »Bevor ausgerechnet Emma spurlos verschwindet, geht eher ein Kamel durchs Nadelöhr. Und was Elsbeths Ängste betrifft: Wer sollte der an den runzeligen Hals gehen außer einer Staubmilbe?« Eilig leerte sie ihren Becher, während sie sich erhob und auch uns aufscheuchte.
»Kommt mit. Ich will mir das selbst anschauen. Außerdem muss ich sowieso irgendwo anders schlafen.«
Rasch stopfte sie einen cremefarbigen Seidenpyjama, ihr Necessaire und die halb geleerte Flasche Whisky in einen Kosmetikkoffer, dessen Ausmaße die eines jeden Kindersargs überstiegen. Danach klemmte sie sich noch eins der Sofakissen unter den Arm und warf einen letzten bedauernden Blick auf ihr belegtes Bett.
»Wenigstens mal Pause von diesem aufdringlichen Lavendelduft«, murmelte sie.
»Das ist Rosmarin«, entgegnete ich, aber da war sie schon zur Tür hinaus.
***
Auf dem Weg vom Rosmarinzimmer zum Minzezimmer ertönte auf einmal das Zwitschern einer Nachtigall. Ziemlich laut, eigentümlich nahe und doch recht ungewöhnlich für die Tageszeit. Es zwitscherte eine ganze Weile, bis ich mich erinnerte, dass mein Neffe mir vor meiner Abreise einen neuen Klingelton auf mein Uralthandy geladen hatte. Sofort fiel mir Alfred ein, mein angetrauter Problemfall. Fred litt unter Diabetes, Bluthochdruck, Krampfadern, Gichtzehen, Hühneraugen, chronischer Naschsucht und einer bedrohlichen Antriebsschwäche. Manchmal fühlte er sich so schwach, dass ihm der Fußweg vom Sofa zum Medikamentenschrank zu weit war, weshalb er statt seiner Tabletten Schokoriegel einnehmen musste, die er stets zufälligerweise und im Dutzend in den Taschen seiner Trainingshosen mit sich trug. Wenn er anrief, was selten genug vorkam, rechnete ich automatisch mit dem Schlimmsten.
Und so war es auch.
»Pauline, etwas Schreckliches ist passiert.« Die gleichen Worte hatte Elsbeth vor nicht mal einer Stunde verwendet.
In Sekundenschnelle fielen mir alle nur denkbaren Katastrophenszenarien ein, in die ein kränklicher, beratungs- wie bewegungsresistenter Vollblutphlegmatiker und mein Neffe, ein abenteuerlustiger schwuler zwanzigjähriger Veganer, mitsamt Hund verwickelt sein könnten. Bei diesem Trio infernal konnte vermutlich nicht einmal »Kevin allein zu Haus« mithalten. Und allein zu Haus waren sie schließlich seit drei Tagen, denn vor unserem Kuraufenthalt hatte ich noch einige Zeit bei meiner alten Tante in St. Ägidius am Schlammbach verbracht.
»Was ist los?«, hauchte ich ins Telefon.
»Vincent trägt seit Neuestem ja einen BH und Damenkleider«, überfiel mich Alfred umgehend mit einer Hiobsbotschaft.
»Waaaaas tut er?« Ich drückte das winzige Telefon noch fester ans Ohr. Entweder sprach mein Gatte im Rausch, wobei er eigentlich kaum trank, oder ich hatte mich fürchterlich verhört.
»Na ja, er kleidet sich halt manchmal wie eine Frau, um sich besser in seine weibliche Seite einfühlen zu können. Behauptet er zumindest.«
Mein Gehirn schaltete in den Panikmodus. Nicht auszudenken, wenn das bekannt wurde. Ganz Oberdistelbrunn würde sich das Lästermaul über uns zerreißen. Mein schwuler Neffe hatte ja schon einmal für Schlagzeilen gesorgt, damals vor zwei Jahren, als er unter Mordverdacht stand. Natürlich war er völlig unschuldig gewesen und mir mittlerweile auch sehr ans Herz gewachsen, aber Frauenkleider? Nein. Das ging entschieden zu weit.
»Das ist ja wirklich schrecklich«, stimmte ich Alfred fassungslos zu.
»Ach, was er anzieht, ist mir im Grunde ja egal. Geschmäcker sind halt verschieden. Aber in der Nacht hat ihm irgendwer seine Klamotten geklaut. Die hingen an der Wäscheleine, und heute Morgen waren sie weg. Einfach gestohlen.«
Ich atmete auf. Ein Hoch auf den Dieb.
»Das ist gut«, entfuhr es mir.
»Nein. Das ist nicht gut. Weil der dumme Bub dann auf seiner Gassirunde mit dem Hund dem Kapplhuber davon erzählt hat. Und der hat zwei Stunden später auf braver Dorfpolizist gemacht und ist nachschauen gekommen. Lokalaugenschein sozusagen.«
Es knirschte an meinem Ohr. Offenbar biss mein Angetrauter gerade von einem Schokoriegel ab. Und das bei seinen notorisch erhöhten Zuckerwerten.
»Ja und?« Wenn die furchtbaren Fetzen fort waren, gab es dort ja eh nichts zu sehen. Dachte ich zumindest.
Aber Fred belehrte mich umgehend eines Schlechteren. »Leider hat sich der Kapplhuber nicht nur umgesehen, sondern auch eine Runde ums Haus gedreht. Und bei den Terrassenstufen hat er sich auf einmal fürchterlich aufgeregt, weil dort angeblich ein paar Gebissstauden stehen. Schlimmes Zeugs wäre das, hat er gesagt, und dass der Drogenanbau bei uns verboten ist und er das eigentlich anzeigen muss.«
Es dauerte einen Moment, bis ich verstand, was Alfred meinte.
»Cannabisstauden? Du meinst Cannabisstauden?«
»Genau. So hat er gesagt. Ich kenn mich ja nicht aus mit dem ganzen Grünzeug bei uns. Aber eine Anzeige brauch ich echt nicht. Außerdem hat der Vincent die Stauden angeschleppt, doch der Kapplhuber ist der Ansicht, dass alles, was bei uns wächst, auch uns gehört und wir dafür verantwortlich sind.« Er biss erneut in den Schokoriegel.
Ich biss mir verärgert auf die Lippen. »Wirf die Pflanzen halt einfach auf den Kompost. Und deinen Schokoriegel gleich mit«, fauchte ich ihn an.
Das war wieder typisch Fred. Lichtjahre vom wahren Problem entfernt. Ein paar lächerliche Hanfpflanzen versetzten ihn in Panik, aber die Vorstellung, wegen eines jungen Mannes in Frauenkleidern zum Gespött der Leute zu werden, verstörte ihn nicht im Geringsten. Wobei die Schande ohnedies nur mich treffen würde, denn Fred ging so gut wie nie unter Menschen.
»Das war doch kein Schokoriegel«, log er mir nun auch noch dreist ins Ohr, »das war eine Selleriestange.« Ich verkniff mir jeden Hinweis drauf, dass er Sellerie garantiert nur aus seinen Kreuzworträtseln kannte, und ließ ihn weiterreden. »Außerdem sind die Töpfe schon weg. Aber der Ordnungswauwau besteht darauf, dass ich trotzdem aufs Revier komme. Ich soll mir mal was Ordentliches anziehen und an die frische Luft gehen, hat er gemeint. Und bei der Gelegenheit endlich die Einverständniserklärung anfertigen wegen der Umbauarbeiten der neuen Nachbarn. Außer uns hätten schon alle unterschrieben. Dabei hab ich die Leute noch gar nie gesehen.«
»Ich auch nicht«, unterbrach ich ihn. »Bislang hat die niemand gesehen. Geh halt einfach aufs Revier und unterschreib. Wo liegt das Problem?«
Ein tiefer Seufzer drang an mein Ohr. »Pauline, ich bitte dich. Das Revier ist gute zwei Kilometer von uns entfernt. Ich hab’s mit den Bandscheiben« – immerhin mal was Neues – »und außerdem keine Ahnung, wo ich was Ordentliches zum Anziehen hernehmen soll.«
Manchmal fragte ich mich, wie es Alfred gelungen war, mich zu finden, da er noch nicht mal seine Hemden im Schrank fand.
»Du schaffst das«, fertigte ich ihn kurzerhand ab und legte zur Sicherheit gleich auf. Seine Probleme würden wir jetzt alle gern haben. Dann betrat ich endlich das Minzezimmer, aus dem wütende Stimmen erklangen.
***
Der Raum unterschied sich nur unwesentlich von unserem, aber das Bild, das sich mir bot, war ein gänzlich anderes. Bobo lehnte teilnahmslos am Fenster, ein Glas Whisky in der Hand, und blickte unbeirrt nach draußen, während Berta und Emma sich wie zwei Sumoringerinnen kampfbereit und hochrot im Gesicht gegenüberstanden.
»Und ich sag dir, der Fleck auf deiner Bluse ist Senf!«, brüllte Berta und griff Emma direkt an den Busen.
»Du spinnst doch!«, brüllte Emma zurück und schlug Berta auf die Hand, »ich hab mich mit diesem komischen Schwammerlpüree angepatzt. Nicht mehr und nicht weniger.«
»Das ist Senf, kein Austernseitlingpüree«, hielt Berta vehement dagegen. »Und jetzt will ich endlich wissen, was du mit dem Senf gemacht hast!«
Fehlten nur noch Pauken und Trompeten, dann wäre der Kampf der Walküren perfekt. Ich warf mich zu meiner vollen Größe von einem Meter neunundfünfzig auf und trat so resolut wie möglich zwischen die beiden Kontrahentinnen. Innerlich fühlte ich mich allerdings wie ein Grashalm zwischen zwei Eichen.
»Was ist hier los?«, blaffte ich die beiden an. »Warum schreit ihr so? Ein Fleck auf der Bluse ist doch kein Kapitalverbrechen. Noch dazu auf der eigenen Bluse. Ich hab mich beim Essen auch bekleckert und trotzdem niemanden umgebracht.«
Keine Reaktion. Berta und Emma schoben mich nahezu zärtlich zur Seite, bevor sie erneut aufeinander losgingen wie zwei Hyänen im Kampf um ein totes Gnu.
Entweder grassierte in diesem Resort eine schwere, hoch infektiöse Gehirngrippe, so eine Art Rinderwahn ohne Rind, also vielleicht ein Pastinakenwahn, oder mit mir selbst stimmte etwas nicht. Verunsichert trat ich auf Bobo zu, die unverändert aus dem Fenster starrte.
»Sag, worum geht’s hier eigentlich? Warum streiten die über Senf? Was ist mit dem Totenkopffläschchen und dem Trauerbillet? Und wo ist Emma überhaupt gewesen, als Elsbeth ihre Panikattacke bekommen hat?«
Langsam, unendlich langsam drehte Bobo sich um. »Komm mit.« Sie ergriff meinen Arm und zog mich ins Badezimmer, wo sie sich auf dem Rand der Wanne niederließ. »Setz dich.« Sie deutete neben sich.
Verunsichert nahm ich auf dem kalten Emaillerand Platz. »Also?«
»Also das ist der Ort des einzig wahren Verbrechens«, stellte sie mit ausdrucksloser Miene fest. »Genau hier wurde eine derart furchtbare Tat begangen, dass der Täter nun die Lynchjustiz riskiert. Er oder, besser gesagt, sie hat übrigens jede Menge Spuren hinterlassen.« Dabei deutete sie mit einer Hand vage in den kleinen Raum.
Ich sah der Hand hinterher, bemerkte allerdings nichts außer ihrem neuen Nageldesign, das in grellbunten Regenbogenfarben glitzerte, sowie einer Ansammlung an Ananas- und Apfelminze, die in bunten Tontöpfen auf dem Fensterbrett standen. Üble Gewächse, fand ich. Sie betörten einen mit ihrem aromatischen Duft, trugen alibihalber ein paar unscheinbare Blüten zur Schau, schmeckten angenehm mild und fruchtig und halfen sogar bei Kopfschmerzen und Verdauungsstörungen. Doch wehe dem, der Minze für ein harmloses Heilkraut hielt. Während man noch an seiner erfrischenden Limonade nippte, hatte sich jedes einzelne Pflänzchen garantiert vertausendfacht und mit seinen unterirdischen Tentakelwurzeln jede andere Pflanze brutal aus dem Beet verdrängt. Und riss man eine mitsamt ihrer Wurzel aus, wuchsen zehn nach. Nein, ich mochte keine Minze im Garten, nur im Topf, wie hier auf dem Fensterbrett. Da waren ihrem Expansionsstreben zumindest unüberwindbare Grenzen gesetzt.
Mehr sah ich allerdings nicht. Von welchen verbrecherischen Spuren faselte Bobo? Da war kein Blut, nirgendwo, es lagen auch keine Stichwaffen herum, Zahnbürsten, Lippenstifte, Puderdosen und Pasten befanden sich penibel geordnet auf der Ablage über dem Waschbecken, die Handtücher schienen unbenutzt, und auf der Klobrille prangte sogar noch die blassrosa Papierschleife als Zeichen einer kürzlich erfolgten Desinfektion.
Entweder ich hatte nicht gut genug geschaut oder unser Schluckspecht zu tief ins Whiskyglas.
»Ich seh nichts«, stellte ich ziemlich gereizt fest.
»Schau auf den Boden. Dort, wo der Duschvorleger liegt«, erwiderte Bobo.
»Was soll da sein? Blassgrüne Fliesen, ein beiger Duschvorleger und etliche Krümel auf dem Boden.«
»Genau. Und diese Krümel hat Berta einwandfrei als Krümel einer Semmel identifiziert, als sie aufs Klo gehen wollte. Gemeinsam mit dem Senffleck auf Emmas Bluse ein eindeutiges Indiz dafür, dass es ihrer Fressfeindin gelungen sein muss, irgendwie eine Wurst- oder Leberkäsesemmel aufzutreiben, die sie dann still und heimlich alleine verputzt hat.« Bobo grinste. »Mehr hat es nicht gebraucht. Berta ist Emma fast an die Gurgel gegangen, so wütend war sie. Sie hat sich persönlich hintergangen gefühlt, Emma als abscheuliche Egoistin beschimpft, von Mundraub und Hochverrat gesprochen und dabei getobt, als hätte man sie nackt in ein Jauchefass gesteckt.«
Es gab Dinge, die absolut unbegreiflich für mich waren. Etwa das, was mir Bobo gerade berichtet hatte. Zwei Rentnerinnen schlugen sich die Köpfe wegen einer Wurstsemmel ein, von der die eine die andere nicht hatte abbeißen lassen. Da kam einem ja die jungfräuliche Empfängnis noch glaubwürdiger vor.
»Ich dachte, es ging um den Giftanschlag auf Elsbeth«, stammelte ich fassungslos. »Also diese Flasche mit dem Totenkopf. Und die Todesnachricht …«
»Ach was. Das hat sich Elsbeth nur zusammenphantasiert. Wobei ich der alten Betschwester gar nicht so viel Phantasie zugetraut hätte. Die gefährliche Flüssigkeit mit den giftigen Dämpfen hat sich als Emmas Fleckenbenzin entpuppt, und das Trauerbillet ist für eine Cousine bestimmt, deren Mann vor Kurzem verstorben ist. Womit die Tragödie um die Wurst das einzige Kapitalverbrechen bleibt.«
»Du meinst also, sie hat sich auch die Sache mit dem Telefonat der Ärztin eingebildet, in dem von Mord die Rede war?«
Bobo begann, an ihren kuhglockenartigen Ohrgehängen herumzufingern. Ein sicheres Zeichen, dass sie angestrengt nachdachte. »Na ja. Dass dieses vogelscheuchenartige Mannweib wirklich telefoniert hat, mag schon sein. Aber sie hat nicht ausdrücklich von ›Mord‹ gesprochen, sondern von ›keinem natürlichen Tod‹. Laut unserer Ohrenzeugin. Meiner Meinung nach hätte sie aber auch ›einem‹ sagen können. Halte ich jedenfalls für wahrscheinlicher. Denn wenn der Mann heute wirklich umgebracht wurde, würde es hier doch vor Polizei nur so wimmeln, oder?«
Das Argument hatte was für sich. Sah man von den beiden verfressenen Furien und Elsbeths eingebildetem Giftattentat einmal ab, ging es im Resort ausgesprochen unaufgeregt zu.
Ich nickte verhalten. »Da magst du recht haben. Außerdem hat die Ärztin bestimmt mehr als einen Patienten. Sie kann über jemand ganz anderes gesprochen haben.«
Bobo ließ endlich von ihren Deko-Kuhglocken ab und blickte mich belustigt an. »Wenn die noch praktiziert, kann ich nur hoffen, dass sie bei der Wahl ihrer Medikamente ein besseres Händchen beweist als bei der Wahl ihrer Klamotten.«
Darauf wusste ich nichts zu sagen, denn umgehend kam mir mein Neffe wieder in den Sinn. Mein Neffe in Rock und Bluse.
»Vincent hat auch ein Kleidungsproblem«, murmelte ich, »er dreht völlig durch.«
»Hängt möglicherweise mit der Ernährung zusammen. Der ist ja auch vegan, oder? Schau dir doch das heutige Theater mal an. Nur weil es weder Fleisch noch Fisch oder Kuchen gibt, zucken die Leute gleich aus. Ich bin langsam davon überzeugt, dass diese fleischlose Fastenkost schuld an den wahren Tragödien der Menschheit ist. Die alten Römer – eine Zeit lang nur Nudeln mit Tomatensoße gefuttert, zack, Untergang des Römischen Reichs. Oder Putin. Womöglich hat ihm der Arzt verboten, täglich drei blutige Grizzlysteaks zum Frühstück zu fressen – zack, schon fällt er bei den Nachbarn ein. Von unseren beiden Kampfkolossen ganz zu schweigen. Einmal Pastinakenpüree und die Fäuste fliegen. Was hältst du davon? Ich finde, meine Theorie ist absolut nobelpreisverdächtig.«
Dass ausgerechnet die Edelzicke unserer Runde mich heute aufheitern würde, hätte ich auch nicht gedacht, aber es war ihr tatsächlich gelungen. Ich musste lachen.
»Eine großartige, eine nahezu bahnbrechende Theorie«, stimmte ich ihr zu. »Preis und Ehrendoktorwürde sind dir sicher.«
Verhalten lächelnd schwiegen wir ein paar Minuten einträchtig nebeneinanderher, bevor mir auffiel, dass ich aus dem Nebenzimmer kein Geschrei mehr hörte.
»Ich denke, wir können wieder reingehen, die zwei scheinen sich beruhigt zu haben«, schlug ich vor. Das Sitzen auf dem Wannenrand kam mir längst wie die Vorstufe zu einem Nagelbrett vor. Es war kalt, unbequem und die Aussicht auf Klobrille und Minztöpfe eher deprimierend.
»Oder sie leben nicht mehr«, sagte Bobo. »Dann hätte ich doch wieder ein Einzelzimmer.«
Aber Berta und Emma erfreuten sich bester Gesundheit und saßen sich freundlich plaudernd gegenüber, so als hätte es nie einen Streit gegeben.
»Na, wieder be-senf-tigt?«, frotzelte Bobo.
»Ach, das war alles nur ein kleines Missverständnis«, konterte Berta betont gleichmütig. »Nichts von Bedeutung.«
»Kommt in den besten Familien vor«, fügte Emma mit übertriebenem Schulterzucken hinzu.
Sekunden später vertieften sich die beiden in ein äußerst unglaubwürdiges Gespräch über die Spanische Wegschnecke. Eine absolute Farce. Ich kam mir vor wie in einer drittklassigen Schmierenkomödie, bei der das Publikum im vorletzten Akt noch immer nicht wusste, was überhaupt gespielt wurde. Fest stand nur, dass meine allerliebste Nachbarin niemals in derart gelassenem Plauderton über ihre Todfeinde reden würde. Immerhin verzehrte sie sich seit Jahren danach, endlich den ersten Platz bei der Prämierung des schönsten Heimgartens von Oberdistelbrunn zu gewinnen. Und das bislang vergebens. Ein Hagelunwetter, eine Hüftoperation, ein mittlerweile verstorbener Hühnerzüchter und daneben noch Invasionen an Maulwurfsgrillen oder Lilienhähnchen hatten ihr jedes Mal einen bösen Strich durch ihr botanisches Meisterwerk gemacht. Dabei besaß niemand im ganzen Ort eine derartige Vielfalt an Pfingstrosen, Ritterspornen und Kaiserkronen, deren offizielle Anerkennung Berta mehr am Herzen lag als jeder Lottogewinn. Allein der Gedanke an Nacktschnecken würde ihr umgehend die Zornesröte ins Gesicht treiben. Emma hingegen brauchte sich erst gar keine Sorgen zu machen. Blumen kultivierte sie nicht, und ihr Nutzgarten glich einer Todeszone für alles, was kein Salatkopf war. Drei Mal täglich schritt sie mit einer großen Schere die einzelnen Beete ab, verbarrikadierte umgehend jedes einzelne Gemüsepflänzchen hinter Kunststoffkrägen, Kupferbändern und Schutzwällen aus Kaffeesatz oder Schneckenkorn und hatte kürzlich sogar vier Kilo Zimtpulver verstreut, was den verbliebenen Schleimern endgültig den Appetit verdarb. Seitdem sah ihr Kohlrabi allerdings ziemlich rostig aus, und die Frühkartoffeln schmeckten nach Weihnachtsgebäck.
Doch von alldem war nun gar nicht die Rede. Berta und Emma sprachen über den Verlauf von Schleimspuren, über Wegnetze und Himmelsrichtungen, Uhrzeiten und Abbiegeverbote. Da war doch irgendetwas im Busch – aber bestimmt keine Schnecke.
»Sag, wo bist du eigentlich gewesen, als Elsbeth wegen deinem Fleckbenzin in Todespanik geraten ist?«, fiel ich Emma brüsk ins Wort. Wobei mich das im Grunde nicht einmal interessierte. Ich wollte einfach keine Ausflüchte mehr hören.
»Ich bin ein wenig herumspaziert. Ist ja nicht verboten, oder?«
Nein. Verboten war es nicht, nur sehr unwahrscheinlich. Es regnete, Emma hatte bereits auf der Herfahrt geklagt, ihren Schirm vergessen zu haben, und das Bedürfnis nach Verdauungsspaziergängen hatte ich von ihr auch noch nie vernommen.
Verärgert murmelte ich ein »Schon gut« und ging.
Wenigstens hatten sich die angeblichen Gewaltverbrechen als Schimäre entpuppt. Dachte ich zumindest …
***