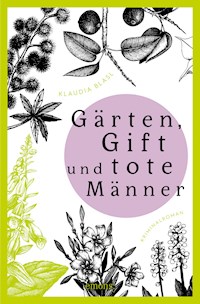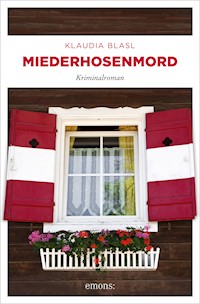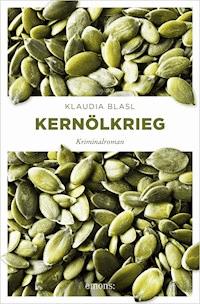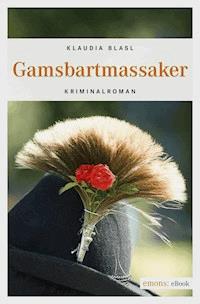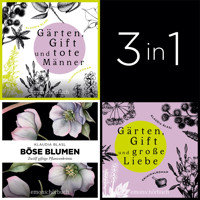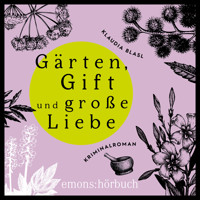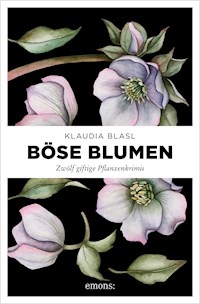
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Herrlich humorvoll und rabenschwarz: botanische Kurzkrimis für Gartenfreunde, GiftmischerInnen und Beziehungsgeschädigte. Sie lieben sich, sie hassen und sie töten sich – mit Alpenveilchen, Christrosen oder Eisenhut denn gegen alle(s) ist ein tödliches Kraut gewachsen, egal, ob ausgediente Ehemänner, alte Widersacher, verhasste Haustiere oder nervende Nachbarn. Wenn böse Menschen die hohe Kunst der botanischen Giftmischerei zelebrieren, wird es mörderisch spannend – bis zum letzten Blatt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaudia Blasl kocht gerne und gut, noch lieber befeuert sie allerdings ihre kriminelle Giftküche. Das Ergebnis dieser Leidenschaft sind spannende Kriminalromane mit schwarzem Humor, bösen Blumen und fiesen Gewächsen. Die Österreicherin lebt und mordet in der Steiermark und dem Südburgenland, wo sie auch einen Giftpflanzengarten betreibt.
www.damischtal.at
Dieses Buch enthält fiktive Geschichten, deren Handlungen und Personen frei erfunden sind. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Die zwölf Pflanzenporträts sind dem Buch »111 tödliche Pflanzen, die man kennen muss« (Klaudia Blasl, emons 2018) entnommen.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/Gannie
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Susanne Bartel
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-507-7
Zwölf giftige Pflanzenkrimis
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Gift übt eine gewisse Faszination aus. Es hat nicht die jähe Brutalität einer Revolverkugel oder einer blanken Waffe.
Agatha Christie
Die Sexualmotive, welche zum Giftmorde führen, verschmähte Liebe, Eifersucht, sexuelle Rache, Abneigung und Hass gegen den Ehegatten, liegen vor allem im weiblichen Gemüte.
Inhalt
Vorwort
Blüte um Blüte, Blatt um Blatt
Röslein rot, Röslein tot …
Post aus dem Jenseits
Stirb durch die Blume
Späte Rache
Alles für die Katz …
From Wellness to Hellness
Die Gänseblümchen-Diät
Verräterische Hortensien
Guerilla Gardening
Ein harter Schlag
www.traumprinz.ade
Vorwort
»Blumen sind das Lächeln der Erde«, hat Ralph Waldo Emerson einst sehr treffend bemerkt. Und ich liebe Blumen. Wenn mein Garten in voller Blüte steht, geht mir die Sonne im Herzen auf. Oft rede ich sogar mit meinen Gewächsen, wünsche dem Bilsenkraut einen schönen Tag, danke den Waldreben für ihren herrlichen Duft und rüge die Rosmarinheide wegen ihres kümmerlichen Wuchses. Manchmal hingegen sitze ich einfach nur schweigend in meinem alten Schaukelstuhl und genieße den Anblick der botanischen Bösewichter.
Andernorts mögen Gartenfreunde ja ihre Freude an Rosen, Tulpen und Nelken haben, mir sind mörderische Gewächse wie Adonisröschen, Akelei, Eisenhut und Zaunrüben allerdings mehr an mein kriminelles Herz gewachsen. Immerhin sorgen diese gemeinen Gewächse nicht nur für ein Lächeln auf Erden, sie können einen durch ihre lebensbedrohlichen Seiten auch ganz schön zum Weinen bringen. Zumindest, wenn »Stirb durch die Blume« angesagt ist.
Bis vor einem Jahrhundert standen Giftmorde ja generell noch hoch im Kurs. In Frankreich gab es sogar einen eigenen »Cour de Poison« (Gift-Gerichtshof), denn bei nahezu zwei Dritteln aller vorsätzlichen Tötungsdelikte war der Übeltäter pflanzlicher Natur. Die Opfer bissen zuverlässig und umweltschonend ins giftige Grünzeug, was durchaus Vorteile hat(te): Man hinterlässt weder Fingerabdrücke noch Blutspuren am Ort des mörderischen Geschehens. Eine saubere Sache sozusagen, ideal für Menschen wie mich, die sich beim Töten nicht gern die Hände schmutzig machen und zudem Wert auf eine »schöne Leich« legen.
Für den perfekten Giftmord bedarf es aber nicht nur böser Blumen und einer noch böseren Phantasie, es braucht auch einen wirklich guten Grund – für die Pflanzen zum Wachsen und für die Opfer zum Sterben.
All das habe ich in den folgenden Erzählungen zu einer spannenden literarischen Reise verwoben, mit erschreckenden Einblicken in die Abgründe der menschlichen Psyche und informativen Ausblicken auf die giftigen Glanzleistungen gemeiner Gewächse.
Egal, ob aus Liebe, Hass, Rachegelüsten oder Hungergefühlen gemordet wird, und egal, ob es Nazi-Schergen, Katzenliebhabern, Hausmütterchen oder Blümchensex-Fetischisten ans Leben geht, die Wurzel allen Übels findet sich stets im Blumenbeet. Denn wozu in die Ferne schweifen, wenn das Böse wächst so nah …
Klaudia Blasl
Blüte um Blüte, Blatt um Blatt
Zärtlich strich Sieglinde Semmelrock dem üppig blühenden Alpenveilchen über die samtigen Blätter, bevor sie es behutsam zurück auf seinen Fensterplatz stellte. Zu ihren Zimmerpflanzen hatte die alte Dame ein sichtlich besseres Verhältnis als zu ihrer Zimmergenossin. Wanda Woppel – ein unmöglicher Name für eine siebzigjährige Speckrolle mit Gichtzehen und einer Neigung zu Extremfürzen – war ihr von Anfang an zuwider gewesen. Grußlos und schwerfällig hatte ihre neue Mitbewohnerin fünf Tage zuvor das kleine Apartment der Seniorenresidenz »Edelweiß« betreten und die schmucken Räumlichkeiten umgehend mit üblen Ausdünstungen gefüllt. Dem Geruch nach zu urteilen, schien dieses Weib sogar zu rauchen. Oder in Bahnhofskneipen zu verkehren. Dennoch verwendete Wanda weder Deodorant noch Duftwasser, was dem Raumklima ganz und gar nicht bekam. Und ausgerechnet mit dieser Person musste Sieglinde sich nun die kleine Wohnung teilen. Bis dass der Tod sie scheide.
Eine schreckliche Sache war das. Mit Wandas Vorgängerin, der ruhigen Hedi, hatte es niemals Probleme gegeben. Hedi war eine echte Dame gewesen, hatte Wert auf Anstand, Ordnung und Sauberkeit gelegt und immer dezent nach Eau de Cologne geduftet. Genau wie sie. Ihre harmonische Zweisamkeit hatte einem Stillleben in Pastellfarben geglichen, mit gedämpfter Salonmusik und Rosinenbrötchen zum Tee. Und während Sieglinde ihr gemütliches Reich – zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Bad – botanisch aufgehübscht hatte, hatte Hedi im Lehnstuhl gesessen und kleine Blümchenunterleger gehäkelt. Doch so still und leise, wie sie gelebt hatte, war sie vor nicht einmal zwei Wochen auch gestorben. Vertieft in ein kompliziertes Muschelmuster in Lavendeltönen hatte sie auf einmal die Nadel fallen lassen, sich ans Herz gegriffen, leise aufgestöhnt und schon war sie tot gewesen. Einfach so.
Für Sieglinde war es weniger einfach gewesen. Der Schock saß ihr noch tief in den porösen Knochen, als die Heimleiterin bereits den Einzug einer neuen Mitbewohnerin ankündigte. Für ein Einzelapartment fehlten Sieglinde leider die finanziellen Mittel, für ein Zusammenleben mit Wanda hingegen die Nerven. Es gab auch absolut nichts, das sie mit diesem Trampeltier gemein hatte, sah man von der gegenseitigen Antipathie einmal ab.
Sieglinde Semmelrock hatte vierzig Jahre lang im Dienst der höheren Bildung gestanden – oder besser gesagt gesessen – und den Nachwuchs der neuen Mittelschule in Sachen Musikgeschichte belehrt. Ein hehres, wenngleich meist sinnloses Unterfangen. Die Jugend hatte damals wie heute mehr Flausen als Dreiklänge im Kopf. Und wen kümmerte schon ein mittelalterliches Madrigal, wenn es Techno Beat gab. Oder Einstürzende Neubauten. Egal, wie inbrünstig die Frau Lehrerin den pubertären Fratzen die akustischen Vorzüge klassischer Musik auch ans Ohr gelegt hatte, ihre schöngeistige Mission war Jahr für Jahr zum Scheitern verurteilt gewesen.
Endlich, an einem wunderschönen Herbsttag vor über fünfzehn Jahren, hatte sie in den Ruhestand treten und dem lautstarken Pöbel für immer den zarten Rücken zukehren dürfen. Und was ein ordentlicher Ruhestand sein wollte, der musste vor allem eins sein, nämlich ruhig. Nur ausgesuchte Kammermusik und Klaviersonaten fanden Gnade vor Sieglindes Ohren. Und natürlich das zarte, nahezu unhörbare Rauschen ihrer innig geliebten Zimmerpflanzen, von denen sie eine Hundertschaft besaß, die dank ihrer hingebungsvollen Pflege prächtig gedieh.
Doch dann kam Wanda. Und Wanda hatte keinerlei Verständnis oder gar Liebe zum Grünzeug. Weder im Topf noch auf dem Teller.
»Wie sieht’s denn hier aus?«, blaffte sie Sieglinde an, kaum hatte sie ihr neues Domizil betreten. Missmutig schob sie sich am prächtigen Fensterblatt vorbei, bedachte den Kolbenfaden mit einem Blick, der wenig Gutes verhieß, und ließ sich schwerfällig auf dem bequemen Fauteuil nieder, was dieser mit einem lauten Knarzen quittierte.
Sieglinde hingegen stöhnte. Das ließ sich wahrlich nicht sehr gut an mit ihrer Mitbewohnerin. Dabei hatte sie als Zeichen ihres guten Willens sogar den Gummibaum, einen besonders schön gezeichneten Ficus tricolor, auf Hochglanz poliert. Mit dunklem Bier, was seinen Blättern sehr gut bekommen war.
Doch Wanda schien kein Auge für die Schönheit der Natur zu haben. Ganz im Gegenteil.
»Ich komm mir ja vor wie aufm Zentralfriedhof«, mokierte sie sich. »Überall Blumen, Kerzen, Krimskrams und dazu noch diese Trauermusik.«
»Das ist Brahms, Sonate für Violoncello und Klavier in e-Moll«, belehrte Sieglinde sie aus alter Gewohnheit.
»Klingt wie Sterben auf Raten«, entgegnete Wanda ungerührt und zupfte mit ihren fetten Wurstfingern achtlos eine Blüte von der herrlichen Orchidee, die auf dem kleinen Couchtisch neben dem Fauteuil stand.
Sieglinde erstarrte. Wie konnte dieses Miststück es wagen, sich an ihrer Cymbidium aloifolium zu vergreifen? Als wäre dieses filigrane Schmuckstück ein banaler Salatkopf. Wo doch jeder Blumenfreund wusste, wie ungemein aufwendig die Pflege einer Kahnorchidee war.
»Was fällt dir ein!«, fauchte sie Wanda entsprechend unfreundlich an und brachte die exotische Schönheit rasch aus der Gefahrenzone, bevor der Fettsack zur Wiederholungstäterin werden konnte.
Dann nahm sie ihren ganzen Mut zusammen, pflanzte sich vor Wanda auf und kreischte: »Wenn du dich noch einmal an meinen Blumen vergreifst, kannst du was erleben.«
»Was’n?«, konterte Wanda völlig ungerührt. Nach fünfzig Jahren Dienst in einer schmuddeligen Bahnhofsrestauration machte ihr nichts mehr Angst. Außer einer Hungersnot. Aber bestimmt kein altes, verhutzeltes Weiblein, das offenbar nicht alle Tassen im Schrank hatte, dafür aber einen halben botanischen Garten auf der Küchenanrichte.
Dass es zu keiner Ausweitung der Kampfzone kam, war allein dem Erscheinen des Hausdieners zu verdanken, der unvermittelt mit Wandas Koffern im Flur stand und zum Abendessen in den Speisesaal rief.
Und da Wanda Woppels häusliche Dreifaltigkeit hauptsächlich aus Essen, Schlafen und Fernsehen bestand, leistete sie dem Ruf umgehend Folge.
Sieglinde hingegen lag ihre neue Mitbewohnerin bereits so schwer im Magen, dass sie keinerlei Appetit mehr verspürte.
Und während Wanda begann, sich im gemeinsamen Apartment zunehmend breiter zu machen, fühlte Sieglinde sich mit jedem Tag weiter ins Eck gedrängt. Ihre unwillkommene Mitbewohnerin besaß nicht nur die Fülle eines ausgewachsenen Walrosses, sondern auch dessen Umgangsformen. Nie kam ihr ein »Bitte« oder »Danke« über die wulstigen Lippen, viel zu selten ein paar verständliche Worte. So wie sie Knödel oder Kuchen nahezu in einem Stück hinunterschlang, so verfuhr sie meist auch mit ihren Sätzen. »Scheissitzir, netzumushaltn, doschwitzmawisau«, grunzte sie gefühlte zwanzig Mal am Tag, und nur, weil sie danach stets die Fenster aufriss, hatte Sieglinde irgendwann verstanden: »Scheißhitze hier, nicht zum Aushalten, da schwitzt man wie Sau«, sollte das heißen. Sie erschauerte bereits bei der Wortwahl, vom kühlen Luftzug ganz zu schweigen. Der tat weder ihr noch ihren Pflanzen gut. Immerhin fehlten ihnen die dicken Fettschichten, die wie maßgeschneiderte Wärmflaschen an Wanda hingen und ihre Schweißdrüsen rund um die Uhr zu Höchstleistungen antrieben. Sieglinde hingegen fröstelte ebenso rasch wie der wunderbare gefüllte Hibiskus oder die selbst gezogene Mimose, die bereits beim leisesten Lufthauch ihre prachtvollen Blüten verloren. Ein Anblick, der der leidenschaftlichen Hobbygärtnerin beinahe das Herz brach. Sie konnte ihren zart beblätterten Schützlingen ja keine Häkeldecke umlegen wie sich selbst, wenn ihr kalt wurde. Und, was weitaus schlimmer war, sie konnte auch Wanda nicht einfach so umlegen, obwohl sie nichts lieber getan hätte.
Dieses Weib war eindeutig ein wandelndes Katastrophengebiet. Es zog wie ein permanentes Sturmtief über alles hinweg, was Sieglinde lieb und teuer war, hinterließ eine Schneise der botanischen Verwüstung und zeigte zudem null Verständnis für den angerichteten Schaden. Das anspruchslose Einblatt, eine biologische Wunderwaffe im Kampf gegen Luftverschmutzung, hatte im Kampf gegen Wandas perfide Bewässerungsstrategie nicht die geringste Chance gehabt. Mehr als einmal hatte Sieglinde ihre Mitbewohnerin dabei ertappt, wie sie ihre dritten Zähne frühmorgens dem Aufbewahrungsbehälter entnahm und die Reinigungslösung, eine Mischung aus Kukident, Apfelessig und Backpulver, vorsätzlich und mutwillig über die arme Spathiphyllum kippte. Primeln, Topfrosen, Narzissen und selbst dem wundervollen Christusdorn erging es wenig besser. Wanda vergiftete sie mit Flüssigkeiten aller Art. Augentropfen, Magenbitter, Zitronensaft – egal. Hauptsache, es tat den wehrlosen Blumen kurzfristig weh und brachte sie langfristig um.
Die Sonnenanbeter auf der Anrichte und dem Fensterbrett hingegen wurden zu einem Schattendasein im Badezimmer verbannt, weil dieses gefühllose Miststück keinesfalls auf die Zurschaustellung ihrer Sammlung an Zinnkrügen verzichten wollte. Und da Sieglinde das einzige kleine Regal in ihrem gemeinsamen Wohnraum mit Schallplatten, CDs, den Biografien berühmter Komponisten sowie der Geschichte der klassischen Musik in zwölf Bänden befüllt hatte, musste sie im Gegenzug Platz für die hässlichen Krüge schaffen. Im Mietvertrag war das Recht auf eine faire Raumaufteilung unter den Bewohnern eindeutig festgelegt. Da half kein Jammern und Lamentieren, nicht einmal der Verweis auf Wandas Körperfülle, die jene der pensionierten Lehrerin um mehr als die Hälfte übertraf und die daher auch weitaus mehr Raum brauchte. Was alles andere als gerecht war.
Um auf die Unerträglichkeit ihrer Situation hinzuweisen, wandte Sieglinde sich sogar an die Heimleiterin.
»So glauben Sie mir doch, Frau Müller-Myrthenberg, meine Zimmergenossin bringt mich noch ins Grab. Diese Frau hat keine Kultur, keine Ordnungsliebe, weder Benehmen noch Anstand, nicht einmal Tischmanieren. Außerdem stinkt sie.«
Wobei Wandas Ausdünstungen in Wirklichkeit schon eher in Richtung Giftgas gingen, fand zumindest Sieglinde.
Sonja Müller-Myrthenberg seufzte. Sie führte ein Pensionistenwohnheim, keine Partnerbörse. Würde sie persönliche Befindlichkeiten über wirtschaftliche Belange stellen, wäre das Haus »Edelweiß« längst wegen Überschuldung geschlossen. Aber das verstanden die Leute nie.
»Schauen Sie, meine liebe Frau Semmelrock«, begann sie schließlich und griff beschwichtigend nach Sieglindes Hand, »ich verstehe ja, dass Frau Woppel nicht ganz Ihrem Geschmack entspricht und gewisse Spannungen bei einer neuen Mitbewohnerin nie auszuschließen sind. Aber ich fürchte, ich kann Ihnen da auf die Schnelle keine Lösung anbieten.«
Nun seufzte auch Sieglinde.
»Sie wissen ja, wir können es uns nicht leisten, ein Apartment zur Hälfte leer stehen zu lassen, da müssten wir Ihnen einen Einzelzimmerzuschlag berechnen, was sicher auch nicht in Ihrem Sinn wäre.«
»Nein, natürlich nicht.«
»Na also.«
Für Frau Müller-Myrthenberg war die Sache damit erledigt, nicht aber für Sieglinde.
»Wäre es nicht möglich, eine andere Mitbewohnerin zu bekommen? Also, ich meine, anstelle der Frau Woppel?« Die Hüterin der Zimmerpflanzen gab nicht auf. Selbst der schwerhörige Opi aus dem ersten Stock, der den Frauen immer an den Hintern grapschte, wäre ihr lieber als Wanda. Der würde sich zumindest nicht an ihren Blumen vergreifen.
Für die Heimleiterin kam so etwas aber gar nicht in Frage. »Wir betreiben doch keinen Partnertausch hier.« Empört schüttelte sie den Kopf. »Was glauben Sie, was hier los wäre, wenn wir ein Wunschkandidaten-System einführen würden? Die Leute würden beim kleinsten Krach einen neuen Mitbewohner fordern.« Tadelnd blickte sie Sieglinde an. »Mit dem Ergebnis, dass alle alle zwei Monate umziehen möchten.«
An Tagen wie diesen bereute es Sonja Müller-Myrthenberg zutiefst, eine Seniorenresidenz zu leiten und keinen Kindergarten. Dort wurden die Plagegeister zumindest am Nachmittag alle wieder abgeholt. Außerdem mochte sie weder die pensionierte Lehrerin, deren ständig wachsende Pflanzensammlung den wöchentlichen Reinigungsdienst zur Verzweiflung brachte, noch sympathisierte sie mit Wanda Woppel, für die der Koch täglich ein Extrafleischgericht zubereiten musste, weil die dicke Kuh sich lautstark weigerte, Gemüse oder gar Obst zu essen. Doch das behielt sie natürlich für sich.
Stattdessen meinte sie: »Meine liebe Frau Semmelrock, zwei Menschen, die sich nicht kennen und die bei uns eine gemeinsame Wohnung beziehen, brauchen erst mal viel Zeit, um sich aneinander zu gewöhnen. Aber mit etwas Geduld und gegenseitiger Rücksichtnahme werden Sie sicher bald bestens miteinander auskommen. Gut Ding braucht eben Weile.« Und mit diesen wenig tröstlichen Worten komplimentierte sie die erschöpfte Beschwerdeführerin resolut nach draußen.
Doch für Weile fehlte Sieglinde die Zeit. Seit Wandas Einzug fühlte sie sich bereits um Jahre gealtert, während immer mehr Blumen unter ihren fürsorglichen Händen wegzusterben drohten.
Das Einzige, was in diesem vergifteten Klima prächtig gedieh, war Wanda. Mit jedem Tag beziehungsweise jeder Kalorie wurde sie noch runder und gesünder. Und schien ungeachtet all der Schnitzelsemmeln, Malakofftorten und Leberaufstrichbrote, die sie ständig vertilgte, weder an Bluthochdruck noch an Diabetes zu leiden. Nicht einmal Sodbrennen oder Magendrücken machten ihr zu schaffen.
Sieglinde hingegen war mittlerweile um zwei Konfektionsgrößen geschrumpft und musste immer öfter zu Beruhigungsmitteln greifen, um einigermaßen durch den Tag zu kommen. Und damit nicht genug. Neben der olfaktorischen Kriegsführung in Form von Extremfürzen begann Wanda eines Tages auch mit der akustischen. Sie hatte ihre Liebe zum Alpenrock entdeckt und drehte das Radio voll auf, sobald eines dieser unsäglich volksdümmlichen Lieder gespielt wurde. Das war doch keine Musik, das war Folter. Selbst die Blumen schienen bei diesem Geschrammel, Gesülze und Gedudel die Blätter einzuziehen, was Wanda natürlich ebenso wenig kümmerte wie Sieglindes leidender Gesichtsausdruck.
Bei ihrer Mitbewohnerin stieß jeglicher Protest auf taube Ohren.
»Geht das nicht vielleicht ein wenig leiser?«, fragte Sieglinde oft.
»Wshschstgsagt?«, murmelte Wanda dann als Antwort, da sie meist den Mund voll hatte. Und fügte noch erklärend hinzu: »Vrschtehnixwegndamusik.«
Klar verstand sie nichts bei diesem Krawall, genau das war ja das Problem. Doch da der Fettsack kein Figurbewusstsein, kein Stilbewusstsein und kein Ordnungsbewusstsein besaß, konnte man auch kein Problembewusstsein erwarten. Geschweige denn einen Lösungsansatz für die angespannte häusliche Situation.
Es mussten noch drei Wochen vergehen, in denen Sieglinde weitere zwei Kilo und vier herrliche Topfpflanzen verlor, bevor sie auf den lang ersehnten Ausweg stieß. Und zwar ausgerechnet in einer alten, abgegriffenen Klatsch-und-Tratsch-Zeitschrift, die sie eines gewohnt unschönen Abends auf der Anrichte entdeckte. Offenbar hatte Wanda ihre Schnitzelsemmel darin eingewickelt gehabt – das Skandalblatt wies Dutzende Fettflecken auf – und das dreckige Stück Papier nach dem Genuss der Semmel einfach liegen lassen. Sie räumte ja nie etwas weg, obwohl Ordnung doch bekanntlich das halbe Leben war. Missbilligend schüttelte Sieglinde den Kopf, während sie mit spitzen Fingern nach dem zerknitterten Magazin griff, um es in den Eimer für Altpapier zu werfen. Dabei fiel ihr Blick auf das Foto eines Weihnachtssterns, neben dem in riesigen blutroten Lettern stand: »Dackel Daisy starb durch die Blume«. Gefolgt von einer warnenden Abhandlung über die vielfältigen toxischen Wirkungen von Pflanzengift mitsamt einer Auflistung von potenziell bösen botanischen Übeltätern, die in nahezu jedem Haushalt zu finden waren. Der tragische Tod des eidgenössischen Dachshundes, der etwas zu lange am Weihnachtsstern geknabbert hatte, ließ Sieglinde zwar ziemlich kalt, doch angesichts der vielfältigen mörderischen Möglichkeiten, die sich ihr unvermittelt auftaten, wurde ihr auf einmal richtiggehend warm ums Herz. Zum ersten Mal seit Monaten.
Wie hatte sie nur so blind sein können, wo die Lösung aller Probleme doch direkt vor ihren Augen lag. Oder besser gesagt auf der Fensterbank stand. Eine schmucke Reihe an scheinbar harmlosen Zimmerpflanzen. Dekorativ anzusehen und tödlich in ihrer Wirkung. Offenbar gab es weitaus mehr pflanzliche Sterbehelfer als Eibe, Oleander und Fingerhut. Doch mit den schlimmen Seiten der Botanik hatte sie sich nie zuvor befasst, immer nur das Gute und Schöne an ihren Ziergewächsen gesehen. Das würde sich von nun an ändern.
Bereits am nächsten Morgen begab sie sich zur öffentlichen Bibliothek, um sich in die Materie einzulesen. Da sie seit Jahren Berge an botanischen Werken, Blumenratgebern und Fachzeitschriften für Gartenfreunde konsultierte, fiel es niemandem auf, dass sie diesmal auch ein paar pharmakologische Bände studierte. Die gesammelten giftigen Schattenseiten der heimischen Flora kamen ihr vor wie ein endloses Heilsversprechen. Es gab doch tatsächlich botanische Killer, die derart giftig waren, dass bereits zwei Gramm für einen Platz auf dem Friedhof genügten. Ein kleiner Spaziergang im Grünen, ein Besuch im Blumenladen, ein Griff zum nächstbesten Blumentopf – angereichert mit genügend Fingerspitzengefühl, Fachwissen und bösen Absichten – und schon würden tödliche Zeiten anbrechen. Zumindest für ihre verhasste Mitbewohnerin.
Mit jeder neuen Seite, in die Sieglinde sich vertiefte, wuchs ihre Zuversicht. Sie erfuhr von Gewächsen, die nicht nur zu Wahnvorstellungen, Durchfallattacken, Schwangerschaftsabbrüchen oder Kammerflimmern führten, sondern sogar das Zeug zum Massenmord hatten. Mit Christrosen etwa wurden einst die Brunnen vergiftet, Dieffenbachien hatten jahrhundertelang als Folterinstrument gedient, Buschwindröschen wurden als Pfeilgift verwendet, und mit dem Wurzelstock der Alpenveilchen hatte man bis vor gar nicht langer Zeit nicht nur ungewollte Leibesfrüchte eliminiert, sondern auch erfolgreich Fischfang betrieben. Dafür hatte man etliche Knollen ins Wasser gehalten, die Tiere wurden durch die Wirkstoffe der Zyklamen betäubt und konnten dadurch mit bloßen Händen gefangen werden.
Jetzt hatte Sieglinde allerdings einen besonders fetten Fisch an der Angel, einen Fisch namens Wanda sozusagen, den sie nicht nur vorübergehend betäuben, sondern auf ewig begraben wollte. Denn – das hatte sie bereits in dieser kurzen Zeit ihres Studiums gelernt – gegen jedes Übel war ein effizientes Kraut gewachsen.
Die zukünftige Giftmischerin wurde immer aufgeregter, die Schmöker, in die sie sich mit wachsender Begeisterung vertiefte, immer dicker. Die Stunden vergingen wie im Flug. Seit ihrer Diplomprüfung als Lehramtskandidatin hatte sie sich den Kopf nicht mehr mit derart vielen Fachtermini und Fremdwörtern vollgestopft.
Sie las über Alkaloide, Saponine und Glykoside, über Pflanzen, die krebserregend waren, Leukozyten zerstörten oder als Neuroleptika eingesetzt wurden, vertiefte sich in Statistiken von Giftzentralen, Fallstudien von Toxikologen und in pharmazeutische Dosierungshinweise und lernte vor allem, verdächtige von unverdächtigen Symptomen zu unterscheiden. Wegen der erwünschten Wirkungen, Nebenwirkungen und Kollateralschäden konnte sie ja weder Arzt noch Apotheker fragen.
Dennoch musste Wandas Tod absolut natürlich erscheinen, das war Sieglinde klar. Kein noch so altersschwacher Kurpfuscher durfte den geringsten Verdacht schöpfen oder gar die Ausstellung des Totenscheins verweigern. Also schieden viele über Jahrtausende erprobte Killerpflanzen leider von vornherein aus. Eine Vergiftung mit Oleander sorgte für blaue Lippen, Tollkirschen, Christrosen und Rainfarn würden die Pupillen erweitern, Seidelbast, Märzenbecher und Akelei dieselben verengen, Herbstzeitlosen konnten Haarausfall verursachen, Efeu scharlachartige Hautausschläge. Und der in Kriminalromanen so beliebte Fingerhut hatte sich im Praxistest leider allzu oft als unzuverlässiges Mittel zum Mord erwiesen, da er heftiges Erbrechen hervorrufen konnte, was eine nachhaltige Wirkung verhinderte. Fazit: viel zu riskant. Sie brauchte eine unfehlbare Methode, einfach in der Handhabung und jederzeit verfügbar.
Es war schon Nachmittag, als sie zum Alpenveilchen zurückblätterte. Davon besaß sie bereits eine beträchtliche Sammlung. Bekannt auch als Schweinbrodt, Erdschwamm oder Gichtapfel, wurden diese dekorativen Primelgewächse seit der Antike als Abwehrzauber, Liebestrank und Abortivum eingesetzt. Heilsam waren die Zyklamen dennoch nicht. Bereits acht bis zehn Gramm der Knolle genügten für einen ebenso raschen wie unauffälligen Tod.
Sieglinde war derart in ihre Machbarkeitsstudien vertieft, dass sie weder Hunger noch Durst verspürte und beinahe die Zeit vergessen hätte. Erst das vorwurfsvolle Hüsteln Mathildas, der Büchereiangestellten, die wie stets unbeweglich an ihrem Tisch saß und ein Kreuzworträtsel löste, holte sie aus ihren Mordphantasien zurück in die Gegenwart. Schnell schob sie die Giftpflanzenbücher zwischen zwei Bildbände über immergrüne Gartenstauden und die wundersame Welt von Dickblattgewächsen ins Regal zurück.
Mathilda, die gerade verzweifelt nach einem Nebenfluss der Wolga mit sieben Buchstaben suchte, nachdem ihr endlich das spanische Wort für Stierkampf eingefallen war, hätte es nicht einmal bemerkt, hätte Sieglinde eine Bauanleitung für ein Atomkraftwerk kopiert. Und abgesehen von der Angestellten sowie ein paar Hausfrauen, die schnell noch ein Kochbuch oder einen Liebesroman ausliehen, hielt sich sowieso niemand mehr in der Bücherei auf, die in Kürze schließen würde.
»Bis zum nächsten Mal, meine Liebe«, säuselte Sieglinde zum Abschied, half Mathilda noch schnell mit Schönberg, dem Erfinder der Zwölftonmusik, aus und trat beschwingt den Heimweg an. Zwischen Stadtpark und Seepromenade trällerte sie sogar ganz leise »So muss allein ich bleiben« aus der »Fledermaus«, obwohl sie Operetten eigentlich gar nicht mochte.
Selbst die kleine Treppe zu ihrem Apartment stieg sie leichter hoch als sonst. Ganz wie Frau Müller-Myrthenberg prophezeit hatte, alles war nur eine Frage der Zeit.
Schon bald würde ihre Mitbewohnerin still und leise vor sich hin kompostieren, während sie und ihre Pflanzen sich endlich wieder entfalten könnten. Sie störte sich nicht einmal mehr an Wandas übler Angewohnheit, ihre dreckigen Schuhe mitten auf dem dunklen Teppich im Flur stehen zu lassen. Wie leicht könnte man da drüberstolpern, sollte das Licht mal nicht funktionieren. Aber egal, Wandas Tage waren fortan gezählt. Selbst die ärgerliche Tatsache, dass dieses fette Weib nach dem Essen in ihrem flauschigen Fauteuil versank, die Beine auf das kleine Blumentischchen daneben legte und eine Stunde lang schnarchte, regte Sieglinde nur noch halbherzig auf. Sie warf einen kurzen Blick auf diese Skulptur aus ranzigem Schweinefett, die wie stets ihren Stuhl okkupierte, hob die Zeitung vom Boden auf und brachte die von Wandas Füßen geknickte Primel in Sicherheit. Danach zog sie sich lautlos ins Schlafzimmer zurück, um sofort mit der Detailplanung ihres mörderischen Vorhabens zu beginnen.
Bereits drei Tage später hatte die Giftmischerin alles vorbereitet. Nun musste sie nur noch warten, bis sich Wanda ihren ersten Morgenkaffee kochte, ein Ritual, das Sieglinde bislang zutiefst verabscheut hatte. Das Walross bereitete den Kaffee ja nicht wie andere Menschen zu, mit einem Filter oder der Kapselmaschine, oh nein. Zuerst musste Wanda frische Bohnen in einer elektrischen Kaffeemühle mahlen, was sich anhörte, als würden Flugsaurier an einer Blechwand entlangschrammen. Dann füllte sie eine rostige Espressokanne mit Wasser, verschüttete unweigerlich einen Teil davon auf dem Boden, löffelte das Pulver in den Filtereinsatz und stellte die Kanne auf die kleine Kochplatte. Während das Wasser in der Kanne zu blubbern begann, schlurfte sie ins Bad, reinigte ihr Gebiss, kippte das widerwärtige Gemisch aus Kukident, Backpulver und Apfelessig über eine der schutzlosen Pflanzen ringsum und kam erst in die Küche zurück, wenn der Kaffee bereits übergekocht war und die Herdplatte geflutet hatte.
»Kafeeammorgnvrtreibtkummaunsorgn«, bemerkte sie dann ein ums andere Mal, schenkte sich eine Tasse der schwarzen Brühe ein und verzog sich auf den Balkon, um das Gesöff zu trinken und dazu mindestens drei Zigaretten zu rauchen. Die Sauerei wegzuputzen blieb Sieglinde überlassen.
Doch an jenem denkwürdigen Montagmorgen war alles anders. Der schreckliche Krach der Kaffeemühle kam Sieglinde süßer vor als alle Sphärenklänge, die Kukidentdusche des Kolbenfadens nahm sie mit einem Schulterzucken hin, und das Überschwemmungsgebiet rund um die Kochplatte legte sie mit einem Lächeln auf den Lippen und nahezu tänzelnd trocken. Dazu summte sie leise »Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen« und warf immer wieder verstohlene Blicke nach draußen, wo Wanda auf dem Balkon stand, ihre schwarze Brühe schlürfte und die Asche der Zigarette achtlos in den Topf mit dem Wandelröschen schnippte. Offenbar hatte sie nichts bemerkt.
Erleichtert ließ Sieglinde den Putzlappen fallen. Zum Leidwesen aller Giftmischer besaß die Wurzelknolle des Alpenveilchens eine ausgesprochen bittere Note. Sie hatte zwar nur ein mikroskopisch kleines Stückchen davon unter das Kaffeepulver gemischt, während Wanda im Badezimmer ihrer minimalistischen Körperpflege nachgekommen war, aber die Angst, dass ihr Anschlag auffliegen könnte, hatte sie nahezu gelähmt. Doch das Glück war eindeutig auf ihrer Seite. Der starke Kaffee, den Wanda schwarz und ohne Zucker trank, schien jeden Beigeschmack zu überdecken.
Der Anfang vom Ende war hiermit getan. Bei einer Dosis von etwa einem halben Gramm pro Tag – acht bis zehn Gramm galten gemeinhin als tödliche Dosis – würde Wanda tatsächlich auf Raten sterben. Dieses furchtbare Weib hatte sich schon viel zu lange einer guten Gesundheit erfreut. Dabei sollte sie, bedachte man ihren Lebenswandel, ihr Ablaufdatum längst überschritten haben. Wanda rauchte wie ein Schlot, verbrachte die Zeit zwischen den Mahlzeiten bevorzugt in einer Art Energiesparmodus, ernährte sich höchst ungesund und besaß die Intelligenz eines Schafwollpullovers. Von ihrer Marotte, sich ständig die Krampfadern blutig zu kratzen, mal ganz abgesehen.
Natürlich konnte Sieglinde bei ihrer aktiven Sterbehilfe nicht auf wissenschaftlich belegte Fallstudien hoffen, aber einige Wochen sollte sich der Verfall von Wanda Woppel schon hinziehen, um keinerlei Verdacht zu erregen. Und wirksam war Cyclamin in jedem Fall. Angeblich galt es selbst in homöopathischen Arzneimitteln ab der vierten Potenz als gefährlich. Nur Schweine waren dagegen immun. Doch Wanda war kein Schwein, sie sah beim Essen nur manchmal so aus.
Danach geschah fünf Tage lang gar nichts. Erst am sechsten Tag machte Wanda einen leicht kränklichen Eindruck, aß nur eine einzige Schnitzelsemmel zum Abendbrot und verspürte keinerlei Lust auf Alpenrockkrawall mit Kartoffelchips. Stattdessen ging sie früh zu Bett und stöhnte im Schlaf. Mehr passierte vorerst nicht.
Dieses leichte Unwohlsein, wie der herbeigerufene Dr. Seidenbart es zwei Tage später bezeichnete, hatte beruhigenderweise keinerlei Auswirkungen auf Wandas Koffeinkonsum. Sieglinde hätte ihr die tägliche Dosis Cyclamin ja nicht intravenös verabreichen oder aufs Schinkenbrot schmieren können.
Nach weiteren zwei Wochen klagte Wanda über ein komisches Gefühl im Bauch, gepaart mit Magendrücken und leichten Schwindelanfällen.
Erneut wurde der Arzt, ganz gegen Wandas Willen, zurate gezogen, und erneut kam nichts dabei heraus außer absurden Dialogen.
»Schauen Sie, Frau Woppel, Sie werden halt nicht jünger. Jetzt kommt die Zeit, wo’s immer wieder wo zwickt und zwackt. Vor allem, wenn man so ungesund lebt wie Sie. Rauchen, Alkohol, fettes Essen, kein Sport, wie lange Ihr Körper das noch aushält, ist fraglich«, meinte der Arzt und klang sogar aufrichtig besorgt.
Wanda zuckte mit den Schultern und schien ernsthaft über seine Worte nachzudenken. Doch dann meinte sie nur: »Also statt ana Malakofftorte an Guglhupf, oda?«
»Frau Woppel, mit seiner Gesundheit scherzt man nicht«, reagierte der Arzt empört. Und mit mir auch nicht, fügte er in Gedanken hinzu. »Sie hören mir jetzt einmal gut zu: Mit Ihrem Herz stimmt etwas nicht. Wahrscheinlich haben Sie auch ein Magengeschwür, jedenfalls starken Bluthochdruck, leichte Darmblutungen, und kurzatmig sind Sie auch. Hört man ja, wie Sie schnaufen. Ich werde also ein großes Blutbild veranlassen, dazu ein ordentliches EKG und wegen Ihrer Magen-Darm-Probleme natürlich auch eine Gastroskopie.«
»Ich brauch ka Gaschtropipi. Und ich brauch schon gar keine depperten Pillen von an Kurpfuscher. Wenn ich was brauch, geh ich ins Bahnhofsbeisl.« Mit einer entschlossenen Handbewegung fegte Wanda die Tablettenpackungen und Pillenröhrchen vom Tisch, die der Arzt bereits auf dem Wohnzimmertisch angeordnet hatte.
Dr. Seidenbart verlor langsam die Geduld. »Da stehen diese alten Weiber eh schon mit einem Fuß im Grab, und dann teilen sie mit dem anderen auch noch Tritte aus«, grummelte er. »Ganz wie Sie meinen«, erwiderte er dann lauter und packte seine Medikamente wieder ein. »Man kann niemanden zu seiner Gesundheit zwingen. Machen Sie ruhig weiter wie bisher, und Sie werden sich wundern, wie rasch so ein Leben zu Ende sein kann.«
Eine Prophezeiung, die sich schon bald erfüllen sollte, wenngleich weniger wegen Wandas ungesunden Lebensstils, sondern vielmehr dank Sieglindes effizienter Sterbehilfe in Form einer täglichen Dosis Cyclamin.
Genau dreizehn Tage lang kämpfte Wanda Woppel weiter gegen die Giftwirkung an, versuchte, Schwindelanfälle, Bauchgrimmen, Durchfallattacken und Muskelschmerzen ebenso zu ignorieren wie alle ärztlichen Ratschläge.
Dann kam der Tag, an dem es Schweinsbraten mit Knödeln gab. Und Schweinsbraten mit Knödeln war Wandas erklärtes Lieblingsgericht. Da durfte sie doch nicht einfach schlappmachen. Oder gar den Soßenlöffel vor dem Nachschlag abgeben. Tapfer verschlang sie zwei Stück Braten, begleitet von vier Kartoffelklößen. Danach wurde ihr schlecht. Mordsmäßig schlecht. Sie murmelte: »Ifühlmitotalbeschissn«, torkelte in ihr Apartment, dann ins Badezimmer und erbrach das ganze gute Essen. Sozusagen ihr letztes Abendmahl.
»Du Ärmste, das ist bestimmt eine Magen-Darm-Grippe, die geht grad überall rum«, suchte Sieglinde sie scheinheilig zu trösten und brühte ihr einen Kräutertee auf.
»Bevoridastrinkbeißinsgras«, erwiderte Wanda und schleppte sich mit vorletzter Kraft ins Bett.
Also trank Sieglinde ihren Tee selbst und beschloss, noch einen kleinen Spaziergang zu machen. Der Tag war schwül gewesen, der Abend lau, und im Park der Seniorenresidenz lauerten keinerlei Gefahren, sofern man tief hängenden Ästen aus dem Weg ging.
Erst gegen zehn betrat sie erneut ihre Wohnung, drehte das Licht an, erblickte Wandas Leiche inmitten einer Lache aus tiefrotem Blut und fiel in Ohnmacht. Eigentlich hatte sie ja um Hilfe rufen wollen, aber Sieglinde hatte den Anblick von Blut noch nie ertragen. Bereits ein kleiner Schnitt in den Finger, eine offene Blase am Fuß, selbst frische Blutwurst brachte sie umgehend um ihr Standvermögen.
Gefunden wurden die beiden kurz darauf vom Erlhofer Schorsch, dem grapschenden Opi aus dem ersten Stock. Der rüstige Witwer kam gerade aus dem Keller, wo er seine Bierdeckelsammlung täglich neu sortierte. Da Sieglinde kollabiert war, bevor sie die Wohnungstür hatte schließen können, waren ihre Beine vom Treppenhaus aus zu sehen.
Erlhofer trat näher, riss die Augen auf und stöhnte: »Jessasmariaundjosef.« Dann schrie er los, laut, schrill und ohne das geringste Verlangen, einer der beiden Damen, die da bäuchlings und wehrlos vor ihm lagen, in den Hintern zu kneifen.
Kurz darauf war im Haus die Hölle los. Außer für Sieglinde, die wieder bei Sinnen war und sich fühlte wie im siebten Himmel. Zwar war sie noch etwas schwach auf den Beinen, aber das würde sich rasch geben. Wanda hingegen würde niemals wieder auferstehen und sich zwischen sie und ihre Pflanzen drängen. Und das Beste daran: Nicht einmal der kleinste Verdacht würde auf sie, die Giftmischerin, fallen. Denn Wanda war nicht durch Cyclamin gestorben, sondern durch ihre eigene Unordnung. Ordnung war halt wirklich das halbe Leben. Vielleicht sogar etwas mehr.
Zumindest Dr. Seidenbart sah es so. Und Sieglinde würde ihm keinesfalls widersprechen.
Seiner Ansicht nach hatte die Tote fast eine halbe Flasche Magenbitter getrunken, die geöffnete Flasche stand als stumme Zeugin der Anklage noch neben dem Bett, wollte dann mit letzter Kraft das Bad aufsuchen und war im dunklen Korridor über ihre eigenen Schuhe gestolpert, zu Boden gestürzt und dabei mit dem Kopf gegen den gusseisernen Schirmständer geknallt.
»Ein wirklich sehr bedauerlicher Unfall«, meinte er und wies Frau Müller-Myrthenberg nachdrücklich auf die Gefahr derartiger Einrichtungsgegenstände hin.
»Außerdem hätte sie längst keinen Alkohol mehr trinken dürfen«, bemerkte er weiterhin und wies die Heimleiterin noch nachdrücklicher auf die Folgen einer allzu liberalen Haltung gegenüber Spirituosen hin.
»Nach dem Abendessen war ihr furchtbar schlecht, wahrscheinlich hat sie deshalb den Magenbitter getrunken. Fetter Schweinsbraten mit Knödeln ist halt keine leicht verdauliche Altweiberkost«, ergänzte Sieglinde, was ihr einen bösen Blick von Frau Müller-Myrthenberg und ein zustimmendes Nicken von Dr. Seidenbart einbrachte.
Dass Übelkeit, Brechreiz, Bauchgrimmen und ein schwankender Gang weder vom Alkohol noch vom Abendessen hergerührt hatten, sondern das alleinige Werk des Alpenveilchens gewesen waren, das kam allerdings nie zur Sprache.
Es war bereits früher Morgen, als endlich Ruhe im Apartment Nummer sechs einkehrte. Auch Sieglinde war todmüde, doch bevor sie zu Bett ging, strich sie dem Alpenveilchen noch zärtlich über seine samtigen Blätter, hauchte ein »Danke« und stellte es liebevoll zurück auf das Fensterbrett.
Alpenveilchen, Cyclamen persicum(giftig)
Fischtod und Pfeilgift
Das Alpenveilchen (egal, ob Zimmerpflanze oder Frischluftgewächs) gilt als Tausendsassa unter den Heil- und Giftpflanzen. Der Wurzelstock, von Plinius in der »Naturalis Historia« als »tuber terrae« (Erdschwamm) bezeichnet, wurde in der Antike als Mittel gegen Schlangenbisse und Milzleiden, als Abwehrzauber, Liebestrank und potentes Abortivum eingesetzt. Im Mittelalter hingegen rührte man bevorzugt Salben aus dem Pflanzenmaterial, um sie auf eiternde Wunden und Geschwüre zu streichen. Was heutzutage als Versuch anmutet, den Teufel durch den Beelzebub auszutreiben, denn der Pflanzensaft des Veilchens kann selbst schwere Hautreizungen hervorrufen. Nur Stiel und Blätter sind relativ harmlos.
Die Giftigkeit von Cyclamin war allerdings schon vor Jahrhunderten durchaus bekannt. So bemerkte etwa der alte Heilkundige Dioskurides zum Alpenveilchen: »Es ist dieses Kraut nicht wol jnnerlich zu gebrauchen / dieweil es in seiner Operation zu viel starck ist: Unnd sonderlich sollen sich schwangere Frauen darfür hüten / dann es der Frucht gar leichtlich grossen Schaden thut.«
Gefeit vor den üblen Nebenwirkungen der Knolle scheinen allein Schweine zu sein. Menschen hingegen werden und wurden bereits durch acht Gramm ins Jenseits befördert, wobei Blattwerk und Wurzel bitter schmecken, sofern sie nicht fein gemahlen im Kaffee landen. Bei Tieren genügt aufgrund der hohen Toxizität eine entsprechend geringere Menge. Nicht umsonst war Cyclamin als Pfeilgift einst sehr beliebt. Und vielleicht sogar ähnlich wirksam wie die Knollen der Pflanze beim Fischfang. Dazu wurde im Mittelmeergebiet der Wurzelstock mit etwas Ton vermengt und ins Wasser gehängt, wodurch die Fische gelähmt und an der Flucht gehindert wurden. So konnte man sie leicht fangen.
Das Gift Cyclamin ist derart stark, dass es angeblich sogar in homöopathischen Arzneimitteln ab der vierten Potenz gefährlich werden kann.
Info: ähnlich der wildwüchsigen Art (Cyclamen purpurascens syn. Europaeum). Auch Erdbrot, Hasenohr, Schweinbrodt, Kreuzwehkraut, Gichtapfel oder Geißkas genannt. Etwa 20 cm hohes Primelgewächs mit unterirdischer Knolle und herzförmigen, langstieligen, duftenden Blüten. Dunkelgrüne Blätter mit heller Zeichnung, Blüten in Weiß, Rosa, Rot oder Lila (Letzteres nur bei der Wildform). Während die Zimmerpflanzen nahezu ganzjährig blühen, ist die Blüte bei der Wildform auf Juni bis September beschränkt. | Inhaltsstoffe: giftige Saponine (unter anderem Cyclamin) | Vergiftungserscheinungen: bei Berührungen Kribbeln der Haut, Reizungen; bei Verzehr ab 0,2 g Knolle toxisch mit Symptomen wie Übelkeit, Durchfall, Blutzersetzung, Kreislaufproblemen, Konvulsionen, Atemlähmung
Röslein rot, Röslein tot …
März 2018, Bad Rosenbrunn, Oberallgäu
Giftanschlag in Thermenhotel fordert Hunderte Opfer +++ Heilendes Wasser brachte Hotelgäste ins Krankenhaus +++ Trinkkur mit tödlichen Folgen +++ Giftmischer versetzt Fünf*-Resort in Panik
So oder ähnlich lauteten die Schlagzeilen an jenem 8. März auf den Titelseiten nahezu sämtlicher Zeitungen. Nie zuvor in seiner mehr oder weniger heilsamen Geschichte hatte das Bad Rosenbrunner Thermalresort für ein derart großes Medienecho gesorgt. Nicht nur im Inland, selbst im benachbarten Ausland schrieben sich die Journalisten über diesen lebensbedrohlichen Vorfall die Finger wund. Wen kümmerten schon die Volkswirtschaft, Regierungsquerelen oder gar der Tag der Frauen, wenn in einem renommierten Thermenhotel ein Giftmischer sein Unwesen trieb.
Exakt hundertdreiundsiebzig Gäste hatten die morgendliche Trinkkur mit derart schweren Vergiftungserscheinungen bezahlt, dass sie ihren Urlaub nun statt auf Wellnessliegen in Krankenhausbetten verbringen mussten. Einem weiteren gesundheitsbewussten Schluckspecht, der offenbar maßlos übertrieben und viel zu tief ins Thermalwasserglas geschaut hatte, hatte der Teufelstrank noch übler mitgespielt. Der Pechvogel ruhte nach einem Zwischenstopp auf der Intensivstation bereits im Leichenschauhaus. Und das, obwohl das Bad Rosenbrunner Heilwasser wegen seiner säurebindenden Wirkung sogar von der Ärzteschaft als ausgesprochen wohltuend für den Magen-Darm-Trakt gelobt wurde. Zwei bis drei Glas dieser fluoridhaltigen Hydrogencarbonat-Chloridquelle pro Tag könnten Stoffwechselleiden lindern, das Immunsystem stimulieren und vitalisierend auf Körper und Geist wirken, hieß es. Über zehn Jahre lang war das auch oft genug der Fall gewesen. Bis ein größenwahnsinniger Massenmörder das Reservoir des Trinkwasserbeckens vergiftet und dem Wellness- und Tourismusbetrieb dadurch einen tödlichen Schlag versetzt hatte.
Binnen kürzester Zeit reisten die meisten der unversehrten Gäste ab, während Heerscharen an sensationsgierigen Pressefuzzis und aufdringlichen Kriminalbeamten in Bad Rosenbrunn einfielen und der beschaulichen Idylle aus dem Fremdenverkehrsprospekt ein jähes Ende bereiteten.
Zum ersten Mal in der langen Erfolgsgeschichte des Bad Rosenbrunner Thermalresorts lag deshalb trotz strahlend blauem Himmel ein dichter Trauerflor über der exklusiven Anlage. Nirgendwo drang die geringste Zukunftshoffnung ans Licht, nirgendwo keimte ein Funken Zuversicht auf. Dieses heimtückische Verbrechen hatte der Bilanz des Unternehmens den Todesstoß versetzt. Schon bald würden die Fremden an anderen Orten fernab dieser toxischen Gefahrenquelle verkehren und mindestens hundert Kilometer Sicherheitsabstand zu Bad Rosenbrunn halten. Nur wagemutige Adrenalinfreaks, denen es an der nötigen Zeit für Andenüberquerungen, Eismeerdurchsegelungen oder ein Survivaltraining in Afghanistan fehlte, würden den Fünf-Sterne-Betrieb in der Hoffnung auf unvergessliche Abenteuer noch frequentieren.
Ein Trauerspiel, dessen katastrophale Ausmaße den Abgasskandal der deutschen Automobilindustrie bei Weitem in den Schatten stellten.
Herbert Hugendünkl, der Inhaber des Thermalresorts, durchlebte angesichts der finanziellen Kollateralschäden dieses Dramas bereits eine existenzielle Grenzerfahrung.
Seit Stunden saß er bewegungslos in seinem feudalen Büro und murmelte in einer Endlosschleife »Wie konnte das nur passieren?« vor sich hin.
Als die ersten Gäste am Frühstückstisch in einer nahezu konzertanten Aktion über Schwindel, Herzrasen und Atemnot zu klagen begonnen hatten, wollte er das noch als harmlose Folge der frühlingshaften Fönwetterlage abtun. Doch der herbeigerufene Kurarzt hatte ihm jede Hoffnung auf atmosphärisch bedingte Befindlichkeitsstörungen geraubt und umgehend Notarzt, Rettung und Polizei alarmiert. Nun lagen hundertdreiundsiebzig seiner insgesamt zweihundertvierundzwanzig Gäste seit zehn Uhr morgens mit Kammerflimmern, Koliken und Lähmungserscheinungen im Kreiskrankenhaus, ein weiterer war seinen schweren Vergiftungserscheinungen bereits erlegen.
»Wie konnte das nur passieren?«, fragten sich aber auch die siebenundvierzig Mitarbeiter des Wellnessbetriebs, die tausendeinhundertdreiunddreißig Einwohner der winzigen Gemeinde im Oberallgäu, die sensationslüsternen Reporter und alle Mitarbeiter des Landeskriminalamts.
Doch die Antwort wusste nur der Giftmischer, und der behielt sie für sich.
»Wie konnte das nur passieren?«, hatte sich natürlich auch der Gebäudetechniker gefragt und das direkt von der unterirdischen Heilquelle gespeiste Trinkwasserreservoir Dutzende Male von ganz oben bis tief unten penibelst untersucht, aber nichts Verdächtiges gefunden. Was wenig verwunderlich war, denn bei Giftstoffen handelte es sich so gut wie nie um leicht sicherzustellende Objekte wie etwa Gummistiefel oder Handfeuerwaffen, die mit bloßem Auge untrüglich zu erkennen waren. Daher hatte das Reservoir weder auf den ersten noch auf irgendeinen weiteren Blick sein giftiges Geheimnis preisgegeben. Außer einer winzigen toten Spitzmaus war das Becken frei von Fremdstoffen jeglicher Art gewesen.
Selbst das umgehend in Auftrag gegebene Wassergutachten hatte kein Licht ins toxische Dunkel gebracht, und die mittlerweile von vielen Einheimischen sowie einigen Boulevardblättern geäußerten abstrusen Hypothesen trugen auch nicht zur Klärung des Vorfalls bei. Da war die Rede von Arsen, Strychnin, Leichengift, Chemtrailspuren, der Strafe Gottes oder Exkrementen von Außerirdischen, angereichert mit ungünstigen Planetenkonstellationen oder bislang unbekannten giftigen Wasserschwämmen, die sich wegen der Klimaerwärmung ein neues Habitat im Bad Rosenbrunner Rohrleitungssystem gesucht hätten. Erst die medizinischen Laborbefunde vom Kreiskrankenhaus beendeten den allgemeinen erkenntnistheoretischen Stillstand.
Der Übeltäter war eindeutig als Helleborus niger – besser als Schnee- oder Christrose bekannt – identifiziert worden, ein todbringendes Gewächs, mit dem man bereits vor Jahrtausenden erfolgreich Brunnen vergiftet hatte und das bis heute nicht mit seinen giftigen Reizen geizt.
Hauptkommissar Schiessl vom Landeskriminalamt München, der mit dem Fall betraut worden war, bekam die verstörenden Befunde als Erster übermittelt.
»Die orale Zufuhr von beträchtlichen Mengen des mit einer Mischung aus Steroidsaponinen, Helleborin, Deglucohellebrin, Bufadienoliden, Protoanemonin und Telocinobufagin versetzten Bad Rosenbrunner Heilwassers verursachte bei den Patienten akute Manifestationen von Bradykardien und Arrhythmien, Erregungszustände der motorischen Hirnzentren, starke Diarrhoen, vereinzelt Anurien sowie negative inotrope Effekte. Zudem zeigte sich die kasuale Symptomatik einer massiven Mydriasis …«
Der Kommissar schüttelte den Kopf, während er die fachärztliche Expertise in dieser ihm völlig unverständlichen Ausdrucksweise las. Am Ende des vierseitigen Befunds stand er knapp vor einem Schleudertrauma, so oft hatte er den Kopf geschüttelt. Kurz kam ihm Goethes »Faust« in den Sinn, in dem es hieß: »Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.« Nur dass er nicht stand, sondern saß. In seinen Augen grenzten die Formulierungen von Ärzten oftmals an intellektuelle Nötigung. Mit diesem Befund konnte er ebenso wenig anfangen wie mit der Relativitätstheorie. Zum Glück hatte er einen Schwager, dessen Sohn Pharmazie studierte und der ihm noch einen Gefallen schuldig war.
Drei Stunden später riskierte auch Herbert Hugendünkl ein veritables Schleudertrauma, denn er konnte einfach nicht glauben, was der Kommissar ihm da gerade zu erklären suchte.
»Ihr Heilwasser wurde mit Christrosen vergiftet, auch bekannt als schwarze Nieswurz, Helleborinkraut, Teufelszahn oder Schneerose«, las Schiessl stolz sein neu erworbenes botanisches Wissen von einem Blatt ab. »Christrosen enthalten gefährliche Herzglykoside, besonders im Wurzelstock. Ich erspare Ihnen die ganzen lateinischen Fachbegriffe, die ohnedies unaussprechlich sind, aber diese Giftstoffe führen zu schweren Herzrhythmusstörungen bis hin zu Kammerflimmern und Herzstillstand, schädigen die Nieren, verursachen starke Erregungszustände, Durchfall, erweiterte Pupillen und kolikartige Magen-Darm-Beschwerden.«
»Das glaub ich einfach nicht«, entgegnete Herbert Hugendünkl. »Sie meinen also, jemand hat versucht, meine Gäste mit einer Blume zu vergiften?«
»Ich meine nicht, ich weiß. Das chemisch-toxikologische Gutachten lässt keine Zweifel am mörderischen Blumengruß im Wasserreservoir. Jemand muss gewusst haben, dass Christrosen bereits in der Antike als eine Art chemischer Kampfstoff genutzt wurden. Doch warum dieser Jemand Ihren Thermalbrunnen mit Unmengen an pulverisiertem Wurzelextrakt versetzt und dadurch einen Menschen getötet und das Leben vieler anderer in Gefahr gebracht hat, das weiß ich leider auch noch nicht.«
Hugendünkl schwieg. Er hatte nicht nur keine Ahnung, er konnte sie auch nicht in Worte fassen. Für derart komplexe Giftmordszenarien waren seine betriebswirtschaftlich trainierten Gedankengänge nicht gebaut. Er wusste nicht einmal, wie diese Christrosen überhaupt aussahen. Blumen interessierten ihn nicht, sie warfen kein Geld ab, nur Blätter. Und die botanische Aufhübschung des Thermalresorts war nun wirklich keine Chefsache, die oblag einzig und allein dem Personal.
Doch plötzlich hatte er eine Idee.
»Haben diese Christrosen etwas mit Religion zu tun?«, fragte er unvermittelt. »Ich meine, könnte es sich vielleicht um ein islamistisches Attentat handeln?«
Hauptkommissar Schiessl riss Augen und Ohren auf. Es erstaunte ihn immer wieder, wie viel kondensierten Schwachsinn selbst gebildete Menschen in Extremsituationen von sich gaben.
»Das halte ich für eher unwahrscheinlich«, versuchte er, Hugendünkl zu beruhigen, »aber wir werden natürlich auch diese Spur verfolgen.«
Das hatte ihm gerade noch gefehlt, ein Verschwörungstheoretiker am gefühlten Arsch der Welt. Als ob die Sache nicht schon kompliziert genug wäre.
»Haben Sie sonst noch einen Verdacht? Hat es bereits früher einmal unliebsame Vorfälle mit Ihrem Heilwasser gegeben? Hegt ein ehemaliger Gast einen Groll gegen Sie? Gibt es Konkurrenten, die über Leichen gehen würden, oder fällt Ihnen sonst noch jemand ein, der Sie in den Ruin treiben möchte?«
Noch einmal schüttelte Hugendünkl entschieden den Kopf. Seit sein Vater vor fast vierzig Jahren den Beherbergungsbetrieb vom Großvater übernommen und ihn vom einfachen Wirtshaus mit Zimmervermietung zum exklusiven Thermalresort ausgebaut hatte, war es, von den Schikanen kleingeistiger Bauaufsichtsbehörden und einem als Hilfskoch getarnten Taschendieb mal abgesehen, eigentlich nie zu unschönen Vorfällen gekommen. Zumindest konnte er sich nicht daran erinnern. »Ich werd mal mit meinem Vater sprechen«, antwortete der Direktor ausweichend und dachte schon mit Schrecken daran, was ihm blühte. Hubert Hugendünkl litt seit dem Tod seiner Frau an Alzheimer. Jede Unterhaltung mit ihm war so zielführend wie drei Runden im selben Kreisverkehr. Und dessen Vater, also Herberts Großvater, der gleichfalls noch lebte, war längst Opfer einer altersbedingten Senilität geworden. Die Chancen auf erhellende Erkenntnisse aus der Vergangenheit standen demnach denkbar schlecht.
»Machen Sie das. Die Vergangenheit wirft oft lange Schatten«, ermunterte ihn der Kommissar, ohne zu wissen, wie recht er damit hatte.
September 2017, Tucson, Arizona
Grandma Carolyn war tot. Vor genau einer Woche war sie gestorben, hatte abends einfach die Augen geschlossen und war morgens nicht wieder aufgewacht, und zwar kurz vor ihrem einundneunzigsten Geburtstag. Dass sie der Tod so ganz ohne Leiden und Schmerz ereilt hatte, betrachtete Jennifer mittlerweile als ausgleichende Gerechtigkeit. Grandma hatte ohnedies fast ihre gesamte Jugend in der Hölle verbracht. Doch weil die betagte Dame zeit ihres Lebens kein einziges Wort über jene Gräueltaten in der Alten Welt verloren hatte, erfuhr Jennifer erst nach ihrem Tod durch eine alte Aktenmappe aus brüchigem Leder von den unfassbar schrecklichen Ereignissen, die Carolyn, damals noch Karoline, in jungen Jahren durchlebt hatte.
Poor Grandma, barbaric Germans, just terrifying, befand die Enkelin jetzt und griff zum wiederholten Mal nach dem inhaltsschweren Ordner, der ihr bei der Durchsicht von Grannys Habseligkeiten vor drei Tagen in die Hände gefallen war. Mit der dunklen Mappe unterm Arm betrat sie ihren gepflegten Garten hinter dem Bungalow und ließ sich in der knarzenden Hollywoodschaukel mit den rosafarbenen Sitzkissen nieder. Der ausladende Mesquitebaum spendete kühlen Schatten, in allen Farben schillernde Kolibris umschwärmten feuerrot blühende Königskronen und Monarden, in der Ferne heulte ein Kojote, und Jennifer blätterte erneut durch Grandmas grauenvolle Geschichte.