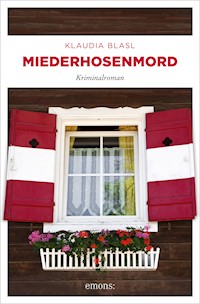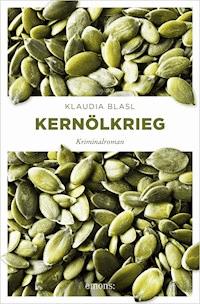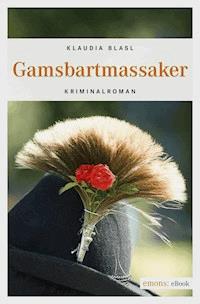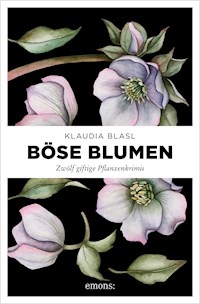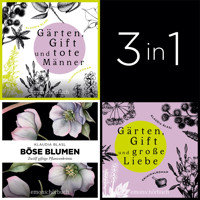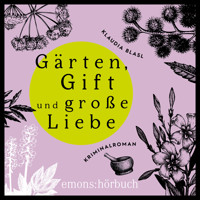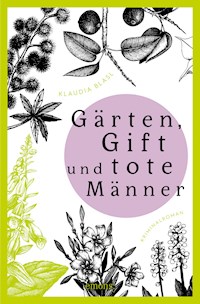
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Berta und Pauline ermitteln
- Sprache: Deutsch
Zwei Hobbygärtnerinnen auf der Jagd nach Maulwurfsgrillen, Meuchelmördern und dem Mann fürs Leben. Im idyllischen Oberdistelbrunn geht ein Giftmischer um. Seine mörderische Bilanz: eine nüchterne Alkoholleiche, ein Pfarrer in Teufels Küche und zwei Tote auf der Gartenschau. Während die Polizei auf der Stelle tritt, verfolgen zwei Pensionistinnen mit grünem Daumen und schwelender Ehekrise eine gefährliche Spur – und legen sich statt mit Maulwurfsgrillen erstmals mit einem echten Mörder an …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman mit frei erfundenen Handlungen und Personen. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Die Pflanzenporträts wurden dem Buch »111 tödliche Pflanzen, die man kennen muss« (Klaudia Blasl, emons 2018) entnommen.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, unter Verwendung eines Motivs von shutterstock.com/Yevheniia Lytvynovych
Abbildungen im Anhang: shutterstock/NINA IMAGES (Bilsenkraut), shutterstock/Yevheniia Lytvynovych (Eisenhut), shutterstock/Bodor Tivadar (Mohn)
Lektorat: Dr. Marion Heister
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-895-5
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Misstraue der Idylle,
sie ist ein Mörderstück,
schlägst du dich auf ihre Seite,
schlägt sie dich zurück.
Sah ein Knab ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden,
war so jung und morgenschön,
lief er schnell, es nah zu sehn,
sah’s mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
Knabe sprach: Ich breche dich,
Röslein auf der Heiden!
Röslein sprach: Ich steche dich,
daß du ewig denkst an mich,
und ich will’s nicht leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
Und der wilde Knabe brach
’s Röslein auf der Heiden;
Röslein wehrte sich und stach,
half ihm doch kein Weh und Ach,
mußt’ es eben leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
Also mir hat Tschül Wern überhaupt nicht gefallen«, merkte die dicke Emma bei unserem abendlichen Lesezirkel an, während sie sich ungeniert die größte Zimtschnecke zum Kaffee griff. Und das bei ihrer Figur. Missbilligend neigte ich ein wenig den Kopf, während Bobo, aufdringlich geschminkt und schmuckbehangen wie ein Christbaum, zustimmend nickte.
»Mich hat er auch nicht gerade vom Sofa gerissen«, pflichtete sie Emma bei. »Ich meine, in achtzig Tagen um die Welt zu reisen, das wäre heute ein Kinderspiel, aber damals ist sich das zeitlich bestimmt nicht ausgegangen, da fuhr man ja noch mit Segelschiffen herum.«
Bobo, die als Einzige im ganzen Ort einen knallroten Sportwagen besaß, dem sie mehr Pflege hatte zukommen lassen als ihrem früh verstorbenen Gatten, schüttelte zweifelnd den Kopf. Für sie galt wahrscheinlich alles unter hundert Kilometern pro Stunde schlichtweg als Stillstand.
»Fogg und Passepartout mussten die Welt ja nicht mehr entdecken, sondern nur noch drum rumfahren«, erwiderte Pater Ägydius verärgert. Der Herr Pfarrer hatte Jules Vernes’ Hauptwerk vor zwei Wochen zur gemeinsamen Lektüre vorgeschlagen, wohl in der Hoffnung, unserem provinziellen Geist neue Horizonte zu eröffnen. Dabei litten die meisten von uns schon unter Jetlag, wenn sie nur nach Wien in die Hauptstadt mussten.
»Ohne Navi echt eine beachtliche Leistung«, warf nun auch die erzkatholische Elsbeth ein, die ohnedies nicht an Büchern interessiert war, sondern nur am neuesten Tratsch, »mein Mann findet nicht mal das Klopapier im Supermarkt.«
»Alfred scheitert sogar an der Suche nach der Butter fürs Brot«, erzählte ich, »und das in den eigenen vier Wänden.«
»Ich hab meinen Hubsi vorgestern um Petersilie in den Garten geschickt«, berichtete Emma. »Und was bringt er mir, Karottenkraut. Das muss man sich vorstellen, der hat doch glatt den ganzen Möhren das Grünzeug abgerissen, dabei hab ich eine riesengroße Kräuterspirale. Mit Beschriftung.«
Rasch langte sie nach dem letzten verbliebenen Nusskipferl.
»So gesehen ist es total schwer vorstellbar, dass ausgerechnet ein Mann Amerika entdeckt haben soll«, bemerkte Bobo, die einzige Witwe unter uns.
»Das war eh reiner Zufall«, stellte Elsbeth fest, während sie eins ihrer silbergrauen Lockenwicklerlöckchen in Form zupfte, »wenn ich mich recht erinnere, wollt er ja ganz woandershin.«
Zum Thema »Männer und ihre Suchfunktion« wussten offenbar alle Frauen was zu sagen.
Das konnte ja richtig heiter werden, dachte ich und lehnte mich auf Elsbeths altersschwachem Biedermeiersofa zurück. Das gute Stück hatte bestimmt noch ein paar Jahre mehr auf dem abgewetzten Buckel als ich. Doch kaum hatte ich es mir einigermaßen bequem gemacht, um entspannt den launigen Ergüssen unseres pseudoliterarischen Quintetts zu folgen, fragte Bobo den Pater allen Ernstes, wie er denn eigentlich Gott gefunden hatte, wo die Wege des Herrn doch bekanntlich auch recht verschlungen waren.
Und schon war die entspannte Stimmung wieder dahin.
Pater Ägydius warf Bobo einen Blick zu, der wenig mit Nächstenliebe zu tun hatte.
»Meine Liebe, es gibt verschiedene Wege, Gott zu finden. Auf dem einen rast du mit deinem roten Rennwagen dahin. Über kurz oder lang wirst du damit auf direktem Weg zu unserem Herrn gelangen.«
Er nahm einen großen Schluck Tee, dann fuhr er mit zunehmend lauterer Stimme fort: »Den anderen bin ich gegangen. Den gemächlicheren Weg. Zu Fuß und von nichts getrieben als einem offenen Herzen und tiefem Glauben. Der Weg war verschlungen, das stimmt, doch ich ging ihn voller Zuversicht, denn in der Bergpredigt steht geschrieben: ›Bittet, und ihr werdet erhalten. Suchet, und ihr werdet finden. Klopfet an, und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer suchet, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft.‹«
Es klopfte.
Beinahe synchron hielten wir den Atem an.
Es klopfte erneut.
Pater Ägydius räusperte sich.
Elsbeth schielte zur Tür.
Emma starrte ein Punschkrapferl an.
Bobo blickte zum Geistlichen und bemerkte betont süffisant: »Vielleicht steht ja Ihr Chef vor der Tür.«
Ich sagte: »Herein.« Göttliche Erscheinungen und teuflische Gestalten pflegten bestimmt nicht anzuklopfen – und der Gansterer Gustl torkelte ins Zimmer. Seine weit aufgerissenen Augen und der kalkweiße Teint verliehen ihm tatsächlich etwas Gespenstisches, auch wenn der eigenbrötlerische Bauer vom Hof nebenan jetzt ganz bestimmt kein Wesen aus dem Jenseits war. Er hielt sich nur allzu oft im dunklen Weinkeller auf.
»Herr Pfarrer, Sie müssen mitkommen, mein Franzl ist tot, und die Christl wird’s auch nicht mehr lang packen«, stammelte er mit schwerem Zungenschlag.
»Jetzt setz dich erst mal hin, mein Sohn, und erzähl«, suchte der Pater den aufgeregten Gustl zu beruhigen und wies auf den leeren Stuhl neben sich.
Der Bauer stand aber nur mit hängenden Schultern da und schwankte von einem Bein aufs andere.
»Ich kann doch nicht einfach hier sitzen, wenn mir daheim die Christl krepiert«, lallte er. »Wo eh schon der Franzl tot ist.«
Verzweifelt raufte er sich seine fünf verbliebenen Haare. Ich kramte schon mal vorsorglich, im Grunde sogar fürsorglich, nach einem Taschentuch. Gustl sah aus, als würde er jeden Moment in Tränen ausbrechen. Der Mann trank einfach zu viel, das war schlecht für die Nerven und sein Standvermögen.
»Aber ich verstehe nicht ganz, vom wem in Gottes Namen redest du denn?«, fragte der Herr Pfarrer und legte seine Stirn in Plissierfalten.
Eine berechtigte Frage, da der Gustl weder Kinder noch Geschwister hatte, noch nicht mal einen Hund.
»Von meinen Sperbern natürlich. Acht Jahre lang hab ich die zwei schon gehabt, ein biblisches Alter, und die hätten bestimmt noch ein paar Jahre gelebt. Und jetzt ist der Franzl tot, und die Christl liegt im Sterben. Und niemand kann was tun. Nur Sie.«
Nun brach der Gustl wirklich in Tränen aus, rasch reichte ich ihm ein Taschentuch. Dass der Mann Greifvögel hielt, war mir neu. Und aus dem Mienenspiel ringsum zu schließen, allen anderen auch.
»Das sind so was wie Adler, nur kleiner, oder?«, erkundigte Elsbeth sich und blickte fragend in die Runde.
Ich nickte, Emma auch, der Pfarrer fuhr sich über seine plissierten Stirnfalten, und Bobo betrachtete andächtig ihr grünblaues Nageldesign. Mit fliegenden Raubtieren hatten wir eben so wenig Erfahrung wie mit flennenden Männern.
»Ich red von meinen Hühnern«, brachte der Gustl endlich ein wenig Licht in unseren geistigen Dämmerzustand. »Landhühner, eine ganz seltene Rasse, total stark vom Aussterben bedroht.«
Er schniefte erneut, hielt sich aber zumindest das Taschentuch an die Nase. »Und wenn s’ mir alle sterben?«, fragte er weinerlich, schlug sich die Hände vors Gesicht und verlor dabei fast das Gleichgewicht.
Mein Blick fiel auf seine Handrücken. Sie waren übersät von kleinen blutigen Wunden, die aussahen, als hätte sein Federvieh ihn im Todeskampf noch mit Hunderten Schnabelhieben traktiert.
»Und jetzt gibt’s noch weniger. Weil meine tot sind, also der Franzl ist schon tot, die Christl …«
Er knüllte das Taschentuch zusammen, warf es achtlos auf den Boden und stolperte auf den Pfarrer zu, der instinktiv zurückwich.
»Saufkopf«, flüsterte Elsbeth und bückte sich mit spitzen Fingern nach dem zerknüllten Taschentuch. Dabei bemerkte sie die blutigen Spuren, die Gustls zerkratzte Hände an ihrer auf Hochglanz polierten Messingtürschnalle hinterlassen hatten. »Ich hol nur schnell ein Desinfektionsspray«, knurrte sie, »womöglich haben die Viecher ja Aids, die Hühnergrippe oder gar Corona.«
Emma legte den angebissenen Kirschplunder zurück auf den Teller und meinte: »Mach dir keine unnötigen Sorgen, du bist gegen Grippe geimpft, du bist gegen diese neue Lungenpest geimpft, und Aids braucht Jahrzehnte, bis es ausbricht, da bist dann eh schon hundert.«
»Wie tröstlich«, fauchte Elsbeth, die sich aus ihrer Zeit als Krankenpflegerin eine schlimme Phobie vor Viren und Bakterien bewahrt hatte.
»Ich wollte dich doch nur beruhigen«, seufzte Emma und nahm den Plunder wieder an sich.
Inzwischen hatte der Gustl den Pfarrer am speckigen Revers seines abgetragenen Gehrocks ergriffen und nuschelte flehentlich: »Kommen Sie mit. Nur noch Sie können mir helfen. Sonst kratzen mir alle ab.«
Er zitterte am ganzen Körper und zog lautstark, nahezu bedrohlich, die Nase auf. Ich suchte vergeblich, ihm ein neues Taschentuch aufzudrängen. Warum hatte ich meine selbst gemachten Beruhigungstropfen aus Melisse, Hopfen, Baldrian und einer winzigen Prise Lerchensporn – bei Erdrauchgewächsen musste man höllisch bei der Dosierung aufpassen, da der Unterschied zwischen Tiefenentspannung und Leichenstarre oft nur ein paar Gramm betrug – auch nicht eingesteckt? Die hätte ich jetzt gut brauchen können. Im Unterschied zu Blasenpflastern, Mullbinden und Fusselroller, die ich stets mit mir herumschleppte. Gustl schniefte erneut, während seine Gesichtsfarbe rapide von totenbleich zu bluthochdruckrot und wieder retour wechselte. Dennoch war ihm offenbar kalt, denn wie im tiefsten Winter schlug er ständig seine Arme um den Oberkörper. Mir schien, als könne der arme Mann sich kaum noch auf den Beinen halten.
»Bitte.« Verzweifelt zog er den Pfarrer am Revers.
»Aber ich bin doch kein Tierarzt«, entgegnete der.
»Der Viechdoktor war eh schon da, der hat mich ja zu Ihnen geschickt.« Schweiß tropfte ihm von der Stirn.
»Warum zu mir? Soll ich vielleicht für die Hühner beten?«
»Oder ihnen die Letzte Ölung erteilen«, warf Bobo höchst blasphemisch ein.
»Nein, verdammt noch mal, nein!«, brüllte Gustl unvermittelt los, »Sie sollen ihnen den Teufel auschtreiben. Der Viechdoktor hat gemeint, so durchgeknallte Hühner hat er noch nie geschehen, da muss der Teufel seine Hand im Spiel haben. Er kann da nichts mehr machen, kein Mittel hat gewirkt. Nicht einmal die Schp… Schp… Schpritzen.« Hektisch schnappte der Bauer nach Luft und zog seinen löchrigen Janker noch enger um sich. Vor lauter Aufregung hatte er auch noch zu stottern begonnen. Sein Gebrabbel war kaum mehr zu verstehen. »Die Hennen t… t… taumeln und g… g… gackern herum wie die Irren, p… p… picken sich gegenseitig b… b… blutig, und der Franzl ist nach zwei Sch… Sch… Schtunden D… D… D… Dauerk…k…krähen t… t… tot vom M… M… Misthaufen gefallen. M… m… mit Schaum vor dem Sch… Sch… Schnabel.«
Fassungslos starrten wir einander an, der Pfarrer bekreuzigte sich. Exorzismus auf dem Geflügelhof. Und das in Oberdistelbrunn. Eine Weltsensation. Zumindest für uns.
Elsbeth brachte die allgemeine Erregung auf den Punkt, als sie beinahe euphorisch verlauten ließ: »Ich hab’s ja gleich gewusst. Wozu achtzig Tage mit einer faden Weltreise vertun, wenn bei uns daheim in acht Minuten mehr passiert.«
Was natürlich völliger Humbug war. In einem Kaff wie Oberdistelbrunn hatte es garantiert seit Jahrhunderten keine weltbewegenden Ereignisse mehr gegeben. Hier im Hoheitsgebiet der Kartoffelknödel fiel ja noch nicht einmal der berüchtigte Sack Reis um. Und da unser beschauliches Dorf fernab von touristischen Trampelpfaden oder kommerziellen Handelsrouten am österreichischen Arsch der Welt lag, riss es auch nichts und niemanden aus seinem Dornröschenschlaf. Kurz gesagt, das Leben in Oberdistelbrunn verlief so unspektakulär und unaufgeregt wie in Tausenden anderen Provinznestern auch, egal, ob diese in Bayern, Brandenburg oder dem Burgenland lagen.
Insofern glich Gustls dramatischer Auftritt in seiner epochalen Bedeutsamkeit nahezu dem Untergang des Weströmischen Reichs. Zumindest für uns. Und dagegen hatte Literatur definitiv keine Chance mehr.
»Stimmt, besessene Hühner hat nicht mal der Jules Verne gesehen«, ätzte Bobo. »Gack, gack, gack, kikerikiii.«
Diese Frau hatte die Peinlichkeit zur Kunstform erhoben.
Pater Ägydius würde mit einer Teufelsaustreibung wohl mehr Erfolg beschieden sein als mit seinem hehren Versuch, unserem Lesezirkel die Klassiker der Weltliteratur nahezubringen, dachte ich gerade, als Gustl seine blutverkrustete Hand vom Revers des Pfarrers löste und stattdessen nach dem priesterlichen Gehstock griff.
»At…t…t…tacke«, schrie er los und schwang den Stock bedrohlich in Richtung Sofa. Ich zuckte zusammen, Emma, die neben mir saß, ließ vor Schreck sogar die Kokosmakrone fallen, in die sie gerade gebissen hatte.
»Gott steh mir bei«, kreischte der Pfarrer und bekreuzigte sich erneut, als der Stock zischend auf ihn zielte. Elsbeth hatte in vorauseilender Vorsicht bereits den Kopf eingezogen und Bobo zur Verteidigung nach ihrer Hardcoverausgabe von Jules Verne gegriffen.
Immer wilder durchfurchte Gustl in seinen Scheingefechten die Luft, es sah aus, als wolle er eine Horde Flugsaurier in die Flucht treiben. Zudem stieß er unartikulierte Kampfschreie aus, die mindestens ebenso bedrohlich wirkten.
»Aargghh.« Mit schrecklich verzerrtem Gesicht wirbelte er den Stock hoch über sich und schlug beinahe den kostbaren kristallenen Kronleuchter vom Plafond.
»Aargghh«, japste nun auch Elsbeth, wenngleich um vieles leiser.
Der Kronleuchter schwankte, Gustl stolperte vor und zurück, wir wagten kaum, zu atmen.
Auf einmal ließ der tobende Bauer die geschnitzte Gehhilfe fallen und torkelte auf uns zu.
»D… D… Durscht«, stöhnte er, griff sich mit beiden Händen an seinen Janker und riss ihn mit einem Ruck auseinander, als wäre er Superman. Ein Sprühregen aus abgerissenen Knöpfen und Stofffasern ergoss sich über den Kaffeetisch. Dann murmelte Gustl noch einmal »D… D… Durscht« und krachte auf den Boden.
»Um Himmels willen«, fiepste Elsbeth.
»Jessasmariaundjosef«, schnaubte Emma.
»Heiliger Bimbam«, konstatierte Bobo, während der Pfarrer zum wiederholten Mal das Kreuzzeichen schlug.
Nach einigen Schrecksekunden sprangen wir beinahe gleichzeitig auf und starrten auf den Bauern, der reglos auf den Holzdielen lag. Wäre da nicht sein Brustkorb gewesen, der sich nahezu unmerklich hob und senkte, wir hätten ihn für tot gehalten.
»Ich ruf den Arzt«, stöhnte Elsbeth und stürzte aus dem Zimmer, bevor sie jemand an ihre berufliche Vergangenheit erinnern konnte. Dabei wüsste sie als ehemalige Krankenschwester bestimmt am besten über die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen in einem derart lebensbedrohlichen Fall Bescheid, aber ganz offensichtlich wollte Elsbeth sich ihre gepflegten Hände nicht schmutzig machen.
»Ich die Rettung«, meinte Bobo und wischte auf ihrem Smartphone herum.
Emma saß mit weit offenem Mund und vorgerecktem Hals einfach da, als wäre sie im Kino, erste Reihe fußfrei, und rührte sich nicht.
Ich beugte mich zu Gustl hinunter, um nach dem Puls zu fühlen. Sein Herzschlag war völlig ins Stolpern geraten, mal langsam, mal schnell, mal ausgesetzt, seine Augenlider flatterten, seine Haut fühlte sich schweißnass und kalt an, und er rang röchelnd nach Luft.
»Schaut schlimm aus«, sagte ich.
»Herzinfarkt, oder?«, fragte Emma, aber es klang mehr nach einer Feststellung.
»Mhm, wahrscheinlich schon.« Darauf gewettet hätte ich allerdings nicht.
»Kein Wunder, so wie der sich aufgeführt hat.« Traurig blickte Emma auf den Boden, wo nicht nur der Gustl und ein halbes Dutzend Knöpfe lagen, sondern auch ihre angebissene Kokosmakrone.
»Sturzbetrunken war er außerdem«, bemerkte Bobo, »der hat sicher zwei Promille im Blut.«
Mir fiel ein, was mir unbewusst bereits aufgefallen war. »Aber er riecht gar nicht nach Alkohol, kein bisschen.«
»Vielleicht hat er Pfefferminzbonbons gelutscht«, erwiderte Bobo, die neben einer kleinen Flasche Nusslikör stets eine beachtliche Sammlung an Minz- und Mentholzuckerln im Handschuhfach ihres Sportflitzers aufbewahrte.
Ich schüttelte den Kopf. »Er riecht auch nicht nach Pfefferminze, nur nach Hühnerstall.«
»Aber der ist doch herumgetorkelt wie eine halbe Schnapsleiche. Und gelallt hat er, dass man kaum was verstanden hat«, wunderte sie sich.
»Ich versteh’s auch nicht«, musste ich zugeben. »Warum wirkt man wie betrunken, wenn man nichts getrunken hat?«
»Vielleicht ist er ja auf Wodka umgestiegen«, überlegte Bobo. »Angeblich riecht man den nicht.« Das »angeblich« nahm ich ihr allerdings nicht ab. Die Frau sprach wohl eher aus Erfahrung. Mir war da so einiges zu Ohren gekommen, was nicht für meine Ohren bestimmt gewesen war.
»Was der Bauer nicht kennt, trinkt er nicht«, konstatierte Emma im Brustton der Überzeugung.
»Der Gustl hat einen gut gefüllten Weinkeller und selber Schnaps gebrannt, der braucht keinen Wodka«, mischte die sparsame Elsbeth sich ein.
Ich zuckte nur die Schultern und fragte mich insgeheim, ob der Mann vielleicht Drogen genommen hatte. Sein Blick war so seltsam angststarr gewesen, mit ungewöhnlich großen Pupillen, weit wie die einer Eule. Aber den Gedanken verwarf ich gleich wieder. Der verschrobene Hühnerzüchter wusste bestimmt nicht, dass es Rauschmittel gab, die nicht in Doppelliterflaschen abgefüllt wurden.
»Ich frage mich«, begann Bobo, doch bevor wir erfuhren, was sie sich fragte, trafen bereits unser Landarzt und die Rettungsmänner ein.
»Macht Platz«, sagte Dr. Seidenbart statt einer Begrüßung und stellte mit autoritärem Gehabe seinen Arztkoffer auf dem Kaffeetisch ab. Wir zogen uns weisungsgemäß Richtung Polsterecke zurück und schwiegen. Bis auf den Pfarrer, der nach wie vor am Fenster lehnte, seinen Rosenkranz in Händen hielt und halblaut vor sich hin murmelte.
Dann ging alles ganz schnell. Der leblose Gustl bekam eine Sauerstoffmaske aufs Gesicht gedrückt, die Sanitäter schoben ihm das fleckige Unterhemd hoch und beklebten seine spärlich behaarte Brust mit Dutzenden Elektroden, während der Arzt ihm zwei Injektionen und einen Infusionsbeutel verpasste. Dermaßen verkabelt und behängt luden die Rettungskräfte den Mann, der mehr tot als lebendig wirkte, auf eine Trage und verließen im Eilschritt das Haus.
»Nicht vergessen, er hat zweihundert Milligramm Metoprolol intus«, rief Dr. Seidenbart den Rot-Kreuz-Männern noch nach, dann griff er nach seiner Arzttasche, verstaute die leeren Ampullen und meinte zu uns gewandt: »Wird aber nichts mehr nützen. Der Mann ist so gut wie tot.«
»Herzinfarkt?« Diesmal wollte ich es genauer wissen. »Vermutlich schwerer Myokardinfarkt«, antwortete er. »Auch wenn …« Er sah uns einen Moment nachdenklich an, dann schloss er seine Tasche und wandte sich zum Gehen.
»Auch wenn?«, insistierte ich.
»Ach, nichts.«
Und weg war er.
Der Abgang des Oberdistelbrunner Gemeindearztes hatte mich ziemlich irritiert. Dr. Seidenbart war zwar generell kein Freund allgemein verständlicher Worte, aber als Frau wusste ich um die unausgesprochenen Drohungen, die sich hinter einem »Ach, nichts« verbergen konnten.
»Und da heißt es immer, wir Weiber würden in Rätseln sprechen«, seufzte ich und versuchte, das ungute Gefühl zu ignorieren, das mir schon wieder leicht im Nacken saß. Dieser seltsam starre Blick, die weiten Pupillen, die rötliche Haut, der kalte Schweiß, sein starker Durst und der Tobsuchtsanfall – ein Infarkt ging meines Wissens doch weitaus unspektakulärer und mit anderen Symptomen über die Bühne …
»Vergiss unseren Kurpfuscher, der will sich doch nur wichtigmachen«, erwiderte Bobo. »Einen offensichtlicheren Herzinfarkt gibt es gar nicht. Noch dazu vor Publikum. Wie er geschwankt ist und wie er sich an die Brust gegriffen, seine Jacke auseinandergerissen und nach Luft geschnappt hat, was bitte hätte das sein sollen außer einem Infarkt?«
»Ganz großes Kino«, antwortete Emma trocken. »Das war ganz großes Kino.«
»Das war wohl eher eine menschliche Tragödie«, warf ich missbilligend ein. »Immerhin ist der arme Mann vor unseren Augen beinahe gestorben.«
»Ich hätte ja eine ganze Malakofftorte verwettet, dass der Gustl mal an Leberzirrhose stirbt«, fuhr Emma ungerührt fort. Sie schien ihr Tagespensum an Mitleid bereits an die gefallene Kokosmakrone verwendet zu haben.
»Und was, wenn er sich bei seinen exotischen Hendln angesteckt hat?«, warf Elsbeth zögernd ein. »Vielleicht ist das eine chinesische Rasse, und die ist wieder von so einem Virus verseucht, das auf den Menschen überspringt? Wäre ja nicht das erste Mal …« Besorgt hielt sie sich die Hand vor den Mund. Richtig böse Bazillen stammten ihrer Ansicht nach ja stets von ausländischem Getier, das wusste man spätestens seit MERS und Corona.
»Blödsinn«, murmelte ich. »Er hat ja selbst gesagt, dass er seine Hendl schon seit acht Jahren hat. Kein Virus hat eine so lange Inkubationszeit.«
Elsbeth blickte mich zweifelnd an. Ich blickte zweifelnd zurück. Dass ausgerechnet jemand wie sie, die jahrzehntelang mit Masern, Windpocken, Grippewellen, Krankenhauskeimen und Antibiotikaresistenzen zu tun gehabt hatte, derart panisch auf kranke Hühner reagierte, zählte für mich zu den großen Rätseln der Menschheit. Aber vielleicht waren Menschen von Natur aus weder gut noch böse, sondern einfach nur rätselhaft. Ich verstand mich ja selbst nicht immer.
»Wenn du meinst«, erwiderte Elsbeth schließlich, und einen Moment lang fürchtete ich, sie hätte meine Gedanken gelesen.
»Ich glaub eher, er war auch vom Teufel besessen«, frotzelte Bobo mit einem Seitenblick auf den Pfarrer, doch der sah über sie hinweg.
»Gott gibt und Gott nimmt«, deklamierte er, »aber Gott heilt auch die, die zerbrochnen Herzens sind, und er verbindet ihre Wunden.«
»Psalm 147«, belehrte uns Elsbeth.
Der Priester nickte anerkennend, griff nach seinem Stock, wischte diesen sorgfältig an einem Zipfel der Brokatvorhänge ab und meinte vorwurfsvoll: »Ich jedenfalls werde für den Gustav beten. Der Friede sei mit euch.«
»Und mit deinem Geiste«, nuschelte unsere Vorzeigekatholikin, geleitete den Seelsorger höflich zur Tür und flötete als Einzige: »Auf Wiedersehen, Hochwürden.«
»Da werden Gebete nicht helfen, der Gustl braucht eher eine Organtransplantation«, bemerkte Emma, kaum hatte Pater Ägydius die Haustür hinter sich zugezogen.
»Ob er überlebt?«, fragte sich Elsbeth. »Seine Eier waren wirklich gut. Wo krieg ich sonst so frische Eier her?«
»Na, bei deinem Mann sicher nicht«, erwiderte Bobo, stellte ihr anzügliches Grinsen aber ein, als niemand reagierte. »Was mit den Hühnern passiert ist, würd mich aber schon interessieren. Also mehr als Gustls Sterbeversuch. Er ist kollabiert, Aufregung, Säuferleber, Bluthochdruck, der Jüngste war er auch nicht mehr, aber was in aller Welt ist mit den Hendln passiert? Da kräht ein Hahn zwei Stunden lang im Akkord und fällt dann tot um. Klingt wie eine Überdosis Viagra.«
»Ich glaub nicht, dass der Gustl überhaupt weiß, was das ist«, warf Emma ein. »Der hat ja nur mit seinen Weinflaschen verkehrt.«
»Vielleicht waren die Hendl ja auch besoffen«, überlegte Bobo. »Ich hab gehört, dass Obst zu gären beginnt, wenn es überreif wird. Möglicherweise haben seine Viecher einfach zu viele überreife Kirschen gefressen?«
Elsbeth schüttelte den Kopf. »Der hat nur Weichselkirschen, die sind noch gar nicht reif.«
»Er war nicht betrunken«, beharrte ich auf meiner Meinung, aber niemand interessierte sich dafür. Ganz wie bei mir daheim, dachte ich resigniert, nur dass ich weder Häkeldeckchen noch Tüllgardinen besaß und meine Wohnzimmercouch im Vergleich zu Elsbeths antiquarischem Foltersofa nahezu futuristisch anmutete. Und zweifelsohne hundertmal bequemer war. Aber Elsbeth war ohnedies ein Mensch ohne Sitzfleisch. Entweder sie putzte, sie betete, oder sie saß – so wie jetzt – angespannt auf der Stuhlkante, damit ihr nicht der geringste Tratsch oder gar ein Staubkorn entging.
»Dann vielleicht Gift?«, meinte Emma nach einer Schweigesekunde. »Durch einen Schlangenbiss oder so?«
»Oder eine Bienenstichallergie«, mutmaßte Elsbeth, die Insekten noch weniger leiden konnte als Staubkörner, Bazillenschleudern und Informationsdefizite.
Bobo runzelte nachdenklich die Stirn. »Bienenstichallergie? Bei Hühnern? Wie kommst denn auf so was?«
»Doch, doch, das kann es schon geben«, mischte Emma sich ein. »Vor zwei Wochen erst hat die Charlotte, also die weiße Angorakatze von meinem Enkerl, vor zwei Wochen also hat dieses dumme Tier in eine Wespe gebissen und wär deshalb fast gestorben. Mein Gott, die kleine Hannah war untröstlich, hat der Katze beim Tierarzt die ganze Zeit über die Pfote gehalten. Analaktischer Schock oder so, hat der gemeint.«
»›Anaphylaktisch‹ heißt das«, verbesserte ich gewohnheitsmäßig. Fast vierzig Jahre im Schuldienst ließen sich leider nicht verleugnen, vermutlich trug ich längst ein Korrektur-Gen in mir.
»Anal hin oder her, jedenfalls könnte auch ein Huhn nach Insekten picken und dabei versehentlich eine Biene erwischen. Oder von mir aus auch eine Wespe. Warum nicht? Gustls Hühner laufen ja ständig im Freien herum«, beendete Emma ihre Wahrscheinlichkeitsstudien.
Bobo nickte nachdenklich, ich auch. An die Theorie der bienengiftallergischen Hühner glaubte ich zwar keine Sekunde, doch das Wort »Gift« hatte sich in meinen Gedanken festgesetzt. Was, wenn wirklich …?
Manchmal waren die Menschen einfach böse, auch hier in unserer trügerischen Idylle, da gab ich mich keinen Illusionen hin. Es gab Hundehasser, warum nicht auch Hühnerhasser, die sprichwörtliche Unschuld hatte sich leider längst vom Lande verabschiedet.
Ich brauchte doch nur unsere ganz und gar nicht illustre Runde anzublicken. Bobo, eine aufgetakelte Mittfünfzigerin, die eigentlich Bibiana hieß, erfreute sich seit Jahren ihres Daseins als wohlhabende lustige Witwe, nachdem ihr Mann in seiner eigenen Badewanne ertrunken war. Der Fall war letztlich zu den Akten gelegt worden, doch die Zweifel an Bobos moralischer Integrität blieben bestehen.
Oder Emma, eine augenscheinlich respektable Person, die im Keller zwar keine Leichen, dafür aber Reichsfahnen, Mutterkreuze und ähnlich bedenkliche Devotionalien hortete und stolz darauf war, noch nie einem Ausländer die Hand geschüttelt zu haben. Selbst Elsbeth hatte sich hartnäckigen Gerüchten zufolge einst unter dem Deckmantel der Kirche recht weltlichen Dingen zugewandt. Ihr ältester Sohn und der Vorgänger von Pater Ägydius sahen sich jedenfalls verdächtig ähnlich.
Und was mich betraf, nun ja, ich hatte in Wahrheit auch keine fleckenlos weiße Weste. Im dritten Jahr meines Junglehrerdaseins hatte ich mir mit meinem gesamten Ersparten ein altes Auto gekauft, drei Tage später die Katze der Nachbarin überfahren und nicht den Mut besessen, es der alten Dame zu gestehen. Wochenlang hatte sie verzweifelt nach ihrer Mieze gesucht, und ich Feigling hatte ihr sogar dabei geholfen.
Etwas, wofür ich mich noch heute geniere.
Auf einmal fühlte ich mich müde und erschöpft, ohne jede Lust auf weitere Diskussionen. Es war ohnedies schon sehr spät geworden.
»Meine Güte, wie die Zeit vergeht.« Nachdrücklich blickte ich auf meine Uhr. »Der Germteig ist jetzt sicher schon drei Mal gegangen. Wünsch euch noch was.«
Und schon war ich an der Tür. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass Emma und Bobo gleichfalls aufsprangen.
»Wir müssen leider auch schon, dabei ist es immer so gemütlich bei dir«, meinte Bobo zum Abschied und zog dabei das »o« derart in die Länge, dass es fast nach dem Gegenteil klang.
»Die Zimtschnecken waren aber echt gut«, verschlimmerte Emma den Missklang noch ein wenig. Auch sie hätte im diplomatischen Dienst vermutlich kaum Karriere gemacht.
»Schönen Abend noch und danke«, sagte ich, weil es sich so gehörte.
»Wir sehen uns spätestens bei der Gartenschau«, rief Elsbeth uns nach, während wir bereits auf die Straße traten. Ich wandte mich nach links, Bobo und Emma querten die Straße und bogen nach rechts, wo die lustige Witwe ihren knallroten Flitzer abgestellt hatte. Da ich mein Fahrrad wegen des kaputten Lichts zu Hause gelassen hatte, musste ich mich zu Fuß auf den Weg machen, was zwar beschwerlicher war, mir aber mehr Zeit zum Nachdenken ließ. Hühner mit Schaum vor dem Schnabel, ein notorisch betrunkener Bauer, der im nüchternen Zustand einen Tobsuchtsanfall bekommt, mit hochrotem Kopf und Pupillen wie Suppentellern, dann aber einen Herzinfarkt kriegt, während sich der Hahn in den Tod kräht, das ergab doch alles keinen Sinn.
Doch je mehr ich mir jedes Detail dieser abendlichen Tragödie in Erinnerung rief, desto konfuser erschien sie mir. Ich durfte mich keinesfalls in abstruse Theorien verrennen, gerade im Ruhestand hatte man ja leider viel zu viel Zeit zum Grübeln.
Mit rauchendem Kopf und schmerzenden Füßen kam ich endlich zu Hause an, wo mich eine ungewöhnliche Stille empfing. Normalerweise lag Alfred, mein Mann, um diese Uhrzeit auf dem Sofa und übte sich im Fernsehschlafen. Diesmal jedoch war alles ruhig, kein Ton drang nach draußen, obwohl die Fenster wegen des warmen Wetters weit offen standen.
Besorgt eilte ich ins Wohnzimmer. Mein Gatte war Diabetiker und hegte eine verhängnisvolle Leidenschaft für Süßspeisen, Schaumrollen und Schokoladenkekse, was gar nicht gut für seine Zuckerwerte war. Seit Jahren begleitete mich die Angst, dass er mir wegen seiner Naschsucht ins Zuckerkoma fiel und zum Pflegefall wurde. Und tatsächlich lag Alfred im Wohnzimmer, aber nicht komatös auf dem Fußboden, sondern schnarchend auf der Couch. Die Zeitung immer noch in der Hand, war er offenbar über einem Kreuzworträtsel eingeschlafen. Ich griff nach dem Papier, dabei fiel ein Kugelschreiber zu Boden. Den ließ ich liegen, Alfred auch.
***
Der nächste Morgen begann mit strahlendem Sonnenschein und fröhlichem Vogelgezwitscher. Nahezu über Nacht war der Flieder erblüht und verströmte einen derart betörenden Duft, dass ich keinen Gedanken mehr an den armen Gustl und seine Hühner verschwendete. Bei Tageslicht und einem opulenten Frühstück im Freien sah die Welt ganz anders aus. Friedlicher, ruhiger, unaufgeregter. Zumindest zehn Minuten lang, dann begann unsere Nachbarin zu brüllen: »Ich bring euch um. Ich bring euch alle um. Alle!«
Vor Schreck ließ ich das Buttermesser, an dem blutrote Spuren meiner selbst gemachten Himbeermarmelade klebten, auf das blütenweiße Damasttischtuch fallen, während sich mein Angetrauter, der wie stets die Morgenzeitung las, instinktiv ein wenig weiter hinter seinem Schutzwall aus Papier verschanzte. Als würde so ein läppisches Kleinformat ihn vor einem tödlichen Angriff retten. Ein meiner Ansicht nach völlig unsinniges Unterfangen. Mit dieser Boulevardpostille könnte er bestenfalls Fliegen in die Flucht schlagen, aber bestimmt kein Hundert-Kilo-Weib, wie Berta eins war.
Alfred dachte offenbar das Gleiche, denn er überwand sein jahrzehntelang trainiertes Trägheitsmoment nahezu in Rekordzeit, sprang unfassbar behände vom Sessel auf, murmelte: »Ich schau mal nach den Eiern«, und eilte mit großen Schritten Richtung Haus. Dass er sein Vier-Komma-fünf-Minuten-Ei von glücklichen Hühnern eine halbe Stunde zuvor bereits gegessen hatte, war ihm offenbar entfallen.
Also griff ich erneut zum Buttermesser und begab mich allein zur blickdichten Hecke, die unseren weitläufigen Garten von dem benachbarten Grundstück trennte. Vorsichtig reckte ich meinen Kopf über die prachtvolle Glanzmispel – und erstarrte.
Meine voluminöse Nachbarin robbte keuchend und fluchend durch die Blumenrabatten, eine angesichts ihrer Körpermasse lebensbedrohliche Art der Fortbewegung, zumindest für die Pflanzen. Platt gewalzter Rittersporn, geköpfte Schachblumen, geknickter Fingerhut, entwurzelte Sterndolden, massakrierter Steppensalbei, ein Reigen an gefallenen Taglilien und Dutzende aufgewühlte Blumenzwiebeln zeugten von ihrem Amok-Gekrabbel.
Der Feind musste in Bodennähe lauern, so viel schien klar. Und er dürfte äußerst gefährlich sein, denn Berta würde eher einen Menschen zu Tode prügeln als ihren Pflanzen auch nur das kleinste Blatt krümmen. Dennoch zog sie eben jetzt und direkt vor meinen Augen eine Schneise botanischer Verwüstung durch ihren Garten.
Wenn sie ihren Vernichtungsfeldzug nicht bald einstellte, würden ihre Blumenrabatten nur noch zum Kartoffelacker taugen.
»Berta«, rief ich zögernd über die akkurat gestutzte Hecke, »was um Himmels willen machst du da?«
»Was ich da mache?« Keuchend und mit irrem Blick bremste Berta sich knapp vor den Taglilien ein. Sie ballte eine Hand zur Faust, sah mich hasserfüllt an und schrie erneut: »Ich bringe sie um. Alle, das sag ich dir!«
Instinktiv umschloss ich das Buttermesser etwas fester. Es war außergewöhnlich warm für Mitte Mai, womöglich hatte meine Nachbarin einen Hitzschlag erlitten. Ihr hochroter Kopf glänzte vor Schweiß, ihr feister Körper schien in den Vibrationsmodus verfallen, da waren ihr vielleicht auch ein paar Sicherungen im Oberstübchen durchgebrannt. Aber deshalb gleich Mord und Totschlag säen? Dabei konnte ich weit und breit nichts Bedrohliches ausmachen. Außer Berta selbst. Und sie war mir in den langen Jahren unserer guten Nachbarschaft noch nie als gewalttätig aufgefallen.
Jedenfalls musste ich etwas unternehmen, bevor die Lage völlig eskalierte. Bertas einst blühendes Reich sah schon aus, als hätte eine Rotte Wildschweine Fußball gespielt.
Ich hatte wohl einen Augenblick zu lang auf den malträtierten Boden gesehen, während ich darüber nachdachte, ob das ein Fall für den Notarzt, den Naturschutzbund oder doch die Polizei war, denn unvermutet traf mich ein erdiger Klumpen mit voller Wucht im Gesicht.
Entsetzt stolperte ich zwei Schritte rückwärts.
»Bist du wahnsinnig?«, schrie ich über die Hecke und versuchte verzweifelt, mit der linken Hand – mit der rechten hielt ich immer noch das Buttermesser umklammert – einen Regenwurm zu entfernen, der sich panisch an meinen Brillenbügel klammerte.
»Hallelujah«, schrie Berta zurück. »Glory Hallelujah. Aus und vorbei.«
Das war ein Fall für den Notarzt, ganz eindeutig. Meine Nachbarin war offensichtlich einem religiösen Wahn verfallen, sie würde die Gartenschürze wohl gegen eine Zwangsjacke tauschen müssen.
Erklären konnte ich mir das Ganze aber nicht. Berta hatte bislang nie besonderes Interesse an himmlischen Sphären gezeigt, dafür war sie ein viel zu bodenständiger, um nicht zu sagen erdverbundener Typ. Und auf den Wegen des Herrn hatte ich sie auch noch nie wandeln sehen. Wenn sie ihr Lebendgewicht in Bewegung setzte, dann höchstens, um den schleimigen Pfaden der Wegschnecken zu folgen. Oder auch dem Ruf der Kuchentheke vom Konditor ums Eck. Je nach Bedürfnislage.
Mit Schokolade und süßen Worten war hier aber nichts mehr auszurichten, ich musste auf ihre krausen Gedanken eingehen, Verständnis für ihre geistigen Kurzschlüsse heucheln, mich vorsichtig aus der Gefahrenzone bringen und danach umgehend Hilfe holen. »Deeskalation« lautete das Zauberwort, das hatte ich in meinem beinahe vierzigjährigen Schuldienst gelernt.
»Halleluja«, säuselte ich daher betont kadenziert retour über die Hecke. »Es lebe Gott Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und die Jungfrau Maria natürlich. Asche zu Asche, Kompost zu Kompost.« Leider hatte ich zeit meines Arbeitslebens nur Lesen, Schreiben und Werken unterrichtet, aber niemals Religion. Nun fehlte mir eindeutig das Fachvokabular. Als Ausgleich hatte ich zumindest eine Dreifachdosis psalmodischer Inbrunst in die Betonung gelegt. Wegen der besänftigenden Wirkung, wie ich hoffte.
Doch der hochrote Kopf von Berta, der erneut hinter der Glanzmispel auftauchte, sah gar nicht besänftigt aus.
»Sag, spinnst du?«, fauchte sie mich an. »Was schwafelst du da für einen Schwachsinn. Die da oben«, dabei blickte sie böse zum blauen Himmel empor, »die sind mir völlig wurscht. Aber die da unten«, der Garten wurde mit einem noch böseren Blick bedacht, »die bring ich alle um. Ich schwör’s. Und du könntest mir gefälligst dabei helfen, statt auf Betschwester zu machen.«
Nun traf der böse Blick auch mich.
»Aber du hast doch ›Halleluja‹ gesagt«, stammelte ich ratlos, »zwei Mal, und mich außerdem mit Kompost beschossen.«
Ich verstand gar nichts mehr. Meine kleinen grauen Zellen begannen, nach künstlicher Beatmung zu lechzen. Das alles klang verworrener als jede Parlamentsdiskussion.
»Glory Hallelujah, ich sagte Glory Hallelujah. Das ist eine Edelpfingstrosenart. Paeonia lactiflora. Spät blühend. Riesige gefüllte Blüten. Kennt doch jeder. Und genau die hab ich dir rübergeschmissen. Abgefressen, verstümmelt, tot. Das wäre die schönste Päonie vom ganzen Dorf geworden, bevor diese verfluchten Viecher über sie hergefallen sind.«
Erneut traf mich ein böser Blick, als hätte ich ihrer Pflanze ein Leid angetan.
»Da ist übrigens ein Regenwurm auf deiner Brille«, meinte sie abschließend, tippte sich an die Stirn und ging.
Ich blieb sprachlos am Zaun zurück.
Berta war der netteste und unkomplizierteste Mensch, den ich kannte. Zwar neigte sie hin und wieder zu spontanen Temperamentsausbrüchen, doch derart von Sinnen hatte ich sie noch nie erlebt. Erst riss sie mich aus meinem beschaulichen Frühstückskoma, indem sie lautstark mit Mord und Totschlag drohte, während sie bäuchlings durch ihre Beete pflügte, dann bewarf sie mich mit einer entwurzelten Zierpflanze, die angeblich Halleluja hieß, und zu schlechter Letzt mokierte ausgerechnet sie sich auch noch über den Regenwurm auf meiner Brille. Wo doch allein sie schuld war an der luftigen Lage des ekligen Gewürms. Unfassbar.
Und weit und breit keine Erleuchtung in Sicht. Nicht einmal Alfred hatte sich blicken lassen, um mir hilfreich zur Seite zu stehen. Aber der war sowieso noch nie im passenden Moment gekommen.
Hier und jetzt blieben mir also genau zwei Möglichkeiten: Entweder ich ging unverrichteter Dinge nach Hause, ärgerte mich über meinen Mann und brühte neuen Kaffee auf, oder ich ging der Sache todesmutig auf den Grund. Ich schien zwar nicht direkt in Bertas Beuteschema zu fallen, aber ich konnte auch nicht ausschließen, dass meine Nachbarin über kurz oder lang zu schwereren Geschützen greifen und statt mit Erdklumpen mit Tontöpfen um sich werfen würde. Sie war offenkundig völlig durchgedreht.
Und schon fiel mir Gustls gestrige Raserei wieder ein. Nicht auszudenken, wenn auch sie …
»Berta«, brüllte ich ihr panisch nach, »Berta, komm her, es ist wichtig.«
Es raschelte, dann erschien erneut ihr hochroter Kopf hinter der Mispel. Der Bauer hatte eine ähnlich besorgniserregende Gesichtsfarbe besessen.
»Sag, fühlst du dich gut, hast du heute schon deinen Blutdruck gemessen, soll ich dir Herztropfen holen? Und lass mal deinen Puls fühlen«, fiel ich über sie her, während ich näher an die hinderliche Hecke trat, um nach ihrem Arm zu langen.
»Nein, ich fühl mich nicht gut, und deine Fragerei macht es auch nicht besser.« Energisch schüttelte sie meine Hand ab. »Wenn ich diese verdammte Brut nicht bald erwische, krieg ich noch einen Herzinfarkt.«
Den Eindruck hatte ich auch.
»Genau das befürchte ich«, erwiderte ich, vielleicht eine Spur zu schroff. »Ich hab gestern schon einen Herzinfarkt gehabt, heute will ich meine Ruh.«
Berta blickte mich skeptisch an.
»Für einen Infarkt hast dich aber schnell erholt.«
»Selbst hatte ich natürlich keinen, aber der Gansterer Gustl«, erklärte ich ihr. »Ich war nur Augen- und Ohrenzeugin, immerhin ist mir der arme Bauer genau vor die Füße gefallen. Das war vielleicht ein Drama. Wegen eines toten Hendls hat er sich so furchtbar aufgeregt, dass er einen Tobsuchtsanfall bekommen und zum Schluss sogar mit dem Stock vom Herrn Pfarrer um sich geschlagen hat.«
Was meine Nachbarin wenig zu beeindrucken schien.
»Kein großer Verlust, stiehlt er mir bei der Heimgartenprämierung wenigstens nicht mehr die Schau«, bemerkte sie lapidar, »und jetzt komm endlich rüber und hilf mir.«
»Gut, ich komme, aber eins sag ich dir, ich will weder umgebracht werden, noch bringe ich jemanden um.«
»Aber dass diese mörderische Bagage mich umbringt, ist dir das etwa egal? Dann hast du einen zweiten Herzinfarkt am Hals oder besser gesagt vor die Füß. Das garantier ich dir.«
Ich hatte zwar immer noch keine Ahnung, von wem Berta überhaupt sprach, aber ich fragte mich, ob sie es möglicherweise gar nicht am Herzen hatte, sondern am Kopf. So eine Art Gehirngrippe vielleicht.
»Ist schon gut«, lenkte ich besänftigend ein, »aber jetzt sag mir endlich, wer die Todgeweihten überhaupt sind.«
Berta sah mich verständnislos an.
»Meine Maulwurfsgrillen natürlich. Diese Mistviecher fressen mir mein Lebenswerk ab. Sie haben meine Prachtpäonie getötet, sie verstümmeln die Radieschen, sie fällen die Stockrosen, und sie haben sich sogar in das koreanische Sesamblatt verbissen. Das sind gnadenlose Serial Killer, also heb dir dein Mitleid besser für mich auf.«
Ich nickte. Maulwurfsgrillen galten als Todfeind jedes Gärtners, das konnte nicht einmal ich bestreiten. Den Schaden, den diese Tiere anrichteten, der ließ sich mit keinem noch so talentierten grünen Daumen mehr beheben, da halfen nur radikale Schritte.
So gesehen blieb mir als langjähriger Freundin wohl keine andere Wahl, als zur meuchlerischen Nachbarschaftshilfe zu schreiten. Resigniert umrundete ich den Sichtschutz aus rötlich schimmernden Glanzmispeln und öffnete Bertas Gartentor. Hier, auf der Vorderseite ihres schmucken Häuschens, schien die Welt noch in Ordnung zu sein. In riesigen Holzbottichen wuchs ein gutes Dutzend Oleandersträucher dem Sommer entgegen, das Rosenspalier war bereits üppig überwuchert, und ein paar frühreife Levkojen hatten erste Knospen angesetzt. Zudem säumte ein Meer aus Tulpen, Bartnelken, Ranunkeln und Storchschnäbeln den Weg zur gepflasterten Terrasse, auf der ein riesiger Wäscheständer von Bertas Faible für die Farbe Lila zeugte. In Kombination mit ihrem karottenrot gefärbten Haar sah das nicht sonderlich gut aus, fand ich. Also eigentlich ziemlich schlimm, so eine Art Vorstufe von Augenkrebs, aber meine Nachbarin hatte mich schließlich nicht als Stilberaterin engagiert, sondern als Jagdgehilfin. Wobei ich meine Zweifel hegte, dass man Grillen so einfach jagen konnte. Die galten bestimmt nicht einmal als Niederwild.
Der botanische Ausnahmezustand, der hinter ihrem Haus herrschte, zeugte jedenfalls von Bertas festem Vorsatz, das Insektensterben nun höchstpersönlich voranzutreiben. Die Beete zerwühlt, die Pflanzen entwurzelt, die Blumen geknickt und mittendrin die Rächerin der Pfingstrosen, die sich auf allen vieren im Kreis drehte und dabei ein Einweckglas durch die Luft schwenkte. Ein Spektakel, besser als jede TV-Komödie.
Vorsichtig trat ich einen Schritt näher.
»Was soll ich tun?«
»Da, nimm dir ein Glas«, herrschte sie mich an und wies auf einen Stapel Einkochgefäße neben der Regentonne.
Zaudernd griff ich nach dem obersten Behältnis.
»Und jetzt komm mit.« Berta hatte sich schnaufend aus ihrer bodendeckenden Position erhoben und schubste mich energisch zu einem pink bemalten Leiterwagen, der – ganz gegen ihre Gewohnheit – keine opulente Blumenpracht zu beherbergen schien.
»Das sind sie«, meinte sie und hielt mir ein bereits verschlossenes Einweckglas vors Gesicht. »Schau sie dir genau an, diese Untiere.«
Ich rückte meine Brille zurecht und schaute besonders aufmerksam, aber alles, was ich sah, war eine große dunkelbraune Grille, die mit ihren Grabschaufeln wild um sich schlug.
»Schon kuriose Tierchen«, sagte ich, »irgendwie putzig, wie sie sich abstrampeln.«
»Genau das ist ja das Gemeine an diesen Viechern«, entgegnete Berta und stellte das Glas zurück in den Wagen, in dem noch mindestens fünf weitere standen, »die machen auf harmlos, ach, was sag ich, auf arm und klein und unbeholfen, und dann, hinterrücks, fressen sie dir über Nacht deine Chance auf den ersten Platz bei der Prämierung des schönsten Heimgartens weg.«
Dass Bertas jährliches Streben weder einem Traumurlaub noch einer Traumfigur galt, sondern allein dem Erhalt dieser begehrten Oberdistelbrunner Auszeichnung, war allgemein bekannt. Seit drei Jahren vergab die Gemeinde diesen Preis, und seit drei Jahren verzehrte sich Berta danach. Bislang vergebens. Das erste Mal hatte ihr ein ungnädiger Wettergott nicht nur die Petersilie, sondern auch gleich ihre ganzen Blumenbeete verhagelt, im Jahr darauf hatte ihr eine Hüftoperation einen dicken Strich durch ihre gärtnerische Rechnung gemacht, der dritte Versuch war dann am Gansterer Gustl gescheitert. Der eigenbrötlerische Hühnerzüchter hatte eigentlich gar nicht mitmachen wollen, sich mit Händen, Füßen und harschen Worten dagegen gesträubt. Und ausgerechnet Berta hatte ihn zur Teilnahme gedrängt. Mit dem Ergebnis, dass der Gustl mit seinen schwindelfreien Kletterrosen – allen voran der seltenen Climbing Soraya, die sich bei ihm bis zum Dachfirst der alten Scheune emporrankte – auf Anhieb den ersten Preis errungen hatte. Berta war nur Zweite geworden. Und nun das.
Wobei mir der Schaden durch die tierischen Totengräber weitaus geringer erschien als Bertas zerstörerisches Werk, aber das verschwieg ich.
Stattdessen fragte ich: »Aber was genau soll ich mit dem Glas machen?«
»Fangen und einsperren. Jede Einzelne. Such alles ab, schau auf den Boden, ob du Grabspuren siehst, unter die Blätter, auf die Erde im Wurzelbereich, zwischen die Zweige. Und überall, wo es verwelkt, angebissen oder abgestorben aussieht, musst du graben. Irgendwo verstecken sie sich und ihre Brut. Ich will diese Biester nicht mehr hier sehen. Kein einziges. So, wie die meinen Garten zugerichtet haben, müssen das Großfamilien sein. Dutzende. Oder sie vermehren sich jeden Tag.«
Mit hochrotem Kopf, ein unangenehmer Kontrast zu ihrem karottenroten Haar, zog sie ein paar Gartenhandschuhe aus der Tasche ihrer lila Kittelschürze und überreichte sie mir. Irgendwann sollte ich mit Berta mal über die Farbenlehre sprechen. Aber besser nicht heute und hier.
»Die wirst du brauchen. Wegen der Dornen. Und weil die Viecher einen ordentlich kneifen können.«
Meine Motivation sank in den Minusbereich.
»Na, dann versuch ich’s halt mal«, erwiderte ich zögernd. In Wahrheit verspürte ich nicht die geringste Lust, auf meinen arthritischen Knien durch Beete und Büsche zu robben, um Insekten auszugraben und in Gläser zu stopfen.
»Dürfen wir das überhaupt?«, merkte ich mit Nachdruck an. »Ich glaub, ich hab irgendwie gelesen, Maulwurfsgrillen stehen unter Artenschutz.«
»Interessiert mich nicht. Der Feind muss vernichtet werden. Und zwar jetzt, weil sie um diese Uhrzeit hoffentlich schlafen.« Berta kannte kein Pardon.
»Das Insektensterben ist dir also völlig egal?«
»Egaler als mein Pflanzensterben ganz sicher. Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie lange ich gebraucht habe, um so eine Hallelujah wie die meine zu finden? Die wär silbrig marmoriert gewesen, total selten so was, das sag ich dir. Und diese verdammten Viecher haben sie umgebracht.«
»Und jetzt willst du sie umbringen. Aus reiner Rachsucht.« Ich bemühte mich um einen besonders vorwurfsvollen Unterton; kombiniert mit meinem Lehrerinnenblick funktionierte das fast immer. Selbst bei Berta.
»Ach was, das hab ich nur so dahergesagt. Wenn ich sie umbringen wollt, dann könnt ich sie ja gleich erschlagen. Das wär doch viel einfacher, als sie alle einzufangen.«
Manchmal fanden Bertas Gedankengänge an meiner Großhirnrinde einfach keinen Halt.
»Ich versteh nicht ganz. Du fängst sie ein, sperrst sie in Gläser – und dann? Lässt du sie verhungern, steckst du sie in den Geschirrspüler, folterst du sie zu Tode, oder was?«
»Was, ›was‹?« Berta sah mich an, als würde sie an meinem Verstand zweifeln. »Ich lass sie wieder frei. Bei der Müllanger Miezi zum Beispiel. Oder beim Gustl, aber das kann ich mir jetzt vermutlich sparen, und natürlich bei der arroganten Amtsratswitwe drüben am Kugelberg. Sollen sie doch denen den Garten ruinieren. Wenn die erst einmal die ganzen Regenwürmer gefressen haben und über deren Prachtstauden hergefallen sind, gewinnen sie garantiert keinen Blumentopf mehr damit.«
Ein heimtückischer Plan. Ich nickte nachdenklich, während ich so tat, als würde ich unter den Hortensien nach den bösen Biestern suchen.
»Aber fair ist das nicht. Nicht für die Grillen und nicht für die Menschen«, versuchte ich erneut, an ihr Gewissen zu appellieren.
»Fair«, sie zuckte die Schultern, »ist es vielleicht fair, dass mich das Schicksal ständig um den Heimgartenpreis bringt? Ist es fair, dass die Einzige im ganzen Ort, bei der der Diptam jedes Jahr verlässlich blüht, ausgerechnet die Miezi ist? Die ist selbst schon schön, die braucht keinen schönen Garten mehr. Und ist es fair, dass diese Viecher, wenn sie nicht gerade auf Hochzeitsflug sind, so gut wie keine natürlichen Feinde haben, während meine Päonien sich gegen Ameisen, Hopfenspinner, Blattschneidebienen, Maikäfer, Heuschrecken und Maulwurfsgrillen verteidigen müssen?«
Darauf wusste auch ich keine Antwort. Diskussionen mit meiner Nachbarin gestalteten sich meist so zielführend wie drei Runden im selben Kreisverkehr. Sie gab selten auf und niemals nach. Und nun hatte sie sich anscheinend in ihren Hass auf die Grillen verbissen wie diese in die Wurzeln ihrer Sträucher und Stauden.
Wenn sie so weitermachte, nahm das kein gutes Ende. Nicht für den Garten und nicht für ihre Gesundheit. Die Insekten kamen bei dieser Treibjagd vermutlich noch am wenigsten zu Schaden.
Stirnrunzelnd betrachtete ich einen Rosenkäfer auf einem Hortensienblatt. Diese glänzenden Krabbler hatten mir immer schon gefallen.
Ich überlegte gerade, warum diese goldigen Blatthornkäfer eigentlich Rosenkäfer hießen, denn bei mir im Garten trieben sie sich vor allem im Kürbisbeet und auf dem Kartoffelkraut herum, als Berta unvermittelt unter einen monumentalen Rhododendron hechtete.
»Arrrgg. Du Mistvieh, du verdammtes, hab ich dich«, schrie sie und zwängte ihre obere Hälfte durchs Dickicht der Zweige.
»Um Himmels willen, pass auf deine Bandscheiben auf«, rief ich ihr hinterher. »In unserem Alter kann da schnell was kaputtgehen.«
»Was heißt ›in unserem Alter‹?«, knurrte Berta zurück, während sie sich stöhnend und ächzend im Rückwärtsgang aus dem Gestrüpp quälte. »Ich bin nach wie vor vier Jahre jünger als du.«
»In unserem Alter macht es keinen Unterschied mehr, ob man neunundfünfzig oder dreiundsechzig ist«, entgegnete ich.
»Und ob das einen Unterschied macht.« Berta erhob sich schwerfällig, den Kopf mittlerweile röter als das kommunistische Manifest. »Liz Taylor hat mit neunundfünfzig nochmals geheiratet, einen um zwanzig Jahre jüngeren Mann. Audrey Hepburn war mit dreiundsechzig schon tot. Die war übrigens auch so dünn wie du.«
»Ich hab Größe achtunddreißig. Mit Größe achtunddreißig stirbt man nicht an Unterernährung, glaub mir. Und ich habe auch nicht die geringste Absicht, heuer noch abzutreten«, konterte ich. Außer Berta würde mir über kurz oder lang einen ihrer steinernen Gartengnome an den Kopf werfen.
»Im Übrigen wusste ich gar nicht, dass du noch einmal heiraten willst.«
Meine Nachbarin hatte in jungen Jahren bereits einen Ehemann besessen. Erich oder Egon, ich konnte mich nicht mehr genau erinnern, wir waren damals gerade frisch aus der Stadt hierhergezogen und mit unserem ersten Eigenheim auf dem Land vollauf beschäftigt gewesen. Jedenfalls war Erich oder Egon Lokführer gewesen und hatte als solcher zu oft in fremden Gefilden verkehrt. Schon nach kurzer Zeit war der häusliche Frieden definitiv entgleist, und ein Scheidungsanwalt hatte die Weichen in eine getrennte Zukunft gestellt. Nach dieser betrüblichen Erfahrung hatte ich Berta den Wunsch nach trauter Zweisamkeit eigentlich nicht mehr zugetraut. Zudem füllte sie ihr Heim auch allein schon ausreichend aus.
Das lag bestimmt an den Wechseljahren; eine beschwerliche Zeit mit hormonellen Schwankungen, die uns Frauen oft seltsame Bedürfnisse vorgaukelten. Ich hatte damals sogar ernsthaft überlegt, mir einen Kakadu ins Haus zu holen, um nicht an Freds Einsilbigkeit zu verzweifeln.
»Na ja. Um ehrlich zu sein, ich würde schon wollen.« Mit einem leicht verschleierten Blick betrachtete Berta ihre fangfrische Beute hinter Glas. »Zwecks der Romantik. Und weil alleine essen unlustig ist. Aber nur einen echten Kavalier, so einen wie bei Rosamunde Pilcher. Einen, der mich auf Händen trägt, absolut treu ist und mir beim Umstechen hilft. Und der einem nicht immer an die Wäsche geht. Ich mein, als Frau ist man heutzutage ja nur noch eine Mischung aus Putzfetzen und Sexobjekt.«
Ich versuchte, mir einen Mann vorzustellen, der hundert Kilo auf Händen trug. Es gelang mir nicht. Es gelang mir nicht einmal, mir einen Mann vorzustellen, der Berta ungefragt an die Wäsche gehen konnte, ohne dabei einen längeren Krankenhausaufenthalt zu riskieren. Aber meine Zweifel behielt ich vorsorglich für mich.
»Liz Taylor wurde aber nicht glücklich in ihrer Ehe«, wandte ich stattdessen ein.
»Ich würde auch niemals einen Bauarbeiter heiraten«, erwiderte sie, »der betoniert mir womöglich noch den ganzen Garten zu. Und ein Alkoholproblem oder gar Schwielen an den Händen hätte er wahrscheinlich auch.«
In Gedanken zog ich meinen Sonnenhut vor Bertas brachialromantischer Lebenseinstellung. Trotz rosaroter Brille jedes Haar in der Suppe zu finden war schließlich eine seltene Gabe.
»Na, dann vielleicht eher einen Kammerjäger. Mit Glacéhandschuhen«, merkte ich allzu leichtfertig an.
Das hätte ich besser nicht sagen sollen, denn nun fiel meiner Freundin erneut der Grund unseres Zusammenseins ein. Umgehend erlitt sie einen spontanen Stimmungsabfall. Der Instant-Seelenfrieden, der sie offenbar beim Gedanken an streichelzarte Gentlemen mit grünen Daumen erfasst hatte, war wieder dem Kampfmodus gewichen. Ich hätte mich ohrfeigen können für meine Dummheit, aber das würde auch nichts mehr ändern.
»Gut, dass du mich erinnerst«, meinte sie da schon und straffte Schultern, Tonfall und Bindegewebe. »Wir sind ja nicht zum Tratschen da. Die Brut muss fort, und zwar schnell, weil ich um elf einen Termin bei der Friseurin habe.«
Sie bewaffnete sich und leider auch mich mit ein paar neuen Gläsern.
»Was lässt denn machen beim Friseur?«
Bei streichholzkurzem pumucklrotem Haar schienen mir die Möglichkeiten gepflegten Hairstylings eher begrenzt zu sein.
»Ich dachte an ein paar Strähnchen. Vielleicht in einem leichten Lilaton. Das macht sich sicher hübsch. Rot allein ist doch ein wenig langweilig. Außerdem gehören die Spitzen geschnitten.«
»Lila. Mhm. Das ist bestimmt eine interessante Kombination, so wie Herbstastern im Kürbisgemüse.«
»Allemal besser als dein Friedhofsblond«, konterte sie.
Berta hatte Mut, keine Frage. Dass die lila Nuancen mit karottenrotem Stachelgurkenlook auf der Suche nach dem Traummann förderlich sein würden, glaubte ich allerdings nicht. Aber ich hatte bis vor fünf Minuten auch nicht geglaubt, dass ausgerechnet Berta der Sinn nach Hochzeitsglocken stand. In unserem Alter strebte man ja eher ein Dasein als lustige Witwe an. Ich zumindest könnte mir das nach fünfunddreißig Jahren Ehe durchaus vorstellen.
Weiter kam ich mit meinen Zukunftsträumereien allerdings nicht, denn Berta hatte sich schon wieder auf die Jagd begeben und robbte angriffslustig Richtung Staudenbeet.
»Du übernimmst das Herzgespann, ich die Akelei«, dirigierte sie mich resolut in die hintere linke Ecke des Schlachtfelds. »Und reiß dich bitte ein wenig zusammen. Du sollst den Viechern nicht ins Gewissen reden, du sollst sie finden, fangen und dann ins Glas mit ihnen. Den Rest erledige ich.«
»Ich find’s halt moralisch nicht ganz in Ordnung«, sagte ich. »Die Insekten könnten durch die Umsiedlung ein Trauma erleiden.«
»Ich habe durch sie bereits ein Trauma erlitten«, sagte sie, »Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie es so schön heißt.«
»Wie du meinst.« Ich ergab mich in mein Schicksal und hob als Zeichen meines versöhnlichen Willens eine mühsam freigelegte Maulwurfsgrille vorsichtig am Hinterteil hoch, um sie ins Glas zu setzen. »Aber nett ist die ganze Aktion trotzdem nicht.«
»Ich weiß. Ich will diese Oberdistelbrunner Heimgartentrophäe halt endlich gewinnen. Immerhin hab ich einen der schönsten Gärten im ganzen Dorf.«
Ich nickte, sie seufzte.
»Da rackert man sich das ganze Jahr über ab, schleppt tonnenweise Kompost durch die Gegend, gräbt Tausende von Blumenzwiebeln ein, gießt, düngt, jätet, hegt und pflegt rund um die Uhr, ruiniert sich das Kreuz und die Fingernägel, und dann war die ganze Mühe umsonst. Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie frustrierend das ist? Du steckst dein ganzes Herzblut in eine Sache rein, und alles, was du rauskriegst, ist ein lauwarmer Händedruck. Oder ein bedauerndes Lächeln.«
»Doch, das kann ich mir vorstellen.«
Und das stimmte sogar. Ich musste nur an meinen langen Schuldienst denken oder an meine fast ebenso lange Beziehung zu Alfred, und ich verstand genau, was sie meinte.
Ein paar Minuten bliesen wir beide einhellig Trübsal und hingen unseren mehr oder weniger mörderischen Gedanken nach.
Dann schrammte ich eine Karde, mein Kopfkino erlitt einen Filmriss, und die Realität hatte mich wieder. Wobei die Realität in diesem Fall auch noch genügend phantastische Züge trug. Um neun Uhr morgens mit Deckelgläsern Maulwurfsgrillen nachzustellen, um diese zum Exil zu bewegen, das konnte man beim besten Willen nicht als Alltagsbeschäftigung normal veranlagter Gartenbesitzer abtun. Wenn ich Berta so zusah, wie sie mit ihren Fettpolstern Gänseblümchen und Himmelschlüssel zur letzten Ruhe bettete, sich auf allen vieren im Kreis drehte, sich immer wieder mal hochwuchtete und mit dem Glas hektisch durch die Luft schlenkerte, dann erinnerte mich das eher an modernen Ausdruckstanz. Oder an Extremsport für Bewegungslegastheniker.
Nur gut, dass ihre sorgsam gestutzte Glanzmispelhecke blickdicht war. Nicht auszudenken, was die Leute bei unserem Anblick sagen würden. Wir wären garantiert Gesprächsthema Nummer eins im Ort. Noch vor der anstehenden Gartenschau auf Schloss Korallenburg, dem mysteriösen Herzinfarkt des Gansterer Gustl und der vaterlosen Schwangerschaft der Scherer Janine.
In Provinznestern wie Oberdistelbrunn wurde das gesellschaftliche Getriebe ja generell durch Klatsch, Tratsch und gemeine Gerüchte geschmiert. Was der Berta jetzt bestimmt am dicken A. vorbeiging, aber mir nicht. Einerseits, weil ich keinen dicken A. hatte, und andererseits, weil ich als ehemalige Lehrerin einen guten, um nicht zu sagen respektablen Ruf zu verteidigen hatte. Als Komplizin einer verwerflichen Racheaktion unter tierschutzwidrigen Bedingungen wollte ich keinesfalls dastehen. Als schlechte Nachbarin oder gar feige Freundin aber auch nicht. Daher schleppte ich mich weiterhin mit Bertas Einweckgläsern und meinen Bedenken ab. Letztere wogen schwerer.
Nach gefühlten drei Ewigkeiten beziehungsweise einer knappen Stunde rettete ausgerechnet mein Angetrauter mich aus meiner misslichen Lage.
»Paula? Bist du dort drüben?«
Sein grauer Haarschopf schob sich vorsichtig über die Hecke, gefolgt von zwei ängstlich aufgerissenen Augen hinter dicken Brillengläsern. Alfreds Anblick erfreute mich schon lange nicht mehr, seine Ausdrucksweise noch weniger. Ich hasste es, wenn er mich Paula nannte. Ich hieß Pauline, von Geburt an. Aber eine dritte Silbe war ich ihm nicht mehr wert. Mein Mann sparte mittlerweile an nahezu allem, an Bewegung, an Worten, ja selbst mit dem Denken geizte er immer öfter herum. Nur mit Kalorien sparte er zu meinem Leidwesen nie.
Unauffällig stellte ich das Deckelglas zur Seite und fragte: »Ist was?«
»Ich hab dich gesucht, überall, aber nirgends gefunden.«
»Und wo ist das Problem? Ich hab mich noch nie in Luft aufgelöst.«
»Du nicht, aber die Marillenmarmelade. In erster Linie hab ich ja die gesucht. Die Himbeermarmelade ist nämlich aus.«
Zumindest ehrlich war er, mein Fred, das konnte niemand bestreiten. Wobei ich persönlich ja der Ansicht war, dass er einfach zu faul war, um sich Notlügen oder Ausreden auszudenken. Aber in meiner derzeitigen Lage war mir jeder Vorwand recht, das Schlachtfeld zu räumen.
»Ich muss mal nach drüben«, erklärte ich der Zierquitte, hinter der ich Bertas Hinterteil zum letzten Mal gesehen hatte, und wandte mich rasch zum Gehen. Die Quitte raschelte leise zum Abschied. Oder vielleicht auch aus Protest, aber ich fragte nicht nach.
***
»Hallo, ich bin wieder da«, rief ich acht Stunden später in den dunklen Flur, mehr aus Gewohnheit denn aus Notwendigkeit. Solange der Kühlschrank gut gefüllt war und ihm kein Orkan die Tarotkarten vom Tisch wehte, schien es meinem Mann ziemlich egal zu sein, ob ich an- oder abwesend war. Außer er fand wie heute Morgen die Marmelade nicht, dann vermisste er mich immer noch.
Aber nach meinem ausgedehnten Ausflug in die Waldeseinsamkeit war ich versöhnlich genug gestimmt, um Freds Fressattacken ebenso zu verdrängen wie Bertas Maulwurfsgrillenmisere. Entspannt, wenngleich ziemlich müde, stellte ich den Korb mit Lungenkraut, Waldmeister, Faulbaumrinde und knotiger Braunwurz auf die Kommode, zog meine Wanderschuhe aus und betrat das Wohnzimmer. Nach der Grillenjagd bei meiner Nachbarin hatte ich definitiv fünf Kilometer Abstand zu jeglicher Zivilisation gebraucht, um wieder zu einem einigermaßen sozialverträglichen Wesen zu werden.
»Und, wie war dein Tag?«, begrüßte mein Mann mich, ohne den Kopf von seinen Karten abzuwenden. Dass wir seit über vierundzwanzig Stunden nicht mehr miteinander gesprochen hatten, sah man von der morgendlichen Marmeladesuchaktion einmal ab, war ihm gar nicht bewusst. Dabei hatte ich in den letzten beiden Tagen mehr erlebt als Fred in seinem gesamten Rentnerdasein.
»Großartig«, begann ich meine Erzählung. »Heute früh habe ich an einer Treibjagd teilgenommen, gestern bin ich in achtzig Tagen um die Welt gereist, und danach hat der Gansterer Gustl wegen seiner toten Sperber einen Herzinfarkt gekriegt. Oder besser gesagt: Ein Hahn war definitiv hin, die Henne lag im Sterben.«
Wie stets hörte Alfred mir nur mit einem Ohr zu, verstand höchstens ein Drittel und würde den Rest bis zum Abendessen vermutlich auch vergessen haben.
»Das klingt aber richtig spannend«, erwiderte er, während er eine Karte mit einer komischen Figur umdrehte, die einen Pokal zu halten schien. »Mir wäre Reisen ja viel zu anstrengend, aber sicher schön, wenn man mal was von der Welt sieht.«
Diesmal hatte er mir offenbar überhaupt nur mit einem halben Ohr zugehört.
Seine ganze Aufmerksamkeit schien dieser Karte zwischen seinen Fingern zu gelten, die er mit gerunzelter Stirn und zusammengekniffenen Augen hoch konzentriert fixierte, als würde er nach geheimen Hieroglyphen suchen.
»Wer ist gestorben, hast du gesagt?«
»Ein Sperberhahn. Ein entweder vom Teufel besessener oder gegen Bienengift allergischer Sperberhahn. Er hat Franzl geheißen. Und er hat dem Gansterer Gustl gehört, du weißt schon, der einsiedlerische Bauer, der hinter der Elsbeth und dem Pfarrhof wohnt, und der hat deshalb vor lauter Schreck einen Herzinfarkt gekriegt. Zumindest hat es so ausgesehen. Der Arme ist mir ja direkt vor die Füße gefallen.«
»Franzl. Mhm. Kenn ich nicht.« Er legte die Karte wieder ab. »Der Gustl tut mir allerdings leid, der war doch noch gar nicht so alt. Oder doch? Wahrscheinlich zu viel getrunken. Aber Hauptsache, dir ist nichts passiert.« Er nahm die Karte wieder auf. »Wann gibt es denn eigentlich Abendessen?«
»Bald.«
»Kaiserschmarrn wär super. Du hast schon ewig keinen Kaiserschmarrn mehr gemacht. Mit Zwetschgenröster.«
»Ich hab erst vorige Woche Kaiserschmarrn gemacht. Mit Zwetschgenröster.«
»Sag ich ja, eine Ewigkeit her.«
Es gab Tage, da konnte ich die Sinnhaftigkeit von Eheschließungen nicht einmal mehr im Promillebereich ausmachen. Ach was, Tage. Eigentlich erging es mir bereits seit Jahren so. Wir teilten Bett, Tisch und allfällige Haushaltsausgaben, aber unser Leben verlief längst in getrennten Bahnen.
Ich seufzte. Was hätte ich auch sagen können? Sollte Fred halt seinen Kaiserschmarrn haben. Dafür würde er die nächsten drei Tage nur noch Gemüse serviert bekommen. Mein Mann litt bereits unter Diabetes, Bluthochdruck, Krampfadern und Gichtzehen, da brauchte er keine Fettleber mehr.