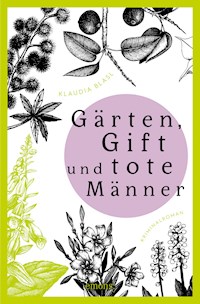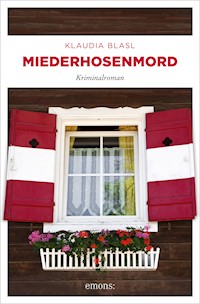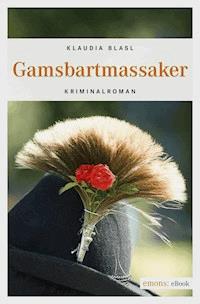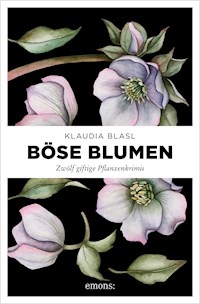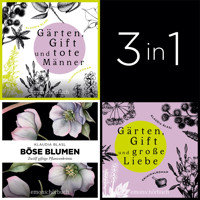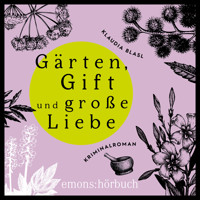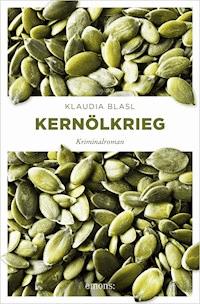
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Damischtal-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine aberwitzige Reise in die giftige österreichische Provinz Im Damischtal ist die Hölle los: Profitgierige Politiker und skrupellose Immobilienhaie wollen doch glatt ein Kraftwerk mitten in die ländliche Idylle bauen. Und das, obwohl der Tourismus die nahezu einzige Einnahmequelle der Region darstellt – es wäre eine Katastrophe für Mensch, Natur und Gemeindesparstrumpf. Doch im Kampf der Dorfbewohner gegen das verhasste Bauprojekt scheint jemand über Leichen zu gehen: Als bereits der zweite stark mit Schilcherwein alkoholisierte Tote mit einer Doppeldosis Gift im Blut im Bach liegt, wird klar, dass dies kein Zufall sein kann ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaudia Blasl ist süchtig nach gutem Essen. Kaum hat sie Hunger, kommt sie auf böse Gedanken. Kein Wunder also, dass die gebürtige Steirerin als Kolumnistin und Kulinarikjournalistin tätig ist. Wegen ihrer kalorischen Triebhaftigkeit hat sie bereits die halbe Welt bereist und lange Jahre in Italien verbracht, wo sie begann, die Zeit zwischen den Mahlzeiten mit »Auftragsmorden« totzuschlagen. Heute lebt die Germanistin vorwiegend im Südburgenland, sofern sie nicht gerade auswärts isst oder unliebsame Zeitgenossen ins Jenseits befördert.
Alle Charaktere, Handlungen, Orte und wirtschaftspolitischen Unterstellungen sind frei erfunden und stimmen in keinem Fall mit der Wirklichkeit überein. Dort, wo Schilcher, Kernöl und Käferbohnen zu Hause sind, dort leben nach wie vor freundliche, friedliche, offenherzige und hilfsbereite Menschen, die bis heute niemandem etwas zuleide getan haben, weder mit Waffen noch mit Worten. Daher ist das Einzige, was der Besucher bei einem längeren Aufenthalt in dieser Gegend riskiert, seine schlanke Figur. Ein Glossar der Austriazismen und Dialektausdrücke sowie ausgewählte Kochrezepte befinden sich im Anhang.
©2018 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: mauritius images/Cultura/Diana Miller Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer Umsetzung: Tobias Doetsch Lektorat: Susanne Bartel eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-348-6 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Es strahlt die Sonn, es lacht das Leben,
die Hügel stehen voller Reben.
Vom Bremsnigg bis zum Wadlpass
reiht sich nun langsam Fass an Fass.
Weil grad, wenn vieles schiefgelaufen,
erfreun die Leut sich hier am Saufen.
Und hat mal wer den Grantscherm auf
– wen schert’s, wir trinken einfach drauf.
Jodel du dö jodel di dai,
das Damischtal macht mich ganz hai.
Auszug aus der Damischtaler Hymne
Die Bewohner vom Damischtal
Alois Feyertag
Bürgermeister von Gfrettgstätten und Plutzenberg und erklärter Feind von Wasserkraftwerken und Ferienwohnungen.
Balthasar Schragl
Situationselastischer Fremdenverkehrsobmann vom Damischtal, Träger des Goldenen Verdienstzeichens der heimischen Blasmusik und betrügerischer Wegbereiter der Wasserkraft.
Bartl Mostburger
Fleischer mit dubiosen Geschäftspraktiken und bedrohlichen Umgangsformen, der immer wieder Leichen angelt.
Bibiana Doppler
Feinstofflich veranlagte Schönheit auf der ständigen Suche nach potenziellen Besamern, um endlich in den Stand der Mutterschaft zu treten.
Familie Bartenstein
Deutsche Feriengäste, die während ihres mehr oder weniger freiwilligen Aufenthalts im Damischtal Kopf, Kragen und Ehekrisen riskieren.
Ferdinand Kapplhofer
Revierinspektor vom Damischtal, dessen einzige Bewegung darin besteht, jeder Bewegung aus dem Weg zu gehen– sofern er sich nicht gerade bei Muttern am Küchentisch den Bauch vollschlägt.
Gusti Birnstingl
Betreiberin der Buschenschank »Zur schönen Aussicht«. Die hübsche Gusti muss sieben Kinder, noch mehr Pensionsgäste und einen alkoholkranken Mann durchfüttern.
Hermine Holzapfel
Moralinsaure Obfrau der ansässigen katholischen Kernölkoalition, der die christliche Nächstenliebe abhandengekommen ist.
Hubert Ehrenhöfler
Damischtaler Umweltschutzreferent und einziger grüner Gemeinderat, der zur Rettung der Damisch-Auen in den Hungerstreik tritt.
Kevin-Karl Bartenstein
Sohn von Rüdiger und Hildegund Bartenstein; ein aufgeweckter Junge, der mit seiner kriminalistischen Spürnase zum Helden der Region wird.
Peter Protzmann
Immobilienhai und Bauunternehmer, der die Damisch weniger als Fluss denn als Quelle zukünftigen Reichtums sieht. Sorgt mit fetten Zuwendungen dafür, dass die Dinge meist wie geschmiert laufen.
Polizeihauptmann Hartmuth van Trott
Ergebnisorientierter Emotionsminimalist vom Landeskriminalamt mit einer Vorliebe für Brachialrhetorik und Bleistiftminen.
Sebastian Schnurz
Verantwortlich für das Kleinkraftwerk an den Flussauen der Damisch, Fachmann für behördliche Winkelzüge, doch wenig versiert im Umgang mit Wasserleichen.
Willibald Pfnatschbacher
Prolog
Wir befinden uns im Jahre 2020 nach Christus. Ganz Österreich erbebt unter umweltpolitischen Rückzügen und wirtschaftspolitischen Vorstößen, schmierigen Korruptionsskandalen und schmutzigen Campaigning-Affären. Nun ja, beinahe ganz Österreich. Denn in einem kleinen südweststeirischen Tal verläuft das Leben weiterhin in gewohnt gemächlichen Bahnen. Skandalös genug, dass der liederliche Bankert von der Strammelbock Xandi mit einer Zuagroasten liiert ist und der blade Bauernschädl von Bartl einen immer mit dem Gselchten bescheißt; wen soll da noch die Volkswirtschaft bekümmern? Und während rundherum gewagte Kraftwerksbauten und gewitzte Bankenmanager bedrohliche Löcher ins Budget reißen, reißen die Menschen aus dem idyllischen Damischtal schlimmstenfalls das Maul auf, aber auch nicht immer und meist nur untereinand. Etwa dann, wenn sie, je nach Alter und Geschlecht, am Wirtshaus- oder Küchentisch sitzen und die Lage der Nation kritisieren. Sofern es nichts Wichtigeres zu bereden gibt. Dass in Gfrettgstätten schon wieder eine Kuh in die Klärgrube gestürzt ist, ist selbst in Plutzenberg von lokaler Relevanz. Und das ernüchternde Überholverbot zwischen Buschenschank und Schrottfriedhof erscheint von nahezu weltpolitischer Brisanz. Zumindest solange nichts Schlimmeres passiert. Aber das war bislang nur vereinzelt der Fall.
Zwar hauen die an Ackerland vermögenderen Plutzenberger bei den einwohnermäßig bessergestellten Gfrettgstättenern gern mal auf den Festzeltputz, und hin und wieder– vor allem in der Bärlauchzeit– fällt ein rüstiger Rentner in den Bach, aber das war’s dann auch schon. Alleine die motorsportliche Jugend sorgt mit ungebremster Lebenslust für sporadischen Polizeieinsatz und ein Umsatzplus beim Autohaus.
Davon abgesehen gleicht das Tal einem beschaulichen Bollwerk der Gemütlichkeit. Die Damisch windet sich sanft und träge zwischen Kürbisäckern, Kukuruzfeldern und Klapotetzen dahin, die Damischtaler– etwas weniger sanft, manchmal sogar rege– wenden sich derweil ihrem mehr oder weniger rechtschaffenen Tagwerk zu. Doch der Unterschied zwischen Gut und Böse fällt Fremden kaum ins Auge. Viel auffälliger sind die vielen Rehe, Rebstöcke und Rapunzeltürmchen, die der Landschaft einen beinahe bukolischen Reiz verleihen.
Petri Unheil
»Himmelarsch noch amoi«, fluchte der Mostburger Bartl und starrte mit zusammengekniffenen Augen angestrengt in die trüben Fluten. Was da an seiner Angel hing, sah gar nicht nach einer Bachforelle aus. Nicht einmal nach Brachse, Barsch oder Weißflossengründling. Bartl starrte und starrte, aber seine Schweinsäuglein erlaubten keinen Adlerblick. Im Grunde genommen hätte der Fleischermeister ja längst schon eine Brille gebraucht, aber Zeitungen oder gar Bücher las er nicht, und fürs Verwurschten einer Sau benötigte er weder Scharfsicht noch Fingerspitzengefühl. Das schaffte er selbst in völliger Finsternis. Wobei die manchmal recht dubiosen Füllstoffe seiner Hauswürstl ohnedies nicht wirklich tageslichttauglich waren.
Jetzt allerdings hätte der Bartl gerne mehr Weitsicht bewiesen, denn ein falscher Fang hatte ihn schon einmal ins Gefängnis gebracht. Unter Mordverdacht hatte er damals gestanden. Dabei hatte er nur einen armseligen ertränkten Mops aus dem Wasser gezogen, der dummerweise einer strangulierten Blondine gehörte. Zwar hatte sich schon bald seine völlige Unschuld herausgestellt, aber beim Gedanken an diese schreckliche Zeit stieg ihm immer noch die Grausbirn auf. Hinter schwedischen Gardinen saß es sich spürbar schlechter als daheim auf dem Sofa. Oder hier, am Ufer der Damisch.
Und weil er keinesfalls zum Rückfalltäter werden wollte, verzichtete der griesgrämige Schinkenspezialist fernab der Arbeit rigoros auf Schweinereien jeglicher Art. Zwar waren seine viel gerühmten und formvollendet geräucherten Klapotetzkeulen mittlerweile in aller Munde, aber über seine teils wahre, teils erfundene verbrecherische Vergangenheit zerrissen sich die Leute gleichfalls gerne das Maul. Daher verbrachte er seine Freizeit lieber am Gestade des Bachs, hing seinen bescheidenen Gedanken nach und hoffte auf einen ebensolchen Fang. Was bis vor zwei Wochen auch stets zu seiner vollsten Zufriedenheit geklappt hatte. Während er sich über Vaterschaftsstreitigkeiten in der Nutzviehzucht oder aktenkundige Fälle der Schweinepest ein wenig den Kopf zerbrochen hatte, hatte sich zuverlässig ein fetter Fisch an seinem Angelhaken verschluckt. Doch dann waren– auf Geheiß eines korrupten Wirtschaftslandesrates und zur Freude der Immobilienhaie– auf einmal diese verdammten Baumaschinen angerückt, um die idyllischen Flussauen zum Zwecke eines Kraftwerkbaus in einen Kahlschlag zu verwandeln. Verstört hatten die meisten Fische die Flossen eingezogen und waren in ruhigere Gebiete abgetaucht. Und Bartls geistiges Naherholungsgebiet war gleichfalls den Bach runtergegangen. Nun musste der Fleischer sich oft tagelang in Geduld üben, damit er auch nur eine einzige, winzige Forelle zu fassen bekam. Von klaren Gedanken ganz zu schweigen. Diese erdbewegenden Höllenmaschinen sorgten nicht nur für weltuntergangsmäßige Naturzustände, sondern auch für ohrenbetäubenden Lärm. Ein akustischer Terror, der die Wasserbewohner in die Flucht schlug und ihn nahezu in den Wahnsinn trieb.
Seit dieser Invasion des Schreckens saß der Bartl Mostburger also entnervt unter den ausladenden Kronen jahrhundertealter Bäume, warf lustlos seine Angelschnur aus und harrte frustriert der Dinge, die da kamen. Badelatschen, Baseballkappen oder Plastikeimer, Bauschutt und– hin und wieder, aber zunehmend seltener– eben Bachforellen, Brachsen oder Weißflossengründlinge. Solche Fische hatte er in den letzten Tagen bereits aus dem Wasser gezogen, doch dieser Fang ähnelte nichts von alledem. Bartl musste bei ihm eher an einen riesigen, auf Hochglanz polierten Karpfen denken. Allerdings gab es in dem verdreckten Fließgewässer keine Karpfen. Was also suchte er da gerade an Land zu zerren? Da die Leine sich offensichtlich an einem Stück Treibgut verfangen hatte, konnte der Fleischer seine ungewollte Beute nicht nahe genug heranholen, um Genaueres zu erkennen. Fluchend rappelte er sich aus seinem meditativen Anglerkoma auf, schlüpfte in die Gummistiefel und schlurfte ins Wasser. Angesichts der großräumigen Rodungen, denen bereits zahlreiche Schwarzerlen, Purpurweiden und Schilfgräser zum Opfer gefallen waren, hatte Bartls Sehschwäche schon fast wieder etwas Tröstliches an sich. Zumindest ersparte sie ihm den detailreichen Anblick abgerissener Äste und entwurzelter Sträucher, die im Fluss vor sich hin dümpelten und jedes Vorwärtskommen zu einem Hindernislauf machten.
»So ein Schas.« Erbost trat der Fleischermeister von Gfrettgstätten gegen einen Haufen ineinander verkeilter Haselbüsche, der gleich Strandgut ans Ufer gespült worden war. Wie eine illegale Deponie für Baumschnitt-, Bauschutt- und Gartenabfälle sah der Bach mittlerweile aus, fand Bartl. Vom schlammigen Braun seiner einst kristallklaren Wässer ganz zu schweigen. Aber reden wollte der Bartl eh nicht. Statt zu rhetorischen Rundumschlägen auszuholen, griff er lieber zum Schlachtschussapparat. Und würde er können, wie er wollte, hätte er die Kraftwerksverantwortlichen schon längst ganz still und leise durch den Fleischwolf gedreht.
Nun war es aber keinesfalls so, dass ausgerechnet der Mostburger Bartl zum militanten Umweltschützer mutiert wäre. Oder ein tiefes Bewusstsein für die Schönheiten intakter Natur entwickelt hätte. Er konnte ja nicht einmal einen Brombeerstrauch von einer Rolle Stacheldraht unterscheiden, und ökologischer Landbau lag ihm gedanklich so fern wie die Andromedagalaxie. Zudem liebte er sein Schlachterhandwerk. Ein lang gezogener Saurüssel erfreute ihn weitaus mehr als ein adrett arrangiertes Blumengebinde.
Insofern ging ihm auch der Massenmord an Sumpfdotterblumen und Flatterulmen nicht näher als der Tod eines Handlungsreisenden am kanadischen Barnaby River. Was ihn in Rage versetzte, war vielmehr der Verlust seines angestammten Jagdreviers. Immerhin hatte er sich sein Recht auf Fischfang in dieser idyllischen Outdoor-Einsiedelei in mehr als sieben Jahren ehrlich ersessen. Und der Wasserkraftwahn machte ihm nun dieses Gewohnheitsrecht auf sein wildwüchsiges Refugium mit Schaufelbaggern zunichte, während die Fischbestände zuhauf den Jordan runterschwammen. Das war dem Fleischer ganz und gar nicht wurscht. Im Gegenteil. Bartl empfand den Rauswurf aus seinem höchstpersönlichen Paradies als lebensbedrohlichen Raubbau an seiner Existenz. Schließlich lebte der Schinkenproduzent vor allem von kaufkräftigen Touristen, die– ausgehungert von ausgedehnten Wanderungen durch die Damisch-Auen, Frischluft macht ja bekanntlich Appetit– in seine Genuss-Fleischerei strömten und das Delikatessenregal plünderten. Ein pfeffriges Sülzchen hier, dreißig Deka von der aromatischen Klapotetzkeule dort, dazu Berge an Selchwürstln, Kübelfleisch und Kernölgrammeln ließen seine gesetzeskonform angeschaffte Registrierkasse von morgens bis abends klingeln. Doch seit diese Armee an Baggern und Planierraupen wie eine Horde Tyrannosaurier ins Damischtal eingefallen war, verkehrten die Touristen fernab in lauschigeren Gegenden. Und die Würstl verschimmelten im Regal. Das zu Dumpingpreisen aus dem Ausland importierte Rudel an Bauarbeitern stellte keine gewinnbringende Alternative zu den Urlaubern dar, denn die halbstarke Bagage schien sich nur von Extrawurstsemmeln zu ernähren. Bereits die Frage nach einem derart banalen Fleischereierzeugnis an seiner Theke empfand der Bartl als persönlichen Affront. Und wenn darauf noch die umständlich mit Händen und Füßen formulierte Bitte nach einem Essiggurkerl folgte, hätte er den kulinarischen Blindgängern am liebsten einen ordentlichen Tritt in den Hintern versetzt. Aber aufgrund seines Vorstrafenregisters durfte er sich keinen Fehltritt mehr leisten. Nicht einmal mehr den in den Allerwertesten dieser ungarischen Extrawurstsemmeljunkies.
Bartl fluchte erneut und kämpfte sich resigniert durch das Dickicht im Damischtaler Bachbett. Das Leben war definitiv ein Jammertal, fand er und strauchelte tapfer voran. Aus der Ferne betrachtet glich sein Gang, wie er sich mühsam zwischen gefällten Baumkronen und angeschwemmtem Baustelleninventar hindurchzwängte, einer etwas ungelenken Art von modernem Ausdruckstanz. Als würde ein Orang-Utan sich am »Schwanensee« versuchen. Nach einer gefühlten Ewigkeit und zwei Dutzend schmerzhaften Insektenstichen hatte er dennoch sein Ziel, die verwickelte Angelschnur, erreicht. Und riss vor Schreck die Augen auf. Was dort zwischen einer verrotteten Europalette und verwelkten Wasserhyazinthen an seinem Haken hing, übertraf seine schlimmsten Befürchtungen. Selbst ein weiterer gemeuchelter Mops hätte ihn weniger schockiert als dieses schmutzig weiße glänzende Objekt.
»Herrgott noch amoi«, entfuhr es ihm, bevor er– um sich beidseitig ausreichend abzusichern– auch noch ein Stoßgebet gen Hölle sandte. Ob göttlicher Beistand oder teuflische Tücke, den Fleischer hätte beides erfreut, doch weder der Gottvater noch der Beelzebub ließen sich blicken.
Bartl atmete tief durch und versuchte es stattdessen mit bodenständigem Stressmanagement. Er griff sich lange in den Schritt, kratzte sich noch länger am Kopf und fixierte ganz lange den linken Rand der Europalette.
Doch der grässliche Anblick blieb.
Der Fleischer, dessen normalerweise cholerisch-rötliches Gesicht mittlerweile einen leichenblassen Teint angenommen hatte, musste etwas unternehmen. Allein, er wusste nicht, was. Sein geistiges Trägheitsmoment erwies sich als äußerst hinderlich für schnelle Entscheidungen.
Doch nun war rasches Handeln angesagt. Er wollte nicht erneut im Zuchthaus landen, nur weil er– wie vor vier Jahren– zur falschen Zeit am falschen Ort geangelt hatte.
Bartl nahm seinen ganzen Mut zusammen und griff mit klammen Fingern nach dem verdreckten Schutzhelm, den er schon so oft auf dem kahlen Kopf des Baupoliers gesehen hatte. Und der bestimmt auch jetzt auf dessen glatzertem Schädel saß. Ohne nachzusehen, konnte das der Fleischer natürlich nicht mit letzter Gewissheit sagen, aber die verschrumpelte Hand, die die verwelkten Wasserhyazinthen noch im Tod zu umklammern schien, gehörte eindeutig zu einem Menschen. Und deutete, so wie sie dalag, auf eine unzerteilte Leich hin. Aber der Bartl verspürte nicht das geringste Verlangen auf Sondierungs- oder gar Bergungsarbeiten. Für Wiederbelebungsversuche war es ohnedies zu spät, das sagte ihm sein schlachterischer Hausverstand. Erneut kniff er die Augen zusammen und riss mit aller Kraft an der Angelschnur. Wenn ihm das Schicksal auch nur ein ganz klein wenig hold wäre oder ihm zumindest eine homöopathische Dosis an Petri Heil zuteilwerden ließe, dann hatte die Leine sich nicht an einer Gürtelschnalle, einem Reißverschluss oder der Stahlkappe eines Sicherheitsschuhs verfangen, sondern nur an irgendwelchen fleischlichen Weichteilen. Und die würden einreißen, wenn er nur ordentlich zog und zerrte.
Der Bartl hatte Glück. Nachdem er zögerlich Hand an die Oberbekleidung des Toten gelegt hatte, kam die Leine tatsächlich frei. Dem Fleischer fiel ein Selchstelzen vom Herzen, vielleicht sogar eine ganze Sau. Energisch kurbelte er an der Spule seiner Angel und trat rasch den Rückweg Richtung Ufer an. Behände, wenngleich nicht sonderlich beherzt, bewältigte er erneut die Hindernisstrecke, die ihn vom rettenden Festland trennte, ständig auf der Hut vor zufälligen Passanten oder arbeitseifrigen Kranfahrern, die neugierige Blicke in seine Richtung warfen.
Aber außer einer strahlenden Mittagssonne ließ sich beruhigenderweise nichts und niemand sehen. Die Hackler vom Bau schienen offenbar gerade ihre Wurstsemmeln zu verschlingen, die Hausfrauen den heimischen Herd zu befeuern, und die Hundehalter aus dem nahen Doggy Wellness& Human Beauty Spa Resort ließen sich wahrscheinlich ihre müden Füße massieren.
Eilig raffte der Fleischer sein Angelzeug zusammen und rannte, so schnell es ihm mit Gummistiefeln, Gichtzehen und löchrigen Socken halt möglich war, zu seinem Traktor. Dass er seinen alten Steyr zwischen zwei üppigen Holunderbüschen abgestellt hatte, um keiner Baumaschine im Weg zu stehen, kam ihm nun sehr zugute. Rasch startete Bartl das alte Gefährt und tuckerte auf wenig befahrenen Feldwegen nach Hause.
Vor lauter imaginären Schreckensszenarien nahm er nicht einmal die drei possierlichen Feldhasen wahr, die ihm beinahe vor die Räder gehoppelt wären. Vermutlich hätte er selbst ein Mammut übersehen, denn in seinem Kopf schleuderten unheilvolle Gedanken herum. Was, wenn ihn doch jemand bemerkt hätte, wie er da soeben mitten im Bach einem Toten beinahe das letzte Hemd ausgezogen hatte? Was, wenn es tatsächlich so etwas wie Spurensicherung gäbe– Bartls Kenntnisse polizeilicher Ermittlungsarbeit beschränkten sich auf den sporadischen Konsum des »Bullen von Tölz«– und man an einer Wasserleiche Fingerabdrücke feststellen könnte? Und vor allem, was, wenn dieser zuwidere Schmalspurkommissar wieder mit den Untersuchungen betraut würde? Dann würde es nicht lange dauern, bis die Klauen des Grazer Polizeischnösels ihn zum dritten Mal ergriffen und in Handschellen aus seinem Selchkammerl zerrten. Dabei sah der Exekutivposten nicht einmal aus wie eine Amtsperson, sondern eher wie ein Sujet auf einem Werbeplakat für die Welthungerhilfe.
Dennoch würde Polizeihauptmann van Trott ihn mit allergrößtem Vergnügen erneut in den Knast verfrachten. Nur weil er sich schon wieder eine Leiche geangelt hatte. Wie seinerzeit vor vier Jahren. Wo er jenem ersoffenen Mops nicht einmal ein einziges Haar gekrümmt hatte. Und dem glatzerten Polier heute auch nicht. Der Bartl zog seinen Kunden hie und da ganz gerne mal das Fell über die Ohren, aber ein Halsabschneider war er deshalb noch lange nicht. Selbst seine rosigen Schinkenlieferanten wurden ordnungsgemäß mit der Bolzenschussmaschine ins Würstlnirwana befördert.
Immer komplexer wurden Bartls Gedankengänge. Eine derartige geistige Tiefenschärfe hatte er nicht einmal bei seiner Meisterprüfung an den Tag gelegt.
Dass er mit heiler Haut und gutem Ruf davonkommen würde, weil er tatsächlich nicht gesehen worden war und weder seine Finger noch der Angelhaken verwertbare Spuren an dem Toten hinterlassen hatten, glaubte er immer weniger. Er hatte zwar viele Schweine, aber dennoch selten Glück. Und an einen Unfall glaubte er auch nicht. Zudem begann seine linke Gichtzehe heftig zu zwicken und zu zwacken, was stets ein schlechtes Zeichen war.
Doch bevor Bartls intellektuelle Höchstleistungen wegen Überhitzung des Denkapparats gänzlich abflauen konnten, erreichte er endlich seinen Hof.
Erleichtert stellte der Fleischer den Traktor in den Schuppen, ergriff die Angelutensilien und beschloss, seinen Nerven zuliebe erst einmal das Denken einzustellen und sich stattdessen den Bauch vollzuschlagen. Mit einem g’scheiten Gselchten, zwei Verhackertbroten und mindestens drei Glas Schilcher sah die Welt bestimmt schon viel schöner aus.
Bartl schloss den Schuppen ab, durchquerte die Scheune, warf einen Blick in seine Selchkammer und schlurfte bereits ein wenig weniger bedrückt zu seinem Wohnhaus. Deftiges Essen und ordentliches Trinken galten im Damischtal ja generell als veritable Stimmungsaufheller, ganz nach dem Motto: »Mit voller Wampe blunznfett ist’s Leben vielleicht doch ganz nett.«
Zwar glaubte der Fleischer schon längst nicht mehr an Nettigkeiten, aber zumindest würde ihm sein Dasein nach einem üppigen Imbiss erträglicher scheinen.
Ein tröstlicher Gedanke, der den Bartl auf seinen letzten Metern bis zur Eingangstür begleitete, wo der Hubert Ehrenhöfler im Schatten des riesigen Kastanienbaums stand und ihn herausfordernd ansah.
Wasserleich mit Schilcherrausch
»Jetzt nimmst aber noch einen Knödel, Bua, vom Kraut allein wird des Schweinsbratl nicht fett«, befahl Theresia Kapplhofer, legte ihrem Sohn noch zwei pausbäckige Erdäpfelknödel auf den bereits vollen Teller und goss liebevoll einen ganzen Schöpflöffel Bratensaft darüber. Die Mutter des Damischtaler Revierinspektors hatte in der Aufzucht und Mast von Fettzellen ihre Lebensaufgabe gefunden. Rund um die Uhr werkelte sie maximal eine Topflappenlänge vom Herd entfernt, ständig um das leibliche Wohl ihres stattlichen Nachwuchses bemüht. Und der Inspektor wusste ihre hochkalorische Zuwendung sehr zu schätzen. Die Pflege seines seit Jahrzehnten aufopfernd kultivierten Feinkostgewölbes lag ihm ja selbst außerordentlich am Herzen beziehungsweise im Magen.
Wobei Schweinsbratl mit Sauerkraut und Knödel zu den Grundpfeilern seiner Instandhaltungsdiät zählten. Voller Elan und Begeisterung, zwei Tugenden, denen sich Ferdinand Kapplhofer ausschließlich am gut gedeckten Esstisch hingab, griff der Inspektor nach Messer und Gabel. Er hatte einen appetitlich dampfenden Braten vor und einen ereignislosen Arbeitstag hinter sich, mehr wünschte er sich nicht. Zielstrebig führte er den ersten Bissen zum Mund, riss diesen weit auf und schlug die Zähne ins zarte Fleisch. Im selben Moment wurde auch die Tür aufgerissen, und Bürgermeister Feyertag, flankiert vom Umweltschutzreferenten Ehrenhöfler, betrat den Raum.
»Da schau her, der Herr Inspektor geht seiner Lieblingsbeschäftigung nach«, frotzelte Alois Feyertag und schritt beschwingt zum Küchentisch, während Hubert Ehrenhöfler abwartend neben der Tür stehen blieb. »Aber jetzt müssen wir dich leider ein bissl auf Diät setzen, gell, Hubert«, fuhr der Bürgermeister fort und nahm dem verdutzten Inspektor den Teller weg.
Kapplhofer schluckte. Mundraub war ein Verbrechen, das seiner Ansicht nach sogar die Wiedereinführung der Todesstrafe rechtfertigen würde. »Was in aller Welt is denn passiert?«, stammelte er und versuchte, nach seinem entzogenen Futter zu greifen, doch der Bürgermeister hatte den Braten vorsorglich außerhalb seiner Reichweite platziert.
»Jetzt lassenS’ den Buam doch was Anständiges essen«, mischte sich nun auch Theresia Kapplhofer ein, während sie Anstalten machte, den Teller erneut seinem rechtmäßigen Esser zuzuschieben.
Doch der Bürgermeister besaß eine lange Hand. »Der Bua braucht keinen Schweinsbraten mehr, wir servieren ihm gleich a g’schmackige Leich«, kommandierte er unnachgiebig.
»Und wennst dann immer noch Hunger hast, kannst den Braten ja kalt auch essen«, spendete Ehrenhöfler tröstenden Zuspruch.
Kapplhofer geriet in Panik. Eine Leiche in seinem Revier verdarb ihm schon beträchtlich den Appetit, da er den Anblick von Verbrechensopfern kaum gewohnt war. Er hatte hauptsächlich mit Scheintoten zu tun, also stammtischgesättigten Schnapsleichen, wahlkampfbedingten Hirntoten oder kurvenschnittigen Bruchpiloten, nur ganz selten mit vorsätzlichem Mord und Totschlag. Allein die Vorstellung davon schlug ihm spürbar auf den Magen, während ihm der gemeinschaftliche Einmarsch dieser beiden unversöhnlichen Kampfhähne in seine gute Stube nahezu eine Spontangastritis verursachte.
Feyertag und Ehrenhöfler, politische Todfeinde bis zum beidseitigen Rufmord, traten ungefähr so häufig gemeinsam auf wie Ebbe und Flut. Es musste also etwas unfassbar Tragisches vorgefallen sein. Etwas, das Kapplhofers gemächlichen Tagesablauf garantiert auf ungesunde Touren bringen würde.
»Habens’ wen um’bracht, brauch ich die Uniform?«, fragte Kapplhofer alarmiert. »Oder gar eine Waffe?«
Erst ein einziges Mal in seiner mittlerweile fast zwanzigjährigen Dienstzeit hatte der Inspektor mit seiner Pistole auf einen Menschen gezielt– und das auch nur auf Befehl der Obrigkeit. Und mindestens zwei Meter daneben. Den Finger am Abzug hatte er– abgesehen von den behördlich vorgeschriebenen Trainingseinheiten– hingegen noch nie gekrümmt. Einen Menschen zu verletzen oder gar zu töten stellte er sich schlichtweg traumatisierend vor. Freiwillig würde er niemals schießen, weder beim Schützenfest noch auf Moorhühner. Und das wollte er auch weiterhin so halten.
»Derschießen brauchst ihn eh nimmer, weil der is schon tot«, meinte der Bürgermeister. »Der liegt im Bach, warum, wissen mir auch nicht. Wir haben ihn selbst noch nicht g’sehen. Und jetzt tummel dich, die Arbeit ruft.« Dabei brachte er sich in Positur, als wäre er ein steinernes Mahnmal für Pflicht und Ordnung, schlug mit der Faust auf den Tisch, dass der Bratensaft über den Tellerrand spritzte, und fast schien es, als wollte er den Revierinspektor an seinem alten, ausgewaschenen Kapuzenpulli über den Tisch schleifen. »Aber vorher ziehst dir noch schnell dein Dienstgwandl an, kommst ja sonst daher wie dem Unterkofler seine Vogelscheuch.«
Der Kukuruzacker des alten Bauern war wegen seiner seltsamen Strohpuppe zu einem beliebten Ausflugsziel der Einheimischen geworden. Der selbst gebaute Amselschreck sah aber auch wirklich äußerst ungewöhnlich aus. An die drei Meter hoch, thronte das Ungetüm auf einem Rundballen Heu, balancierte einen ausgedienten Melkapparat auf dem Kopf und war behängt mit Kleidungsstücken, die augenscheinlich aus dem ehemaligen Einzugsgebiet des Warschauer Pakts stammten.
Kapplhofer seufzte. Seine optischen Fehltritte hatten ihm vor einigen Jahren beinahe ein Disziplinarverfahren wegen mangelnder Sorgfaltspflicht gegenüber seiner Uniformjacke eingebracht. Er habe sich in Ausübung seiner Pflichten zu wenig zugeknöpft gezeigt, hatte der Vorwurf gelautet. Als ob er die Gesetze mit korrekt gebundenem Schlips und ordnungsgemäß geschlossenen Knöpfen besser hüten könnte. Aber was verstanden diese innerstädtischen Schreibtischtäter schon vom Leben auf dem Land. Seitdem war er allerdings sensibilisiert, was seine öffentlichen Auftritte betraf. Von denen ihm ein weiterer offenbar bevorstand.
»Is ja gut, ich komm schon.« Missmutig zwängte er sich zwischen Herrgottswinkel, Tischbein und Bürgermeister hindurch und schlurfte mit der ihm eigenen Langsamkeit aus der Küche, um sich standesgemäß zu adjustieren. Der Inspektor verfügte ja generell nur über einen äußerst sporadischen Bewegungsdrang. Und der erschöpfte sich ausreichend zwischen Kühlschrank, Esstisch und Hobbykeller, wo er mit großer Leidenschaft und noch größerem Fingerspitzengefühl an seinen Buddelschiffen herumbastelte. Wie gern hätte er heute noch die filigrane Ankerwinde fertig gefräst und auf dem Vordeck der HMS Bounty angebracht, um den legendären Dreimaster endlich in sicherem Glas versenken zu können. Aber nein. Stattdessen hatte sich irgend so ein Pleampel in die ewigen Jagdgründe befördert. Oder gar befördern lassen. Und das ausgerechnet in seinem friedvollen Revier, wo außer Sabotageakten an landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Handgreiflichkeiten auf dem Feuerwehrfest oder spontaner Eigentumsübertragung von Kukuruzkolben kaum kriminelle Aktivitäten zu verzeichnen waren. Nicht einmal die hundertsiebenundzwanzig Flüchtlinge, die bis vor Kurzem im leer stehenden Plutzenberger Krankenhaus untergebracht gewesen waren, hatten Anlass zu ernsthaften Amtshandlungen gegeben. Gerade mal ein Dutzend verbale fremdenfeindliche Angriffe von ein paar ewig gestrigen Einheimischen hatte er ahnden müssen. Doch mit den Neuwahlen hatte der Staat einen ideologischen Umkehrschwung Richtung Vergangenheit eingelegt, die unwillkommenen Ausländer zurück ins Ausland verfrachtet, die Sozialhilfeempfänger mit einem Hungertuch abgespeist und die Meinungsfreiheit der Medien ärger beschnitten als Feyertag nun seine heiß geliebte Essenspause. Kurz gesagt, es herrschten Umstände, die man sich täglich aufs Neue schöntrinken musste. Aber das war zumindest in dieser Situation nicht von Bedeutung.
Mit leerem Magen und vollem Kopf zog Kapplhofer sich seine Dienstuniform an, setzte die dazugehörige Mütze auf und nahm die offizielle Amtshandlungshaltung ein. Ihm schwante Übles. Da weder der Umweltschutzreferent noch der Bürgermeister in die ortsübliche Schreckstarre verfallen waren, die Plutzenberger und Gfrettgstättener beim Erstkontakt mit einer Leiche normalerweise befiel und die sich nur am Wirtshaustisch mit Schilcher und Speckbrot erfolgreich aussitzen ließ, handelte es sich beim Toten mit allergrößter Wahrscheinlichkeit um jemanden, dem ohnedies kein Hahn nachkrähen würde. Jemanden, dessen radikales Ableben weniger ins dörfliche Gewicht fallen würde als ein Fliegenfurz beim Aufmarsch der Blasmusik. Jemanden, der den endgültigen Biss ins Damischtaler Gras vielleicht sogar ein klein wenig verdient hatte; zumindest glaubte der Inspektor, in der Mimik Feyertags einen leichten Anflug von Schadenfreude zu erkennen. Doch wem außer einem tiefroten Sozi würde der tiefschwarze Bürgermeister schon einen unfreiwilligen Tod wünschen? Der seit zehn Jahren amtierende Platzhirsch von Gfrettgstätten und Plutzenberg war ein erfolgreicher Stimmenfänger und Kampfredner, aber bestimmt kein verhinderter Totschläger, dessen war Kapplhofer sich sicher. Nicht einmal Ehrenhöfler, der Umweltschutzreferent, sah sonderlich betroffen aus, dabei brach der grüne Ökofreak bereits beim Anblick einer platt gefahrenen Kröte in Tränen aus.
Nun ja, alles ziemlich mysteriös, befand Kapplhofer, legte jedoch keinerlei Eile an den Tag, dem Rätsel so rasch wie möglich nachzugehen. Die Leiche war eh schon tot, da hätte man mit den ersten Ermittlungsschritten ruhig bis nach dem Essen warten können. Doch seine beiden Amtswegsgefährten schubsten ihn mitleidlos nach draußen, wo die Sonne immer noch hoch am Himmel stand und der Mostburger Bartl an seinem Traktor lehnte.
Schlimmer ging demnach immer. Der kauzige Fleischer war ja nicht nur ein genialer Wurstveredeler und begnadeter Schinkenalchimist, er besaß auch das unnachahmliche Talent, auf die eine oder andere Weise bislang in jeden einzelnen Damischtaler Mordfall verwickelt gewesen zu sein. Und wenn dieses perfekte Opfer behördlicher Irrungen und Wirrungen mit von der Partie war, war vermutlich nicht mit einem banalen Verkehrsunfall zu rechnen, den man rasch zu den Akten legen konnte. Insofern tat dem Inspektor der Fleischer bereits a priori leid. Bestimmt würde man den grantigen Menschenfeind gleich wieder unschuldig in Untersuchungshaft stecken, sofern sich an der Leiche auch nur mikroskopisch kleine Hinweise auf Fremdeinwirkung zeigten. Von wegen schweinische Veranlagung, der Mostburger Bartl hatte echt das Zeug zum jungfräulichen Sündenbock.
»Bartl, bring uns zur Leich«, befahl Ehrenhöfler nun, und während der Fleischer wunschgemäß den Traktor anließ, musste Kapplhofer sich auf die schmale Rückbank des bürgermeisterlichen Boliden zwängen. Da fuhren sämtliche Provinzpiloten, die etwas auf sich hielten, einen tonnenschweren, sichtbehindernden SUV mit Allradantrieb und fünf Türen, nur der Alois Feyertag hatte sich als motorisiertes Viagra ein knallrotes Oldtimer-Coupé zugelegt, ein winziges Gefährt, das nicht einmal dem Zusammenstoß mit einer Milchkuh standhalten würde.
***
Die Fahrt zu den einst lauschigen Damisch-Auen verlief langsam und wortlos. Bartl tuckerte mit seinem rostigen Steyr voran, der Bürgermeister röhrte mit seinem feurigen Schlampenschlepper hinterher. Vorüber ging es am blumengeschmückten Dorfplatz mit seiner imposanten Pestsäule, an einladenden Gastgärten und unverhohlen gaffenden Dörflern, vorbei an pittoresken Klapotetzen, steilen Weingärten und einer blühenden Botanik. Aber wen kümmerte schon das Rundblättrige Knabenkraut, wenn eine echte Leiche in der Landschaft lag. So etwas bekam man hier doch um vieles seltener zu sehen. Hinter dem Marterl, wo der kleine Pfad zur Klachlkapelle auf dem Sterzkogel abbog, fand die unberührte Naturlandschaft allerdings ein abruptes Ende. An ihrer statt breitete sich eine Baugrube aus, Baumstümpfe und Bagger prägten das unansehnliche Bild. Dem wenig willkommenen Flusskraftwerk wurden unübersehbar Opfer gebracht. Und nun schien die Verstümmelung der Landschaft nicht nur ein Artensterben von Wasseramseln, Würfelnattern oder Steinkrebsen mit sich zu bringen, sondern hatte auch gleich noch einen zweibeinigen Kollateralschaden verursacht. Ob vorsätzlich oder versehentlich, würde sich bald zeigen.
Wobei Kapplhofer im Grunde wenig Mitleid mit Wasserleichen verspürte. Oder Verkehrstoten. Oder verunfallten Bergsteigern. Für den Inspektor war jegliche Aktivität, die nicht im Sitzen ausgeführt werden konnte, potenziell lebensbedrohlich. Daheim am Esstisch war noch nie jemand verunglückt, sah man von Schnittverletzungen durch das Buttermesser oder Erstickungsanfällen durch einen Sulmtaler Hendlhaxen einmal ab. Aber daran starb man nicht. Und ein Polizeieinsatz war auch nicht notwendig.
Aber nein, die Leut wollten ja unbedingt ihren ungesunden Bewegungsdrang ausleben– und dabei ereilte sie dann der Tod. Durch fremde Gewalt oder eigene Dummheit. An Selbstmord dachte Kapplhofer keine Sekunde, zumindest nicht in diesem Fall, denn deprimierte Damischtaler mieden das Wasser und griffen stattdessen zum Wein. Also war die Leiche entweder im Suff verunfallt oder– die weitaus schlimmere Vorstellung– ermordet und versenkt worden. Aufgrund zweier Verdachtsmomente befürchtete der Inspektor allerdings einen unfreiwilligen Tauchgang in der Damisch. Denn erstens hatte der Fleischer offensichtlich etwas damit zu tun, und zweitens wäre der Umweltschutzreferent bestimmt nicht wegen eines alkoholisierten Nachtschwärmers angetrabt. Das Ertrinken in dem ohnedies schon arg verdreckten Fluss verstieß seines Wissens ja weder gegen die Gewässerordnung noch gegen etwaige Umweltschutzauflagen. Doch angesichts all der mörderischen Gefühle, die die Einheimischen dem Kraftwerksprojekt entgegenbrachten, konnte durchaus ein echtes Kapitalverbrechen im Busch beziehungsweise Bach sein.
Wehe mir, wenn das der Fall ist, dachte der Inspektor besorgt und versank prophylaktisch in Selbstmitleid.
Kaum waren sie am Fundort des Toten angelangt, würgte der Bartl seinen Traktormotor ab, grunzte: »Dort isses«, und wies mit der Hand vage Richtung Fluss.
»Das is uns ein bissl zu ungenau«, erwiderte der Bürgermeister. »Ich kann weder hellsehen noch übers Wasser gehen, und der Hubert«, dabei würdigte er den Umweltschutzreferenten mit keinem Blick, »hat seinen Feldstecher nicht dabei. Gibt ja auch keine Vögeleien zu bestaunen.« Diese boshafte Anspielung auf das Intimleben des Ehrenhöfler hatte Feyertag sich nicht verkneifen können.
»So eine Zeiss-Optik ist für die Leichenbeschau auch gar nicht geeignet. Die is nur für bessere Fernsicht«, konterte der Umweltschützer ungerührt und starrte dabei konzentriert auf die verunstaltete Grasnarbe vor seinen Füßen. Seit er vor Jahren– unter dem Vorwand morgendlichen Birdwatchings– bei einem intimen Zusammenstoß vom Hochsitz gestürzt war, empfand er jeglichen Hinweis darauf als rhetorischen Schlag unter die Gürtellinie. »Außerdem geht mich die Sache eigentlich gar nix an, du bist ja der Alleinherrscher über Leben und Tod.«
»Und das muss ich auch, ihr Grünen habts doch bis heut nix bewegt außer eurer Pappalatur.«
»Bitte hörts auf«, mischte sich nun der Inspektor ein. »Das hier ist keine Wahlkampfveranstaltung, sondern eine Tatortbegehung.«
Manchmal und besonders dann, wenn er sich nicht mehr anders zu helfen wusste, schlug Kapplhofers höhere Bildung durch. Immerhin hatte er ein paar Semester in Graz studiert und seinen Wortschatz beträchtlich erweitert, während sein Bauchumfang im selben Ausmaß geschrumpft war. Mutters kalorische Liebesbeweise waren ihm halt spürbar abgegangen. Außerdem hatte er ständig steile Treppen bezwingen müssen, denn alle Hörsäle im Hauptgebäude der Grazer Karl-Franzens-Uni waren nur fußläufig zu erreichen gewesen. Selbst als überzeugter Nichtraucher hatte er nach fast jedem Aufstieg beinahe ein Sauerstoffzelt benötigt. Also hatte er den Schwerpunkt seines Lebens wieder an den heimischen Esstisch verlegt. Und gehofft, bis zu seinem Pensionsantritt geruhsam und mehrfach täglich gesättigt auf seinem Beamtenstuhl kleben bleiben zu können.
Nun allerdings stand er hier. An der Damisch. Mit leerem Magen. Und musste seines Amtes walten, ob es ihm gefiel oder nicht.
»Bartl, steig ab und komm mit«, wandte er sich an den Fleischer, der aussah, als hätte er in eine Art Energiesparmodus geschaltet. Er rührte sich nicht, er sagte nichts, er hielt nicht einmal eine seiner stinkenden, selbst gedrehten Zigaretten zwischen den schmutzigen Fingern.
»Ja, des wär echt an der Zeit«, befand auch der Bürgermeister. »Ich will hier keine Wurzeln schlagen, ich muss noch zur Generalversammlung der Bezirksjägerschaft.«
»Und ich zur Podiumsdiskussion auf die Photovoltaik-Tagung.«
»Meine Butsch warten auch schon«, schloss der Fleischer sich der allgemeinen Aufbruchsstimmung an.
»Ja, seids ihr denn alle deppert worden.« Kapplhofer traute seinen Ohren nicht. Da schleppten ihn diese notorischen Nervensägen vom gedeckten Tisch weg zu einer Wasserleich, und dann standen sie alle untätig herum, als wäre die Angelegenheit damit geklärt. Offenbar wollte sich niemand nasse Füße holen oder der Sache gar auf den schlammigen Grund gehen.
Der Inspektor war frustriert. Während Feyertag und Ehrenhöfler die Hände immer tiefer in ihren Hosentaschen vergruben und dabei synchron, wenngleich voneinander abgewandt, ins Narrenkastl schauten, erinnerte der Fleischer zunehmend an eine Skulptur aus gefärbtem Schweinefett. Reglos, leichenblass und offensichtlich von akuten Lähmungserscheinungen befallen. Er schien förmlich mit seinem Traktorsitz verwachsen zu sein. Was eher ungewöhnlich war. Dass der Bartl seinen Denkapparat nur zu besonderen Anlässen in Betrieb nahm, war hinlänglich bekannt. Um Dampf in seine arthritischen Hirnwindungen zu bringen, bedurfte es oft Stunden, aber das Sitzfleisch hievte er normalerweise recht schnell in die Höhe. Wenn ihm eins seiner Mangalitza-Schweine ausbüxte, bevor er ihm den Rüssel lang ziehen konnte, oder eine diebische Katze vor dem Selchkammerl patrouillierte– dann konnte er ebenso gut sprinten wie eine gesengte Sau.
Aber Kapplhofer hatte weder Zeit noch Lust auf tiefenpsychologische Erklärungsversuche, er wollte seine Nase nicht in fremde Seelen stecken, sondern in den mütterlichen Bratentopf. Also beschloss er, sein friedfertiges Naturell ausnahmsweise hintanzustellen und Bartls temporäres Energiedefizit mit einem gezielten Schlag zu beheben.
Er stieg auf den Traktor und hieb dem Fleischer derart stark zwischen die Schultern, dass der beinahe das Gleichgewicht verlor und vornüberkippte. Dazu brüllte er: »Aufwachen, die Sau is los!«
Und tatsächlich, der Bartl schreckte hoch und blickte sich um.
Nun ergriff auch der Bürgermeister die Gelegenheit am Schopf beziehungsweise den Fleischer am Ärmel seiner Arbeitsmontur und zog mit aller Kraft daran. »Pack mas endlich, bevor die Sonn untergeht.«
Langsam, unendlich langsam, stieg der Bartl von seinem alten Steyr, schlurfte im Zeitlupentempo ans Ufer, blieb dort erneut stehen und senkte bedeutungsschwanger den Kopf.
Woraufhin auch Kapplhofer, Ehrenhöfler und Feyertag aufmerksam zu Boden blickten, aber abgesehen von Baumschnitt und Bauschutt absolut nichts entdeckten, das einer Leiche glich.
»Wo jetzt?«, fragte der Inspektor.
»Ich seh nix«, bemerkte der Umweltschützer.
»Willst uns verarschen, oder was?«, schnaubte der Bürgermeister, der versehentlich einen Schritt zu weit gegangen war. Nun hatte er nasse Füße und musste sich beherrschen, nicht handgreiflich zu werden.
Da Feyertag als langjähriger Revierjäger durchaus über eine gewisse Zielsicherheit verfügte und der Fleischer berufsbedingt eine nachhaltige Schlagkraft besaß, ging Kapplhofer rasch dazwischen. Eine Prügelei würde seine Aufenthaltsdauer an diesem unliebsamen Ort nur zusätzlich in die Länge ziehen. Also legte er dem Bartl nahezu zärtlich seinen uniformierten Arm um die Schulter und versuchte sich in behördlichem Krisenmanagement. »Bartl, da du den Toten ja g’funden hast, musst uns jetzt auch hinbringen, sonst machst dich strafbar, verstehst?«
Und der Fleischer verstand. Wortlos setzte er sich in Bewegung, stapfte mit grimmigem Gesichtsausdruck ins Wasser und kämpfte sich erneut zwischen den gefällten Bäumen und entwurzelten Sträuchern hindurch, die aussahen, als hätte sie eine kollektive Ohnmacht erfasst. Überall ragten abgebrochene Äste und Wurzeln in die Luft und verliehen dem Ganzen ein gespenstisches Aussehen. Als hätte ein Orkan durch das Damischtal gefegt, dachte der Inspektor, der hinter Bartl missmutig durch den schlammigen Fluss watete und dabei Gott, die Welt und vor allem seinen Beruf verfluchte.
Hätte er sich seinerzeit nur für die Laufbahn des Postboten entschieden. Aber nein, aus Angst vor dieser doch recht schweißtreibenden Tätigkeit hatte er lieber den Job als Dorfpolizist am idyllischsten Arsch der Welt ergriffen, um dort auf seinem ergonomisch geformten Bürostuhl unaufgeregt und gemächlich seinem Pensionsantritt entgegenzuschlafen und schlimmstenfalls sein Sitzfleisch zu trainieren. Doch stattdessen musste er jetzt mit knurrendem Magen, durchnässten Hosen und unter schmerzhaften Verrenkungen seines Körpers einen Hindernislauf durch ein verschlammtes Bachbett absolvieren.
Während der Bürgermeister und der Umweltschutzreferent am Ufer zurückgeblieben waren. Der eine aus Rücksicht auf sein handgenähtes Schuhwerk, der andere, um keine wertvollen Spuren zu zerstören, sollte sich die Wasserleiche doch als Opfer einer Gewalttat entpuppen. Dafür hätte es allerdings einen Brontosaurier als Täter gebraucht. Nur der hätte Spuren hinterlassen können, die neben den Fahrrinnen der tonnenschweren Baufahrzeuge noch erkennbar gewesen wären.
Da sah man wieder, welche Auswirkungen politisch eingefärbtes Gedankengut im Alltag hatte. Der tiefschwarze Bürgermeister legte mehr Wert auf gebügelte Schnürsenkel, frisierte Statistiken und aufpolierte Festzeltreden denn auf Bodenständigkeit, Pflichtbewusstsein und Nächstenliebe, der grasgrüne Umweltschützer hingegen besaß zwar durchaus soziale Seiten und wenig empfindsame Latschen, hatte vom echten Leben aber gerade mal so viel Ahnung wie Kapplhofer von der Quantenphysik. Nur mit Bestäubungstechniken von Nachtschattengewächsen, mit Balzritualen der eurasischen Waldschnepfe und mit intellektuellen Kampftechniken gegen Wasserkraftwerksbetreiber kannte er sich wirklich aus. Wenigstens war es Sommer, und der grobe Stoff seiner Uniform schützte den Inspektor vor den massiven Angriffen der Stechmücken, die ihn aufdringlich umschwirrten. Zudem schien Bartl am Ziel angelangt.
»Da, schau.« Mit abgewandtem Kopf zeigte der Fleischer auf eine morsche Palette, die von matschigem Grünzeug überwuchert war. Und an die sich eine eindeutig menschliche Hand klammerte. Ein Stillleben mit Tod, wie es schrecklicher nicht sein konnte.
Bei näherem Hinsehen entdeckte der Inspektor auch einen verdreckten weißen Schutzhelm, der schief auf dem Kopf des Toten saß. »Irgendwie kommt mir der bekannt vor«, meinte Kapplhofer und starrte weiterhin auf den Helm, als würde dieser eine Inschrift tragen.
»Das ist der Ploderer Pepi, der Polier«, erwiderte der Fleischer und betrachtete ein einsames Blatt, das im trüben Wasser schaukelte.
Danach legten beide eine einvernehmliche Schweigeminute ein. Der Revierinspektor litt unter einem Anfall geistiger Windstille, der Fleischer hegte Fluchtpläne.
»Ich glaub, ich ruf erst mal den Doktor an.« Kapplhofer hatte endlich einen machbaren Gedanken zu fassen bekommen und griff entschlossen nach seinem Diensthandy.
»Bei dem werden Wiederbelebungsversuche aber nichts mehr bringen«, brummte Bartl Mostburger und trat vorausschauend den Rückzug an.
»Du bleibst da.«
»Willst mi verhaften, oder was?«
»Natürlich nicht.«
»Also bin ich immer noch frei?«
»Eh klar.«
»Dann kann ich ja gehen, wohin ich will. Der Pepi schwimmt dir eh nimmer davon.«
Und bevor Kapplhofer eine passende Entgegnung eingefallen war, war der Bartl im dichten Röhricht verschwunden. Er konnte ihm nur noch: »Trottel, depperter!«, nachrufen.
***
Genau in diesem Moment nahm Dr.Seidenbart den eingehenden Anruf entgegen. Und brach ihn unverzüglich wieder ab. »Die Menschheit wird immer unverschämter«, erklärte er seiner Frau, die ihm gerade einen Nachschlag vom getrüffelten Beef Tatar auf den goldgeränderten Teller hatte legen wollen, als Beethovens »Eroica« das sanfte Geklapper des Tafelsilbers unterbrach. »Da ruft doch glatt einer an, nur um mich zu beschimpfen.« Erzürnt schüttelte der Arzt den Kopf.
»Heb einfach nicht mehr ab, Liebling«, flötete sein dekoratives Eheweib und näherte sich erneut mit der Vorlegeplatte.
***
Dem Revierinspektor blieb also nur die Hoffnung auf Unterstützung durch die Feuerwehr. Die Leiche musste an Land gebracht werden, denn Seebestattungen in Arbeitsmontur waren in Österreich garantiert verboten.
Und die Spritzenmänner ließen ihn nicht im Stich. Schon bald tauchte das knallrote Löschfahrzeug, gefolgt von einem Rettungswagen, am Ufer der Damisch auf, und drei umfangreich ausgerüstete Feuerwehrleute, flankiert von zwei sportlichen Sanitätern mit einer Bahre, stürzten sich diensteifrig ins Wasser. Der Pfnaderer Fred, Kommandant der örtlichen Brandschutztruppe, hatte wirklich an alles gedacht.
Energisch räumten die Männer die Palette zur Seite, griffen vielhändig nach dem leblosen Polier, hievten ihn auf die mit einer weißen Plastikplane belegte Bahre und machten auf ein unhörbares Kommando hin im Gleichschritt kehrt, um den Toten sicher ins Trockene zu bringen.
»Da hast dir aber einen fetten Brocken geangelt«, bemerkte der Pfnaderer nach einem raschen Blick auf das kräftige Opfer der Fluten zum Inspektor. »Die Blondine damals, die mit ihre Genussstelzen, hat mir da weitaus besser gefallen.«
Die hat auch keinen Blaumann getragen, sondern einen Minirock, dachte der Inspektor, hielt aber seinen Mund. Stattdessen versuchte er sich an der Vorstufe eines dankbaren Lächelns, während er, den Schutzhelm in der linken Hand, gleichfalls zum Ufer zurückwatete.
Wo gleich die nächste böse Überraschung auf ihn wartete. Eine Schar schaulustiger Bauarbeiter stand mit offenen Mündern und weit aufgerissenen Augen am Gestade und kommentierte wild gestikulierend das Geschehen. Und etwas abseits, aber dafür unübersehbar in der ersten Reihe, hatte sich das Damischtaler Regionalfernsehen platziert.
Kapplhofer geriet in Panik. Hilfesuchend blickte er sich nach dem Bürgermeister oder zumindest nach dem Umweltschutzreferenten um, aber beide hatten sich erfolgreich aus dem Staub gemacht. An ihrer statt kamen ein paar sensationsgierige Einheimische langsam näher.
Kapplhofer musste dieser Invasion des Schreckens also alleine Rede und Antwort stehen. Böse blickte er den Grund allen Übels an, der auf der Transportliege nach wie vor mausetot vor sich hin tröpfelte. Und noch böser den sensationsgierigen Fernsehfuzzi, der dem Einsatzwagen in der Hoffnung auf einen blutrünstigen Bericht gefolgt war.
»Wohin sollen wir den überhaupt bringen?«, fragte derweil einer der beiden Rettungsmänner. Seit das Plutzenberger Krankenhaus wegen großzügiger Einsparungsmaßnahmen durch politische wie betriebswirtschaftliche Totengräber geschlossen und in eine mittlerweile gleichfalls lahmgelegte Flüchtlingsherberge umfunktioniert worden war, stellte jeder Todesfall, der sich außerhalb der eigenen vier Wände ereignete, ein logistisches Vabanquespiel dar. Verkehrsopfer waren dem Inspektor da noch am liebsten, die konnte er direkt beim Bestatter abgeben, in Einzelteilen oder als Gesamtpaket. Bei Arbeitsunfällen gestaltete sich die korrekte Entsorgung der Toten schon schwieriger. Rechtlich machte es einen gewaltigen Unterschied, ob irgendein Fassadenkletterer nüchtern, also im Vollbesitz seiner geistigen wie körperlichen Kräfte, leicht angetrunken oder im Vollrausch sechs Meter vom Gerüst fiel. Und dann musste auch noch geklärt werden, ob er auf der Stelle verstarb oder erst auf dem langen Weg ins Krankenhaus. Unfreiwillige Tauchopfer jedoch waren noch aufwendiger, denn ohne Autopsie konnte niemand sagen, ob Alkohol, sportliche Selbstüberschätzung oder mörderische Absichten Schuld an ihrem Ableben trugen.
Es war also durchaus nachvollziehbar, dass Kapplhofer den Polier am liebsten noch rasch auf die stark befahrene Bundesstraße und danach ins Archiv zu den Akten gelegt hätte. »Bringts ihn zum Seidenbart«, befahl er stattdessen, denn die Alternative wäre nur der weite Weg in die Landeshauptstadt Graz gewesen.
Da der Polier keine sichtbaren Verletzungen hatte, nirgendwo Blutspuren zu sehen waren, sondern nur ein paar dunkelgrüne Kleckse, die aussahen wie Kernölflecken, und der Ploderer zudem über die Muskelmasse eines ausgewachsenen Zuchtbullen verfügte, hielt Kapplhofer Tod durch Fremdeinwirkung für eher unwahrscheinlich. Nur ein echtes Rindvieh hätte sich freiwillig mit so einem durchtrainierten Testosteronpaket angelegt. Und der seltsame Schaum, der dem Toten in den Mundwinkeln klebte, sah auch nicht sonderlich besorgniserregend aus, eher wie verschmutzter Fischlaich oder ein aufgequollenes Schwammerl. Womit er gar nicht so falschlag, denn das Gebilde stellte tatsächlich einen Schaumpilz dar, ein Zeichen für Tod durch Ertrinken. Aber das wusste Kapplhofer natürlich nicht.
Zu seinem großen Bedauern verfügte der Inspektor über keine ähnlich ausgeprägten Muckis, sah man von seinem Kaumuskel einmal ab, und war dem Angriff des Damischtaler Fernsehfuzzis daher rettungslos ausgeliefert. Nicht einmal im Umgang mit der Rhetorikkeule war er ausreichend geübt. Im Schlagabtausch zwischen ihm und dem Reporter unterlag er Runde um Runde.
»Herr Inspektor«, begann der Fuzzi, obwohl Kapplhofer einst sogar Postenkommandant gewesen war, bevor die Polizeidienststelle durch Personaleinsparungen zum Einmannbetrieb geschrumpft worden war, »der Krieg zwischen Umweltschützern und Kraftwerksbetreibern hat einen ersten Todesfall gefordert. Was sagen Sie zu den tödlich verhärteten Fronten?«
»Was für ein Krieg? Der…« Kapplhofer war der Name des Opfers entfallen, und er legte eine kurze Nachdenkpause ein.
»Das sagen Sie, Herr Inspektor. Was aber soll die Bevölkerung tun, um in dem mörderischen Kugelhagel nicht zwischen die Fronten zu geraten? Wie kann man sich, seine Familie, sein Land schützen?«
»Der…«, Kapplhofer suchte immer noch verzweifelt nach dem Namen, »der is nicht derschossen worden, sondern…«
»Erst ging es mit den Bäumen Schlag auf Schlag, nun werden schon die ersten Menschenopfer gebracht. Welche Maßnahmen werden Sie als Damischtaler Hüter von Recht und Ordnung im Interesse der allgemeinen Sicherheit ergreifen? Und an welchem Punkt stehen die Ermittlungen? Ein derartiges Verbrechen darf nicht ungesühnt bleiben, denken Sie nur an die verängstigten Bewohner von Plutzenberg und Gfrettgstätten. Hören Sie auf Ihr Gewissen und handeln Sie.«
»Aber wer red denn von Mord? Das war ein…« Doch bevor Kapplhofer die Worte »bedauernswerter Unfall« aussprechen konnte, hatte sich der Großmeister der boulevardesken Berichterstattung bereits abgewandt und schritt mit hoch erhobenem Haupt und ebensolchem Mikrofon ins Wasser.
»Hier, liebe Zuseher und Zuseherinnen von PlutzerTV, hier hat das Gemetzel also stattgefunden. An exakt dieser Stelle wurde ein grauenhaftes Verbrechen an einem unschuldigen Menschen begangen. So wird einem heutzutage die ehrliche Arbeit gelohnt. Mit Mord und Totschlag. Man mag zu dem aktuellen Kraftwerksprojekt stehen, wie man will, doch hier ist offenbar jemand am Werk, der für den Schutz von ein paar Büschen, Bäumen und Blümchen sogar über Leichen geht. Und jeder von Ihnen könnte die nächste sein.«
Den hatten die Energielieferanten oder Immobilienhaie wohl ordentlich geschmiert, befand Kapplhofer angewidert. Vor nicht einmal zwei Wochen hatte exakt derselbe Mensch noch gegen das grauenhafte Massaker an Mutter Natur gewettert und die Zerstörung der Damisch-Auen mit der Rodung des Regenwalds verglichen. Der Inspektor fragte sich insgeheim, wie man mit einem Rückgrat von der Härte gekochter Spaghetti überhaupt so aufrecht daherlaufen konnte.
»Der bräucht echt eine Charaktertransplantation«, murmelte er leise und suchte der aufgeladenen Stimmung ringsum zu entkommen. Was alles andere als einfach war. Die Bauarbeiter, die immer bedrohlichere Schatten warfen, konnte er kaum um eine Mitfahrgelegenheit in der Baggerschaufel oder auf dem Kranarm bitten. Zudem ging ihm deren vielstimmiges »Was passiert sein mit Pepi?« immer mehr auf den Geist. Er wusste es ja selbst nicht. Er wusste nur, dass er seit mehr als zwei Stunden planlos hier herumstand. »Abg’soffen is er halt«, erklärte er den Männern also zum wiederholten Mal. »Er hat im Wasser keine Luft mehr bekommen. Ertrunken.«
»Pepi nix trinken bei Arbeit.« Die Schatten rückten näher.
»Ja eh. Er hat nicht getrunken, er ist ertrunken.«
»Nix trinken bei Arbeit!«
»Jetzt schleichts euch doch endlich mit eurer depperten Fragerei!«
Leider verstanden die ausländischen Bauarbeiter eine derart bodenständig-komplexe Formulierung nicht und trampelten weiterhin auf der kargen Rasenscholle und Kapplhofers Nerven herum. Doch bevor die missverständliche Kommunikation in verständlichere Handgreiflichkeiten ausarten konnte, bog erneut der Rettungswagen um die Kurve, und Dr.Seidenbart sprang heraus.
»Untersteh dich, mir noch einmal einen Toten zu schicken«, fuhr der Arzt den Inspektor an. »Noch dazu an meine Privatadresse. Meine Frau hat beinahe einen Herzinfarkt bekommen, und die Nachbarn haben sich vor lauter Schauen den Hals verrenkt.« Aufgebracht zupfte der Arzt sich eine Fluse von seinem exklusiven Button-down-Hemd. Privat trug er offenbar Casual Chic. »Davon abgesehen gehört ein Mann, der unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen ist, in die Gerichtsmedizin, nicht auf meinen Schreibtisch. Merk dir das bis zu deinem hoffentlich baldistgen Pensionsantritt!«
Das Ausrufezeichen am Ende des Satzes war unüberhörbar. Selbst die gaffenden Baggerfahrer und Holzfäller verstummten. Einen Bullen, der öffentlich zur Sau gemacht wurde, bekamen sie sehr selten zu sehen. Seltener noch als einen verunglückten Arbeitskollegen.
Und während Kapplhofer sich bemühte, einigermaßen schuldbewusst aus der Wäsche zu gucken, war der unfreiwillige Leichenbeschauer bereits am Ende seines Monologs angelangt.
»Jedenfalls weist die Wasserleiche keine Zeichen von Fremdeinwirkung auf, dafür aber einen deutlichen Schaumpilz. Dazu an die zwei Promille im Blut und großflächige Kernölflecken und Schilcherspritzer auf der Kleidung.«
Beim Gedanken an den damit verbundenen Essiggeruch rümpfte der Arzt angeekelt die Nase. Es war ihm bis heute ein Rätsel, was die Menschen hier– und mittlerweile im ganzen Land– an dem säurelastigen Tropfen aus der Blauen Wildbachertraube fanden, der seit Jahren als Kultgetränk gehandelt wurde. Wo doch eigentlich nur französischer Barrique die Bezeichnung Wein verdiente. Beruhigenderweise gingen ihn die Trinkgewohnheiten von Wasserleichen nichts an. Und was dieses dunkle Öl aus gepressten Kürbiskernen betraf, ohne das die steirische Küche nicht existieren könnte und das als Wundermittel gegen Prostataleiden gehandelt wurde– was natürlich jedem Schulmediziner sauer aufstieß–, so fand er dessen nussiges Aroma zwar recht geschmackvoll, verzichtete im Interesse seiner blütenreinen Oberbekleidung aber dennoch darauf.
»Meiner Ansicht nach ist der gute Mann einfach ertrunken. Vermutlich im Suff ins Wasser gefallen und dann exitus letalis. Einen Tauchgang mit Sturzhelm wird er ja kaum versucht haben«, schloss Dr.Seidenbart seine Expertise.
»Immerhin weder Mord noch Totschlag«, murmelte der Inspektor erleichtert, während er den Fall gedanklich bereits in dreifacher Ausfertigung zu den Akten legte. Warum Baupoliere spätnachts in betrunkenem Zustand und vollständig bekleidet ein Bad nehmen wollten, war ihm schlichtweg egal. Solange es keinen ursächlichen Zusammenhang mit dem Hass der Bevölkerung auf das Wasserkraftwerk gab, konnten die Leute ins Gras beißen