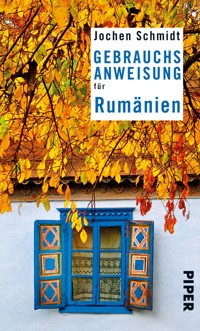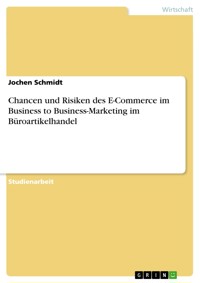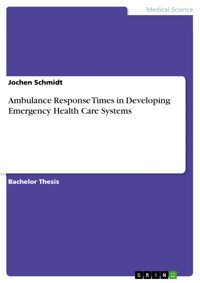12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Bretagne: rau, felsig und winddurchtost. Hier haben die Kelten gelebt und die Gallier – weil es kein Römer je ausgehalten hätte. Behauptet Jochen Schmidt. Und er muss es wissen, denn er hat sich lange umgesehen, dort, wo die Artischocken herkommen, der Cidre und natürlich die Artussage. Aber trotz aller Drachen und Feen, die in dem keltischen Land zwischen Wind und Wald zu Hause sind, ist auch in der Bretagne die Zeit nicht stehen geblieben. Was sich geändert hat, welche Sprache dort heute wirklich gesprochen wird und warum alle Bretonen dickköpfig und katholisch sind – das verrät Schmidt auf kurzweilige Weise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Allen, die nicht genug bekommen vom Studium der Romanistik
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
2. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-96810-2
überarbeitete und erweiterte Neuausgabe 2009
© 2004 Piper Verlag GmbH, München
Coverkonzeption: Büro Hamburg
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de
Coverabbildung: Côte de Granit Rose bei Le Gouffre/Pointe du Château (Berthold Steinhilber/Laif)
Karte: cartomedia, Karlsruhe
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
»Der Bretagner hat, vielleicht ein Ausdruck seines von Stürmen umbrausten, rauhen Landes, eine melancholische Gemütsstimmung, ein zurückhaltendes Wesen, dabei aber lebhafte, poetische Einbildungskraft, innere Empfindsamkeit und oft große Leidenschaftlichkeit, verborgen hinter äußerer Rohheit und Fühllosigkeit.«
Meyers Konversations-Lexikon, 1896
Vorwort
In all den Jahren, die ich die Bretagne kenne, erst als Matrose der Kriegsmarine, dann, nach meiner Heirat mit einer Bretonin, als Gemüsebauer, und schließlich als Honorarkonsul der Bundesrepublik in Brest, ist mir von dieser Region nichts verborgen geblieben. Die pittoresken Altstädte, deren Fachwerkfassaden sich wie Fingerabdrücke nie gleichen, die rätselhaften Figurenansammlungen der Kalvarienberge, die einsamen Inseln, die märchenhaften Wälder, das urzeitliche Meer.
Und obwohl das alles gar nicht stimmt, nehme ich mir das Recht, ein Buch über die Bretagne zu schreiben. Ich bin ein gewöhnlicher Reisender, der immer von der Angst getrieben wird, das Entscheidende zu verpassen: die erhabenste Klippe, die einsamste Waldlichtung, die feinste Crêpe, das urtümlichste Volksfest. Alles, wovon die Reiseführer schwärmen. An welcher Kreuzung hat man den falschen Weg eingeschlagen? An welchem Wochenende wäre in dieser verschlafenen Stadt die Hölle los gewesen? Warum hat man zu spät erfahren, dass man diese berühmten Grotten auch besichtigen konnte?
Bevor ich sie bereist habe, dachte ich wie die meisten, die Bretagne wäre ein Land, in dem es immer regnet. Wenn die Männer nicht auf dem Meer oder im Alkohol ertrunken sind, sind sie damit beschäftigt, mit uralten Traktoren den Verkehr zu behindern, während die Frauen mit seltsamen weißen Röhren als Kopfschmuck Kühe, die ihnen kaum bis zur Schulter reichen, zur Weide führen. Die Menschen verlieren sich in der mit Menhiren übersäten Heide, um abends am Kamin zusammenzukommen und sich Gruselgeschichten über böse Geister und launische Kobolde zu erzählen.
Inzwischen weiß ich es besser: Denn die Bretagne ist ein Land, in dem oft die Sonne scheint. Weil die Männer nicht mehr aufs Meer fahren und stattdessen im Alkohol ertrinken, sind schon die Kinder damit beschäftigt, mit modernen Traktoren den Verkehr zu behindern, während die Frauen mit seltsamen weißen Broten unterm Arm vom Bäcker kommen, der ihnen kaum bis zur Schulter reicht. Die Touristen verlieren sich in der mit Menhiren übersäten Heide, um abends in der Pension zusammenzukommen und sich Gruselgeschichten über das böse Wetter und launische Preiserhöhungen zu erzählen.
So viel zu den einfachen Wahrheiten, für den Rest muss man weiter ausholen.
Brest (nicht Litowsk)
»Why does it always rain on me? Is it because I lied, when I was seventeen?«
Travis
»Es gibt dort jeden Tag so einen seltsamen Sprühregen, von dem man nicht richtig nass wird. Aber zwischendurch scheint die Sonne. Die Stadt besteht nur aus grauem Beton, das Rathaus ist so ein kantiger, stalinistischer Klotz. Alkohol ist ein großes Problem. Man sieht kaum Touristen. Der Hafen ist eine Stadt für sich.«
Als mir so zum ersten Mal von Brest erzählt wurde, wusste ich: Das ist meine Stadt. Weil ich an einem Ort schätze, wenn er es mir nicht leicht macht. Und weil ich nicht auffallen will, wenn ich mich einsam fühle. In Hafenstädten sind alle ein wenig einsam. Wahrscheinlich ist Brest genau das Gegenteil von dem, was man sich unter einem Urlaubsort vorstellt. Ich würde auch niemandem raten, dort seinen Urlaub zu verbringen. Aber wenn man mich fragt, wo für mich die Bretagne liegt, dann müsste ich nicht lange überlegen.
In meinem Jahr dort bin ich kaum aus der Stadt gekommen. Ich hatte kein Geld und ich dachte, der Rest der Bretagne würde genauso trist aussehen. Aber in Wirklichkeit ist der Rest der Bretagne heute das glatte Gegenteil von Brest: bunt, durchrenoviert, von Touristen bevölkert und relativ wohlhabend.
Dennoch beginne ich meine Reise auch diesmal in Brest.
Immerhin weiß ich schon, was ich auf jeden Fall mitnehmen muss: eine Regenjacke, Magentabletten, Alka-Seltzer, Vomex-Zäpfchen. In Frankreich gibt es eine Sperrstunde, weshalb man nur umso schneller trinkt.
Am schwersten wiegen allerdings die Reiseführer. Warum werden gerade diese Bücher auf so schwerem Papier gedruckt? Am Flughafen in Berlin verabschiedet sich eine Schülergruppe von ihren französischen Gästen, die Mädchen schnuppern sich gegenseitig an den Haaren, um das Shampoo zu vergleichen. Ich werde genau in dem Moment fotografiert, als ich einer Frau auf die Brüste schaue. Im Buchladen liegt nichts von mir und viel von Wladimir Kaminer. Ich sehe noch einmal genauer nach, aber nein, auch unter seinen Stapeln versteckt sich kein Buch von mir, das muss ein Irrtum sein.
Immerhin habe ich schon einen Prominenten entdeckt, die Chancen, dass wir nicht abstürzen, stehen also gut. Es scheint mir doch unwahrscheinlich, dass ich ausgerechnet zusammen mit Joschka Fischer sterbe. Außerdem erkenne ich einen berühmten koreanischen Architekten, von dessen Existenz ich allerdings erst heute Morgen aus der Zeitung erfahren habe. Zwei Prominente, da kann eigentlich nichts passieren.
Ich habe große Angst vor dieser Fahrt, weil mir jedes Wiedersehen mit Brest ans Herz geht. Außerdem ist Fliegen eine unnatürliche Art sich fortzubewegen. Die Seele kommt nicht so schnell hinterher. Die halbe Nacht konnte ich nicht schlafen und habe mich mit Cape fear getröstet. Meine Angst war ja lächerlich, verglichen damit, dass Robert de Niro mit so einem Gesicht um mein Haus schleichen und meiner Familie nachstellen könnte.
In Paris regnet es, und ich bin sofort umringt von französischen Beamtengestalten. Es ist ja ein unvergleichlicher PR-Coup, dass dieses Paradies der Bürokratie es geschafft hat, auf der ganzen Welt mit Leidenschaft und Romantik assoziiert zu werden. Juliette Binoche, Émanuelle Béart und Isabelle Adjani haben sich aber mal wieder gut versteckt, ich kann nur schmallippige, graue Männer mit Aktentaschen entdecken.
Für meinen Inlandflug muss ich durch kahle Betonröhren in den Keller des Flughafens zu einer speziellen Abfertigungshalle gehen. Es hat mich beim Umsteigen immer amüsiert zu beobachten, wie sich der Strom der Mitreisenden lichtete, und ich am Ende nur noch von Menschen umgeben war, die auch nach Brest wollten. In diesem kühn gestalteten Flughafen nehmen sich die versammelten Brest-Heimkehrer wie Fremdkörper aus. Man erkennt sie an ihrer unmodernen Kleidung, der ungesunden Gesichtsfarbe und einer gewissen Biederkeit. Trotzdem wirken sie gelöst. Denn die Nationalkrankheit der Bretonen soll ja das Heimweh sein, und jetzt geht es nach Hause. Zwar regnet es wahrscheinlich auch in der Bretagne, aber sicher auf viel schönere Art. »En Bretagne, il fait que beau«, scherzt jemand beim Besteigen des Flughafenbusses. Genau, in der Bretagne ist immer schönes Wetter. Ob Sonne oder Regen ist egal, das Einzige, was den Bretonen wirklich bedrückt, ist, wenn das Wetter sich nicht täglich ändert.
Das Flugzeug nach Brest ist schon viel kleiner. Die Reihe 13 ist nicht vergeben. Zur Beruhigung spielen sie Andrea Bocelli Time to Say Goodbye. Egal, wie viel Sport man treibt, wenn man im Flugzeug an sich heruntersieht, hat man doch einen Bauch. Der Steward führt uns die Sicherheitsmaßnahmen vor. Dann geht er durch die Reihen und fragt: »Wünschen Sie Kekse oder eine leckere Salzgebäckmischung?« Ich denke an einen Freund aus Brest, den ich seit Jahren nicht gesehen habe.
Cédric
Eigentlich hatte Cédric Schauspieler werden wollen. Seine Leidenschaft fürs Theater hatte er an der Universität entdeckt, als sie Die kahle Sängerin von Eugène Ionesco aufführten. Die Inszenierung war so gelungen, dass sie das Audimax dreimal hintereinander füllten. Immer, wenn Cédric sich mitten im Stück auf einen Stuhl stellte und sagte, »Nur die Marine ist anständig in Frankreich!«, jubelten die Zuschauer. Sie wurden sogar zu einem Gastspiel in der École navale eingeladen, wo sie das Stück vor Rekruten spielten. Von denen wurde der Satz so begeistert aufgenommen, dass die Vorgesetzten den Zwischenapplaus abbrechen mussten.
Natürlich musste Cédric die Bretagne verlassen, um sich seinen Traum von der Schauspielerei zu erfüllen. Einerseits wollte er die Intensität eines Klaus Kinski erreichen, andererseits in Berlin Brecht spielen. Er tingelte ein paar Jahre durch Europa und nahm hier und da Schauspielunterricht. Aber die einzige Aufnahmeprüfung, die er bestand, war die bei Air France, wo er heute als Flugbegleiter arbeitet. Durchs Fenster sieht er die unvergleichliche Küstenlinie seiner Heimat. In die Vorführung der Atemmasken legt er sein ganzes schauspielerisches Talent. Aber die Hoffnung, auf diesem Weg doch noch entdeckt zu werden, hat er im Grunde aufgegeben.
Am Flughafen von Brest kaufe ich mir die Michelin-Karten. Die rote gilt für ganz Frankreich, die gelben für einzelne Regionen und die blauen kann man zum Wandern benutzen. Es gibt sogar noch genauere, wer weiß, am Ende bin ich selbst darauf als kleiner Punkt zu sehen.
Draußen ist es windig, am Himmel ziehen zerrissene Wolkenformationen über uns hinweg. Der Flughafen ist nicht sehr groß. Weil es damals keinen Bus hierher gab, bin ich einmal vom Nachbarort Guipavas zu Fuß gegangen. Durchs Maisfeld zum Rollfeld. Guipavas kannte ich aus einer penetranten Radiowerbung, die mich das ganze Jahr über verfolgt hatte: »ON THE ROAD TO GUIPAVAS, THERE IS: LA BOÎTE! LA BOÎTE! PARCE QUE LES NUITS NE SONT PAS FAITS QUE POUR DORMIR!« Ich war nie in »La Boîte« gewesen, wo die Nächte nicht nur zum Schlafen gemacht waren.
Heute habe ich einen blitzenden Renault Clio gemietet und probiere aufgeregt wie ein Kind die vielen Knöpfe aus. Dann lese ich mich in der dicken Gebrauchsanweisung fest. Bevor ich losfahre, esse ich die letzten meiner mitgebrachten Vollkornbrotstullen. Ab jetzt gibt es nur noch Weißbrot. Ich gebe Gas, der Tank ist voll. Hoffentlich habe ich diesmal mehr Glück, als bei meinem ersten Besuch mit dem Auto. Damals hat uns die Bretagne ein Bein gestellt.
C’est sympa!
Dirk hatte für eine Woche den alten Opel seiner Eltern, und weil ich jede Gelegenheit nutzte, nach Brest zu kommen, überredete ich ihn, zusammen mit mir dorthin zu fahren. Wir trafen uns um Mitternacht an der Schönhauser Allee. Ich hatte ausgerechnet, dass wir für die 1800 Kilometer achtzehn Stunden brauchen würden. Bis Köln sollte ich schlafen und dann das Steuer übernehmen. Aber ich konnte nicht schlafen, weil Dirk, um sich wach zu halten, etwas hörte, was er »Acid-Trance« nannte. Ich lag auf dem Rücksitz und spielte im Kopf durch, wie ich mich bei einem Unfall schnell aus dem Auto retten könnte. Weil ich nicht schlafen konnte, rauchte ich.
Wir freuten uns auf den Zwischenstopp in Köln, wo wir Arne abholen und bei ihm frühstücken wollten. Um sechs Uhr morgens kamen wir an. Wir brauchten lange, bis wir ihn wach geklingelt hatten. Leider hatte er vergessen einzukaufen, und wir konnten nicht frühstücken. Kaffee war auch keiner mehr im Haus.
Ich übernahm trotzdem das Steuer und sah in der Ferne mit Bedauern den Kölner Dom, den ich noch nicht kannte. Um wach zu bleiben, rauchte ich. Die anderen rauchten auch. Wir hörten immer noch »Acid-Trance«. In Belgien gerieten wir in einen Schneesturm, weswegen wir von Belgien nicht viel sahen. Immerhin verstand ich jetzt, was Jacques Brel mit Il neige sur Liège hatte sagen wollen. Dirk meinte, das sei sein Lieblingswetter, da sich bei schlechten Bedingungen die Spreu vom Weizen unter den Autofahrern trennen würde. Ich vermutete, dass er sich zum Weizen rechnete. Um Geld zu sparen, mieden wir in Frankreich die Autobahn. Außerdem durfte ich nur 100 fahren, weil Dirk Angst um sein Auto hatte. Wir wählten immer den direkten Weg, aber wenn man sich unsere Route auf einer Karte größeren Maßstabs ansah, dann beschrieb sie Schlängellinien. Alle paar Kilometer kamen Hinweisschilder: »HIER VERLIEF DIE FRONT AM 16.7.1916« und »HIER VERLIEF DIE FRONT AM 17.7.1916«. Ich freute mich darauf, in Brest meine Freunde wiederzutreffen. Allerdings hatte ich Arne und Dirk noch nicht verraten, dass ich bisher niemanden erreicht hatte und nur hoffen konnte, dass sie uns bei sich übernachten lassen würden.
Der Weg wurde immer länger, wir waren jetzt schon weiter als die deutsche Front im Ersten Weltkrieg, und das, obwohl wir nur einen alten Opel hatten. Um wach zu bleiben, rauchten wir. In der Ferne sah ich mit Bedauern die Kathedralen von Amiens und Reims, die ich noch nicht kannte. Dirk hatte endlich seine zweite Kassette eingelegt, Tocotronic. Ich hatte von dieser Band, die er als beste Band der Welt bezeichnete, noch nie gehört, aber schon ihr erstes Lied überzeugte mich: »Wir haben gehalten / in der langweiligsten Landschaft der Welt / wir haben uns unterhalten und festgestellt, dass es uns hier gefällt.« Ich nickte zustimmend mit dem Kopf.
Wir fuhren den ganzen Tag, und als es schon wieder dunkel wurde, tauchte rechts der Straße in der Ferne ein beleuchteter Hügel auf, das musste der Mont Saint-Michel sein. Ich sah es mit Bedauern, weil ich ihn noch nicht kannte.
Aber es kam nicht infrage anzuhalten, wir wollten so weit kommen, wie die Straße führte, bis ins Finistère, ans Ende der Welt. Allerdings waren wir so müde, dass wir die letzten Kilometer alle drei schliefen. Tocotronic fuhren für uns und rauchten.
Nach dreiundzwanzig Stunden Fahrt hatten wir Brest erreicht. Nach einer so langen Fahrt durch kahle Landschaften umgaben uns plötzlich schmale Gassen mit grauen, schmucklosen Betonhäusern. Es nieselte auf den Asphalt. Ich konnte nicht glauben, dass ich wieder hier war. Beim Aussteigen nahm ich einen tiefen Atemzug: diese salzige Luft, der Geruch von Teer und Holzfeuer. So hatten die Kleider meiner Freunde immer gerochen, wenn sie mich in Berlin besuchen kamen.
Leider öffnete bei meinen Freunden niemand. Allerdings schloss man hier seine Türen nicht ab. Weil ich von innen Geräusche hörte, betrat ich die Wohnung.
Die Stereoanlage war voll aufgedreht, infernalische, japanische Trommelmusik. Auf dem Sofa schlief Yann. Vielleicht hörte er diese Musik, um wach zu bleiben.
Ich ließ ihn schlafen, und wir gingen ins »Comix«, eine Kneipe, die früher an Sonnabenden so voll war, dass man nur stehen konnte. Alle kamen hierher. Jetzt war niemand da. Ein paar Straßen weiter, im »Zèbre«, sah es schon anders aus: Man konnte nur stehen. Die Jugend war gemeinschaftlich eine Ecke weiter gezogen. Ein gutes Zeichen, die Dinge waren im Fluss, auch am Ende der Welt. Leider konnte ich niemanden von meinen Bekannten entdecken, wir mussten also im Auto schlafen. Am Morgen war die Scheibe beschlagen von unseren Ausdünstungen. Aber sie durfte nicht abgewischt werden, sonst würden sich Schlieren bilden, erklärte Dirk, der sich mit Autos auskannte. Wir warteten eine halbe Stunde, bis die Ventilation die Scheiben getrocknet hatte und fuhren zu Anne. Sie liebte Brecht und Marlene Dietrich, und als Deutsche waren wir für sie so etwas Ähnliches wie Brecht und Marlene Dietrich. Zum Glück war sie zu Hause und bot uns sofort an, bei ihr zu wohnen. Arne sagte: »C’est sympa!«, das war der einzige französische Satz, den er bis jetzt aufgeschnappt hatte, aber er passte fast immer.
Wir aßen Croissants und Apfeltaschen, der Boden war schnell mit Krümeln bedeckt. Dann zogen wir los, um Gauloise caporal zu kaufen, jeder eine cartouche. Nach Deutschland wurden diese Zigaretten nicht exportiert, man bekam nur eine dünnere, elegante Version, das Original war aber dick und kurz, wie die Finger der Menschen hier. Wir hüllten uns in den Geruch dieses schwarzen Tabaks und fuhren ans Meer. Ich hatte bei meinem ersten Aufenthalt nur ein altes Kinderfahrrad mit ausgeleierten Pedalen zur Verfügung gehabt und war deshalb kaum aus der Stadt rausgekommen. Jetzt würde ich endlich etwas von der Bretagne sehen. Zum Beispiel den berühmten zehn Meter hohen Menhir de Kerloas, der irgendwo in der Nähe stehen musste.
Am Meer bewunderten wir die Wellen und dachten über den Anfang von Heiner Müllers Hamletmaschine nach: »Ich stand an der Küste und redete mit der Brandung blabla –«. Schwer, dem etwas hinzuzufügen. Auf dem Rückweg verfuhren wir uns auf der Suche nach dem Menhir. Wir holperten über schlammige Feldwege und verfluchten die Karte. Vielleicht hielten sie ihre Heiligtümer vor uns versteckt? An einem Bauernhof kurbelte ich die Scheibe herunter und sprach eine Frau unbestimmbaren Alters an, wo hier »le menhir« sei. Statt zu antworten, entblößte sie grinsend ihr zerklüftetes Gebiss. Vielleicht hatte sie mich falsch verstanden. Jedenfalls bestand kein Zweifel: Das hier war la Bretagne profonde. Als wir uns gründlich genug verfahren hatten, stießen wir durch Zufall doch noch auf den Menhir. Wir rüttelten daran und es donnerte kurz, sonst passierte nichts.
Der Stein war tatsächlich zehn Meter hoch, ursprünglich sogar zwölf, aber ein Blitz hatte die Spitze abgeschlagen. Er war 5000 Jahre alt und dreißig Kilometer weit zu sehen. Auf einer kleinen Tafel stand:
»FRISCH VERMÄHLTE RIEBEN IHREN UNTERLEIB AN DEN BUCKELN DES MENHIRS. DER MANN, UM MÄNNLICHEN NACHWUCHS ZU BEKOMMEN, DIE FRAU, UM IHRE HERRSCHAFT IM HAUS ZU SICHERN.«
Der Legende nach lag unter dem Menhir ein Schatz vergraben. Wenn die Menhire am Heiligabend um Mitternacht mit dem ersten Schlag der Glocke ans Meer gingen, um einmal im Jahr zu trinken, konnte man den Schatz leuchten sehen. Mit dem zwölften Schlag der Glocke kamen sie aber schon wieder zurück. Viele Schatzsucher sollen davon überrascht worden sein und unter dem Stein begraben liegen.
Am nächsten Tag wollten wir eine größere Tour machen und fuhren tanken. Die erste Tankstelle war geschlossen. An der zweiten gab es kein Benzin mehr. Wir probierten es weiter, aber wir hatten kein Glück. Ich telefonierte alle Tankstellen der Umgebung an, nein, kein Benzin, die Fernfahrer streikten doch, ob wir das nicht wüssten? Nein, das war uns entgangen, wir saßen fest. Wir hatten zwar ein Auto, aber kein Benzin. Jeden Tag hofften wir, dass die Fernfahrer zur Vernunft kommen und ihre kindische Blockade aufheben würden, aber sie hatten kein Einsehen. Es blieb uns nichts anderes übrig, als unsere Tage damit zu verbringen, beim trotzkistischen Antiquar feuchte Bücher zu kaufen, mit meinen Freunden in der überfüllten Kneipe zu stehen und Annes Zimmer nach und nach mit Croissants vollzukrümeln.
Warum waren wir auch ausgerechnet im November ans Ende der Welt gefahren? Jetzt würden wir vielleicht für immer hier festsitzen. Denn selbst wenn der Streik einmal beendet wäre, wer sagte uns, dass sie es hier mitbekommen würden? Und wenn sie es mitbekämen, wer sagte uns, dass sie es uns sagen würden? Vielleicht wollten sie uns ja dabehalten, weil sie sich so über unseren Besuch freuten.
Mir war es recht, ich ging ja immer noch davon aus, dass der Rest der Bretagne genauso trist wie Brest aussah. Außerdem hatte ich so die Möglichkeit, in Gesprächen über den Streik mein Französisch aufzufrischen. Nur Arne bedauerte, dass er wegen der allgemeinen Stimmung nichts mehr mit seinem einzigen französischen Satz anfangen konnte. Er sagte trotzdem bei jeder Gelegenheit »C’est sympa«, es war ironisch gemeint.
*
Diesmal drohte wieder ein Streik, allerdings betraf er die Lehrer. Aber wer wusste schon, ob sich in Frankreich nicht die Fernfahrer mit den Lehrern solidarisierten? Ich nahm mir vor, die Streiknachrichten aufmerksamer als den Wetterbericht zu verfolgen. Für die nächsten Tage war noch nicht mit dem Schlimmsten zu rechnen.
Die Einfahrt in den Hafen von Brest ist für mich eindrucksvoller als die von JFK nach Manhattan. Solche Behauptungen sind natürlich Unsinn, vielleicht hatte ich im Bus von JFK nach Manhattan nur immer noch mit dem Flugzeugessen zu kämpfen und schreckliche Angst, weil ich es nicht geschafft hatte, in irgendeinem YMCA zu reservieren. Aber bei Städten wie Brest, von denen es normalerweise heißt: »Dann sind wir durch Brest gefahren. Es hat geregnet. Wir haben nicht gehalten, da gibt es doch überhaupt nichts zu sehen«, muss man ein bisschen Pathos auftragen, um sie zu unterstützen. Der Hafen und die Bucht von Brest sind ein Erlebnis, für Hafen- und Buchtfreunde sowieso, aber für alle anderen auch, und sei es als grauer Fond für die bunten Eindrücke der folgenden herrlichen Ferientage in der Bretagne.
Rechts erhebt sich auf dem Fels die Stadt, und links sieht man Molen, Kräne, Silos, verrostete Lagerhäuser, im Bau befindliche Schiffe, sogar eine Bohrinsel wird gerade montiert. Viele der leerstehenden Lager- und Fabrikgebäude sind von der Stadt für Graffitisprayer freigegeben worden. Diesen Teil des Hafens hat man erst auf Befehl Richelieus dem Meer abgetrotzt.
Wie im Walzertakt schwingt man durch die Kreisverkehre und nach und nach wird das Gelände urbaner. Bei den ersten Kneipen fragt man sich noch, wer sich hierher verirren mag. In solchen Kneipen müssen Geschichten wie die Schatzinsel beginnen. Dann kommen Spezialgeschäfte für Angler und Taucher, Depots mit Militärbekleidung und sogar einzelne Wohnhäuser. Aber vielleicht hängt die Wäsche in den Fenstern auch schon seit Jahren zum Trocknen, es regnet ja immer gleich wieder.
An der Jugendherberge steht: OSTALERI AR YAOUANKIZ. Man führt mich auf mein Zimmer, ich erkenne alles wieder, obwohl einige Jahre vergangen sind. Die Kissenbezüge sind inzwischen durchgescheuert, aber das Leselicht am Kopfende der Betten, das mir damals so nützlich vorkam, geht noch. Im Gemeinschaftssaal sitzen polnische Bauarbeiter, leider weiß ich nicht einmal mehr, was auf Polnisch »Ich habe alles vergessen« heißt. Ich suche im zerfledderten Telefonbuch nach meinen alten Bekannten. Diese seltsamen Namen: Michel le Buan, Nadine Festoc, Roger Kerserho. Dann stoße ich auf meine eigene Telefonnummer: Jochen Schmidt, Rue Massilon 30. Das Telefonbuch ist wirklich sehr alt. Die Adresse hatte ich schon vergessen. Meine Post aus Berlin wurde damals oft auf einen monatelangen Umweg über das weißrussische Brest-Litowsk geschickt.
Ich fahre erstmals im Auto in die Stadt, wie ein König in seiner Sänfte. Was ist von meinem Viertel geblieben? Angeblich soll es diesem traditionellen Militärstandort (die ersten Befestigungsanlagen stammen noch von den Römern) schlechtgehen, seit Chirac Mitte der 90er das Militärbudget gekürzt hat. In vielen Fenstern hängen a louer-Schilder. Im »Zèbre«, das bei meinem Besuch mit Dirk und Arne immer so voll war, ist, obwohl heute Sonnabend ist, kein Mensch. Wer weiß, wohin die Jugend inzwischen weitergezogen ist, vielleicht ja wieder zurück ins »Comix«. Die Markthallen, in denen uns der Crêpe-Bäcker mit der Fistelstimme immer eine Crêpe spendiert hat, sind renoviert worden. Die Bäume davor hat man durch neue ersetzt. Die kleine Postfiliale ist geschlossen, aus der alten Schule ist eine moderne Mediothek geworden. Der Supermarkt Leclerc, zu dem ich eine persönliche Beziehung aufgebaut hatte – wie gut, dass der Mensch fähig ist, sich in der Fremde sogar an solche Dinge wie Supermärkte zu binden –, längst ist er umgebaut worden. Immerhin gab es hier importiertes, eingeschweißtes Schwarzbrot. An der Uni steht in großen Buchstaben FAC EN GRÈVE (»Fakultät im Streik«), das »g« ist aber abgefallen, deshalb liest es sich, wie FAC EN RÊVE (»Fakultät im Traum«). Die Filiale des Crédit agricole, in der ich mein erstes französisches Konto eröffnet habe. Sie haben mir noch jahrelang Abrechnungen nach Berlin geschickt, obwohl das Konto längst leer war. Ich habe das immer als Anhänglichkeit empfunden und als Einladung interpretiert, wiederzukommen. Ich hatte dann ein ganz schlechtes Gewissen, als ich mein Konto doch noch auflöste. Aber immerhin habe ich dabei das Wort für »Konto auflösen« gelernt: résilier.
Selbst das kleine France-Télécom-Büro ist geschlossen. Außen steht ein Graffiti: »Stopp dem Serviceabbau!« Sie haben nicht durchgehalten. Vielleicht auch ein bisschen wegen mir, weil ich meine letzte Rechnung nicht bezahlt habe. Es war nicht viel, aber damals hätte ich das Geld einfach nicht gehabt. Ich wusste, dass sie mich nicht finden würden, weil ich bei ihnen nicht als »Jochen«, sondern als »Gochen« geführt wurde. Dass sich der Buchstabe »J« nicht »Je«, sondern »Ji« buchstabiert, hatte ich bei meiner Ankunft in Frankreich noch nicht gewusst.
Der Papierladen ist jetzt ein Reisebüro. Der Betreiber hatte immer eine dicke Goldkette um den Hals. Die Bäckerei mit dem Brotautomaten für nachts gibt es nicht mehr. Aber im Fenster des Büros dieses Geistlichen, der kostenlos Bretonisch unterrichtete, finde ich das vergilbte Plakat mit dem mit Filzstift gemalten Fahrrad, auf dem die einzelnen Teile auf bretonisch bezeichnet sind. Und eine Ecke weiter hängt immer noch derselbe Kondomautomat in der Sonne. Wenigstens etwas, das sich nicht verändert hat.
Mein altes Kino »Les studios«. Es subventionierte sich mit einer etwas abseits gelegenen Sexfilm-Filiale. Das Geld, das dort eingenommen wurde, investierte man etwa in ein Festival des spanischen Films, das in jedem Frühjahr stattfindet. Ich sah Filme, in denen die Menschen dauernd Durst hatten und sich leidenschaftliche Szenen machten. Wenn man das Kino dann durch den Hinterausgang verließ, stand man in einer dieser schmalen, geteerten und baumlosen Straßen. Der feine Regen im gelben Laternenlicht, der Holzfeuergeruch, die verrosteten Scharniere der Plastikfensterläden. Man musste aufpassen, nicht zum Lyriker zu werden und sich wirtschaftlich zu ruinieren.
Jetzt ist das Foyer voller Menschen, die für Karten anstehen. Wie ein Geist, der aus dem Jenseits kommt und unsichtbar zwischen den Lebenden umhergeht, stelle ich mich einen Moment zu ihnen. Aber ich sehe mir keinen Film an, ich gehe weiter zur Pont de Recouvrance, dem eindrucksvollsten Bauwerk von Brest. Sie stammt von 1954 und ist eine der bedeutendsten Hubbrücken Europas. Man überquert auf ihr den Penfeld, eine Art Fjord, der die Stadt teilt und in dem sich das alte Arsenal befindet, der Militärhafen mit seinen Reparaturkränen, abgerüsteten Minensuchern, Geschützen, Trockendocks. Man kann das Arsenal nur zu Führungen betreten. Es arbeiten Tausende Menschen hier. Der Flugzeugträger Charles de Gaulle ist hier gebaut worden.
Die Brücke hat einer derer besungen, die es aus Brest weggeschafft haben. Miossec ist in Deutschland kaum bekannt, aber in Frankreich war schon die erste Platte Boire ein Erfolg. Dem folgten Baiser und A prendre. Boire lebte sehr von der morbiden Atmosphäre dieser Stadt: »Aber auf der Brücke Recouvrance / sie ist so schön anzusehen / dass ich fast denke / ich könnte doch eines Tages mit dem Trinken aufhören…«
Brest ist ein Ort, der wenig Ausreden bietet, sich nicht zu konzentrieren. In manchen Lebensphasen ist das genau das Richtige. Abends ging ich immer auf den Molen spazieren, so weit ich kam. Leider konnte man die kilometerlangen Hafendämme nicht betreten. Das wären stundenlange Spaziergänge auf einem durchs Meer führenden schmalen Betonpfad gewesen, in der Hoffnung, irgendwie verwandelt zurückzukehren. Dieser seltsame Wunsch nach Einsamkeit, weg von den Menschen, aber auf der Suche wonach? Am besten wäre natürlich eine Insel gewesen. Alles, was von außen kam, konnte nur Ablenkung sein, aber wovon? Was hat die Völker, die als erste hier gelebt haben, her verschlagen? Warum sind sie nicht in den Süden gezogen, wo uns heute alles um so viel leichter erscheint?
Ich bleibe plötzlich stehen und atme diesen seltsamen Holzfeuergeruch ein wie das Parfum einer alten Bekannten. Ob es überhaupt Holzfeuer ist? Vielleicht auch eine Mischung aus Teer, Regen und Salzluft. Wind kommt auf, und immer wieder fallen ein paar Regentropfen, gegen die eine einfache Kapuze ausreicht. Ich bin jetzt in einer Gegend, in der die Straßen nach Admiralen benannt sind. Die Baumstämme sind von grünen Flechten überwuchert, nicht nur an der Wetterseite. Wenn ich lange genug stehenbleibe, wächst mir vielleicht auch so ein Panzer. Vorher werde ich nie erfahren, was es heißt, in der Bretagne ein Baum zu sein.
Ich hatte immer das Gefühl, nicht das Recht zu haben, etwas über diese Stadt zu denken, solange ich mich nicht ganz für sie entscheide. Dann würde man zum Adel derer gehören, die hier bleiben. Sie sind alle nicht mehr jung, denn die Jungen studieren an der Uni und machen sich davon. Und denen, die bleiben, sieht man an, was es bedeutet, hier zu leben. Es ist nicht, dass sie nicht weggekonnt hätten, aber sie haben sich entschieden. Manche haben auf eine Karriere in Paris verzichtet. Diese Menschen legen Wert darauf, nicht käuflich zu sein.
Immerhin hatte ich mich der Stadt verschrieben, wenn auch nur für ein Jahr. Es war kein Hochzeitsversprechen. Ich wollte mich wie eine Auster verstecken, die an der Luft eine Woche überleben kann. Ich wusste, dass ich ein Jahr ohne Freunde aushalten konnte. Aber das musste ich dann gar nicht, ich fand schneller Freunde als in Berlin. Denn Brest wirkt zwar abweisend und trist, aber die Menschen sind umso herzlicher.
Gaël
Gaël hatte eigentlich, wie sein Vater und dessen Vater, Fischer werden sollen. Aber von der Fischerei war in ihrer Gegend nicht mehr viel geblieben, die letzten Fischer machten ihr Geld mit dem Beliefern der Inseln. Seit Gaëls Vater öfter zu Hause war, verstanden sie sich nicht mehr. Er hatte plötzlich wieder das Kommando übernehmen wollen, obwohl sie längst gewohnt waren, ohne ihn auszukommen. Außerdem litt Gaël stark an Seekrankheit. Schon im Auto wurde ihm schlecht, eine Busfahrt ertrug er kaum. Wenn sein Vater ihn trotzdem zwang, mit ins Boot zu steigen, wurde Gaël ganz weiß im Gesicht, aber er riss sich zusammen, weil er ihn nicht enttäuschen wollte. In der Schule war er auch nicht der Hellste und schaffte das Abitur nicht. Aber er hatte seinen Stolz und war entschlossen, weder seinen Eltern noch dem Staat auf der Tasche zu liegen. Jedes Jahr arbeitete er in einem anderen Job. Manchmal ging er monatelang auf Montage nach Monaco, sie bauten immer neue Hotelkomplexe. Er fuhr einen Betonmischer und lernte den Akzent seiner italienischen Kollegen nachzuahmen. In der Mittagspause setzten sie sich in ein Café und hielten Ausschau nach prominenten Schauspielerinnen.
In der Saison arbeitete er oft auf einem Leuchtturm und erklärte den Touristen die Funktionsweise des Scheinwerfers. Er machte immer denselben Witz: »Wie viele Stufen haben Sie gezählt? Wenn Sie eine 132. gezählt haben, wird Ihr Name eingemeißelt.« Insgeheim hoffte er, bei der Arbeit einmal ein Mädchen kennenzulernen. Aber das war aussichtslos, sie wollten ja nur die Aussicht genießen.
Außer der Saison arbeitete er als Plakatkleber. Am liebsten hatte er Parfumwerbung, er fühlte sich für die Mädchen auf den Plakaten verantwortlich. Es gab eine Ecke im Hafen, in die kaum jemand kam. Trotzdem stand ausgerechnet hier eine Plakatwand. Das Mädchen auf dem Plakat hatte goldene Haare und schwamm in flüssigem Gold. Zu ihren Füßen pickte eine Möwe in einer Pfütze. Warum hätte er malen sollen, wenn er so schöne Dinge aufhängen durfte?
Ende der Leseprobe