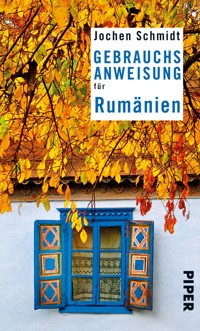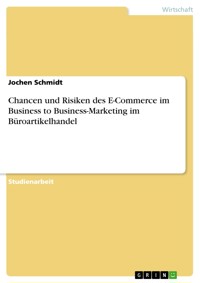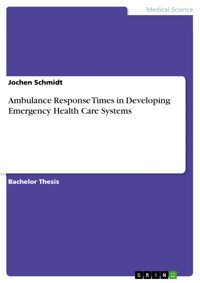12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wissen Sie, was den Burj Khalifa in Dubai mit dem Palast der Republik verbindet? Wo der Eierscheckenäquator verläuft? Und welches Wahrzeichen die »Fit«-Flasche kopiert? Jochen Schmidt, aufgewachsen in der DDR, reist durch die Bundesländer des Ostens, die immer noch für viele Deutsche Neuland sind. Um dies zu ändern, besichtigt er die Raumfahrtausstellung im Heimatort des ersten Deutschen im All. Erkundet nationale Aufbauprojekte wie den Rostocker Seehafen. Und sucht im Köpenicker Forst den Kopf einer vergrabenen Lenin-Statue. Er ergründet die Zeugnisse der »Ostmoderne«, würdigt das Improvisationstalent der Menschen und lässt sich ihre Geschichten erzählen. Eine kluge Anleitung für alle, die den Osten entdecken wollen oder sich gerne erinnern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Christine Schmidt
ISBN 978-3-492-97173-7
September 2015
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2015
Redaktion: Margret Trebbe-Plath, Berlin
Comic im E-Book: Markus Mawil Witzel, Berlin
Karte: cartomedia, Karlsruhe
Coverkonzeption: Büro Hamburg
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaasbuchgestaltung.de
Covermotiv: renovierte »Milchbar«-Fassade in Stralsund (Jürgen Karau)
Litho: Lorenz & Zeller, Inning a. A.
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Vorwort
Ich gehe in Berlin spazieren und gucke dabei, wie als Kind, immer nach unten. So gelingt es mir manchmal für eine Weile, mir vorzustellen, ich sei fünf Jahre alt. Am Boden sieht es nämlich oft noch aus wie früher, ich denke dann: Hoffentlich ist nicht so bald Geld da, um die Bürgersteige neu zu pflastern. Dann gucke ich doch nach oben und freue mich, dass da alte Straßenlaternen sind. Die schönsten, die aussehen wie ein Mann mit Blechhut, werden leider durch ein neues Modell ausgetauscht, das ihnen ähneln soll.
Ich bin unterwegs zu einem Kinderflohmarkt im Prenzlauer Berg. Mit den Jahren findet man hier immer weniger Sachen aus der DDR, aber wenn ich alte Kinderbücher sehe und die Verkäufer darauf anspreche, freuen sie sich manchmal, dass ich die Herkunft erkannt habe. Ein Ratespiel mit einer Wählscheibe, das »Wähle mit« heißt, was im Osten nicht ohne Ironie war. Ich liebäugle damit, das Spiel zu kaufen, da ich es als Kind auch besaß, obwohl meine Wohnung schon überquillt von Dingen, die ich auf diese Weise rette. Mit meinem Interesse bringe ich die Dame dazu, das Spiel dann doch lieber zu behalten. Das ist in Ordnung, ich will nur nicht, dass es auf dem Müll landet. Eine silberne Stoppuhr leiste ich mir, so eine hatten wir auch, ich habe damit monatelang Fernsehsendungen vermessen und sogar geprüft, ob die Uhr vom Testbild richtig ging. Sonst hatten ja nur die Sportlehrer eine Stoppuhr. Erst jetzt sehe ich, dass die Uhr »Made in USSR« ist. Ich lerne so viel über mein Leben, indem ich die Dinge von früher noch einmal genau betrachte. Am schönsten ist der Moment, wenn man etwas wiedersieht, von dem man gar nicht wusste, dass man es nicht vergessen hatte.
Jetzt ist es Zeit, wählen zu gehen, denn heute ist Wahlsonntag. Mein Wahllokal ist in einem Seniorentreff untergebracht, in der Nähe meiner Wohnung. Beim Schlangestehen kann man sich dort immer mit einem Tisch voller alter Bücher ablenken, die es hier gegen eine Spende zum Mitnehmen gibt: »Man wird nicht als Soldat geboren« von Konstantin Simonow, aber auch »Tod am Meer« von Werner Heiduczek und »Unsere Menschen in Protzendorf« vom genialen Karikaturisten Henry Büttner.
Im Raum mit der Urne stehen in einer Schrankwand gebundene Jahrgänge vom Magazin. Die Zeitschrift mit den gesitteten Aktaufnahmen war früher so eine Kostbarkeit, dass man sie zum Buchbinder gebracht hat und das Abo weitervererbte. Zum Verkauf habe ich das Magazin nur gesehen, wenn ich morgens um 5 mit der S-Bahn aus Berlin-Buch zum ESP-Unterricht (»Einführung in die sozialistische Produktion«) im Bremsenwerk am Bahnhof Ostkreuz musste und der Kiosk gerade aufgemacht hatte. Mich freuen auch der Kachelofen und die elegante hölzerne Faltwand, mit der der Raum geteilt wird.
Joseph Beuys hat 1980 in seiner Installation »Wirtschaftswerte« als Erster ein Regal mit DDR-Waren zur Kunst erklärt. Inzwischen gibt es im Land Dutzende neue »Heimatstuben«, in denen DDR-Produkte ausgestellt werden, oft privat betrieben. Ich bin für jede Form von Bewahren, denn die Wiederbegegnung mit Gegenständen des täglichen Lebens ist immer lehrreich und weckt Emotionen. Die DDR findet sich aber auch dort, wo man sie nicht vermutet. Die Stahlträger vom Palast der Republik wurden angeblich im Burj Khalifa verbaut, andere sagen in den Motorblöcken von Phaeton und Golf. Eine alte DDR-Klospülung im Haus für russische Kultur und Wissenschaften an der Friedrichstraße. Ein Stern-Radio auf einem Flohmarkt in Haifa. Eine Wernesgrüner-Pilsner-Werbung auf einem Dach in Budapest. RFT-Lautsprecher an einer Westberliner S-Bahn-Station. Eine alte S-Bahn-Heizung in einem Büro an der Humboldt-Universität. Mir machen solche Entdeckungen Freude, und ich staune immer, wie schnell man darüber ins Gespräch mit Fremden kommt.
Auf den Straßen Berlins will die Schwalbe einfach nicht verschwinden, im Einigungsvertrag soll ihr eine Klausel das Überleben gesichert haben, obwohl man mit ihr 60 km/h fahren kann statt der üblichen 45 km/h. Seit ein paar Jahren tauchen auch massenhaft Klappräder von MIFA auf, manchmal im besten Zustand, noch mit den alten Lampen und Rückspiegeln – standen sie so lange im Keller? Bei meiner Physiotherapeutin fällt mein Blick auf ein Gerät aus dem Dresdner VEB Transformatoren und Röntgenwerk. Es sei ihr nach der Wende von ihrem Medizinausstatter gebraucht verkauft worden, berichtet sie mir, sie bekommt dafür jedes Jahr immer noch den TÜV.
Im Meilenwerk in Moabit, wo Hunderte Oldtimer angeboten werden, steht der EMW vom DDR-Kulturminister Johannes R. Becher (genannt Johannes »Erbrecher«). Zu meiner Zeit fuhren die Funktionäre Citroën, was wir immer seltsam fanden, denn warum hatten sie nicht Autos, die bei uns hergestellt wurden?
Dann gehe ich mit meiner Tochter zu einer Aufführung von »Spuk unterm Riesenrad« im ehemaligen Akademie-gebäude an der Prenzlauer Promenade, in dem meine Eltern gearbeitet haben. Es wird sicher irgendwann abgerissen werden, das ist nur eine Zwischennutzung. Die Waschbecken auf der Toilette haben keine Mischbatterie, sondern zwei separate Plastehähne. Und noch dazu haben beide einen blauen Punkt für »kalt«, da hat wer gepfuscht. Ich erinnere mich wieder, wie man sich in der Schule in der Pause drunterbeugte und gierig Wasser trank oder damit spritzte. Abends habe ich eine Lesung im RAW-Tempel im Friedrichshain, früher ein Reichsbahnausbesserungswerk. Auf dem Gelände befindet sich hinter Büschen ein kleiner Ehrenhain für Franz Stenzer und Ernst Thälmann. Irgendwer hat ihre Köpfe golden angemalt. Die Büsche dienen als Depot für die zahlreichen Drogendealer auf dem Gelände, Asylbewerber von heute, die uns Ostdeutsche daran erinnern sollten, dass wir alle einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Da ich weiß, was von den Dingen von früher stammt und was von heute, kommt es mir oft vor, als lebte ich in zwei Ländern auf einmal. Aber ich empfinde das als Bereicherung. 25 Jahre war ich in der ganzen Welt unterwegs, aber auf die Idee, durch meine alte Heimat zu reisen und nachzusehen, was davon geblieben ist, komme ich erst jetzt. Und plötzlich habe ich es eilig, denn vieles von dem, was ich sehen werde, wird in wenigen Jahren schon verschwunden sein.
Autofahren nach Norden
Ich komme immer so schwer los, wenn ich im Hausflur meinen Nachbarn treffe. Er war vor der Wende kein Freund der DDR und hat aus Bettlaken für Mitschüler USA-Victory-Zeichen genäht. Aber das Leben im Kapitalismus setzt ihm so zu, dass er zu seinem Schrecken sogar schon beim Hören einer Ostrock-CD sentimental wird, Musik, die man damals aus Prinzip verachtete. Er hat seine Arbeit als Filialleiter einer Buchkette gekündigt, weil er das niveaulose Sortiment und die Gehirnwäsche in den regelmäßigen Marketingschulungen nicht mehr ertrug. Dafür hat er jetzt kein Geld. Ich habe einige Freunde, die wie er dem Osten nicht nachweinen, aber mit dem Westen nicht warm werden. Mein Nachbar erzählt mir, dass er die Unterlagen seiner ersten Wohnung in Pankow gefunden hat, für die er damals 21 Mark Miete zahlen musste; heute geht das ganze Geld, das er verdient, für Miete und Heizung drauf. Sein einziger Trost: wenn der FC Bayern mal verliert.
Wie schön ist es immer, am Alexanderplatz vorbeizufahren, aber es ist jedes Mal ein Abschiedsbesuch, denn seit der Wende wird über neue Wolkenkratzer geredet, also vor allem über Abriss. Sogar das schöne Haus des Reisens soll fallen. Über die unmenschlich großen Freiflächen würden sibirische Winde pfeifen, die »sozialistische Einschüchterungsarchitektur« müsse dringend auf traditionelle Blockrandbebauung umgestellt werden. Die ästhetischen Argumente sind für mich reine Folklore, man könnte ja darüber diskutieren, aber in Wirklichkeit geht es um Geld. Der Plattenbau neben dem Berliner Verlag gilt der BZ als größter Schandfleck von Berlin. Wenn das so ist, wünsche ich mir mehr Schandflecken, immerhin kann man dort im Zentrum einer europäischen Hauptstadt noch günstig wohnen. Ich habe mich an den Bau gewöhnt, und dass heute so nicht mehr gebaut würde, macht ihn für mich interessant. Da es im Osten keine wirkliche Öffentlichkeit gab, haben Gerüchte immer eine große Rolle gespielt. Von diesem Haus hieß es, dass in der einzigen Wohnung, die an der seitlichen Fassade ein zusätzliches Fenster hatte, Honeckers Tochter wohnte, was natürlich nicht stimmt, da sie ja in der Leipziger Straße ihre Wohnung hatte, das Fenster erklärt sich durch die Konstruktion des Hauses. Reicht so eine Geschichte, um das Haus unter Denkmalschutz zu stellen? Rechts daneben steht das ehemalige Presse-Café, heute »Escados«. Es hatte bis zur Wende einen bunten Wandfries von Willi Neubert, der inzwischen in Thale, wo er vor seiner Zeit als Künstler in den Eisen- und Hüttenwerken gearbeitet hat, wieder geschätzt wird. Der Emailfries wurde übrigens nicht abgenommen und ist unter der Verkleidung noch vorhanden. Vielleicht nur eine listige Form von Konservierung?
In Neuruppin fahre ich von der Autobahn auf die Landstraße, Dörfer mit Feldsteinkirchen. Hier sind die Häuser viel weniger bunt renoviert als zwischen Berlin und Frankfurt (Oder). Überall gibt es interessante Technikmuseen, in Kyritz ein Agrarflugmuseum, in Lindenberg ein Kleinbahnmuseum. In Perleberg ist neulich von der Polizei ein Multicar angehalten worden, das seit der Wende mit DDR-Kennzeichen gefahren ist. Es gibt ein DDR-Museum, an der Fassade hängen zwei Mauersegmente und der etwas seltsame Spruch: »Den Opfern zum Gedenken 1945 1989« – »Das Wunder vom Herbst 1989. Wir sind das Volk – das Volk sind wir!« Man müsste mal eine Datenbank aller noch erhaltenen Mauersegmente erstellen. Ich kenne sogar eines in einem Friedrichshainer Hinterhof, niemand weiß, wie es dort gelandet ist. Warum war ich noch nie in Perleberg? Ein Busfahrer in Moskau hat mir, als er hörte, dass ich Deutscher bin, einmal gesagt, dass er dort gedient habe. Auf einem zentralen Platz finde ich einen russischen Soldatenfriedhof mit dem roten Stern. Ich freue mich, dass ich inzwischen die russische Inschrift lesen kann; in der Schule wäre ich dazu nicht in der Lage gewesen, aber jetzt, wo ich freiwillig Russisch lerne, liebe ich diese Sprache. Dann fahre ich im Dunkeln weiter, und ich sehe Irrlichter am Himmel, Dutzende blinkende rote Punkte, das sind Windräder, der einzige Wirtschaftszweig, der in manchen östlichen Regionen noch floriert.
Schwerin
In Schwerin suche ich nach einem preiswerten Hotel und lande am Hauptbahnhof. Parken ist nicht so einfach, früher gab es die Parteileitung, heute das Parkleitsystem. Im Innenbereich des Hotels ist alles rosa überlackiert. Drei Uhren im Flur zeigen die Zeit von Tokio, Schwerin und New York. Auf Leinen gezogene Fotos von Schwerin schmücken das Treppenhaus. Ein Stadtplan auf Lackpapier liegt im Zimmer bereit, außerdem eine Werbebroschüre für »Gyulova Rakiya«, Rosenschnaps aus Kazanlak in Bulgarien. »Die Liebe zum Leben entfachen! Schenke ihm nur einen Blick und brich das Eis, tobe mal wild herum! Ein einmaliger feiner Geschmack und dezenter Duft, die die Seele dazu treiben, das Eis zu brechen, in der Unordnung Ordnung zu stiften! Oder gerade das Gegenteil? Unwichtig! Mit jedem weiteren Schluck wird die Existenz des Offensichtlichen verleugnet, des Nicht-Existierenden – bestätigt! Das Geheimnis bleibt ungelüftet. Das Getränk wird heutzutage von einer einzigen Person hergestellt, die auch das Herstellungsrezept streng geheim hält. Das Getränk wird aus vorsichtig erlesenen Blättern der Ölrose hergestellt.«
Mein Verdacht bestätigt sich, als die Rezeptionistin am Telefon bulgarisch spricht, manchmal flicht sie auch deutsche Wörter wie »Hüftspeck« ein. Gibt es das Wort bei ihnen nicht? Ich bin in einem bulgarischen Hotel! Ich war oft genug in Bulgarien, um diesen speziellen Kitsch zu erkennen und zu schätzen. Bestimmt kann sie auch wahrsagen! Im Restaurant gibt es Kebaptscheta, Kjufteta, Schweineleber »Dorf Art«, Schopska-Salat. Ein bulgarisches Hotel in Deutschland scheint mir eine gute Idee, dann muss man nicht so weit fahren im Urlaub. Ähnlich geht es mir immer im tschechischen EC nach Dresden, wenn im Restaurant »behmische Biere« angeboten werden. Eigentlich sollten in Deutschland nur ausländische Züge verkehren, dann wäre man bei jeder Fahrt in den Ferien.
Am Pfaffenteich eine Eisbahn. Silvestermüll liegt noch rum. Von Stephan Horotas Skulptur »Schirmkinder«, die es auch in Berlin an der Danziger Straße gibt, steht nur noch der Sockel. Aber diesmal waren es keine Altmetalldiebe, sie musste dem Weihnachtsmarkt weichen. Dafür ist hier vor Kurzem eine Schliemann-Skulptur zersägt worden. Obwohl es jetzt so viel Wachschutz gibt. »Dieses Objekt wird bestreift durch …«, schreiben sie auf ihren Hinweisschildern. In der Friedrichstraße mehrere Trödelläden. Im Schaufenster sehe ich das rote Maßband aus dem Sportunterricht, das die Sportbefreiten immer ausrollen durften. Die Holzkegel, mit denen auch die Jungen durch die Turnhalle tänzeln mussten. Die ganz Coolen spazierten einfach durch und holten sich eine 5 ab. Eine Flasche Bärenblut hat es auch in den Trödelladen geschafft. Wer sich die schon alles aufgespart hat?
Hoffentlich kaufe ich das nicht gleich alles. Eigentlich bin ich ja in Schwerin, um eine der westlichsten Lenin-Statuen Europas zu finden (die westlichste dürfte ein 9 Meter hoher Lenin aus Merseburg sein, den ein holländischer Unternehmer 1997 auf sein Firmengelände in Nieuweschans geholt hat). Im Laden gegenüber gibt es sogar ein Augenmodell aus dem Biounterricht. Beim Reingehen merke ich, dass ich beim Trödler immer unbewusst anfange, unschuldig vor mich hin zu summen, um nicht als Kenner aufzufallen und die Preise hochzutreiben. Das Augenmodell kostet 100 Euro! Ich nehme zwei kleine Plaste-Ikarus-Busse, den alten 66er, der noch die Form einer Zigarre hatte, und den 260er, ein Emblem meiner Kindheit. Der Ikarus 260 ist für mich einer der schönsten Busse, die es je gegeben hat. Warum sie wohl Ikarus hießen? Der Aussteigeknopf war oben über der Tür angebracht, sodass man als Kind nicht ranreichte. In der DDR fuhren mal 30 000 Ikarus-Busse, inzwischen ziehen sie sich, wie Elefanten, an den Ort ihrer Geburt zurück, um dort zu sterben, deshalb sieht man in Budapest noch so viele davon. Die aus Kuba kommen nicht über das Meer.
Was kostet denn der Roller, frage ich? (Mit Trittbremse und Klingel!) Den könne er nicht verkaufen, da renne seine Tochter immer gleich hin, wenn sie ihn im Laden besuche. Es gibt ein Blechauto, Ferrari aufgedruckt; das ging in der DDR, 50 Prozent der Spielzeugproduktion wurde ja exportiert. Sehnsüchtig gucke ich einen Plastekipper an. Wie schön unser Spielzeug war, aber wir haben es nicht zu schätzen gewusst und nach LEGO und Playmobil verlangt. Ich kaufe zwei Holzschweine, am Hintern ein Pfropfen, da gehören Salz und Pfeffer rein, eine Menage. Das hätten die Omas nach dem Krieg gehabt, sagt er. Zwei Postkarten von »Bild und Heimat Reichenbach«, »echt Foto« steht drauf, ein Zeppelin über Stralsund und eine Badeanstalt. Er wickelt mir alles in die Bildzeitung ein. »Bild und Heimat« eben.
Ein Schaukasten wirbt für eine Hoop-Manufaktur, die auch Kurse anbietet. »Jeden Sonntag treffen wir uns, um gemeinsam DURCHZUDREHEN.« Man könne die Gruppe auch für Heiratsanträge mieten. Hula-Hoop war in der DDR mal als westlich-dekadente Unkultur verpönt wie Kaugummis, bedruckte Nickis, Petticoat, Comics und später die Jeanshose. Ich knipse übrig gebliebene Fahnenhalter an den Fensterbrettern und über den Hauseingängen; daran erkennt man, dass man im Osten ist. Bei der Fußball-WM werden sie jetzt für Deutschlandfahnen genutzt. Sie eignen sich aber auch gut als Abschussrampe für Silvesterraketen. Die Altstadt ist renoviert worden, viele der Häuser und viele Fassadendetails hätten im Westen den autogerechten Stadtumbau der betonseligen 60er- und 70er-Jahre nicht überlebt. In der DDR ist alles vergammelt, war aber zur Wende zumindest noch vorhanden.
Die Stadt liegt an mehreren Seen, und man kann ein Hausboot mieten. Ich gehe bis zum Schloss, aber es soll hier ja nicht um alte Kultur gehen, sondern um DDR-Relikte, da kann das Schloss noch so viele Türmchen haben. Ich lande in einem italienischen Restaurant. Ein Runde Senioren am Nebentisch, ein Sachse erzählt vom Zweiten Weltkrieg, so werden wir als Rentner beisammen hocken und über unsere Jugend in der DDR diskutieren. An einem anderen Tisch sitzen fünf junge Israelis, die mit der Kellnerin Russisch reden. Auf dem Klo sehe ich zum ersten Mal im Leben einen elektrischen Mülleimer. Per Knopfdruck öffnet er sein Mäulchen, per Knopfdruck schließt er es wieder. Man hat nicht das Gefühl, dass das eine Erleichterung darstellt. Die Betreiber der Pizzeria sind Armenier, deshalb können sie Russisch. Es würde mich nicht wundern, wenn ich heute auch noch einem Eskimo begegne.
Morgens weckt mich die Rezeptionistin: »Herr Schmidt, Sie haben Frühstück bestellt, Frühstück ist bis 10 Uhr, bitte kommen Sie frühstücken.« Auch im Frühstücksraum ist jede Oberfläche altrosa oder rot lackiert. Eine golden gerahmte elektronische Postkarte steht auf dem Buffet. Laute Popmusik? Ich traue mich nicht, sie zu fragen, ob das ein bulgarisches Hotel ist. Mich hat mal auf einer Silvesterparty eine Frau beschimpft, weil ich sie fragte, ob sie Bulgarin sei, wegen ihrer silbernen Stiefel. Offenbar hat sie das als Beleidigung empfunden. Auf die Idee wäre ich nie gekommen, ich hatte doch mal eine bulgarische Freundin und liebe dieses Land.
Ich gehe drei Schritte über den Bahnhofsvorplatz, wo ein Brunnen mit einer Skulptur steht: »Rettung aus Seenot«. Ein nackter Mann hebt eine nackte Frau in sein Boot, vier Seehunde schauen ihm dabei zu und ich jetzt auch. Viel begeisterter bin ich, als mein Blick auf die vier Platzleuchten fällt, von denen jede aus fünf »Kindersärgen« besteht, diesen quaderförmigen Leuchten aus schwarzem Polyäthylen vom VEB Narva Leuchtenbau Leipzig, die anscheinend unverwüstlich sind. Gegen Ende der DDR hatte ich den Eindruck, dass, wo es möglich war, an allen Produkten Metallteile durch Kunststoff ausgetauscht wurden; das war im Chemieland wohl billiger. Man sieht überall noch alte Leuchten aus den verschiedensten DDR-Epochen, manchmal auch importiert aus Osteuropa. Ich freue mich, wie lange so etwas überlebt. Aber Kindersärge, die zu einem Kranz kombiniert worden sind, hatte ich noch nie gesehen. Dass das an so prominenter Stelle nicht ausgetauscht wurde!
Ich fahre zum Großen Dreesch, einem Schweriner Neubaugebiet. Es ist windig, nur wenige Spaziergänger sind draußen. Schön, dass hier Möwen fliegen. Ich bin sofort begeistert von der verstörend konsequenten Geometrie der Plattenbauten. Manche sind allerdings ziemlich heruntergekommen. Die Vorgärten sind ungepflegt. Man könnte die schönen, filigranen Beeteinfassungen aus Bewehrungsstahl mal wieder streichen. Neu im Westen war, dass die Briefkästen vor dem Haus aufgebaut wurden, bei uns hingen sie noch im Hausflur. Weil wir keinen zweiten Schlüssel hatten, habe ich den Hausbriefkasten immer mit einem Schraubenzieher aufgebrochen, wenn ich Liebesbriefe erwartete. Im Grunde hätte ich die Post aller Familien aus den Fächern nehmen können.
An den Giebelwänden sehe ich konstruktivistische Ornamente aus Kreisen und Halbkreisen, die mir noch nie begegnet sind. So geht das in jedem der 150 Neubauviertel, die es im Osten gab; die vermeintliche Einheitsarchitektur steckt voller überraschender Details. Ein Infoaufsteller mit Bildern von der Einweihung des Viertels, die Menschenmassen – das ist der große Unterschied: Menschen, und vor allem Kinder fehlen. Die Menschen kamen aus den verfallenden Altbauten und waren glücklich über den Komfort, heute sind die Altbauten im Zentrum saniert und nur die weniger Betuchten bleiben. Damals wohnte hier der Akademiker neben dem Bauarbeiter.
Eigentlich suche ich an der Ostsee den Papierkorb in Pinguingestalt, an den ich mich aus meiner Kindheit erinnere, stattdessen finde ich Lenin. Eine Statue, die von einem estnischen Künstler stammt. War er überhaupt so groß? Eine Plakette klärt über Lenins fragwürdige Leistungen auf. Lenin guckt kämpferisch auf die Hamburger Allee, die früher seinen Namen trug. Bürgerrechtler wollten Lenin am 17.6.2014 verhüllen. Die Stadt lehnte das ab, jemand könnte dabei von der Leiter fallen. Ein Gericht entschied: Die könne man ja festhalten.
Die Anekdoten aus dem Lesebuch über Lenins Klugheit, List und Bescheidenheit haben sich mir tief eingeprägt. Im Grunde waren es Heiligengeschichten. Besonders beeindruckt hat mich, dass er, von der Polizei gesucht, in einem Heuhaufen Bücher las, um die Revolution vorzubereiten. Wenn ich heute Heuhaufen sehe, denke ich immer, dass darunter vielleicht ein Revolutionär studiert.
Ich halte kurz im Hafen von Wismar. Daran, dass die DDR aus ökonomischen Gründen mal eine riesige Handelsflotte hatte, erinnern nur noch die neun Folgen der Fernsehserie »Zur See«, eine der Vorlagen vom »Traumschiff«, allerdings ungleich anspruchsvoller. Vier blau-gelbe Kräne stehen am Kai, wie staksige Insekten. Ich wollte ja immer Kranführer werden, eine kleine Kabine hoch in den Lüften war als Arbeitsplatz das Gegenteil von einem Großraumbüro. Man konnte langsam, aber sicher Ordnung schaffen in der Welt, indem man schwere Dinge an den richtigen Platz stellte. Ich leide unter dem zeitraubenden Zwang, durch bloßes Anstarren die Konstruktion solcher Großgeräte verstehen zu wollen, falls ich einmal in die Verlegenheit kommen sollte, so etwas selbst herstellen zu müssen, zum Beispiel, wenn ich alleine auf einer einsamen Insel strande. Dieses geniale System von stählernen Armen und Gelenken. Eigentlich heißen die Kräne Einlenkerwippdrehkräne »Kalmar« und wurden im VEB Kranbau Eberswalde, Teilbetrieb des Kombinats TAKRAF hergestellt (Tagebau-Ausrüstungen, Krane und Förderanlagen) und von einem zentralen Gestaltungsbüro des Kombinats in Leipzig designt. Der Name hat als Kind mein Sprachgefühl gestört, weil ich immer dachte, es müsste eigentlich TRAGKRAFT heißen, so wie »Badedamit« und nicht »Badedas«. Das Kombinat TAKRAF ist von der Treuhand aufgelöst worden, der Eberswalder Kranbaubetrieb nennt sich jetzt seltsamerweise Kirow Ardelt GmbH, immer noch nach dem sowjetischen Funktionär, mit dessen Namen man 1952 geehrt wurde, und seit 2008 auch wieder nach der Gründerfamilie Ardelt, die im Nationalsozialismus tief in Rüstungsproduktion und Zwangsarbeit verstrickt war und 1945 enteignet worden ist. Aber ich wollte eigentlich nur die schönen Kräne bewundern.
Rötlicher Buchenwald, Dörfer mit Agrarmuseen, reetgedeckte Häuser. Links sieht man schon die Ostsee. Der Himmel hängt tief. In Bad Doberan fährt gerade in einer Dampfwolke die »Molli« ab. Ich überlege, ob ich ihr nachrase, den Weg abschneide, um sie zu fotografieren, wie einer dieser Pufferküsser. Ich habe mich immer mit einem Schulfreund gestritten, was toller war, die »Molli«, der »Rasende Roland« oder die Harzquerbahn? Im Prinzip machte jeder immer dasselbe in den Ferien, je nachdem, wo der Betrieb der Eltern Ferienplätze bereitstellte, und ich fand das großartig.
In Warnemünde ein Gang ins Foyer des Hotel »Neptun« mit der schönen, angenehm unverschnörkelten Neonschrift auf dem Dach. Das Hotel war für DDR-Bürger unerreichbar gewesen, man wollte Devisen einnehmen. Der Direktor schaffte es, die Speisekarte zu beleben, indem er mit landwirtschaftlichen Betrieben Naturalien gegen Hotelzimmer tauschte. Es gibt eine 50-Meter-Schwimmbahn. Gegenüber steht der »Teepott«, ein Hyparschalenbau. Man könnte diese Dächer nicht »abwickeln«, also auf eine ebene Fläche projizieren. Trotzdem ließen sie sich mit Holzverschalungen bauen, ein geometrisches Kunststück. 2000 hat man einen der markantesten Hyparschalenbauten, das Berliner »Ahornblatt«, abgerissen und gegen einen völlig gesichtslosen Neubau ersetzt. Das sind die Dinge, die mich an Berlin verzweifeln lassen. Die Hyparschalentechnik war eine Weiterentwicklung des Rügener Bauingenieurs Ulrich Müther und eine Bauform, die gut zu den 60ern passte, auffallend elegant, ein bisschen futuristisch, materialsparend. Ich habe mir vorgenommen, den noch stehenden Gebäuden einen Besuch abzustatten. Viele sind aber bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Und um alle zu sehen, müsste ich auch nach Tripolis fahren, wo es ein Planetarium von Müther gibt, und nach Amman, um seine Moschee zu besichtigen.
In Rostock-Lichtenhagen groß das Sonnenblumenhaus, der Ort der rassistischen Ausschreitungen vom August 1992. Die Erinnerung an die Wut, die man damals auf seine Landsleute empfand, woher kam dieser Hass auf die freundlichen Vietnamesen? Eben waren doch noch alle in der SED gewesen, und jetzt benahmen sie sich wie Nazis. Im Literaturhaus Rostock hatte ich einmal eine Lesung, leider vor sehr wenigen Zuschauern, während der Biergarten draußen voll war. Immerhin durfte ich dadurch das Peter-Weiss-Haus betreten, in dem sich das Literaturhaus Rostock befindet; es ist das ehemalige Haus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft. Die Wand des holzgetäfelten Büros ziert eine Besonderheit, eine Karte der Sowjetunion, in die alle Errungenschaften eingezeichnet sind, von denen damals immer die Rede war: Baikal-Amur-Magistrale, Olympia-Sportstätten in Moskau, Staudämme, eine Eismeer-Station, Baikonur. »Das schönste Land, das wißt ihr schon, das ist die Sowjetunion.« Aber auch einen Lenin-Kopf gibt es, dort wo er in der Verbannung war, manche erinnern sich an den Ort: Schuschenskoje. »In der Verbannung« – w ssilke, das war eines der Wörter aus dem Schulstoff der Mittelstufe, das sich mir eingeprägt hat, denn es war so sinnlos, solch ein ausgefallenes Wort zu lernen, wenn man die einfachsten Begriffe nicht kannte. Die Deutsch-Sowjetische Freundschaft war für mich eine reine Pflichtveranstaltung, ich war nur Mitglied, um mir Ärger vom Leib zu halten, im Ausweis gab es nicht mal ein Foto. Mich auf Befehl für die Sowjetunion zu interessieren, das gelang mir einfach nicht. Und doch hat die damalige Berieselung dazu geführt, dass ich zehn Jahre nach der Wende plötzlich neugierig auf Russland wurde, weil ich der Sache auf den Grund gehen wollte, und ab da immer wieder für Russischkurse hingefahren bin. Ich frage mich nur, ob wegen oder trotz DDR-Prägung. Ich würde diplomatisch sagen, weil es die DDR nicht mehr gab, musste man sich nicht mehr gegen alles wehren, was einem dort aufgezwungen wurde und eigentlich ja eine Horizonterweiterung war, über die man im Nachhinein froh sein kann. Beim Russischkurs im Haus der russischen Kultur und Wissenschaften in Berlin habe ich meine Lehrerin immer amüsiert, wenn ich die alten Begriffe und Themen anbrachte. Als das Wort »ссылка« vorkam, konnte ich stolz anmerken, dass Lenin »в ссылкев Шушенском« war, in der Verbannung in Schuschenskoje. Die Lehrerin lachte, denn das Wort hat inzwischen eine ganz andere Hauptbedeutung, es heißt nämlich nicht nur »Verbannung«, sondern auch »Verweis« und von hier ist es nicht weit zum Neologismus »Link«. Es ging gar nicht um Lenins Verbannung, sondern um den aktuellen Wortschatz für die Computerbenutzung. Über Lenins Zeit in Schuschenskoje gibt es ein Pionierlied: »Joschka aus Schuschenskoje! Nichts Schönres gab’s für ihn/als auf dem Eis zu laufen mit Schlittschuhn wie Lenin/mit Schlittschuhn wie Lenin/der nach des Tages Mühen im Dämmern auf dem Schusch/dahinglitt, dahinglitt, dahinglitt, husch/Doch Joschka konnt nicht stehen alleine auf dem Eis/Da flüstert ihm ins Öhrchen Wladimir Iljitsch leis/der nach des Tages Mühen im Dämmern auf dem Schusch/dahinglitt – husch: / ›Komm, reich mir deine Hände, ich führ dich, bitte sehr/von rechts nach links und rundum, es ist gar nicht so schwer/so nach des Tages Mühen im Dämmern auf dem Schusch/zu gleiten – husch.‹« (Worte: Anne Geelhaar, Weise: Siegfried Bimberg)
Das Navi soll mich weiter nach Markgrafenheide leiten, aber es geht kreuz und quer durch Hafenanlagen. Groß Klein, sicher einer der kuriosesten Ortsnamen, die es gibt. Dann endet die Straße an einem Zaun, hier kommt nur noch Wasser. Seltsamerweise hält hinter mir ein Auto, ich bin nicht der einzige Dumme. Doch dann klärt sich alles auf, denn eine Fähre legt an und ein Tor öffnet sich. Auf dem Dach haben sie einen Weihnachtsbaum angebracht. Wie herrlich es ist, Fähre zu fahren, für den viel zu kurzen Moment der Überfahrt ist man ein Seefahrer. In Markgrafenheide finde ich eine Ferienanlage, aber in der Dunkelheit nicht das runde Wellblechkino, das es hier noch geben soll, diese Kinos der Dauercamper, wo man in den Ferien »Der stille Don« sah, oder »Beverly Hills Cop«.
Über eine breit ausgebaute Straße komme ich nach Ahrenshoop, ohne von der nahen Ostsee etwas zu merken. Im Nachbarort Wustrow habe ich nach der Wende mal in einer Pension eine Klobrille kaputt gemacht, weil ich draufstieg, um den Spülkasten zu reparieren, deshalb habe ich in dieser Gegend immer noch ein mulmiges Gefühl. Ahrenshoop war für mich ein unerreichbares Reiseziel, hier konnten sich nur Funktionäre und »Kulturschaffende« einquartieren, einer der Gründe, warum ich Künstler werden wollte. Und jetzt habe ich es geschafft und habe eine Lesung mit David Wagner aus unserem Buch »Drüben und drüben«, der Parallelerzählung unserer Kindheiten; er stammt aus Andernach bei Bonn und ich aus Berlin.
Anschließend raunt man mir zu, dass der Ort jetzt ziemlich in der Hand der Wessis sei. Ein Zuschauer meint, wir Berliner hätten es früher besser gehabt als der Rest der DDR. Er ist aus Dessau, fuhr nur zum Einkaufen in die Leipziger Straße. Jahrelang hatte er dort Möbel bestellt, dann kam der Anruf und er musste beim Chef Urlaub nehmen, um gleich am nächsten Tag sein erstes Ehebett abzuholen. Der Buchhändler verwirrt mich, weil er sächselt, aber seit 1956 in Westberlin lebt. Sein Vater war im Krieg Offiziersanwärter und sollte dann als Werkmeister die Betriebskampfgruppe aufbauen, er wollte aber keine Waffe mehr anfassen. Sie bekamen einen Tipp, dass sie vor der Stasi abhauen sollten. Er bekniete seine Eltern, noch zu warten, weil er erst noch den Thälmann-Film mit Günter Simon sehen wollte, der gerade in die Kinos kam. Sein Vater hat sich bei der Flucht alles Lametta angeheftet, also die Orden und Auszeichnungen. Erst sind sie nach Karl-Marx-Stadt, dann nach Berlin. Große Angst im Zug. Sie hatten viele Koffer. Die Westberliner verteilten ihre Koffer im Zug wortlos auf sich, damit es nicht so auffiel.
Anschließend fahren wir zum Hotel »Der Fischländer«, wo man noch etwas zu essen bekommt. Der Kellner ist sehr beflissen und erklärt uns sein Fach. Wasser verkoste man blind, und dann entscheide man sich. Das Hotel, in dem er gelernt hat, da gab es 21 Wassersorten. Als Kellner beriet man den Gast: Welche Sauna haben sie heute genommen? Aha, und dann empfahl man zum Beispiel entmagnetisiertes Wasser aus den Pyrenäen, bei Mondschein abgefüllt. Er ist in Magdeburg geboren, lebt aber schon ewig hier. Selbst in den Bergen möge er nur die Flüsse, er brauche das Wasser. »Könntest du noch das Besteck einsetzen?«, sagt er zum anderen Kellner. Mich begeistern solche Fachbegriffe. Wir überlegen, ob es noch Moulin Rouge gibt oder ob das ein DDR-Drink war. Neben mir sitzt Kai aus Dortmund, der gerade mit einer MZ aus den 60ern eine Ostdeutschland-Tour gemacht hat, um mit einer alten EXA von Pentacon für ein Fotobuch zu fotografieren. In Zschopau hat er einen ehemaligen internationalen Enduro-Meister getroffen, das war ein Höhepunkt für ihn. Ab einem bestimmten Tempo fliege man über das Kopfsteinpflaster, das hat er festgestellt.
Am nächsten Morgen packe ich mich in drei Schichten, dazu eine Windjacke, und laufe eine Allee entlang zum Strand. Eine DDR-Seilwinde für Boote steht in den Dünen. Ein neues, bombastisches Terrassenhotel fällt völlig aus dem Rahmen, wer hat das hier erlaubt? Es ist sehr windig, die Brandung erzeugt Schaumflocken: »Gischt schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee.« Durch den zentralen Lehrplan wurde in der DDR der Lehrstoff zu einer Generationenerfahrung. Bestimmte Gedichte haben alle gelernt. Und natürlich dieselben Bücher gelesen. »Wie der Stahl gehärtet wurde«, die sowjetische Heiligengeschichte eines sozialistischen Märtyrers, die im Osten jeder lesen musste und im Westen viele für ein Fachbuch der Metallurgie halten würden. 1952 hieß es in einer Broschüre darüber: »Dieses Buch ist uns heilig, man darf es nicht unachtsam beiseitelegen, in seiner Gegenwart schämt man sich, ein böses Wort zu sagen.«